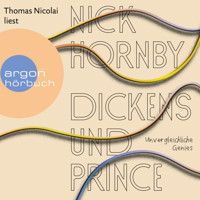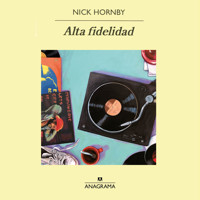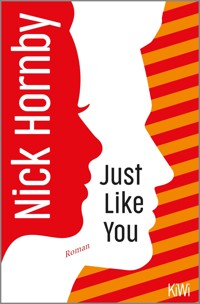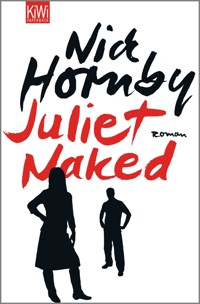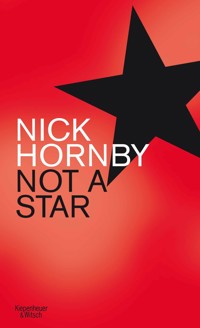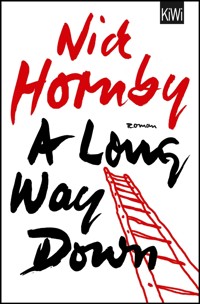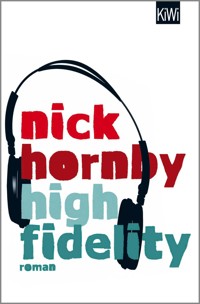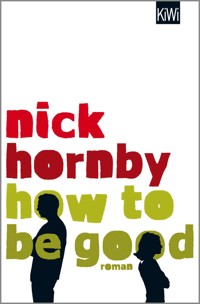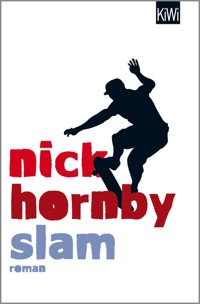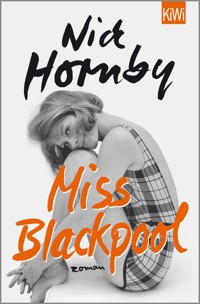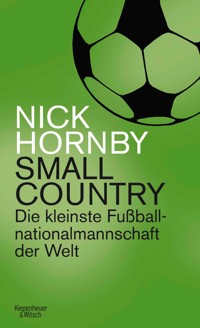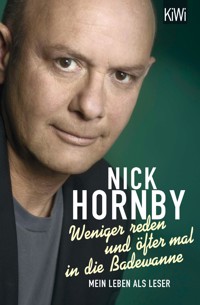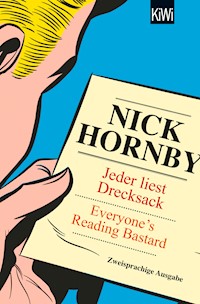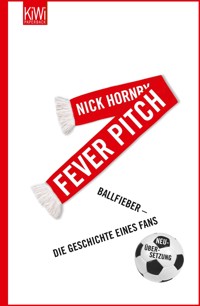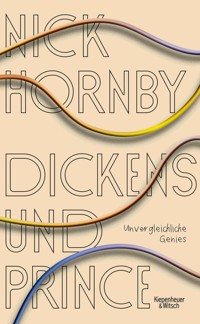
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein warmherziges und unterhaltsames Buch über Kunst, Kreativität und die überraschenden Gemeinsamkeiten zwischen dem viktorianischen Romancier Charles Dickens und dem modernen amerikanischen Rockstar Prince. Mit der Bewunderung eines Fans und seinem typischen Humor und Witz zeigt uns Nick Hornby die kuriosen Ähnlichkeiten zwischen zwei auf ihre Art genialen Künstler, die bis heute gelesen oder gehört, bewundert und nachgeahmt werden. Hornby untersucht die persönlichen Tragödien der beiden Ausnahmetalente, ihren sozialen Status und ihre grenzenlose Produktivität und zeigt, wie diese beiden ungleichen Männer aus verschiedenen Jahrhunderten »die Welt erleuchteten«. Dabei schafft er ein anregendes Kaleidoskop über die Kreativität, die Extravaganz, die Disziplin und die Leidenschaft, die es braucht, um große Kunst zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nick Hornby
Dickens und Prince
Unvergleichliche Genies
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Nick Hornby
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Nick Hornby
Nick Hornby, 1957 geboren, studierte in Cambridge und arbeitete zunächst als Lehrer. Er ist Autor zahlreicher Bestseller: »High Fidelity«, verfilmt mit John Cusack und Iben Hjejle, »About a Boy«, verfilmt mit Hugh Grant, »A Long Way Down«, verfilmt mit Pierce Brosnan, »How to Be Good«, »Slam« und »Juliet, Naked«, sowie weiterer Bücher über Literatur und Musik. Nick Hornby lebt in London.
Stephan Kleiner, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u. a. Michel Houellebecq, Charlie Kaufman, Tao Lin und Quentin Tarantino ins Deutsche.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit der Bewunderung eines Fans und seinem typischen Humor und Witz zeigt uns Nick Hornby die kuriosen Ähnlichkeiten zwischen zwei auf ihre Art genialen Künstler, die bis heute gelesen oder gehört, bewundert und nachgeahmt werden.
Hornby untersucht die persönlichen Tragödien der beiden Ausnahmetalente, ihren sozialen Status und ihre grenzenlose Produktivität und zeigt, wie diese beiden ungleichen Männer aus verschiedenen Jahrhunderten »die Welt erleuchteten«. Dabei schafft er ein anregendes Kaleidoskop über die Kreativität, die Extravaganz, die Disziplin und die Leidenschaft, die es braucht, um große Kunst zu schaffen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Dickens and Prince. A Particular Kind of Genius
© Nick Hornby 2022
All rights reserved
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung und -motiv: © Miriam Bloching
ISBN978-3-462-31107-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Einleitung
Kindheit
Zwischen zwanzig und dreißig
Die Filme
Das Arbeitsleben
Das Geschäftliche
Frauen
Das Ende
Danksagung
Ausgewählte Literatur
Nachweise
Für John Forrester, mit Dank von allen
Er zog einen Schweif hinter sich her wie ein Komet, und jeder findet seine eigene Version darin […] Das geschundene Kind, der unbändig ehrgeizige junge Mann … der besessene Arbeiter […] Der Mann, der Amerika hasste und liebte. Der Partyveranstalter, der Magier, der Reisende […] Der Tänzer […] der Schauspieler, der Schmierenkomödiant […] Der Unersetzliche und Unwiederbringliche […] Das strahlende Licht im Raum.
Claire Tomalin, Charles Dickens: A Life
Einleitung
Es kursierte einmal etwas, ein Meme vor der Zeit der Memes, das die verblüffenden Gemeinsamkeiten zwischen Abraham Lincoln und John Fitzgerald Kennedy aufzeigte: Beide wurden ’46 in den Kongress gewählt und ’60 zum Präsidenten ernannt; beide erlitten an einem Freitag einen Kopfschuss; beide verloren während ihrer Zeit im Weißen Haus einen Sohn; auf beide folgte im Amt ein Demokrat aus dem Süden namens Johnson; beide wurden von einem Mann mit drei Namen aus insgesamt fünfzehn Buchstaben getötet und so weiter. Nun, so etwas habe ich hier nicht vor. Charles John Huffam Dickens (vierundzwanzig Buchstaben) war ein weißer Schriftsteller aus dem neunzehnten Jahrhundert, und Prince Rogers Nelson (achtzehn Buchstaben) war ein schwarzer Musiker aus dem zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhundert. Dickens hat nie eine von Prince’ Aufnahmen gehört, und nichts lässt darauf schließen, dass Prince je irgendetwas von Dickens gelesen hätte. Man könnte vielleicht das schwachbrüstige Argument vorbringen, dass sie unter einem einzigen Namen bekannt waren und es noch immer sind, aber das gilt eigentlich für die meisten Künstler. Gut, zu Emily muss man immer Brontë dazusagen, wegen ihrer Schwestern. Und zu Michael muss man Jackson dazusagen, da er bekanntermaßen ebenfalls Geschwister hatte und sein außerordentlicher Ruhm zugleich nicht ausreichte, um das alleinige Besitzrecht an seinem höchst gewöhnlichen Nachnamen zu beanspruchen. Durch die Verwendung beider Namen setzt er sich von Stonewall, von Jesse, von Samuel L. und Shoeless Joe ab (vgl. Will und Maggie Smith, Tom und January Jones, Jimmy und Rod Stewart). Ein Name allein reicht nicht aus. Als ich darüber nachdachte, Prince und Dickens in einem längeren Essay zusammenzubringen, gab es eine einzige Übereinstimmung als Arbeitsgrundlage: Bei ihrem Tod waren beide achtundfünfzig Jahre alt. Aber im Jahr 2016 mit achtundfünfzig zu sterben wie Prince, ist etwas ganz anderes, als im Jahr 1870 mit achtundfünfzig zu sterben wie Dickens. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts lag die durchschnittliche Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt bei vierzig und bei um die siebzig, wenn man den vierzigsten Geburtstag erlebte. Und bei genauerer Betrachtung starb Prince auch gar nicht mit achtundfünfzig. Er starb mit siebenundfünfzig. Also bleibt mir nicht mal das.
Aber die Sache kam folgendermaßen in Gang: Im Jahr 2020 wurde Prince’ Album Sign o’ the Times mit dem obligatorischen Boxset ausgestattet. In der Wiederveröffentlichung eines ikonischen Albums sind meist sämtliche Extras enthalten, die die Plattenfirma aufgabeln kann – ein paar Liveaufnahmen, eine Handvoll Demos der ursprünglichen Stücke, vielleicht ein, zwei verworfene Stücke. Sign o’ the Times enthielt dreiundsechzig Songs, die nicht auf dem ursprünglichen Album gewesen waren. Dreiundsechzig! Das sind fast viermal so viele, wie auf dem eigentlichen Album waren, drei mehr, als Jimi Hendrix in seinem ganzen Leben veröffentlicht hat, zwei mehr, als die Eagles im zwanzigsten Jahrhundert aufgenommen haben … und sie entstanden fast alle mehr oder weniger gleichzeitig. (Nicht alle wurden für dasselbe Album aufgenommen, aber dazu kommen wir noch.) Die Fanseite PrinceVault verzeichnet 102 Einträge in der Kategorie »1986 aufgenommene Lieder«. Und es deutet sich bereits an, dass 1986 kein untypisches Jahr war. Als ich von dem Boxset las, dachte ich mir: Wer hat sonst noch so viel produziert? Wer hat sonst noch auf diese Weise gearbeitet? Es sollte eine rhetorische Frage sein, aber dann wurde mir bewusst, dass es eine Antwort gab: Dickens. Dickens hat so gearbeitet.
Vielleicht waren noch andere so produktiv, aber ich bezweifle es, zumal Prince noch einiges mehr tat, als nur Platten aufzunehmen, und Dickens tat mehr, als bloß Romane zu schreiben. Aber gedanklich spannte ich sie in diesem Augenblick zusammen, weil sie zu denen gehören, die ich in Ermangelung eines präziseren Ausdrucks als meine Leute bezeichnen muss – diejenigen, über die ich im Laufe der Jahre ausgiebig nachgedacht habe, die mich geformt, mich inspiriert, mich zum Nachdenken über meine eigene Arbeit angeregt haben. Ich habe eine ganze Menge solcher Leute, Einflüsse, Vorbilder und Helden. Galton und Simpson, Donald Fagen, Preston Sturges, Barbra Streisand, Robert Altman, Pauline Kael, Kurt Vonnegut, Stephen Sondheim, Mavis Staples, Arsène Wenger, Joan Didion, Anne Tyler, Jerry Seinfeld, Rickie Lee Jones, Aretha Franklin, Thierry Henry, Elizabeth Strout, Raymond Carver, Frederick Exley, Joe Henderson, Lorrie Moore, Edward Hopper, Liam Brady, Peter Blake, Bruce Springsteen, Emmylou Harris, Duke Ellington, Elizabeth McCracken, Larry McMurtry, Roddy Doyle, Tom Verlaine, Peter Wolf, Dave Eggers, Al Green und viele, viele mehr. Ich werde mich nicht darüber auslassen, was sie mir im Einzelnen bedeutet haben: Mal war es ihr Geschmack, mal ihre Denkweise, ihre Seele, ihr Blick für Details, ihr Wagemut, ihr Gespür für Komik und Timing, ihre Arroganz, ihre Hingabe, ihr Mut oder ihre Lebensweise. Jeder, der sein Leben lang kulturelle Erzeugnisse in allen Formen und in womöglich ungesunden Mengen konsumiert hat, verfügt über eine ähnliche Liste, und hat man sein Erwachsenendasein mit irgendeiner Art von kreativer Tätigkeit zugebracht, ist diese Liste wahrscheinlich noch länger, weil man den Input braucht (und weil man, seien wir ehrlich, über Zeit verfügt, die jemand, der am Fließband steht oder in einer Gesamtschule oder Bank arbeitet, einfach nicht hat). Prince und Dickens sind zwei von vielen, aber vielleicht hätten sie einen etwas größeren Schriftgrad verdient als einige der anderen. Sollte noch irgendjemand ein Werk von so überwältigendem Ausmaß geschaffen haben, dann ist es niemand, über den ich viel wüsste. Vielleicht lesen Sie das hier gerade und schreien: Wagner! Picasso! Dann müssen Sie eben Ihr eigenes Buch schreiben.
Dickens habe ich erst auf der Universität gelesen, und ich bin froh über diese Lücke in den Schullehrplänen Mitte der Siebzigerjahre. Hätte man mich gezwungen, ihn auf der Schule zu lesen, wäre mir seine Größe nicht bewusst geworden, und ich kenne viele, die gegen ihn resistent sind, was so gut wie immer daran liegt, dass er ihnen als Jugendliche zwangsverabreicht wurde. »Ich muss etwa neun Jahre alt gewesen sein, als ich David Copperfield erstmals las«, schreibt George Orwell in einem Essay aus Inside the Whale. »Die geistige Atmosphäre der einleitenden Kapitel war mir auf Anhieb so verständlich, dass ich die vage Vorstellung hatte, sie seien von einem Kind geschrieben.« Tja, die Tage sind gezählt, George. Sie waren es schon zu meiner Schulzeit, und auch in der näheren Zukunft wird es nicht viele Neunjährige geben, die David Copperfield lesen. (Und sollte Ihr Kind genau das gerade tun, halten Sie es bitte davon ab. Es wird jeder späteren Freude an diesen außergewöhnlichen Romanen nur im Wege stehen. Und im Übrigen sind Sie furchtbare Eltern.)
Als Orwell neun war, gab es David Copperfield schon seit etwa sechzig Jahren. Orwells zeitliche Beziehung zu dem Roman war die gleiche wie unsere zu Wer die Nachtigall stört (erschienen 1960), einem weiteren Buch, das uns viel über die Kindheit verrät – oder jedenfalls über eine Kindheit. Doch die Sprache des mittleren zwanzigsten Jahrhunderts ist für uns und in jedem Fall für jüngere Menschen wesentlich besser verständlich als die des Viktorianischen Romans mit seinen ausgedehnten Metaphern und Nebensatzketten. Harper Lees Roman wird noch immer in Schulen gelesen, weil ihre Kinderaugen-Ichperspektive äußerst benutzerfreundlich ist und die Länge des Romans (einhunderttausend Wörter anstelle der dreihundertfünfzigtausend von David Copperfield) nicht einschüchtert.
Man kann sich gerade eben vorstellen, wie ein superkluges, ein orwellmäßig kluges Kind in die Geschichte von Scout Finch eintaucht, wenngleich sich das Verhältnis zwischen Jugendlichen und Büchern natürlich erheblich verändert hat seit Orwells Kindheit und meiner eigenen und der Kindheit von überhaupt jedem, der in einem Vor-iPad-Zeitalter aufgewachsen ist. Ich las überall, während endloser Autofahrten, in Zügen, in Zahnarztwartezimmern, an verregneten Sonntagnachmittagen, vor allem, weil mir stinklangweilig war. Ich wäre heute kein Leser ohne die quälende, niemals endende, aus nicht existenten Fußballübertragungen im Fernsehen und geschlossenen Geschäften resultierende Langeweile, die mich in die örtliche Bibliothek und später in die Buchhandlungen trieb – die sonntags natürlich geschlossen waren. Meine jüngeren Söhne, beide im einundzwanzigsten Jahrhundert geboren, haben nie die Art von Stumpfheit kennengelernt, die sie veranlasst hätte, in der Literatur Zuflucht zu suchen, und obwohl das bedauerlich ist, freut es mich auch für sie. Ein Teil von mir wünschte, mich nicht so gelangweilt zu haben, dass ich mein halbes Leben mit der Nase in Büchern verbrachte. Aber so verzweifelt ich auch war, umwehte Dickens doch immer ein Hauch artiger BBC-Vorabend-Kostümdramen, und ich machte einen weiten Bogen um ihn.
Ich war zwanzig oder einundzwanzig, als ich anfing, Bleak House zu lesen. Alt genug. Ich hatte E. M. Forster in der Schule gelesen und Vonnegut, Nathanael West und Chandler zu Hause, und ich weiß noch, dass Dickens auf dem Lektüreplan stand, nachdem wir – oder zumindest meine Kommilitonen, denn ich hatte mich nicht lange damit herumgeschlagen – uns gerade durch den Gawain-Dichter und Piers Plowman und wahrscheinlich noch irgendetwas geackert hatten, was ich als junger Clash-Fan vollkommen unverdaulich fand. Und ich erinnere mich an zweierlei: Zum einen war es lustig, und Dickens’ Ausdrucksweise und komische Einbildungskraft waren für mich völlig überraschend. Ich erkannte ungläubig, dass ihm viel daran gelegen war, die Leser zum Lachen zu bringen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Zum ersten Mal lachte ich in Kapitel acht, als Esther Summerson mit der Weltverbesserin Mrs Pardiggle den Armen der Stadt einen Besuch abstattet. Sie laden sich beim örtlichen Ziegelstreicher ein, dessen Haus »in einer Gruppe jämmerlicher Hütten« steht, ein Schock für Esther; da ist ein »Schweinestall dicht vor den zerbrochenen Fenstern«, ein »kleines ächzendes Kind am Feuer«, ein Mädchen, das in Schmutzwasser irgendetwas zu waschen scheint, und der Ziegelstreicher liegt verdreckt auf dem Boden und raucht Pfeife. So weit, so Dickens oder zumindest Dickens, wie ich ihn mir vor der Lektüre vorgestellt hatte, als einen, der Armut voller Wut und Mitgefühl beschreibt. Doch darauf folgt eine urkomische Tour de Force, in der der Ziegelmacher die Fragen der Weltverbesserin vorwegnimmt und ihr die Antworten entgegenschleudert. »Ob ich Ihner kleines Buch glesen hab? Nein, ich hab Ihner kleines Buch nicht glesen. Hier kann keiner lesen, und dann paßts für ein Wickelkind, und ich bin kein Wickelkind. Und wie ich mich aufgführt hab? Drei Tag bsoffen gwesen! Und ich hätt mich vier Tag lang bsoffen, wenns Geld glangt hätt. […] Und woher hat meine Frau das blaue Äug? Hm. Von mir. Und wenn sie sagt nein, so lügts.«
Ich überlege, ob mich zu diesem Zeitpunkt schon einmal irgendein Buch zum Lachen gebracht hatte. Bücher schienen mir im Allgemeinen nicht lustig zu sein. Meine Erfahrungen mit Humor in der Literatur wurden von Rowan Atkinson in der Rolle des verblühenden Schullehrers in einem brillanten Sketch aus jener Zeit auf den Punkt gebracht. »Hören Sie auf zu kichern, Babcock! Das ist nicht lustig. Antonius und Cleopatra ist kein lustiges Stück. Hätte Shakespeare gewollt, dass es lustig ist, dann hätte er einen Witz hineingeschrieben. In Antonius und Cleopatra gibt es keine Witze … In welchem Shakespeare-Stück gibt es einen Witz? Wer weiß es? In Die Komödie der Irrungen, Himmel noch mal! In Die Komödie der Irrungen gibt es den Witz, dass sich zwei Leute zum Verwechseln ähnlich sehen. Zweimal.«
Für mich war das die perfekte Zusammenfassung literarischen Humors: Zwei Menschen sahen einander ähnlich, und wir sollten darüber lachen. Morecambe und Wise brachten mich zum Lachen und Taxi und Fawlty Towers und meine Freunde, aber keine Bücher. Doch diese Passage ließ mich laut auflachen, und sie schien in humoristischer Hinsicht auf dem neusten Stand zu sein. Es war kein kuscheliger Showbiz-Humor; es war so gnadenlos wie Fawlty Towers und Monty Python, aber in Gestalt von Mrs Pardiggle und Mrs Jellyby fand sich darin auch die präzise beobachtete Darstellung eines wiedererkennbaren zeitgenössischen Typus. Wir sind immer schon von Menschen umgeben gewesen, die sich einem guten Zweck verschrieben haben und dadurch übergriffig, gönnerhaft und unsensibel werden; wir alle kennen Menschen, die sich mit den großen Problemen der Welt auseinandersetzen und darüber ihre eigenen Familien vernachlässigen wie Mrs Jellyby.
Und als Zweites ist mir von dieser ersten Lektüre, bei der mir aufging, dass ich Dickens womöglich unterschätzt hatte, im Gedächtnis geblieben, dass es da diesen unglaublichen Moment gab, in dem ich spürte, dass sich die Erzählung wie ein riesiges Tankschiff in Bewegung setzte. Das Buch war so monumental, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen war, so etwas wie Bewegung wäre überhaupt möglich; ich dachte, ich würde einfach so lange müßig darin umherschlendern, bis es an der Zeit war, einen Essay darüber zu schreiben. Ich war mir nicht sicher, ob ich es überhaupt zu Ende lesen würde; meine drei Jahre auf der Universität waren mit ähnlichen Schiffswracks übersät. Doch als es einmal Fahrt aufgenommen hatte, wurde mir bewusst, dass es mich schlicht dorthin bringen würde, wohin es wollte, und dass ich weder anhalten noch aussteigen konnte. Ich war Dickens-Fan.
Wie viele andere, die in den 1970er- und 1980er-Jahren zeitgenössische amerikanische Musik hörten, wurde ich durch Prince’ ersten Hit »I Wanna Be Your Lover« auf ihn aufmerksam. Mehr als die ekstatisch wippenden ersten Sekunden brauchte man nicht zu hören, wenn man bereits auf die Isley Brothers, Chic und Sly Stone stand. Es war das erste Stück des Albums mit dem Titel Prince, was nach einem Debüt klingt, aber keines war: Es hatte schon ein erstes Album mit dem Titel For You gegeben, das floppte. Während ich das schreibe, wird mir bewusst, dass ich Prince und Dickens im Abstand von nur achtzehn Monaten begegnet bin, aber natürlich fühlt es sich heute nicht so an, und es hat sich auch damals nicht so angefühlt. Prince war ein neuer Musiker, mehr oder weniger ein Zeitgenosse, noch keine große Nummer, und Ende der Siebziger entdeckte ich so jemanden alle paar Wochen. Dickens war fester Bestandteil des britischen Lebens. Er hatte sein eigenes Adjektiv, und seine Figuren sind in die Alltagssprache eingegangen. Auch wenn Prince und Dickens also während desselben Lebensabschnitts zu »meinen Leuten« wurden, wusste ich damals noch gar nicht, dass es so etwas wie »meine Leute« überhaupt geben würde – ich wusste nicht, dass ich Künstler, die ich mochte, als Inhaltsstoffe für meine eigene Arbeit verwenden würde, und ganz bestimmt hätte ich nicht gewusst, wie ich einen einundzwanzigjährigen R-&-B-Sänger aus Minneapolis mit einem einhundertsiebenundsechzigjährigen Schriftsteller aus Portsmouth zusammenbringen sollte.
Jedenfalls verlor ich Prince nach diesem Album ein wenig aus den Augen. Ich rechnete nicht damit, dass ich an einer Platte mit dem Titel Dirty Mind großes Interesse haben würde. Mir kam der Verdacht, dass Prince sich als eher einseitig erweisen könnte und dass der Sexkram genau diese eine Seite wäre, eine Masche, ein schmuddeliger Showbiz-Trick in einer Zeit, in der ich auf Authentizität aus war, was auch immer das bedeuten mochte. Natürlich irrte ich mich. Der Sex war authentisch, ein Teil von ihm, der sich durch ihn hindurchzog wie die Schrift durch eine Zuckerstange[1], aber Prince zu lieben, bedeutete, im Laufe der Jahrzehnte über einige unangenehm anzügliche Texte hinweghören zu müssen. (Vor seinem Tod erzählte er in mindestens einem Interview, er lebe enthaltsam, was möglicherweise damit zusammenhing, dass er den Zeugen Jehovas angehörte, aber irgendwie glaube ich, dass er uns nicht dadurch im Gedächtnis bleiben wird.) Er verschwand also aus meinem Blickfeld, bis 1999 und insbesondere »Little Red Corvette« herauskam. In »Little Red Corvette« hält er uns noch an, uns ein Objekt der Liebe vorzustellen, das benutzte Kondome in der Hosentasche aufbewahrt, offenbar ohne sich bewusst zu werden, dass eine solche Entdeckung für viele von uns in einer einsamen Nacht und einem langen, furchtsamen Duschbad statt in stundenlanger erotischer Verzückung münden würde. Aber das Lied ist großartig mit seinem umwerfenden Gesang, den unwiderstehlichen Hooklines, den ziemlich genialen Metaphern, die sich durch das ganze Stück ziehen und sowohl die aufregenden Seiten eines One-Night-Stands als auch seine Gefahren darstellen, und mit dem 60er-Jahre-Backbeat unter einer Decke aus Post-Disco-Synthesizern. Ich liebte das Album Purple Rain und sah mir den Film am Premierenabend an, aber trotz der Musik und der fesselnden Schauspieldarbietungen war er so schlecht (haben Sie seit 1984 noch mal versucht, sich den Film anzusehen, nun, da diese großen Songs geläufiger sind?), dass Prince noch immer keinen Zutritt zum