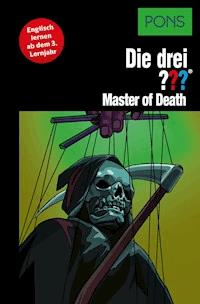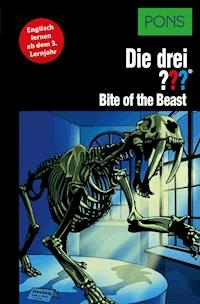Didaktische Konsequenzen aus Märchentheorien für den Deutschunterricht der Grundschule E-Book
Susanne Göpel
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1, Universität Hamburg (Didaktik der Sprachen), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Märchentheorien aus der Literaturwissenschaft, der Psychologie und der Volkskunde und deren didaktische Konsequenzen für den Deutschunterricht der Grundschule. Für jede Forschungsrichtung wurden zwei belangvolle Wissenschaftler gewählt, deren Arbeiten die Ergebnisse der jeweiligen Forschung repräsentieren sollen. Der zweite Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendbarkeit dieser Märchentheorien im Unterricht. Als Märchenbeispiele dienen die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Vor allem auf das Märchen Aschenputtel wird näher eingegangen. Dieses dient als Exempel für die praktische Anwendbarkeit der Märchentheorien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Gebrüder Grimm und ihre Kinder- und Hausmärchen
1.1. Geschichte der Kinder und Hausmärchen
1.2. Kritik an den Kinder- und Hausmärchen
2. Analyse und Interpretationsmodelle der Märchentheorien
2.1. Literaturwissenschaftliche Theorien
2.1.1. Stilanalyse der Märchen nach Max Lüthi
2.1.2. Strukturalistische Märchenanalyse nach Vladimir Propp
2.2. Psychologische Theorien
2.2.1. Tiefenpsychologische Märchenanalyse nach Carl Gustav Jung
2.2.2. Entwicklungspsychologische Analyse nach Bruno Bettelheim
2.3. Volkskundliche Theorien
2.3.1. Ursprungs- und Erweiterungstheorie der Märchen nach Antti Aarne
2.3.2. Analyse und Interpretation von Märcheninhalten nach Lutz Röhrich
2.4. Aktueller Ausblick zu den Märchentheorien
3. Analyse und Interpretation des Märchens Aschenputtel
3.1. Literaturwissenschaftliche Analyse und Interpretation
3.2. Psychologische Analyse und Interpretation
3.3. Volkskundliche Analyse und Interpretation
4. Didaktische Konsequenzen aus den Märchentheorien
4.1. Rahmenplan Deutsch Grundschule
4.1.1. Bereich „Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht“
4.1.2. Bereich „Sprechen und Zuhören, Erzählen und Gespräche führen“
4.1.3. Bereich „Lesen“
4.1.4. Bereich „Texte schreiben“
4.1.5. Bereich „Richtig schreiben“
4.1.6. Bereich „Sprache untersuchen“
4.1.7. Fächerübergreifendes Lernen
4.1.8. Kritik am Rahmenplan Deutsch Grundschule
4.2. Konsequenzen aus der Literaturwissenschaftlichen Theorie
4.3. Konsequenzen aus der Psychologischen Theorie
4.4. Konsequenzen aus der Volkskundlichen Theorie
4.5. Fazit aus den Konsequenzen der unterschiedlichen Theorien
Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Anhang
Einleitung
Mancher will dem Kinde keine Märchen geben,
weil die Märchen »lügen«,
weil sie mit der »Wirklichkeit nicht zusammengehen«.
Aber ist nicht die nackte nützliche Wirklichkeit,
der Sinn für den lebendigen Menschen Lüge und Schein?
Was ist wahrer:
diese so vorgestellte Wirklichkeit oder das Wunder?
Die Naturwissenschaft könnte alle sinnlich erfassbaren Zusammenhänge kennen,
und doch würde ihr erst dann das volle Gewicht der Tatsache bewusst werden,
dass alles Sinnliche wie ein Zauber aus einem Unsinnlichen heraus blüht.
Christian Morgenstern, Stufen
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Märchentheorien aus der Literaturwissenschaft, der Psychologie und der Volkskunde und deren didaktische Konsequenzen für den Deutschunterricht der Grundschule. Für jede Forschungsrichtung wurden zwei belangvolle Wissenschaftler gewählt, deren Arbeiten die Ergebnisse der jeweiligen Forschung repräsentieren sollen. Der zweite Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendbarkeit dieser Märchentheorien im Unterricht. Als Märchenbeispiele dienen die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Vor allem auf das Märchen Aschenputtel wird näher eingegangen. Dieses dient als Exempel für die praktische Anwendbarkeit der Märchentheorien.
Es wurden die drei Forschungsrichtungen Literaturwissenschaft, Psychologie und Volkskunde ausgesucht, da sie auffällige inhaltliche Gegensätze aufweisen und die Bedeutung ihrer Ergebnisse in der Märchenforschung sehr weit reichend sind. Da in dieser Arbeit die Ergebnisse der wichtigsten Repräsentanten der jeweiligen Forschungsrichtung vorgestellt werden, deren Resultate noch heute gültig sind beziehungsweise anerkannt werden, muss auch auf Publikationen älteren Datums zurückgegriffen werden. Es existiert zudem eine umfangreiche Sekundärliteratur, die ebenfalls in die Arbeit mit eingeflossen ist. Diese ist gleichermaßen nicht in jedem Fall aktuellen Datums, denn nicht in jedem Gebiet der Märchenforschung liegen Ergebnisse aus den letzten Jahren vor. Dies mindert jedoch nicht die Aktualität des behandelten Themas, da die Forschungsergebnisse im zweiten Hauptteil der Arbeit mit dem heutigen Deutschunterricht in der Grundschule in Bezug gebracht werden.
Die vorliegende Arbeit hat eine zentrale Leitfrage: Welche didaktischen Konsequenzen kann oder sollte man aus den Märchentheorien ziehen und wie integriert man sie in den Deutschunterricht der Primarstufe? Um sich der Antwort zu nähern, wird einleitend im ersten Kapitel die Entstehungsgeschichte der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm vorgestellt. Die Gebrüder Grimm sind die Begründer der modernen Märchenforschung und aus diesem Grund nicht aus ihr wegzudenken. Dieses erste Kapitel hat eine grundlegende und erklärende Funktion für die folgenden Inhalte der Arbeit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den drei ausgewählten Märchentheorien und ihren verschiedenen Analyse- und Interpretationsmodellen. Innerhalb der Theorien werden jeweils zwei unterschiedliche Forschungsansätze und ihre bedeutendsten Vertreter vorgestellt. Dabei werden die kritischen Kommentare anderer Wissenschaftler nicht außer Acht gelassen. Im dritten Kapitel wird das Märchen Aschenputtel beispielhaft für alle anderen Märchen der Gebrüder Grimm analysiert und interpretiert. Es wird nach den verschiedenen Prinzipien der Wissenschaftler, deren Werk im vorangegangenen Kapitel vorgestellt wurde, vorgegangen und untersucht ob ihre Methode auf das Märchen anwendbar ist. Es folgt die Antwort auf die Leitfrage der Arbeit im vierten und letzten Kapitel. Die didaktischen Schlüsse aus den Märchentheorien werden gezogen. Des Weiteren werden Methoden für eine praktische Umsetzung vorgezeigt. Das vierte Kapitel nimmt auf den Rahmenplan Deutsch Grundschule Bezug. Der Rahmenplan Deutsch Grundschule ist die aktuelle wissenschaftliche Grundlage für den Deutschunterricht in den Hamburger Primarstufen. Bestehende Streitpositionen fließen in die Darstellungen mit ein und beleuchten sie so von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus. Die Schlussbemerkung beinhaltet eine kurze Zusammenfassung und das aus der Arbeit zu ziehende Fazit.
Im Anschluss an die vorliegende Arbeit folgt ein Anhang, der unter anderem die Daten zu Leben und Werk und ein Bild mit den Unterschriften der Gebrüder Grimm enthält. Diese dienen dem Leser als Hintergrundinformation. Das Verzeichnis der Abkürzungen der Kinder- und Hausmärchen verleiht einen Überblick über das Werk der Brüder Grimm. Diese beiden Teile gehören vor allem zu Kapitel 1. Ein Verzeichnis der Abkürzungen Vladimir Propps gibt Einblicke in seine strukturelle Arbeit. Es empfiehlt sich zu Kapitel 2.1.2.1. einen parallelen Blick hierauf zu richten. Das Märchen Aschenputtel (KHM 21) 2. Auflage soll dem Leser die Möglichkeit geben, bei Bedarf den Text nachzulesen, auf den sich vor allem das 3. Kapitel bezieht.
1. Gebrüder Grimm und ihre Kinder- und Hausmärchen
Wenn man in Deutschland und vielen anderen Ländern an Märchen denkt, dann kommen den meisten Menschen als erstes die Kinder- und Hausmärchen (im folgenden des öfteren mit „KHM“ abgekürzt) der Brüder Jacob (1785 - 1863) und Wilhelm (1786 – 1859) Grimm in den Kopf, die in ihrer ersten Auflage in zwei Bänden 1812 und 1815 erschienen (Rölleke 1985, 7). Lange wurde angenommen, dass diese die ersten von den Geschwistern Grimm gesammelten Märchen waren. Wie sich später herausstellen sollte, war dies eine falsche Annahme. Im Folgenden wird kurz die Geschichte der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm wiedergegeben.
1.1. Geschichte der Kinder und Hausmärchen
Ursprünglich ist der Begriff Märchen eine Diminutivbildung zum Substantiv „maere“ oder „maer“, was im eigentlichen Sinne „Nachricht, Kunde, Erzählung“ bedeutet (Kluge 2002, 598). Die Brüder Grimm wurden in den Jahren 1802 und 1803 zu Wertschätzung und historisch-wissenschaftlicher Betrachtung dieser Volkspoesie angeregt. Sie begeisterten sich für die romantische Rezeption des Mittelalters, wie sie ihnen erstmals in den Minnesangbearbeitungen Ludwig Tiecks von 1803 begegnete (Rölleke 1985, 28ff). Die Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts beeindruckte laut Nissen (1984, 30) vor allem Jacob Grimm. Ausschlaggebend für den Beginn ihrer Sammeltätigkeiten war die Bekanntschaft mit dem Rechtshistoriker Carl von Savigny und dessen Schwager, dem Dichter Clemens Brentano. Brentano veröffentlichte im Herbst 1805 gemeinsam mit seinem Freund Achim von Arnim den ersten Band der Volksliedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“. Geplant war ein zweiter Band, in dem neben den volkstümlichen Liedern auch Märchen Platz haben sollten. Brentano beauftragte die Brüder Grimm, sowohl aus älterer Literatur als auch aus mündlich verbreiteten Texten Volkslieder und -märchen für sein Werk zu sammeln. Im Jahr 1806 fingen die Brüder Grimm an, mit an der Volksliedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ von von Arnim und Brentano zu arbeiten. So gewannen sie erste Einblicke in die Praxis des Sammelns und Publizierens (Rölleke 1985, 29). Am 17. Oktober 1810 sandten die Geschwister Grimm eine Abschrift von 54 gesammelten Texte an Brentano, die dieser jedoch weder veröffentlichte noch zurückschickte. Das Manuskript wurde 1920 in dem elsässischen Kloster Ölenberg wiedergefunden. Aus diesem Grund nannte man es „Ölenberger Handschriften“. Die Märchen dieser Sammlung erscheinen sprachlich spröde, sie sind jedoch im Vergleich zu den späteren Märchenfassungen enger an die Form mündlicher Erzählungen angelegt und haben weniger Stilisierungen erfahren. Die Brüder Grimm ließen sich durch Brentano nicht entmutigen und nahmen zwei Märchenaufzeichnungen mit den Titeln „Von dem Fischer und syner Frau“ (KHM 19) und „Von dem Machandelboom“ (KHM 47) die der Maler Philipp Otto Runge Brentano für seinen zweiten Band gesandt hatte zum Vorbild und als Inspiration für ihre weiteren Niederschriften. Diese beiden Texte besaßen Qualitäten, die die Geschwister Grimm besonders ansprachen. Zum einen war es die durch den Dialekt der Geschichten deutlich werdende mündliche Tradition. Zum anderen war es die Verwandtschaft mit Tierfabeln, die die beiden an den Texten beeindruckte. Die Brüder Grimm machten sich auf die Suche nach Geschichten aus dem Volk, die bestimmte Kriterien erfüllen sollten. Versionen die ethische Fragwürdigkeiten, Obszönitäten oder auffällige Unstimmigkeiten enthielten, sollten von vornherein ausgeschlossen werden. Um sicherzugehen, dass die erzählten Märchen nicht aus dem Stegreif erfunden wurden, nahmen sich die Geschwister Grimm vor, ihre Erzähler ein und dieselbe Geschichte mehrmals hintereinander vortragen zu lassen. 1811 fasste Jacob Grimm in Absprache mit seinem Bruder Wilhelm Grimm seine Ideen in einem öffentlichen Aufruf zum Sammeln von Volksliteratur zusammen. Der Aufruf richtete sich vor allem an Laien, die das Rohmaterial für die Sammlung der Geschwister Grimm liefern sollten. Die Gewährsleute der ersten Stunde waren vor allem junge, gebildete Frauen aus gutbürgerlichem Hause (Knoop 1985, 19). Die Rohfassung des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen bestand laut Rölleke (1985, 74) aus zwei Märchen aus Runges Niederschrift, sechzehn Märchen der Geschwister Hassenpflug, sechs Märchen aus dem Mund von Friedericke Mannel, zwei von der Marburger Märchenfrau, eines von den Geschwistern Ramus und sechzehn aus literarischen Quellen. Der Hauptlieferant für die Märchen des zweiten Bandes der Kinder- und Hausmärchen war die Familie Haxthausen. Durch diese Menschen erhielten Jacob und Wilhelm Grimm 33 Geschichten, die fast die Hälfte des gesamten Märchenbestandes des zweiten Bandes ausmachen. 1812 überredete von Arnim die Brüder Grimm zur Veröffentlichung ihres ersten Märchenbandes. Außerdem vermittelte er ihnen seinen Berliner Verleger (Rötzer 1982, 123). Im selben Jahr erschien der erste Band der Kinder- und Hausmärchen (Rölleke 1985, 7). Der zweite Band erschien 1815. Insgesamt wurden zu Lebzeiten der Geschwister Grimm sieben Auflagen der Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht, wobei zu jeder neuen Auflage Märchen hinzukamen oder durch andere ersetzt wurden. Nach Erscheinen des zweiten Bandes zog sich Jacob Grimm von der Märchenarbeit zurück und überließ sie mehr und mehr seinem Bruder (Nissen 1984, 56). 1822 erschien ein separater Band mit Anmerkungen über die Herkunft und Verbreitung sowie wichtige Varianten der Kinder- und Hausmärchen (Rötzer 1982, 124). Hiermit begründeten die Brüder Grimm die volkskundliche Erforschung des Märchens (Schrader 1986, 56).
1.2. Kritik an den Kinder- und Hausmärchen
Das Erscheinen der zwei Bände löste zahlreiche Kritik aus. Die Rezipienten stießen sich vor allem an der Zwiespaltung des Buches (Rölleke 1985, 75). Durch die Anmerkungen der Geschwister Grimm war ihr Werk weder ein reines Kinderbuch, noch eindeutig wissenschaftliche Lektüre. Jacob Grimm war stets bestrebt, die Märchen so wenig wie möglich zu verändern um ihren wissenschaftlichen Charakter bewahren. Die Mehrheit der Leser forderte jedoch ein Vorlese- beziehungsweise ein Lesebuch für Kinder. Wilhelm Grimm gab schließlich nach und schloss sich den Forderungen der Rezipienten an. Er begann zugunsten einer kindgerechteren Sprache durch das Einbringen von zahlreichen volksläufigen Redensarten den Stil der Märchen zu verändern. Wilhelm Grimm hatte den Anspruch, den Märchen einen pädagogischen Wert zu verleihen und sie zu einer geeigneten Kinderliteratur umzuformen. Er strich also auch einige grausam erscheinende Märchen wie zum Beispiel „Wie die Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben“ ersatzlos aus dem Werk heraus. Zuvor hatte er einen Brief von von Arnim erhalten, in dem er Wilhelm Grimm mitteilte: „Schon habe ich eine Mutter darüber klagen hören, dass das Stück, wo ein Kind das andere schlachtet, darin sei, sie könnt’ es ihren Kindern nicht in die Hand geben“ (zitiert nach Richter 1986, 7).
Wilhelm Grimm nahm allerdings kaum Kritik auf, ohne sich zu rechtfertigen. So erklärte er, dass er selbst in seiner Jugend wiederholt von seiner Mutter mit grausamen Märchen konfrontiert wurde. Dies hätte ihm nicht geschadet „es hat mich gerade vorsichtig [...] beim Spielen gemacht“ (ebenda). An die, um ihre Kinder besorgten, Eltern appellierte er: „[...] fürchtest Du Dich vor Missverständnissen, Missbräuchen, so binde dem Kind die Augen zu und hüte seiner den ganzen Tag, dass es seine unschuldigen Blicke nicht auf alles werfe, was es ebenso verkehrt oder schädlich nachahmen würde, da doch im Gegenteil sein menschlicher Sinn es schon bewahren und keine Aefferei geschehen lassen wird.“ (ebenda, 8).
2. Analyse und Interpretationsmodelle der Märchentheorien
Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm haben wie bereits beschrieben mit der systematischen Erforschung des Märchens begonnen (Pöge-Alder 1994, 26). Ihre Vorreden, Anmerkungen und Briefe stellten schon die entscheidenden Fragen nach der Wesensart, der Bedeutung und dem Ursprung der Märchen und legten so die Grundlage zu einer umfassenden Theorie (Lüthi 1990, 62). Die Brüder Grimm veränderten ihre gesammelten Märchen allerdings auch mit der Zeit. Von der ersten Ausgabe bis zur heute bekannten Endfassung lässt sich ein Prozess fortschreitender Stilisierung und Ausmalung, seit dem zweiten Band hauptsächlich durch Wilhelm Grimm bemerken (Tismar 1983, 59). Das erschwert die nachfolgenden Forschungen in erheblichem Maße. Seit der Romantik ist das Märchen Forschungsgegenstand verschiedenster Disziplinen, die sich der Analyse und Interpretation dieser Literatur widmen. Den Hauptanteil machen die Forschungsrichtungen der Literaturwissenschaft, der Psychologie und der Volkskunde aus. Ihre Ergebnisse ergänzen sich, sie widersprechen sich aber auch. Im Folgenden werden jeweils zwei bedeutende Vertreter jeder der drei Wissenschaften und ihre Positionen zur Märchenforschung vorgestellt.
2.1. Literaturwissenschaftliche Theorien