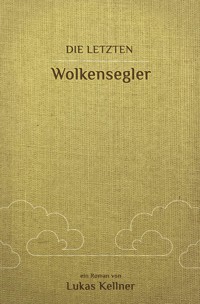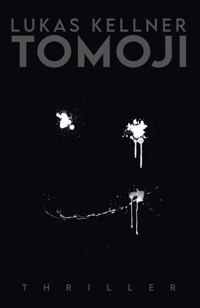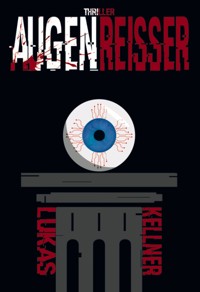Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ich wache auf und er ist weg. Er hat in eine Packung Mehl gebissen und ist fortgerannt, durch die Dunkelheit erkenne ich die Spur aus weißem Staub. Ich will ihn suchen, muss ihn finden, doch die Stimme tief in meinem Innern schreit und speit – mein Ziel ist ein ganz anderes: "Dein Ziel ist ein ganz anderes." ||||||| "Ein atemberaubendes Leseerlebnis, irgendwo zwischen Traum, Fiktion und Wahrheit." - Wahre-Werte-Magazin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe Februar 2025 © Lukas Kellner, 2025 Covergestaltung: Lukas Kellner Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Autors wiedergegeben werden. Verlag: Waiter Serves Productions - Lukas Kellner Stossberg 4, 87490 Haldenwang www.ws-productions.de, [email protected] Druck: epubli - ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Prolog
»Die Zeit endet. Sie wird bereits langsamer.«»Und der Raum schneller.«»Aber wir drehen uns immer noch im Kreis.«»Ein endlicher Kreis.«»Vielleicht.«Die beiden Menschen betrachteten die Oberfläche des Mars, die sich rostrot vor ihnen in die Weite erstreckte. Nichts war übrig geblieben aus einer Zeit, in der es um das Streben nach Stärke und Größe ging. Fast nichts.»Es ist das alte Problem.«»Das alte Problem.«»Im Grunde hat sich nichts verändert.«In der steinernen Höhle vor ihnen bedrängten kahle Wände jedes Lebewesen, das es wagte, sie zu betreten. Nur eine einzige Stelle darin fiel aus der Norm. Sieben Striche waren in speziellem Abstand zueinander und aufgeteilt in zwei Reihen – vier oben, drei unten – in den Stein gemeißelt worden.»Sie ist von hier aus rasch zu erreichen«, sagte der andere.»Die Erde meinst du?«, fragte der eine.»Ja, die Erde. Aber ich bin mir bei der Sache offen gestanden nicht so sicher. Es sprechen viele Dinge dafür, die Aussicht auf Erfolg bleibt meiner Meinung nach trotzdem gering.«»Vielleicht zu gering.«»Außerdem widersprechen wir uns damit ein Stück weit selbst.«»Natürlich, aber die Zeit reicht nicht aus, wenn wir sie einfach dem Lauf der Dinge überlassen. Bis sie so weit sind, wird sich die Expansion des Raumes derart beschleunigt haben, dass sie die Lichtgeschwindigkeit erreicht und das bedeutet unweigerlich einen Stillstand der Zeit. Das wäre das Ende.«»Vielleicht.«Sie näherten sich der Erde. Die Oberfläche war von Einschlägen gezeichnet, die im letzten Jahrtausend zu einem plötzlichen Abschmelzen der Gletscher geführt hatten – mit katastrophalen Folgen. Ganze Arten von Lebewesen fielen den klimatischen Turbulenzen zum Opfer, der Mensch überlebte nur um Haaresbreite. »Was werden wir ihnen geben?«»So wenig wie möglich. Gerade so viel, dass sie es rechtzeitig schaffen könnten.«»Ich befürchte immer noch, dass wir durch unser Eingreifen das genaue Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich anstreben. Die Gefahr ist groß, dass wir unser Bewusstsein ganz einfach duplizieren.«»Es ist ein Risiko, auf jeden Fall.«»Aber?«»Kein Aber.«Sie kamen der Erde nun immer näher. Raue Zeiten peitschten noch immer über die Meere, die Berge und die Lebewesen.»Wie glaubst du, werden sie uns empfangen.«»Gut und dann wieder weniger gut. Ich vermute, dass es so geschehen wird, wie bei den Malen zuvor.«»Glaubst du, dass Menschen auch in unsere Vergangenheit eingegriffen haben?«»Schwer zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, du kennst ja die Mythen aus alter Zeit. Die Frage ist nur, warum sie es bei uns getan haben.«»Vielleicht sind wir ein Teil der Lösung.«»Oder des Problems.«
|
Ich sterbe.
Ich bin umgeben von nassgrauer Dunkelheit. Zu schwach, um ihr noch länger zu widerstehen, zu stark, um mich ihr einfach zu ergeben. Und die Stimme fragt: »Was hast du auf deinem Weg erblickt?« Und ich antworte: »Ich sah zwei Gefäße, gefüllt mit rotem Bambus.«Ich weiß nicht einmal, wie lange ich schon hier unten bin. Vielleicht sind es erst wenige Sekunden, vielleicht schon mehrere Minuten. Allein und umgeben von Kälte fühlt sich selbst der lächerlichste Zeitsplitter wie eine Ewigkeit an. Und die Stimme fragt: »Weißt du, wie viele Pflanzen es waren?« Und ich antworte: »In dem einen Gefäß waren es 36, in dem anderen 72, zusammen 108.«Ich hätte im Kopf mitzählen sollen, um das Zeitgefühl nicht vollständig zu verlieren. Aber dafür ist es jetzt zu spät.Und die Stimme fragt: »Hast du einige davon mit nach Hause genommen, um sie zu gebrauchen?« Und ich antworte: »Ja, ich habe 108 Pflanzen mit nach Hause genommen.«Zum ersten Mal muss ich dem Reflex widerstehen, einzuatmen. Ich versuche, meinen Herzschlag zu stabilisieren, versuche, das Adrenalin in meinem Blutkreislauf zu ignorieren, das dazu führt, dass ich die Kälte weniger stark spüre und meine Muskeln bis zum Zerreißen gespannt sind. Es bräuchte nur einen lächerlich kleinen Gedanken und mein Körper würde sich krampfhaft in Bewegung setzten. Und die Stimme fragt: »Wie kannst du das beweisen?« Und ich antworte »Ich kann es in Versen beweisen!«Es wird unerträglich. Trotzdem harre ich aus. Taubheit breitet sich in mir aus, mir wird übel und mein Magen flau. Von den Seiten drängt Dunkelheit herein und das, obwohl ich die Augen geschlossen halte. Es ist eine andere Art von Dunkelheit, eine andere Qualität. Wenn ich müsste, dann würde ich so das Nichts beschreiben. Es droht mich zu übernehmen und einfach zu verschlucken, dieses Nichts.Und die Stimme fragt: »Wie lauten diese Verse?«, doch du antwortest nicht. Du hörst sie in deinem Kopf, die Verse, du hörst sie dich sagen, du hörst es ganz klar und deutlich, wie den angezupften Ton an einer Harfe, der erblüht, stehen bleibt und anschließend verhallt: Der rote Bambus aus Canton ist selten auf der WeltIn den Hainen sind 36 und 72Wer in der Welt weiß, was das bedeutet?Wenn wir zur Arbeit aufbrechen müssen, werden wir das Geheimnis kennen.Du kennst das Geheimnis, das dir niemand glauben will. Und der Mann, der dich fragt, der kennt es auch, denn es ist seine Stimme gewesen. Seine Stimme, die du kennst, obwohl du sie nicht kennen darfst. Seine Stimme, die du fürchtest, obwohl du sie nicht fürchten darfst. Sein Geheimnis, das du kennst und das dir keiner glaubt. Ich bin wieder an der Oberfläche, höre mich keuchen und beginne zu husten. Das Meer ist dunkelgrau, formt in regelmäßigen Abständen weiße Schaumkronen, die vom Wind zu nadelartiger Gischt versprüht werden. Nach Atem ringend lege ich meinen Kopf in den Nacken und trete Wasser. An diesem Tag ist es schwer zu sagen, wo das Meer endet und der Himmel beginnt.Ich schwimme zurück zum Ufer und die Züge fallen mir viel schwerer als sonst. Vielleicht liegt es daran, dass mich heute kein grauer Pitbull empfangen wird, mit dem Schwanz wedelt und abwechselnd mit den Pfoten auf den sandigen Boden tappt. Wie schnell man ein Tier vermissen kann, ist faszinierend. Wie viele Tage waren es? Zehn? Elf? Zwölf.Irgendwann kann ich den Boden unter meinen Füßen spüren. Ich höre auf zu schwimmen, steige aus den Fluten und wate durch den klebrigen Sand. Wo ist mein Handtuch? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich es hingelegt habe. Irgendwo hinter einen Stein. Dort hinten!Ich stapfe hinüber, ergreife es und schüttele es zweimal kräftig aus, um den Sand loszuwerden. Die Narbe an meinem linken Schulterblatt schmerzt ganz fürchterlich, doch es gelingt mir, mich nicht davon übermannen zu lassen. Ich stoße einen lang gezogenen Seufzer aus, lege mir das Handtuch lose über die Schultern und stapfe in Richtung der kleinen Treppe, die vorbei an den übergroßen Felsbrocken zur etwas höher gelegenen Straße führt. Wenn wir zur Arbeit aufbrechen müssen, werden wir das Geheimnis kennen. Den ganzen Weg über blicke ich nicht auf. Ich bin allein um diese Uhrzeit, das weiß ich, niemand ist auf den Straßen unterwegs, das weiß ich auch. Ich kenne die Route und muss deswegen nicht einmal mehr den Kopf heben. Von außen betrachtet muss es ein seltsamer Anblick sein, wie ich bei schlechtem Wetter früh morgens und halb nackt durch die Straßen laufe. Die Menschen mögen Seltsames nicht, sie hassen es sogar. Du solltest schnell verschwinden. Das Rauschen des Meeres wird leiser, das Dröhnen der Autobahn lauter. Ein letztes Bisschen des Geschmacks ist zurückgeblieben, des Geruchs nach Seetang und Öl und Salz. Doch mit jedem Schritt verdeckt die Stadt mehr davon und zeigt mir meine Grenzen auf, die von der einen Seite der Straße bis zur anderen reichen. Ich fummele an meiner Badehose herum, hole den Schlüssel hervor und betrete wenig später meine bescheidene Wohnung. Sie befindet sich im dritten Stock und besteht eigentlich nur aus einem Zimmer, hat dafür aber noch eine Küche, ein Bad und einen großen Flur, der mir zugleich als Speisekammer dient. Hinter mir schließe ich ab, lasse den Schlüssel wie immer einfach auf den Boden fallen, halte inne und senke meinen Blick. Direkt vor meinen Füßen beginnt eine schneeweiße Spur, die bis an das entlegene Ende des Flures reicht. Ich weiß genau, an welcher Stelle sie beginnt. Es war das Erste, was ich heute Morgen nach dem Aufstehen zu Gesicht bekommen habe. »Warum Mehl?«, höre ich mich fragen und forme die Augen zu Schlitzen. Irgendetwas hindert mich daran, die Spur aus weißem Pulver einfach aufzukehren und zu entsorgen. Ich fühle mich träger und schwerfälliger als sonst. Es muss an der Narbe liegen, die in mir aufgebrochen ist. »Eine Narbe«, murmele ich und betrachte die weiße Spur aus Mehl vor mir, die mit etwas Fantasie wirklich so aussieht, wie eine klaffende Wunde im Boden. Ich folge ihr bis an das andere Ende des Flures, dort, wo ich Bretter an der Wand angebracht habe, um darauf Lebensmittel zu lagern. Auf dem untersten Brett, ungefähr auf Kniehöhe, steht das grob aufgerissene Päckchen Mehl. Ich gehe in die Hocke und betrachte es. »Es muss Tiki gewesen sein … Aber warum?« Ich kann mir keine Antwort darauf geben. Warum würde der Hund so mir nichts, dir nichts in eine Packung Mehl beißen und dann wegrennen? Vor allem wie wegrennen, wenn die Tür doch die ganze Nacht über verschlossen war? Und wie konnte ich davon nichts mitbekommen haben? ER hat dir alles genommen. »Egal, die Wahrheit habe ich versteckt!«, schnaube ich und greife nach Schaufel und Besen, die unter dem provisorischen Regal verstaut sind. Ich beginne damit, das Mehl aufzukehren und schmeiße es in den Mülleimer. Danach nehme ich den Wischmop und fahre damit über den Laminatboden. Ich gehe unter die Dusche und wasche mich gründlich. Ich ziehe mich an und zwinge mich dazu, zwei Bananen zu frühstücken, außerdem trinke ich eine Tasse Kaffee mit Milch. Sie schmeckt mir, ich stecke in meiner Routine, ich funktioniere. Doch warum bekomme ich Tiki nicht mehr aus dem Kopf? Ich habe andere Sorgen! Du hast andere Sorgen! Ein Blick auf die Uhr und ich weiß, dass mir nur noch zwei Stunden bleiben. Wenn ich es trotz Rush-Hour rechtzeitig schaffen möchte, muss ich in einer guten halben Stunde los. Dieser Termin ist wichtig. Genau genommen ist es aktuell meine letzte Option. Und ein Telefonat muss ich davor auch noch führen.
»Du hast mich übers Ohr gehauen, Fujin. Das war nicht der Deal«, keife ich in das Telefon hinein, das ich mir so stark an das Ohr presse, dass es beinahe wehtut. Das Gewimmel in der Bahn ist kaum zu ertragen. Die Stadt hat ihre Auslastungsgrenze erreicht. Die Infrastruktur ist für viel weniger Bewohner entworfen worden, aber jetzt, wo immer mehr Hochhäuser, Bürogebäude und Bezirke dazukommen, platzen die Waggons, Fußgängerzonen und Parks aus allen Nähten.»Falsch«, antwortet er mir und untermalt seine Worte mit einem hämischen Lachen, »Delivered as ordered. Ich habe mich an unseren Deal gehalten, nicht mehr und nicht weniger. Außerdem«, das Lachen verstummt, seine Stimme verwandelt sich in ein tiefes und bedrohliches Brummen, »solltest du vorsichtig sein. Vergiss lieber nicht, mit wem du sprichst. Bei mir brauchst du kein Mitleid zu erwarten.«»Fujin, du«, beginne ich, aber er hat bereits aufgelegt. Ich starre das Display meines Smartphones an und unterdrücke ein lautstarkes ‚Scheiße!‘ Die Bahn bremst ab, kommt zum Stehen und ich steige aus. Ich bin wütend und gleichzeitig nervös – eine ekelhafte Mischung. Ich will nicht nervös sein. Wieso bin ich nervös? Weil es um dein Leben geht. Der Duft von aufgebrühtem Kaffee aus einem Kiosk steigt mir in die Nase und verführt mich. Doch aus der Ferne sehe ich bereits die Auslage des kleinen Ladens und die digitalen News-Bildschirme, die sogar heute noch über die Explosion der Rakete berichten. Ein Feuerball ohne Überlebende. Widerwillig schreite ich an dem Kiosk vorbei und versuche, meine Gedanken auf das Gespräch zu lenken, das vor mir liegt. Als ich die Oberfläche erreiche, donnert mir das Getöse von hupenden Autos und vorbei hetzenden Menschen entgegen. Die Stadt ist endgültig erwacht und zeigt sich in ihrer gestaltwandlerischen Pracht. Ich war noch nie hier. Es ist ein Stadtteil, der einem Menschen wie mir nur wenig zu bieten hat. Die Gebäude erwecken den Anschein von Tradition und Tugendschleier: bleigefasste Tudorfenster in geschwungenen Fassaden, Steinblöcke halb so groß wie ich, Marmorsäulen, kolossal und über viele Stockwerke erhoben, Treppenaufgänge, als würden sie zur Himmelspforte selbst hinaufführen. Nur diejenigen, die wissen, dass vieles davon nicht aus Stein, sondern allenfalls aus Stuck erbaut worden ist und dass die Mehrzahl keine Originale, sondern simple Nachbauten sind, kann sich diesem Schein entziehen. Der Krieg hat das meiste davon in Schutt und Asche gelegt. Er hat einfach alles zerstört und ich frage mich, wo wir als Spezies stünden, wenn wir nicht damit beschäftigt gewesen wären, uns ein drittes Mal gegenseitig auszulöschen. Ob man diesen Rückschritt beziffern kann? Wie viele Jahre es uns in der Zeit zurückgeworfen und gekostet hat? Ich vermute, dass es irgendein schlauer Universitätsprofessor berechnen könnte. Nur laut aussprechen wird er es nicht dürfen. Angekommen. Das Gebäude ist aus braunem Sandstein erbaut und wirkt etwas bescheidener als seine Nachbarn. Die Treppe zur hölzernen Pforte besitzt nur drei Stufen. Mehrere Messingplaketten neben der Tür künden von Kanzleien, Steuerberatern und Unternehmen, die hier ihre Büros eingerichtet haben. Ganz unten lese ich seinen Namen: Dr. V. G. Bartholomäus Jameson. Ich hole einmal tief Luft und drücke die Klingel. Es dauert keine drei Sekunden, da ertönt das Summen und ich kann den Eingangsbereich betreten. Der Boden knarzt unter meinen Füßen. Die von einem roten Teppich verdeckten Dielen müssen ihre besten Jahre bereits hinter sich gebracht haben. Ich betrachte die alte Treppe, die sich einige Meter vor mir erhebt und deren Geländer aus geschwungenen Messingstreben besteht. Dann höre ich ein lautes Räuspern. Ich wirbele herum und bemerke erst jetzt die geöffnete Tür links von mir. Obwohl ich Dr. Jameson bisher nur auf Fotos gesehen habe, erkenne ich ihn sofort. Er steht auf der Schwelle, starrt für den Bruchteil einer Sekunde lang in meine Richtung, dreht sich dann kommentarlos um und humpelt den Gang hinab. Er verschwindet in einem der Zimmer des Büros, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ich verstehe nicht, was das soll oder was gerade von mir erwartet wird. »Kommen Sie schon«, ruft mich seine Stimme. Sie klingt schroff, kalt und alt. Ich löse mich aus meiner Starre, betrete den angrenzenden Korridor und schließe vorsichtig die Tür hinter mir. Sein Büro scheint lediglich aus drei Zimmern zu bestehen; eine verschlossene Tür rechts, etwas weiter den Gang hinunter das Zimmer, in dem er soeben verschwunden war und am Ende des Flures eine kleine Teeküche mit Fenster zum Innenhof. »Worauf warten Sie denn?«, schallt es mir entgegen. Ich rolle mit den Augen und haste in das Zimmer. Woher hat der die alle? Die Wände des wohnzimmergroßen Raumes bestehen aus deckenhohen Regalen, vollgestopft mit den unterschiedlichsten Büchern – bunte, alte, teure, schäbige, zerfledderte, abgerissene, vergilbte und skurrile Buchrücken reihen sich dicht gedrängt aneinander. Vor allem aber ist jedes einzelne davon echt, jedes einzelne aus Papier und Tinte, kein einziges nur aus digitalen Bits und Bytes. Dazwischen blitzen sogar schwer mitgenommene Papierhefter, lose Blätter mit Eselsohren und allerlei Krimskrams hervor. Wie kam er nur an diese ganzen Bücher ran? Weil die Regale wohl irgendwann als Stauraum nicht mehr ausgereicht haben, wurden auf mehreren kleinen Tischchen noch mehr Bücher und Dokumente gestapelt. Als diese Fläche dann auch nicht mehr genug war, wurde der Boden mitgenutzt, wo sich ebenfalls einige Bücherstapel in die Höhe recken. Dr. Jameson hat hinter einem großen Schreibtisch Platz genommen, der genau in der Mitte zwischen den zwei Fenstern des Raumes steht. Er hält einen Gehstock mit goldenem Griff in der Hand und tippt sich damit im regelmäßigen Takt an die Schläfe.»Wie ist Ihr Name?«, fragt er mich. Ich antworte ihm knapp.»Sie scheinen nicht sehr gesprächig zu sein. Ungewöhnlich für jemanden in Ihrem Beruf, oder?« Als ich nichts erwidere, stoppt er die Bewegung mit seinem Stock und hält ihn mit beiden Händen fest umschlossen. »Dann erzählen Sie mal – was wissen Sie über mich und wie sind Sie auf diese Stelle gekommen?« Endlich eine Frage, die ich beantworten kann: »Ich habe einen Newsletter erhalten, der über Sie berichtet hat. Um ehrlich zu sein, kannte ich Ihre Arbeit davor nicht und hatte auch keine Berührungspunkte damit, aber –«»Das heißt, Sie haben bisher keine relevanten Erfahrungen in meinem Forschungsbereich?«, unterbricht er mich.»Nein, Sir, aber ich habe bereits damit begonnen, mich mit der Materie vertraut zu machen, damit –«»Mit der Materie vertraut zu machen? Sie wissen, dass es sich dabei um nicht weniger als jahrzehntelange Untersuchungen handelt?«»Ja, Sir, das weiß ich, ich wollte damit auch auf keinen Fall ausdrücken, dass –«»Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Waren Sie schon einmal im Ausland?« Dr. Jameson legt seinen Stock auf den Tisch und beginnt damit, beiläufig in einem Papierstapel herumzublättern. Ich spüre, wie sich meine Hand zur Faust ballt, versuche aber dem Drang zu widerstehen und strecke krampfhaft meine Finger aus. »Nein, Sir, ich konnte mir das bislang nicht leisten.«»Woher kommen Sie, wer sind Ihre Eltern?«»Ich glaube nicht, dass das hier wichtig ist.« Ich sehe, wie die Hände des Doktors innehalten. Er hebt seinen Blick und starrt mich an. Dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht.»Glauben Sie oder wissen Sie es?« »Ich weiß es. Ganz genau.« Zu meiner Überraschung lehnt er sich in seinem Stuhl zurück und scheint mir zum ersten Mal seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. »Und warum wollen Sie diesen Job?« Ich überlege eine Weile, obwohl ich es gar nicht bräuchte. Ich habe mich auf die Frage vorbereitet, habe eine Antwort schriftlich verfasst, sie mehrere Male umgeschrieben, verfeinert, das Fett entfernt, solange bis nur noch das wirklich Essenzielle daran übergeblieben war. Ich denke an die Worte, die ich verwenden wollte, an die spannenden Herausforderungen, den Aufbau von speziellen Fähigkeiten, die Ambivalenz aus künstlerischer Autorenschaft und wissenschaftlicher Genauigkeit, an all den ganzen Schrott. »Weil ich Geld brauche«, sage ich. Ich höre die Worte, als hätte sie ein anderer ausgesprochen, eine dritte Person, die hinter mir aufgetaucht war und dieses Vorstellungsgespräch gestört hatte. Was hast du gerade gesagt? Mir rutscht das Herz in die Hose, ich habe endgültig die Kontrolle verloren und anscheinend auch vollständig vergessen, was für mich auf dem Spiel steht. Du bist nicht deinetwegen hier!Dr. Jameson ergreift seinen Stock, deutet mit der gummierten Spitze auf meine Stirn und knurrt: »Man hat Ihnen nicht beigebracht, wie man sich bei einem Bewerbungsgespräch verhält, oder?« Ich suche panisch nach einer Möglichkeit, meine letzte Aussage abzufedern und brabbele wie wild drauflos: »Das sollte ein Scherz sein, tut mir leid, ich bin etwas durcheinander und ich … Mich … Also mich fasziniert Ihre Arbeit wirklich und dann ist mir heute Morgen mein Hund weggerannt und deswegen –«»So, Ihr Hund ist also weggerannt?«, unterbricht mich Dr. Jameson gelangweilt, legt seinen Stock zurück auf den Tisch und widmet sich wieder dem Papierstapel. Ich spüre, dass ich verloren habe. In Gedanken bin ich bereits auf dem Rückweg und komme an dem Kiosk mit der digitalen News-Anzeige vorbei. Dort werde ich wieder diesen furchtbaren Feuerball sehen. Ich denke an meinen Bruder. Du siehst einen glühenden Feuerball vor dir. Je länger die Stille anhält, umso weiter breiten sich die rot orangenen Flammen aus, drängen zu allen Seiten, vermischen sich mit den grauschwarzen Aschewolken und zehren dabei alles auf, was sich ihnen in den Weg stellt. ER ist verantwortlich, ER ganz allein. ER ist schuld!»Ja … Er hat einfach in eine Packung Mehl gebissen und ist weggerannt«, murmele ich, weil ich wenigstens irgendetwas sagen möchte. Ich erhebe mich von meinem Stuhl und gehe zur Tür.»Was haben Sie gesagt?« Ich bleibe stehen, drehe mich um. Dr. Jameson starrt mich an. Er hat sich seinerseits erhoben und stützt sich mit den Fäusten auf seinem Schreibtisch ab.»Nichts, tut mir leid, ich werde Sie nicht länger –«»Nein, nein, was haben Sie gerade gesagt?«, wiederholt er mit einem Ausdruck in der Stimme, den ich nicht richtig einordnen kann. Widerwillig antworte ich: »Mein Hund. Er hat heute Nacht in eine Packung Mehl gebissen und ist dann weggerannt.«»Hat er eine Spur hinterlassen?«, hakt der Doktor nach.»Ja, aber nur bei mir im Flur. Danach nicht mehr.«»Haben Sie ihn schon gefunden?«»Nein, ich habe in der Nachbarschaft gesucht und am Strand, da bin ich die letzten Tage mit ihm ein paar Mal gewesen, aber dort war er nirgends.«»Dort war er nirgends … «, murmelt Dr. Jameson und lässt sich langsam zurück in seinen Bürostuhl sinken. Eine Weile starrt er auf ein Buch, das schräg links vor ihm auf dem Tisch liegt. Es hat einen blauen Einband und auf dem Cover ist ein Baum abgebildet, der aus einer halb abgeschnittenen Erdkugel erblüht. Dieselbe Stelle betrachtend, greift er blind nach einem Notizblock. Er wirft mir einen flüchtigen Blick zu und notiert dann einen Namen sowie eine Adresse. Er reißt den Zettel energisch ab und streckt ihn mir entgegen. Ich brauche einen Moment, um zu verstehen, dass die Notiz für mich gedacht ist. Zögerlich gehe ich auf ihn zu und greife danach. Er lässt den Zettel nicht sofort los.»Wie war Ihr Name noch gleich?« Ich antworte ihm.»Sie sind nicht verheiratet?« Ich verneine.»Sie erinnern mich an jemanden. Es wird wohl ein besonders geschickter Zufall sein.«»Ja.«»Nun gut«, er lässt den Zettel los, »Das ist die Adresse, an der Sie meinen Hundefänger treffen. Gehen Sie direkt zu ihm. Sie sollten Ihren Hund schnellstmöglich zurückbekommen, bevor er jemand anderem in die Hände fällt. Heutzutage haben diese Tiere einen schweren Stand.« Ich bleibe wie angewurzelt stehen und starre ihn an.»Na los, worauf warten Sie denn noch, keine Zeit zu verlieren!«, sagt er. »Ich kann mir leider keinen Hundefänger leisten«, sage ich, weil es das Erstbeste ist, was mir in den Sinn kommt. »Wieso? Sie haben doch jetzt einen Job. Herzlichen Glückwunsch, Sie fangen sofort bei mir an, sagen wir morgen früh um acht Uhr?«, erklärt er beiläufig und widmet sich dabei wieder dem Papierstapel. Ein gehauchtes »Ja, Sir« ist alles, was ich zustande bringe. Ich nicke ihm zu, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihm zunicken sollte, doch Dr. Jameson beachtet mich schon gar nicht mehr. Ich drehe mich um und gehe.
Wieder U-Bahn. Wieder zu viele Menschen. Die meisten husten, hinken und reiben sich die glasigen Augen, aber bemerken ihren Zustand nicht, weil es ganz normal geworden ist, krank zu sein. Selten finden mich ihre Blicke, weil viele digitale Kontaktlinsen nutzen und nur beiläufig auf ihre Umwelt bedacht sind. Es ist mir ganz recht so. Schließlich erreiche ich die Straße und sehe das Gebäude, das die Adresse trägt, die mir Dr. Jameson auf dem Notizzettel hinterlassen hat. ‚Veterinäramt‘ steht auf der kleinen Messingplakette neben einer unscheinbaren Eingangstür. Dr. Jameson hat mich hierher geschickt, um einen – wie er sagte – Hundefänger zu finden. Er muss eben dieses Amt gemeint haben. Vielleicht nannte man das zu seiner Zeit noch anders. Damals vor dem Krieg, als es noch lustige Komödien gab und unbeschwerte Sonnenabende und Kaugummiautomaten. Wieso denke ich an Kaugummiautomaten? Wieso denkst du an Kaugummiautomaten? Ich halte die Klinke bereits umschlossen, drücke sie aber noch nicht durch. Links neben mir, in ein paar Metern Entfernung, ist ein Kaugummiautomat angebracht. Die rote Hülle aus Metall geht vor dem burgunderfarbenen Anstrich der Mauer beinahe verloren. Es ist ein Automat von der Sorte, wie ich sie bisher nur in alten Filmen gesehen habe. Er hat zwei silberglänzende Drehspender, darüber einen kleinen Schlitz, in den man eine passende Münze einschieben kann. Kurbelt man dann einmal um 180 Grad, fällt in die von einer Klappe geschützte Öffnung eine Plastikkugel mit einer Süßigkeit oder einem Spielzeug. Kurz überlege ich, mir dieses Ding etwas näher anzusehen, doch irgendetwas hält mich davon ab. Sie verfolgen dich. Ich werfe einen letzten Blick über meine Schulter und trete ein.
»Ich brauche zuallererst Ihren Namen!«Der Mann vor mir sieht aus wie eine Ratte. Es liegt an der fettigen Haut und an dem leichten Überbiss. Ich nenne ihm meinen Namen und er kritzelt dabei etwas auf sein Tablet. Es ist düster und die spärlichen LED-Lampen flackern gelbgrün von der Decke. Pflanzen gibt es keine, Tiere gibt es keine, Möbel gibt es nur die nötigsten und ausschließlich von der Art, wie man sie in öffentlichen Ämtern eben findet. »Einen schönen Namen haben Sie da«, zischt er und leckt sich einmal über die Lippen, »Sie haben also ihren Hund verloren?«»Eigentlich ist er mir weggelaufen.«»So oder so streunt das Tier gerade irgendwo in der Gegend herum. Welche Rasse ist es?«»Ein Pitbull.« »Du meine Güte!«, japst der Mann und starrt mich erschrocken an, »Wie haben Sie für den denn eine Genehmigung bekommen?« »Eine Genehmigung?«»Natürlich eine Genehmigung. Wir geben ja schon bei gewöhnlichen Haustieren fast keine Zulassungen mehr raus, aber bei einem Tier dieser Art, ich meine … Und der läuft jetzt gerade einfach so frei rum?«»Ich vermute mal.«»Das …«, der Mann gerät ins Stocken, zieht ein Taschentuch hervor und fährt sich damit einmal über die Stirn.»Also ich muss zuallererst Ihre Genehmigung sehen.« »Ich habe keine.«»Sie haben keine Genehmigung für dieses Tier?«»Nein, ich habe keine.«»Lassen Sie mich raten. Schwarzmarkt?«, zischt der Mann und durchsichtige Tropfen spritzen auf sein Tablet. »Nein«, antworte ich. »Nein?«»Nein.« »Aber ist das Tier denn überhaupt gemeldet?«, fragt er mich und wischt dabei mit dem Taschentuch über das Display, was nichts weiter tut, als die Tropfen zu einem schleimigen Film auszubreiten. »Ja, ist es.«»Und wie lautet dann die Nummer?«»Welche Nummer?«»Na die Registrierungsnummer! Die Nummer im Chip und auf der Hundemarke.« Er wird ungeduldig, trommelt mit dem Smartpen auf der Tischplatte herum und verdreht die Augen. »Oh, ja, er hat ein Halsband, aber ich kann mich nicht mehr an die Nummer erinnern.«»Sagen Sie mal!«, er erhebt sich von seinem Stuhl. Zu meiner Überraschung ist er wesentlich kleiner als erwartet und würde mir gerade mal bis an das Kinn reichen. Ein kleiner Mann. Kleine Männer sind gefährlich.»Wenn Sie nur hier sind, um mir einen Streich zu spielen, dann ist das ein Verstoß gegen das Gesetz. Sie können nicht einfach eine Geschichte erfinden, um damit einen Beamten zu belästigen.«»Ich spiele Ihnen keinen Streich, ich muss nur diesen Hund finden.«»Der nicht Ihnen gehört?«»Es geht mir nicht um den Hund, es geht mir um …« Bevor ich die Wahrheit ganz aussprechen kann, fällt mir auf, dass der Mann sie gar nicht verstehen würde. Er weiß nicht, was mich zu ihm geführt hat und dass es im Grunde rein gar nichts mit dem Verschwinden eines Tieres zu tun hat. Dein Plan beginnt zu scheitern, bevor du überhaupt damit begonnen hast.»Um?«, hakt er nach. »Um nichts. Haben Sie nicht eine Datenbank oder so etwas? Von aufgegriffenen Streunern, meine ich.« »Streuner? Wissen Sie denn, was mit Streunern geschieht? Mit den Tieren, die zu niemandem gehören?« Der Ausdruck auf seinem Gesicht verändert sich. Es wirkt, als sei er auf einen Schlag um mehrere Zentimeter gewachsen und seine Augen verengen sich ganz allmählich zu engen Schlitzen.»Ich verrate Ihnen jetzt etwas, das nur die Wenigsten wissen. Ein Geheimnis.« Ich kann seinen Atem riechen und er stinkt widerlich. Nach Kaffee und einer eitrigen Entzündung im Hals. »Die wenigsten Streuner, die aufgegriffen werden, landen in einer Datenbank. Vor allem dann nicht, wenn niemand nach ihnen sucht. Die Regierung hat es schon vor zwei Jahren beschlossen, na ja, beschlossen hat sie eigentlich gar nichts, sie hat es nur ‚im Zweifel der Entscheidungsgewalt der Veterinärämter und der unter diesen Organen handelnden Befugten‘ überlassen.« Er hält seinen Kopf leicht schief und stiert mich herausfordernd an. Mit düsterer Miene zischt er: »Wissen Sie, ich arbeite zwar hier, aber eigentlich hasse ich Tiere. Und ganz besonders hasse ich Hunde.« »Er ist mir zugelaufen. Erst vor Kurzem«, sage ich, weil ich möchte, dass der Gestank aufhört, der jedes seiner Worte ungebremst begleitet. Du musst hier weg.»So …«, raunt der Mann und lässt sich zurück in den Bürostuhl sinken, »Dann hätten Sie tatsächlich die Möglichkeit eine Erlaubnis für das Tier zu bekommen. Natürlich ist der Genehmigungsprozess mittlerweile sowohl kostspielig als auch zeitintensiv. Außerdem braucht es eine spezielle Ausbildung, um Hunde der Rasse Pitbull halten zu dürfen, haben Sie die?«Ich starre ihn an.»Dachte ich mir schon. Aber wenn Sie Glück haben, sind Sie ja damit fertig bis das Tier aufgegriffen wird. Was sehr lange dauern kann, da Sie mir ja keine Registrierungsnummer nennen können – wenn es überhaupt eine hat. Wann ist er Ihnen zugelaufen, haben Sie gesagt?«»Ich habe überhaupt nichts gesagt.« Mein Bauch wird warm und meine Handflächen schwitzen. Ich denke an Ratten, aufgespießt und über einem Lagerfeuer elendig verbrennend. Die Gedanken machen dir Angst.»Und wann ist er Ihnen zugelaufen?« »Vor zwölf Tagen.«»Wie sieht er aus?«»Graues, glänzendes Fell, ein großer weißer Fleck auf der Brust. Ein braunes Lederhalsband mit einer pyramidenförmigen Marke.«»Und Sie können sich sicher nicht mehr an seine Registrierungsnummer erinnern?« »Nein.« »Hm, zu schade«, seufzt der Mann und grinst dabei, »mit einer Nummer hätten wir selbstverständlich sichergestellt, dass ein unter unserem Organ handelnder Befugter keine Fehler macht.« Seine Zähne glänzen gelb und nass. Wieder rieche ich diesen widerwärtigen Gestank aus seinem Mund.»Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ihn finden«, presse ich noch hervor.»Falls wir ihn finden«, antwortet der Mann und nickt. Der Gestank bleibt in meiner Nase und begleitet mich sogar nach draußen.
Ich stürme aus der Tür und sauge so viel Luft in mich ein, wie ich nur kann. Die Hände auf meine Oberschenkel gestützt, versuche ich, wieder Herr meiner Sinne zu werden. Dann höre ich ein Geräusch rechts von mir und schnelle hoch. Etwas von mir entfernt steht ein Mann neben dem Kaugummiautomaten an die Mauer angelehnt. Er hat ein kleines, quer aufgeschlagenes Büchlein in der Hand und kritzelt darin mit einem fingergroßen Bleistift herum. Ich bemerke eine Narbe in seinem Gesicht, die am Kinn beginnt und sich bis zu seinem linken Wangenknochen zieht. Seine Haare sind schwarz, glatt, aber zerstrubbelt, so als sei er gerade erst aufgestanden. Der Mantel, den er trägt, gefällt mir. Es ist einer mit hohem Kragen und reicht ihm bis zu den Knien. Ich nicke in seine Richtung, doch er bleibt in seinem Buch versunken. Kaffee. Ich möchte einen Kaffee. Sofort. Ich laufe los, nicke dem Mann beim Vorbeigehen erneut zu und überlege, wo es in der Nähe möglichst günstigen To-Go-Kaffee geben könnte. Ein Stöhnen. Ich bleibe stehen. Dann mein Name. Dein Name? Ich drehe mich um. Es muss der Mann gewesen sein, der ihn gesagt hat, auch wenn der weiterhin in das aufgeschlagene Büchlein starrt. Keine andere Person ist in Hörweite. Oder habe ich mir das alles nur eingebildet? Wahrscheinlich. Ich schüttele den Kopf und gehe weiter. »Das bist du doch, oder nicht?«Wieder drehe ich mich um, wieder kritzelt der Mann konzentriert in dem Büchlein herum. Erst nach einer Weile hebt er den Kopf, verdreht dabei die Augen, sieht mich direkt an und sagt: »Das ist er doch, dein Name, oder liege ich da etwa falsch?« Ich antworte nicht, nicke aber kurz.Mit einem mürrischen »Hm« steckt der Mann das Büchlein samt Stift in die Innentasche seines Mantels, stößt sich von der Wand ab und verschränkt die Arme.»Von Dr. Jameson?«, fragt er. »Ja.«»Schonmal bei einem Hundefänger gewesen?«»Sie sind Hundefänger?«Er antwortet nicht, gibt mir aber mit einem verächtlichen Blick das Gefühl, dass ich ihm die Zeit stehle. Mir fällt auf, wie jung er aussieht. Irgendetwas zwischen 18 und 25 Jahren.»Hat er was gesagt?«, fragt er.»Wer?«»Der Weihnachtsmann.« Er starrt mich grimmig an.»Nein, er … Dr. Jameson hat nichts erwähnt«, sage ich und füge schnell hinzu, »Wer sind Sie?«»Dein Hundefänger. Das bin ich. Eigentlich der von Mr. Jameson, aber …« Er will noch etwas hinzufügen, winkt dann ab und holt eine Münze hervor. »Seit wann ist er weg?«, fragt er. »Der Hund?«, hake ich nach. Er wirft mir erneut einen grimmigen Blick zu. »Er ist letzte Nacht weggerannt. Hat in eine Packung Mehl gebissen und ist verschwunden. Als ich aufgewacht bin, war da nur noch die Spur. Ich habe nichts davon mitbekommen.«Er zuckt mit den Achseln: »Klar, dass dem alten Jameson das gefällt. Heute Nacht … Dann könnten sie schon etwas für uns haben.« Er steckt die Münze in den Schlitz des Kaugummiautomaten, dreht an der Kurbel, es rattert – ratteratat – dann hört man Plastik auf Metall – plopp – er öffnet die kleine Klappe, greift hinein und holt eine unscheinbare, durchsichtige Kunststoffkugel hervor. Er hält sie sich nahe vor das Gesicht und betrachtet den Inhalt. Es scheint lediglich ein gefalteter Notizzettel enthalten zu sein.»Enttäuschend«, murrt er und streckt mir die Plastikkugel entgegen. Ich ergreife sie, weiß aber nicht, was ich damit machen soll.»Na mach schon auf«, schnaubt er und rollt genervt mit den Augen.Hastig friemele ich die zwei Plastikhälften auseinander und entnehme den Zettel. Ich falte ihn auf. Vier Worte sind darauf gedruckt, in einer Reihe direkt untereinander: MinatoPortPuertoHafen»Ich dachte, da bekommt man Kaugummi«, murmele ich und zucke etwas enttäuscht mit den Achseln. Der Mann schüttelt den Kopf und fischt mir den Zettel aus der Hand. Er überfliegt die vier Worte, schaut zu mir auf und fragt: »Warst du oder der Hund mal bei 'nem Hafen?«»Nein, natürlich nicht. Das ist doch einfach nur ein dummer Zettel aus einem Kaugummiautomaten und –« »Tiki«, unterbricht er mich. Tiki. Das stand in dem Brief. So heißt er, der Hund. Sein Hund. Ein seltsamer Name für einen Hund.»Ja, das ist sein Name. Woher wissen Sie das?« Er antwortet nicht, sondern dreht lediglich den Zettel um. Auf der Rückseite der Notiz sind erneut drei Worte abgetragen, zuerst mein Vorname, darunter mein Nachname und ganz unten schließlich ‚Tiki‘. Dann verschwindet das Blatt vor meinen Augen. Der junge Mann zerknüllt es und steckt es sich in die Tasche. Die leeren Plastikhülsen der Kugel lässt er einfach fallen. Er dreht sich um und stapft schnellen Schrittes die Straße hinab. Ich betrachte den Boden, weil ich etwas brauche, auf das ich meine Gedanken lenken kann. Mein Kopf geht unter in einem Feuermeer aus hastigen Schlüssen und Fragen und Erinnerungen und Angst. Ganz besonders in Angst. Woher kennen sie meinen Namen? Woher kennen sie diesen Namen?»Herrgott, jetzt komm doch endlich!« Ich zucke zusammen. Der junge Mann ist stehen geblieben und winkt mich genervt zu sich. Ich löse mich aus meiner Starre und versuche, mir nichts anmerken zu lassen. »Muss ich mit Ihnen kommen?«»Du musst überhaupt nichts. Mir wärs lieber, wenn ich allein arbeiten könnte, aber ich kenne dich zu wenig und vor allem kenne ich deinen Hund zu wenig.«Er setzt sich wieder in Bewegung und ich jogge fast, um mit ihm Schritt zu halten. »Wohin gehen wir?« »Hafen«, nuschelt er.»Häfen gibt es aber doch viele?«Er stöhnt auf, bleibt stehen und sieht mich wütend an.»Einen Hafen. Irgendwo müssen wir anfangen. Ich mache das nicht zum ersten Mal.«Seine Art erinnert mich an jemanden. Ich kann nicht verhindern, dass mir ein Lächeln über die Lippen huscht. Es scheint ihn zu verwirren, denn einige der Falten zwischen seinen Augen und auf der Stirn verschwinden. »Wie heißt du?«, frage ich. »Kakashi. Und jetzt beweg deinen Arsch!« Er dreht sich von mir weg und stapft weiter. Ich will ihm hinterherlaufen, bleibe dann aber doch noch einmal kurz stehen. Man sollte sie nicht so einfach auf der Straße liegen lassen. Lass sie doch einfach liegen! Schnell drehe ich mich um und renne zu dem Kaugummiautomaten zurück. Ich hebe die zwei leeren Plastikhälften auf und stecke sie mir in die Tasche.»Kommst du wohl endlich«, schreit er mir hinterher.»Ich komme«, rufe ich ihm nach und verdrehe die Augen. Kakashi … Ein schöner Name.
Die Frau summte eine Melodie und es klang fast so, als versuche der auffrischende Wind es ihr gleichzutun. Die langen Vorhänge wölbten sich und der Geruch von Meer drang herein. Jonas erkannte das Lied erst nach ein paar Takten. Fly me to the moon. Ein Klassiker. Dabei war der Mond mittlerweile eher zweitrangig, beinahe schon langweilig geworden. Sie spreizte die Beine auseinander. Selbst im gedimmten Licht von Jonas Schlafzimmer strahlten ihre nackten Brustwarzen noch blutrot. Sie wölbten sich zu festen Spitzen auf und sie griff selbst danach, presste die Finger zusammen, zog daran, ließ sie sogar noch größer werden. Jonas ging auf die Knie und vergrub seinen Kopf in ihrem Schoß. Er versuchte, sich ganz darin aufzulösen, in ihr unterzugehen. Das Tattoo an seiner Schulter zeigte das Motiv einer Lotusblume und schien von seiner Lust genährt lebendig zu werden.Jonas drang in sie ein, ein Stöhnen durchbrach das Säuseln des Windes, nicht eindeutig definierbar, ob im Schmerz oder in purer Lust. Sie flüsterte ihm ins Ohr und streichelte über seinen Rücken, während er seine Hüfte immer stärker kreisen ließ, den Rhythmus veränderte, mal schneller, mal langsamer wurde. Sie fuhr ihm durch das nussbraune Haar und er erschauderte beinahe, weil ihn die Berührung süchtig machte, weil er dabei gar noch größer wurde und schneller und lauter; wilder, länger, öfter. Aber ER hat geschwiegen. Nicht einmal seine Stimme hat ER dir gegönnt, obwohl es dieses eine Mal so wichtig gewesen wäre. Nächster Morgen. Die Frau war bereits verschwunden. Jonas saß nur mit einer kurzen Hose bekleidet auf der Treppe zur Veranda seines kleinen Strandhauses und beobachtete das Meer. Die Sonne hatte den Horizont noch nicht überschritten, aber der Himmel färbte sich bereits lila, blau und gold. Neben ihm stand eine Tasse Kaffee, die er gar nicht angerührt hatte und die mittlerweile kalt geworden war. Er drehte den Kopf und betrachtete sein Haus. Es hatte zwei Stockwerke, war im modernen Stil aus hellgrauen Betonelementen erbaut und trotz der etwas abgeschiedenen Lage optimal an das Straßennetz angebunden. Mit seinem Mustang brauchte er gerade einmal 45 Minuten in die Stadt und nur 30 Minuten zum Hafen. Er wandte sich wieder dem Meer zu und blickte in die Augen einer dunklen Gestalt.»Hey!«, japste er, sprang auf und warf dabei die Tasse Kaffee um. Mit pochendem Herzen starrte er den grauen Hund an, der vor ihm zufrieden hechelnd im Sand stand. »Ein Pitbull?«, keuchte Jonas und blickte suchend den Strand auf und ab. Aber dort war weit und breit kein Spaziergänger zu sehen. Außerdem gab es ohnehin so gut wie keine Hundehalter mehr, vor allem nicht von einer solchen Rasse. »Schlepp mir bloß nicht eine deiner Krankheiten hierher. Na los, verschwinde!«, bellte Jonas. Der Hund neigte den Kopf, so als verstünde er nicht so recht, was man von ihm wollte.»Verschwinde!«, wiederholte Jonas. Anstatt zu gehorchen, machte der Hund einen kräftigen Satz nach vorn, wedelte mit dem Schwanz und hielt direkt auf die Treppe zu. Jonas stieß sich vom Geländer ab, taumelte ein, zwei Schritte, fing sich dann wieder auf und flüchtete Hals über Kopf zur gläsernen Schiebetür, die er panisch hinter sich verschloss. Keine Sekunde zu spät, denn der Hund hatte bereits die Veranda betreten, blieb zwischen Jacuzzi und Tischgruppe stehen und starrte Jonas durch das Fensterglas hindurch an.»Was für eine Scheiße!«, maulte er und hielt sich dabei den rechten Ellenbogen, den er sich bei seiner Flucht böse angestoßen hatte. Er schüttelte wütend den Kopf und schlug mit der flachen Hand gegen die Scheibe. Der dumpfe Ton beeindruckte den Hund nicht weiter, im Gegenteil – der Pitbull grinste zufrieden, nahm Platz und schleckte sich über die Schnauze. »Der will mich doch verarschen«, zischte Jonas und warf einen Blick auf seine silberne Uhr. Es war noch zu früh, um beim Veterinäramt anzurufen, außerdem …»Scheiße, es ist ja Sonntag«, murmelte er und rieb sich die Augen. »Muss ich jetzt wegen dir wirklich die Polizei holen?«, keifte er in Richtung des Hundes. Als wollte der ihn verhöhnen, begann der Pitbull zu hecheln und wippte dabei mit dem Kopf. Jonas seufzte laut, ging in die Küche und schenkte sich ein Glas Wasser ein. Er leerte es in einem Zug, füllte es erneut und ging damit zurück in das Wohnzimmer. Der Hund hatte sich keinen Millimeter von der Stelle bewegt. Kopfschüttelnd ergriff er das Buch, das er sich für den Tag vorgenommen hatte und ließ sich in seinen Lieblingssessel nieder. »Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich lese jetzt!«, rief er trotzig in Richtung Veranda und schlug demonstrativ das Buch auf. Es handelte sich um eine Neuauflage der Originalversion, die lange vor dem Krieg im Jahr 1995 erschienen war. Sie enthielt ein aktualisiertes Vorwort, das Jonas jedoch getrost übersprang. Ihn interessierte das Geschwafel nicht, er wollte nur die Informationen, die dazu geführt hatten, dass dieses Werk mittlerweile verboten und für die Menschen nicht mehr zugänglich war. Der Autor des Buches hatte sich zu Lebzeiten nie auf ein Spezialgebiet festgelegt und war deswegen schwer einzuordnen – eine Mischung aus Schriftsteller, Journalist und Wissenschaftler. Seine Kritiker hingegen bezeichneten ihn am liebsten als einen Drogen konsumierenden Vollidioten. Der Text allein ließ diesen Schluss nicht ohne weiteres zu. Jonas musste immer wieder inne halten, glich Quellen ab, überprüfte neu gewonnene Erkenntnisse und verstand mit jedem Wort mehr, warum dieses Buch so viele Menschen begeistert hatte. Der Erzähler sprach eine klare Sprache, versteckte sich nicht hinter fachspezifischen Floskeln und vage formulierten Binsenweisheiten. Ihm ging es um nichts weniger als um die Entstehungsgeschichte der Menschheit. Und dabei scheute er auch nicht davor zurück, die etablierten Theorien schonungslos in Frage zu stellen. Nach einer Weile klappte Jonas das Buch zu, rieb sich die Augen und hielt sie für einen Augenblick geschlossen. Obwohl es so gut wie keine physischen Bücher mehr gab, hatte er es – Lautrec sei Dank – tatsächlich geschafft, eine echte Kopie aus Papier zu bekommen.Er betrachtete den Einband und murmelte: »Dein Name wurde öfter erwähnt … Jetzt weiß ich auch, wieso.« Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er bereits anderthalb Stunden mit der Lektüre verbracht hatte. »Fesselnd ist es, das muss ich zugeben«, seufzte Jonas, erhob sich und wollte gerade in die Küche gehen, als er den Hund noch immer auf der Veranda sitzen sah.»Wirklich?«, schnaubte er, stapfte an die Schiebetür heran und patschte mit der Hand erneut gegen die Scheibe. Wieder zeigte sich der Hund zur Gänze unbeeindruckt und bewegte sich keinen Zentimeter. Er hechelte fröhlich vor sich hin und ließ sich die aufgegangene Sonne auf den Rücken scheinen. Jonas hastete kopfschüttelnd in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Nachdem er eine Packung Schinken und einen Kopfsalat grob herausgegriffen hatte, begann er damit, sich ein Sandwich zu belegen. Er schnappte sich eine kleine Packung Sour-Cream-Chips aus der Schublade und legte sie zu dem Teller mit dem Brot dazu. Schließlich murmelte er: »Scheiß drauf«, öffnete den Kühlschrank und holte eine Dose Bier hervor. Eigentlich verbat es ihm seine Arbeit, Weißbrot und Chips zu essen, und ganz besonders verbat sie es ihm, Bier zu trinken. Doch an diesem Tag schaffte er es nicht, die notwendige Disziplin aufzubringen, um sich der leisen Verführung zu widersetzen. So wie es aktuell aussah, machte es ja ohnehin keinen Unterschied, ob er sich den Arsch aufriss oder einfach allein in seinem Haus verfettete. Jonas nahm einen großen Bissen von seinem fertigen Sandwich. Das Brot war weich und süß, der Salat knackig und leicht bitter, was von der saftigen Tomate, dem kräftigen Schinken und der herzhaften Mayonnaise genau richtig abgefedert wurde. Er griff zu den Chips und kostete auch davon. Dann folgte die Krönung. Mit einem leisen Zischen öffnete er die eisgekühlte Dose seines Lieblingsbiers. Das Kondenswasser benetzte seine Haut, während er das Getränk anhob, es an die Lippen führte und die perlende Flüssigkeit in seine Kehle laufen ließ. Nach drei großen Schlucken setzte er ab und betrachtete die Dose in seinen Händen, als hätte er einen alten Freund nach Jahren der Trennung wiedergetroffen. »Massephase … So kriegen wir das schon wieder hin«, grinste er und klatschte sich dabei beherzt auf den schmal gewordenen Oberschenkel. Es war ihm danach, sich zu bewegen. Also ging er mit dem Sandwich in der Hand hinüber in das Wohnzimmer und holte sich sein Tablet. Der Hund saß immer noch auf der Veranda und folgte gespannt seinen Bewegungen.»Dich kleinen Scheißer hätte ich fast vergessen!«, sagte er mit Hohn in der Stimme und grinste das Tier herausfordernd an. Er bewegte die Hand mit dem Sandwich etwas von sich weg – der Hund drehte seinen Kopf und schien von dem Leckerbissen ganz und gar in Bann gezogen worden zu sein. »Ja, ist ziemlich geil!«, sagte er, streckte dem Hund die Zunge raus und verschwand wieder in der Küche. Er tippte auf sein Tablet und suchte nach einem Video, das er sich zum Zeitvertreib beim Essen ansehen konnte. Er fand einen Zusammenschnitt von Missgeschicken aus aller Welt und ließ es laufen. Während er einen weiteren Bissen des Sandwichs nahm, beobachtete er einen Mann dabei, wie er versuchte, seine Dachrinne zu säubern, dann aus Versehen die Leiter umstieß und anschließend auf den Boden plumpste. Er verzog keine Miene. Das nächste Video begann mit einem jungen Teenager, der einen Tanz aufführte, sich wild im Kreis drehte, das Gleichgewicht verlor und gegen einen Computer samt Bildschirm krachte. Danach folgte ein Mountainbiker, der bei einem seiner Sprünge die Distanz falsch einschätzte und unkontrolliert gegen einen Baum klatschte. Jonas stoppte das Video und schaltete das Tablett aus. Er wollte noch einen Bissen des Sandwichs nehmen, hielt dann aber inne und betrachtete es eine Weile. Etwas in seinem Innern begann zu nagen und zu flüstern. Allmählich verfestigte sich eine Idee, die er unter anderen Umständen sicherlich entschieden zurückgewiesen hätte. Doch jetzt erschien ihm dieser Gedanke weit weniger dämlich, als es ihm lieb gewesen wäre. Vielleicht hatten die vielen Wochen mit geringer Schwerkraft doch mehr Einfluss auf die Denkprozesse, als bisher angenommen. Oder es war das Bier. Wahrscheinlich eher das Bier. »Ich muss doch echt verrückt sein!«, knurrte er nach einer Weile und schüttelte den Kopf. Mit grimmiger Miene begann er damit, ein zweites Sandwich zu belegen. Er drapierte es auf einen Teller und suchte in einem seiner Küchenschränke nach einem Gefäß. Er fand eine Müsli-Schale mit Donald Duck Motiv und füllte sie mit Wasser. Dann nahm er Teller sowie Schale und ging damit in das Wohnzimmer. Vor der Schiebetür zur Veranda blieb er stehen. Der Hund schaute mit wedelndem Schwanz zu ihm auf. »Du hörst mir jetzt gut zu: Ich will einfach nur, dass du verschwindest, verstanden? Vielleicht hast du Hunger und bist deswegen hier. Ich hab kein Hundefutter und weiß auch gar nicht, was so ein Ding wie du überhaupt frisst, aber das hier wird es schon tun. Also treffen wir jetzt eine Abmachung. Ich gebe dir was zu essen, und dafür verpisst du dich dann auf der Stelle. Deal?« Der Hund schleckte sich mit der Zunge über die tropfenden Lefzen. »Und wehe, du fällst mich an!«, fügte Jonas hinzu und schob mit seinem Fuß die Schiebetür auf. Hastig stellte er Schüssel und Teller direkt davor. Der Hund erhob sich, wedelte mit dem Schwanz und näherte sich dem Sandwich. Jonas knallte die Schiebetür sofort wieder zu, konnte aber noch das laute Schnuppern des Hundes hören, der sich nicht sofort in das Vergnügen stürzte, sondern zunächst akribisch überprüfte, ob das Angebot überhaupt seinem Geschmack entsprach. Ein paar Sekunden später begann er damit, das Sandwich in wenigen Happen herunterzuschlingen. Dann schlabberte er noch das kalte Wasser aus der Schüssel. »Prost«, murmelte Jonas, ging in die Küche und holte sich seine noch halb volle Dose Bier. Er nahm sie mit ins Wohnzimmer, setzte sich zurück in den Sessel, griff nach dem Buch und keifte in Richtung des Hundes: »Und jetzt verschwinde endlich. Das war der Deal!«Dann vertiefte er sich wieder in seine Lektüre. Er hatte an einer Stelle aufgehört, an welcher der Text auf einen Widerspruch bei mittelalterlichen Karten verwies. Ein Mann namens Piri Reis hatte im 16. Jahrhundert eine dieser Karten angefertigt und die ganze Welt darauf abgebildet, inklusive einer detaillierten Darstellung der Antarktis. Das Problem dabei war nur, dass der Südpol zu dieser Zeit noch gar nicht entdeckt worden war und sich der Kontinent ohnehin unter gigantischen Eismassen verbarg. Jonas überprüfte diese These und studierte die eingezeichneten Küstenlinien. Noch verwirrender dabei war, dass Piri Reis auf der Karte handschriftlich vermerkt hatte, dass seine Abbildung der Kontinente auf mehr als einhundert verschiedenen Quellkarten basiert, von denen einige bis auf die Zeit von Alexander dem Großen zurückgingen. Mit einem energischen Kopfschütteln klappte Jonas das Buch zu und rieb sich die Augen. Der Mangel an Schlaf machte sich bemerkbar, seine Gedanken begannen abzuschweifen und verfingen sich in einfältigen Hirngespinsten, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. »Vielleicht brauche ich wirklich einfach nur eine Zeit lang Urlaub … Vielleicht hat ER recht«, sagte er zu sich selbst und erhob sich aus dem Sessel. Mit der Dose Bier in der Hand, das mittlerweile schal geworden war, ging er zum Schiebefenster hinüber und betrachtete die glitzernden Wogen des Meeres. Die Sonne strahlte nun fast senkrecht vom Himmel und Jonas spielte mit dem Gedanken, sich in seinen Jacuzzi zu legen. Er bemerkte, dass der Hund nicht mehr auf der Veranda saß. Sofort schob er die Tür auf, trat nach draußen und blickte den Strand hinab. Keine Tieresseele weit und breit. »Deal …«, murmelte er. Dann nahm er den Teller und die Donald Duck Schale und ging damit zurück in die Küche.
Wir betreten einen entlegenen Teil der Stadt. Es gibt keine U-Bahn Stationen mehr und Busse würden den Ort zwar erreichen, aber Kakashi will keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Auf meine Frage, wieso, antwortete er nur mit einem schroffen: »Versuch, weniger Fragen zu stellen.«Wir müssen mindestens seit einer Stunde unterwegs sein. Hätte ich gewusst, was mich an diesem Tag erwartet, hätte ich auf die Jeans, die Bluse und den Blazer verzichtet. Und dieser zunehmende Gestank macht mir zu schaffen. Es hat vor zehn Minuten begonnen und wird seitdem immer penetranter. Mal riecht es wie an einer angeranzten Tankstelle, dann wieder nach vergammeltem Fisch, nur um sich wenig später mit dem Geruch von zu lange benutztem Bratfett abzuwechseln. Die Straße ist in schlechtem Zustand, ebenso die Gebäude, die sich in unregelmäßigen Abständen nebeneinander reihen. Es sind meistens verrostete Blechhallen, Schrotthöfe oder Lagerstätten für Kohle und Düngemittel.Möwen schreien über unseren Köpfen und beobachten uns wie Eindringlinge. Mittlerweile hat der Geruch nach verrottendem Seegras, Öl und Diesel die anderen verdrängt. Wir kommen an einem Maschendrahtzaun an, der einen großen Umschlaghafen von der Öffentlichkeit abschirmt. Vor uns erheben sich mehrere Wellblechhallen in die Höhe, dazwischen sieht man hindurch bis zu den Kränen, die tonnenweise Ladung von Containerschiffen anheben können. Kakashi führt mich zu einer Stelle am Zaun, an welcher der Maschendraht aufgebrochen worden ist und zur Seite geschoben werden kann. Er geht vor mir in die Hocke und winkt mich zu sich herunter. »Wir werden uns das jetzt näher ansehen«, flüstert er mir zu. »Ist das nicht verboten?«, frage ich.»Nein, ist es nicht«, sagt er. Ich hebe den Kopf und lese den Text auf dem Schild, das über uns am Maschendrahtzaun angebracht ist. Rote Schrift auf weißem Grund verkündet: Betreten verboten. Widerrechtliches Betreten wird strafrechtlich verfolgt. »Da steht doch«, beginne ich zu sagen, verstumme aber, als mich Kakashi genervt ansieht. »Natürlich ist das verboten«, zischt er, »Aber willst du deinen Hund jetzt finden oder nicht?« Ich weiß keine Antwort auf die Frage und schweige lieber. »Wir werden uns da drin ein bisschen umsehen. Ich würde lieber allein gehen, aber ich kann den Hund nicht selbst identifizieren. Eins ist ganz wichtig«, Kakashi berührt mich am Handgelenk und hält es fest. Ich hebe den Kopf und sehe ihm direkt in die Augen. Sie sind pechschwarz und dunkel wie die Nacht. Trotzdem verleiht ihnen die Spiegelungen des Lichts einen spielerischen, fast fürsorglichen Anschein, der nicht so recht zu dem Ton seiner Stimme passen will. »Auf gar keinen Fall entfernst du dich von mir weiter als einen Meter, du bleibst immer direkt hinter mir, verstanden?« Ich nicke. Er nickt zurück, lässt mein Handgelenk wieder los, zupft sich seinen Mantel zurecht und schlüpft durch das Loch im Zaun. Wir schleichen an der Wellblechwand entlang und nähern uns dabei der dem Hafenbecken zugewandten Seite. An einem brusthohen Wassertank, auf dem einige übereinander gestapelte Taue liegen, bleiben wir stehen. Kakashi gibt mir mit einer Bewegung seiner Hand zu verstehen, dass ich mich dahinter verstecken soll. Ich gehe in die Hocke und tauche im Schutze des Plastiktanks unter. Während Kakashi gebückt über die Taue hinweg lugt, entsteht ganz in unserer Nähe das Geräusch von schepperndem Metall. Kakashi lässt sich fallen und kniet nun wieder direkt neben mir. Er ist mir so nahe gekommen, dass ich ihn riechen kann. Er hat ein Deodorant benutzt, das viele junge Männer in seinem Alter nutzen. Der Duft wird im Internet von einem berühmten Schauspieler beworben. Das war eine der ersten Kampagnen, bei denen sich Menschen mit implantiertem Chip direkt vom Geruch des Produkts selbst überzeugen konnten. Die Stimmen zweier Männer ertönen nicht weit von uns entfernt, eine Tür fällt laut krachend ins Schloss. Ein Feuerzeug klickt zwei, dreimal, dann entsteht endlich eine Flamme daran. »Es ist wirklich eine Ehre, dass der Hafenmeister während unserer Pause höchst persönlich vorbeischaut.«»Spar dir das Geschleime. Ich bin nur hier, weil ihr euch zu viel Zeit lasst.«Kakashi blickt mir ermahnend in die Augen und legt dabei den Zeigefinger auf seine Lippen. Ich versuche, mich so klein wie möglich zu machen. In der Spiegelung der großen Pfütze neben mir, sehe ich die beiden Männer, die nicht weiter als zwei, drei Meter von uns entfernt sein können. Der eine ist groß, trägt einen Anzug mit roter Krawatte und raucht eine Zigarette. Der andere steht etwas gebückt vor ihm und trägt irgendeine Art Pelzmantel. »Hafenmeister, das tut uns ja auch alles sehr, sehr leid, aber …«, beginnt der Mann in dem Pelz wild gestikulierend zu erklären, wird aber sogleich von dem Mann im Anzug unterbrochen.»Kein ‚aber‘. Wir werden in Zukunft sogar noch mehr verarbeiten müssen und in diesem Geschäft kann es kein Versagen geben. Versagt ihr, versage ich und versage ich, dann muss ich das dem da oben klarmachen und der da oben ist nicht gut mit schlechten Nachrichten. Genau genommen hasst ER sie. ER kann sie einfach nicht ab, das ist für ihn wie mit einer Allergie, sobald ER damit in Berührung kommt, explodiert es in ihm.« Der Mann schmeißt die halb aufgerauchte Zigarette zu Boden und tritt sie aus. »Am Ende ist es ganz einfach: wenn wir Wachstum wollen, müssen sich unsere Räder schneller drehen. Alles muss laufen wie geschmiert und da können wir uns keine Jammereien erlauben, habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«»Ja, Hafenmeister, natürlich, natürlich, natürlich.« Der Mann im Pelzmantel nickt unterwürfig und hält dabei seine abgeknickten Hände vor der Brust, so als wäre er ein Hund, der vor seinem Herrchen brav das Männchen macht. Und im nächsten Moment tätschelt der Mann im Anzug ihm sogar den Kopf und stopft ihm etwas in den Mund hinein, das er mit größter Freude laut schmatzend zerkaut. »Guter Junge!«, seufzt der Anzugträger, dreht sich dann ohne ein weiteres Wort zu sagen um und eilt davon. Es dauert noch kurz, bis der andere mit Kauen fertig ist. Dann schleckt er sich ein paar Mal genüsslich über die Lippen und stapft zurück in die Wellblechhalle. Die Tür fällt mit einem lauten Donnern ins Schloss.»Hast du das gesehen?«, flüstere ich Kakashi zu, doch der wirft mir nur einen wütenden Blick zu und presst sich erneut den Finger auf die Lippen. Nach einer Weile erhebt sich Kakashi und deutet mir an, dass er die Halle noch einmal in der anderen Richtung umrunden will. Ich folge ihm ohne Widerrede. Wir schleichen zurück zum Maschendrahtzaun und erreichen wenig später die entlegene Seite der Anlage. Weil es die letzte Halle des Hafens ist, befindet sich zu unserer linken das offene Meer. Kakashi schenkt der grau vernieselten Weite keine Beachtung, aber ich werfe einen flüchtigen Blick darauf. Mein Tag hat dort draußen begonnen. Ich bin aufgetaucht, zurück an Land geschwommen und musste an Tiki denken, der mir über Nacht weggelaufen war. Etwas in meinem Innern verdunkelt sich, obwohl ich nicht verstehe, wieso. Es fühlt sich an, als hätte jemand meinen Kopf vom Hals abgetrennt und anschließend eine großzügige Menge der dunklen Brühe hineingegossen, die dort vor unseren Augen im Meer hin- und herschwappt. Kakashi bleibt stehen, geht in die Hocke und deutet auf den Boden vor sich. Dort liegt etwas, das ich auf den ersten Blick nicht richtig zuordnen kann. Es ist milchig weiß; glänzig und ungefähr faustgroß. Ich gehe meinerseits in die Hocke, forme die Augen zu schlitzen und versuche zu verstehen, warum Kakashi dem Klumpen so große Bedeutung beimisst. Ich beobachte ihn dabei, wie er den Zeigefinger ausstreckt, über die Oberfläche der Masse fährt, den Finger zum Mund führt und ihn mit der Zunge berührt. Seine Augen weiten sich. Er holt einen kleinen Plastikbeutel hervor und flüstert mir zu: »Mehl!«Ein unsagbarer Schrei hallt durch die Luft. Ich zucke zusammen und reiße den Kopf herum, sehe aber nichts. Kakashis Miene verfinstert sich, während das Geräusch in ein verzweifeltes Gejaule übergeht, so hoch und penetrant, dass es in den Ohren schmerzt. »Da!«, sage ich und deute auf eine Stelle ungefähr vier Meter hinter uns, wo sich ein Segment der Wellblechverkleidung gelöst hat und einen Spaltbreit den Blick in das Innere der Halle preisgibt. Ich stehe auf und halte darauf zu, spüre zwar noch die Hand Kakashis, der versucht, mich zurückzuhalten, doch ich ignoriere ihn. Mit jedem Schritt, den ich dem Spalt näher komme, wird das blutgefrierende Kreischen lauter und verstörender. Ich muss mich auf die Zehenspitzen stellen, um sehen zu können. Dann wird mir schlagartig klar von was die verzweifelten Schreie stammen. Im Zentrum der Halle steht der Mann von vorhin, der sich mit dem Hafenmeister unterhalten und von ihm einen Keks bekommen hat. Ich kann nun auch sein Gesicht erkennen. Er hat eine schwarze Nase, wild wucherndes Haar, das eine Einheit mit seinem Bart bildet und ungewöhnlich weit über die Wangenknochen reicht. Seine Zunge hängt heraus und der Sabber tropft ihm aus dem Maul, platscht auf den Boden und vermischt sich dort mit dunklem Blut. Denn in der rechten Hand hält er einen Hund gepackt, einen Golden Retriever mit lose zugebundener Schnauze, und mit der linken hält er ein großes Messer fest umschlossen, das er dem Tier bereits oberhalb des Schulterblatts unter die Haut gerammt hat. Der Hund schreit, brüllt, jault und fiept vor Schmerz, doch dem Mann ist das einerlei. Er fährt mit der Klinge weiter, gleitet knapp oberhalb des Fleisches über den Körper des Tieres und ich sehe, wie sich seine Haut langsam von den Faszien und Sehnen löst, sehe Stellen, an denen er zu tief geschnitten hat und das Blut hervorquillt, sehe, wie der Mann das Messer an einem Magneten an seinem Gürtel befestigt, um mit der bloßen Faust zuzupacken und ein Stück weiter zu reißen, um das Fell auch möglichst rein zu halten. Ich höre die Geräusche, die dabei entstehen und die klingen, als ziehe man einen Klebestreifen von einer neuen Rolle Klebeband, ich höre das Schmatzen, das der Mann von sich gibt, während er seiner Arbeit nachgeht und vor allem höre ich die Schreie des Hundes, die zwischenzeitlich abflauen, weil er das Bewusstsein verloren hat, dann wiederkehren, wenn der Mann einen erneuten Schnitt setzt, der einen solchen Schmerz auslösen muss, dass er sogar die Ohnmacht durchbricht. Bald jedoch wandeln sich die Schreie endgültig zu einem leisen Gewimmer, spätestens als der Mann ein letztes Mal zupackt und mit einem gekonnten Griff die Haut über Ohren, Augen, Maul und Schnauze zieht.