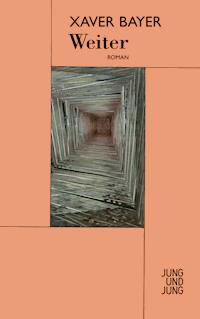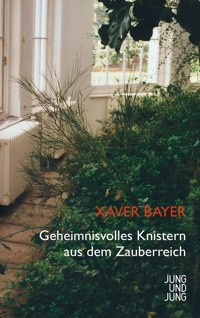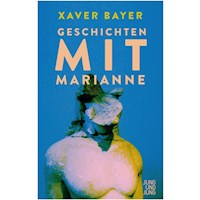Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Machtabscheu des Protagonisten. Der Versuch, ein für allemal die Posen der Macht aufzugeben. Der Zwang, in jeder Bestimmtheit auch eine Willfährigkeit auszumachen, und der Wunsch, diese im selben Atemzug zu vernichten. Was würde es heißen, darin erfolgreich zu sein? Und was geschähe dabei mit dem blinden Fleck des Daseins, dem Körper? Von einem Tag auf den anderen kündigt er bei der Partnerschaftsvermittlungsagentur. Es bleibt nicht viel, was die zähe Gleichförmigkeit der Tage durchbricht. Da entschließt er sich zu einem Inselurlaub, mit seiner Freundin. In seltenen Stunden, es waren die schönsten, wurde alles leicht zwischen den beiden: die Gesten, die Berührungen, die Worte. Der helle Raum spiegelte sich hinaus in die Nacht, öffnete sich. In diesen Momenten war Einklang. Seine Liebe allein darauf zu gründen, sie frei halten zu wollen von Wiederholung und Ritual, Macht und Unterwerfung, ist kühn, hochmütig und von einer Radikalität, die sich im Handumdrehen gegen den Ich-Erzähler selbst wendet. Dem Drang nach Auslöschung, Selbstauslöschung gibt er zunehmend nach, Gewaltphantasien brechen sich Bahn, immer unkontrollierter, den Haß fühlt er an seiner Seite »wie einen großen muskulösen Freund«. Besessen von sich, seinen Versuchen, die Wirklichkeit in Erinnerung zu übersetzen, weil er sie nur vermittelt erträgt, verweigert er sich jeder Form der Erlösung, der des Augenblicks so wie der anderen, die es nicht gibt. Mit kaltem Blick, schonungslos, selbstentblößend wird hier die »perfide Allianz von Sexualität und Tod« noch einmal und noch einmal gültig seziert.»Deine Gewaltphantasien sind nur Ablenkungsmanöver, deine Sehnsucht nach Veränderung, und sei es durch Krieg, ist nichts anderes als deine Sehnsucht, dein eigenes Herz klopfen zu hören. Du willst dann nicht nur der Auslöser sein, sondern auch der Spielball und der Sieger. Nein, erwiderte ich, das stimmt alles, aber der Sieger wollte ich nie sein.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Alaskastraße
© 2013 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenKlappenfoto: Tizza CoviISBN E-Book 978-3-99027-109-4 ISBN print 978-3-902144-53-X
XAVER BAYER
Die Alaskastraße
Roman
Das große Geheimnis aller Zeiten ist, daß der Mensch sich nur zu einem Zweck, zu einem einzigen Zweck entwickelt hat, geboren wird, lebt und stirbt: Um einen anderen Menschen sexuell zu attackieren oder sich dieser Attacke zu unterwerfen.
Walker Percy
Von der Straße her war das leise, rhythmische Schleifen einer Betonmischmaschine zu hören. Wenn ich die Augen schloß und mich darauf konzentrierte, klang es fast so, als würde jemand mit heiserer Stimme immer denselben Satz flüstern, wie in der Auslaufrille einer Schallplatte oder in einer Litanei. Ich hatte das Verlangen, den Computer auszuschalten, denn das hochfrequente Sirren des Bildschirms umhüllte alle Geräusche, die von draußen hereindrangen, mit einer künstlichen Schicht, so daß es mir vorkam, als würden sie von einem Fernseher stammen, den irgendwer vergessen hatte abzustellen. Da ich aber die einlangenden E-Mails, die sich mit einem Klingelton ankündigten, nicht hören hätte können, wenn der Computer nicht in Betrieb gewesen wäre, mußte ich ihn laufen lassen. Seitdem ich bei einer Partnervermittlungsagentur angestellt war, wo ich Werbebroschüren ausarbeitete und die Homepage der Firma betreute, saß ich jeden Tag mehrere Stunden vor dem Computer und hatte fast jedesmal nach Arbeitsschluß Kopfweh.
Das letzte E-Mail, das ich erhalten hatte, war von Rolf gewesen, obwohl er ja nur einen Raum weiter in seinem Büro saß. Er hatte geschrieben, daß er mir zu meiner Kündigung gratulieren würde und ob ich in den nächsten Tagen einmal Zeit hätte, am Abend irgendwo etwas zu trinken, und als Anlage hatte er mir ein Photo mitgeschickt, das eine Frau zeigte, die sich nackt über die Kühlerhaube eines Mercedes beugte und den Stern des Wagens fast zur Gänze in ihrem Mund hatte. Es sah einigermaßen absurd aus, aber verglichen mit den Bildern, die mir Rolf sonst zukommen ließ, harmlos. Ich hatte das E-Mail wie üblich sofort nach dem Lesen gelöscht, weil mir die Vorstellung, daß jemand so ein Photo in meinem Posteingang finden könnte, unangenehm war. Ich wechselte zwar jede Woche mein Paßwort, aber war dennoch überzeugt, daß meine E-Mails auch von anderen Leuten gelesen wurden. Das war ein Grund, warum ich Conny so ungern E-Mails schrieb. Ein anderer war, daß mir immer, wenn ich es versuchte, alles Wörtliche und Persönliche in diesem Medium abhanden kam und versackte, es war so, als ob nur durch die Tatsache, daß die Wörter und Buchstaben als zerlegte binäre Reihen wegschossen, um schließlich auf dem Monitor eines anderen Computers wiedergelesen zu werden, schon aller Sinn und alle Aufrichtigkeit verhöhnt und entstellt würde, und ich konnte mich nie überwinden, das Geschriebene abzusenden. Conny hatte mir einmal vorgehalten, daß ich nie auf ihre E-Mails antworten würde, und als ich ihr erklären wollte, warum das so ist, deutete sie meinen Erklärungsversuch als eine Ausflucht, als eine Ausrede und eine Vorsätzlichkeit, ihre E-Mails, in denen sie schrieb, daß sie mich liebt, nicht beantworten zu müssen. Einmal tat ich es doch und schickte ihr nachts in einer Stimmung von verliebtem Übermut ein paar Sätze. Als ich tags darauf keine Antwort erhalten hatte, rief ich sie an. Sie mußte wohl meine Nummer auf der Anzeige ihres Telephons gesehen haben, denn sie nahm den Anruf mit einer so ärgerlichen Stimme entgegen, als hätte ich sie eben in einem Streit mit jemandem anderen gestört, und fragte mich, warum ich mich über ihre Gefühle lustig machen würde. Mein E-Mail hatte sie in einer Stimmung der Niedergeschlagenheit erwischt, und so war vor ihren Augen das, was in meinen Worten liebevoll und neckend gewesen war, in etwas Hämisches und Boshaftes verwandelt worden. Ich beteuerte meine gute Absicht, aber allein durch die Notwendigkeit des Beteuerns verfiel ich in eine fast lamentierende Sprache, so daß ich mir letztlich selber unglaubwürdig vorkam. Wir beschlossen, nicht mehr darüber zu reden, und somit war der Vorfall für alle Zeiten kriminalisiert und beiseite gelegt mit der unausgesprochenen Option, eines Tages wieder hervorgezogen zu werden.
Rolf nebenan schrieb oft E-Mails. Er tippte auch gerne Kurznachrichten in sein Handy, und mehrmals am Tag hörte ich es piepsen, wenn er eine Nachricht gesendet bekam, während mein Handy, dessen Abmeldung ich zur selben Zeit vornahm, in der ich auch meine Kündigung bekanntgab, ausgeschaltet in meinem Sakko steckte. Den Beschluß, es abzumelden, hatte ich gefaßt, als ich einmal auf der Straße spazierte und bemerkte, daß jeder der Passanten ein Handy an sein Ohr hielt. Es waren vielleicht sechs oder sieben Menschen unterwegs, und alle telephonierten. Als in diesem Moment auch mein Handy zu läuten anfing, genierte ich mich, es aus der Tasche zu holen. Ich verwendete es dann nur noch für ein paar agenturinterne Gespräche, und um bei der Betreiberfirma anzurufen und mich wegen der Abmeldungsmodalitäten zu erkundigen. Als sich ein paar Tage später eine Mitarbeiterin der Firma bei mir zu Hause meldete, um die Gründe meiner Abmeldung zu erfahren, log ich und behauptete, daß ich für längere Zeit im Ausland sein würde, denn ich brachte nicht den Mut auf, ihr die Wahrheit zu sagen.
Die Kündigung war unangenehmer. Zuerst hatte mich unsere Chefin noch mit einer Gehaltserhöhung umzustimmen versucht, aber als ich nicht darauf einging, begann sie meinen Ausstieg als einen Boykott an ihrer Arbeit und als Anschlag auf das Wohl der Firma hinzustellen. Dann wechselte sie wieder den Ton und wollte, da ich den Fehler gemacht hatte, als Grund für meine Kündigung »private Gründe« anzugeben, wissen, ob ich Probleme hätte, bei denen sie mir helfen könnte, denn schließlich, wie sie sagte, seien wir ja fast schon eine Familie. Ich hatte mich nicht darauf eingelassen, und seitdem war ihre Haltung mir gegenüber wieder feindselig und sehr distanziert geworden. Ich erledigte meine Arbeit nach wie vor verläßlich.
Als es erneut in meinem Posteingang klingelte, sah ich, daß Rolf mir noch eine Nachricht geschickt hatte, diesmal ein weitergeleitetes E-Mail einer Kundin, die sich darüber beschwerte, daß ein ihr vermittelter Mann nicht ihren Vorstellungen entsprach. Ich erinnerte mich an die Frau. Aus Mangel an männlichen Bewerbern hatte unsere Chefin einen ihrer Bekannten gebeten, sich mit der Kundin zu treffen, aber diese wollte ihn nicht kennenlernen, da, wie sie in dem E-Mail, das ich gerade las, schrieb, allein der Name des potentiellen Partners für sie nach einem jüdischen Händler klang. Ich rief Rolf durch die offene Verbindungstür zu, was ich davon hielt, und rechnete mir dann mit Hilfe eines Kalenders aus, wie viele Stunden ich noch im Büro verbringen müssen würde.
Punkt siebzehn Uhr schaltete ich den Computer aus, verabschiedete mich von Rolf, der noch länger dablieb, und verließ das Büro. Im Stiegenhaus dachte ich mir, daß ich manchmal gerne, wie in Horrorfilmen, meinen Kopf unter den Arm nehmen und so mit ihm spazierengehen würde. Hätte ich meinen Schädel erst auf der Höhe des Herzens, wäre ich gerettet, so war meine Vorstellung. Ich wäre auch gerne wie dieses eine Zeichentrickmonster gewesen, das alles und jeden aufsaugt und verschluckt, am Ende sich selbst, und nichts bleibt zurück.
Dann fiel mir wieder einmal nicht ein, wo ich mein Auto geparkt hatte. Ich schritt die Gassen in der Umgebung ab und versuchte, mich zu erinnern, ob mir heute morgen irgend etwas Besonderes widerfahren war wie zum Beispiel, daß ich beim Einparken an das Auto vor mir gestoßen oder daß ich vor der Auslage eines besonderen Geschäfts ausgestiegen wäre, aber so sehr glichen einander die Tage und ihre Zeremonien, daß ich keine Anhaltspunkte finden konnte. Schließlich entdeckte ich den Wagen und wunderte mich, daß mir nicht gleich eingefallen war, wo er stand. Ich stieg ein und startete, aber er sprang nicht sofort an, weil ich auf das Vorglühen vergessen hatte.
Als ich in der Nähe meiner Wohnung eine Viertelstunde lang keinen Parkplatz fand, wurde ich schlagartig, so wie ein Schloß einschnappt, wütend. Ich geriet völlig außer mir, wie in den Filmen, in denen von einer Sekunde auf die andere ein biederer Mann ausrastet und Amok läuft. Ich brüllte und schlug auf das Lenkrad und verfluchte diesen Tag, und es hatte etwas Befreiendes, sich so gehenzulassen. Wäre Conny in diesem Moment neben mir gesessen, ich hätte all meinen Haß, der ja aus dem Unvermögen, mich zu beherrschen, bestand, in meine Worte an sie gelegt. Ich empfand Lust, mich von meiner polternden Blindwütigkeit übermannen zu lassen. Es war, als würde mir genau das einen Kitzel verschaffen, der mir schmeichelte, wie wenn mir eine Frau etwas ins Ohr flüsterte. Es war so einfach und wohltuend, mich mit meinem Haß zu solidarisieren, denn ich fühlte ihn stark an meiner Seite wie einen großen, muskulösen Freund. Dabei fragte ich mich, wovon ich mich denn gleichzeitig auch so angegriffen fühlte, aber ich kam auf kein Ergebnis, denn eine Antwort wurde von mir selber verstellt, als würde ich mir den Weg dahin mit meinem Dasein zugeschüttet haben oder als würde ich wie bei einem Fußballoder Korbballspiel von einem dermaßen gewandten Gegner gedeckt werden, daß ein Weiterkommen undenkbar war und ich nur in eine Ecke gedrängt im Besitz des Balls bleiben konnte. Dann spann ich, während ich wie ein Besessener um den Häuserblock fuhr, das Bild weiter und überlegte, was der Ball in dieser Metapher sein könnte. Mein Haß? Ich selber, meine Identität? Meine Souveränität? Die Möglichkeit, den Ball einfach weiterzuspielen, kam mir in den Sinn, aber ich fand mich allein, und ich war mir nicht sicher, ob ich den Ball kampflos dem Gegner überlassen sollte oder ob es legitim war, das Spiel einfach abzubrechen und es somit wirklich als Spiel zu definieren und nicht als Ernst. Ich stellte mir unaufhörlich die Frage, ob ich dann ein Spielverderber wäre, aber bei diesem Punkt merkte ich, daß ich mich schon so sehr in das Bild verrannt hatte, daß es sich vor Erschöpfung selbst auflöste, und ich drehte mich in der Phantasie um und begann, mit dem Ball in der Hand meinen Gegner zu attackieren, also ein Foul zu begehen.
Endlich erblickte ich eine Frau, die im Begriff war, in ihr Auto einzusteigen, um wegzufahren, und ohne daß ich eine fragende Geste gemacht hätte, nickte sie und lächelte mich an, so daß ich unwillkürlich zurücklächelte und mir bewußt wurde, wie verkrampft ich ausgesehen haben mußte.
Ausgeräumt vor Lächerlichkeit, das war mein Gedanke, und mir fiel das Huhn ein, das ich vor ein paar Tagen in einem Supermarkt gekauft hatte. Im Inneren des in Zellophan gewickelten Tiers steckten in einem Plastiksäckchen ein paar seiner Eingeweide. Ich mußte lachen, aber mein Lachen schlug, ohne einen Atemzug dazwischen, in ein trauriges Schaudern um, bei dem ich übergangslos an einen Luftballon denken mußte, den ich wenige Minuten vorher, als ich bei einer roten Ampel halten mußte, auf der Straße gesehen hatte. Er lag am Trottoir, wackelnd vorwärtsgetrieben im Wind, und an seiner Schnur schleifte er einen zweiten – jedoch zerplatzten – Luftballon mit sich. Es war fast qualvoll anzusehen, denn es erinnerte an die Bilder von Soldaten, die einen Verletzten mit sich ziehen, oder an eine Katze, der man einen schweren Stein an den Schwanz gebunden hatte. Ich erschrak über die Erinnerung und über den Einfall, daß es eben nur noch Erinnerung war, als ob es sonst gar nichts mehr geben würde, von einem Augenblick zum nächsten.
Ich parkte, merkte mir den Platz, um morgen in der Früh nicht wieder nach dem Auto suchen zu müssen, und schlug den Weg zu meinem Wohnhaus ein. Zu Hause angekommen, rief ich Conny an, um mit ihr ein Lokal auszuwählen, in dem wir zu Abend essen könnten. Wir einigten uns auf ein Restaurant, das von unseren beiden Wohnungen ungefähr gleich weit entfernt war, wie um dadurch gleiche Chancen zu haben, und verabredeten uns dort für acht Uhr.
Mir war schon während des Telephonierens aufgefallen, daß ich alles, was auch nur vage eine Abmachung betraf, nicht ernst nehmen konnte, als würde schon dem Umstand, daß wir vereinbarten, uns zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu treffen, eine unabsprechbare Lächerlichkeit innewohnen. Es wäre mir in gewisser Weise lieber gewesen, wenn sich unsere Begegnung nur auf Zufälligkeiten begründet hätte. Die Absehbarkeit schien alles, Hand in Hand mit der Angst vor jeglicher Wiederholung, vorsätzlich und im voraus zu verheeren. Dementsprechend lief dann auch im Restaurant alles wie gewohnt ab. Den angebotenen Platz, der zu nahe an den Toiletten war, lehnten wir ab, ich bat den Kellner, als er das Feuerzeug schon gezückt hatte, unsere Tischkerze nicht anzuzünden, und wir rauchten beide eine Zigarette, während wir die Speisekarte durchsahen. Dann bestellten wir beide das gleiche, ein Steak, und ich fühlte mich dabei, als wäre ein kleines Kind an unserem Tisch, dem ich vorbildhaft zeigen wollte, wie man es richtig macht.
Beim Essen hielt Conny die ganze Zeit ihre linke Hand unter den Tisch. Wie ein Mohammedaner, dachte ich. Als ich ihr zusah, wie sie das Steak zerteilte, hatte ich den widersinnigen Gedanken, sie würde extra vorsichtig schneiden, um dem Fleisch nicht weh zu tun. Ich hingegen kam mir plötzlich zu resolut vor, wie ich das Messer durch das Fleisch zog. Als an einem anderen Tisch ein Glas hinunterfiel und zerbarst, sehnte ich den Tag herbei, an dem sich niemand mehr umdreht, wenn so etwas in einem Lokal passiert. Und auf einmal hatte ich den beunruhigenden Einfall, daß ich ja Fingerabdrücke auf meinem Glas hinterließ, als müßte ich befürchten, daß es nachher an einen Tatort geschafft würde. Ich spielte mit dem Gedanken, es auch auf den Boden fallen zu lassen.
Connys Aufforderung, mir etwas durch die Auslage des Lokals anzuschauen, was auf der Straße vor sich ging, konnte ich gleich darauf nur für einen Augenblick nachkommen, weil mein Blick sofort wie magnetisch vom Staub angezogen wurde, der in der Ritze am unteren Fensterrahmen lag, kleine Fussel und Härchen, der Vorfall auf der Straße – ein Lastwagen hatte sein Ladegut verloren – konnte nichts dagegen ausrichten. Als Conny eine Frage an mich richtete, blickte ich auf, als wäre ich bei etwas Verbotenem ertappt worden. Wie als Entschuldigung erzählte ich ihr daraufhin von einem Traum, aber anstatt wahrheitsgemäß zu berichten, daß ich darin mit einer anderen Frau in einem Auto gefahren war, erfand ich, daß sie es gewesen war. Ich fühlte mich dabei wie als Kind, wenn ich mir durch Lügen immer mehr den Rückweg zur Wahrheit abgeschnitten hatte. Sie erzählte danach auch von einem ihrer Träume, und die restliche Zeit des Essens sprach fast nur noch sie. Während des Redens schloß sie öfter die Augen, so offensichtlich, als schmerzten sie. Es kam mir vor, sie würde mich durch ein zur Schau gestelltes Leiden ablenken oder etwas vertuschen wollen. Die Disziplin der Vertuschung, dachte ich.
Nach dem Essen zündete ich mir eine Zigarette an, aber sie blieb an meiner Unterlippe kleben, und als ich sie losgerissen hatte, blutete ich dort aus einer kleinen Wunde. Dann bat mich Conny, von meinem Arbeitstag und den Vorkommnissen im Büro zu erzählen. Ich bemühte mich, alles anschaulich zu schildern, aber mir kam vor, als wäre jedes Wort, das ich aussprach, ein Glimpfwort, und selbst als ich über Rolf sprach, dem Conny schon einmal begegnet war, hatte ich das Gefühl, hinter meinen Wörtern und Sätzen würden sich andere, furchtbare verstecken. Auch war ich, als wir dann gehen wollten, plötzlich unsicher, ob ich: Zahlen! sagen oder förmlich die Rechnung verlangen sollte: Das Lokal schien keine von den beiden Möglichkeiten zuzulassen.
Schon im Stehen, beim letzten Blick auf unseren Tisch, sah ich, daß ich meine Zigarette im Aschenbecher nicht sorgfältig genug ausgetötet hatte, denn sie qualmte noch. Aus einem Grund, der mir nicht klar war, tat ich schließlich beim Verlassen des Lokals so, als hätte ich ein steifes Bein, und hinkte.
Es war schon dämmrig draußen, und beim Anblick der Kastanienallee zwischen Gehsteig und Straße krampfte sich mein Herz zusammen, als würde ich das alles zum allerletzten Mal erleben. Ich fühlte plötzlich eine vor Hoffnungslosigkeit dermaßen verkommene Liebe zu Conny und zu der Erscheinung der sommerlichen Alleebäume, unter denen langsam und fast bedächtig die Autos dahinzogen, daß ich nur noch allein sein wollte, auch weil ich fürchtete, unmenschlich zu werden in meiner seltsamen Besessenheit, alles sich in mir ausbreiten zu lassen, was sich eigentlich zum Komprimieren anbot. Ich fragte Conny, ob es sie sehr stören würde, wenn ich sie jetzt allein ließe, anstatt mit ihr nach Hause oder noch in irgendein Lokal zu gehen, und sie wirkte zwar enttäuscht, aber sagte: Wenn du willst, mit so einer Resolutheit, daß ich mich für meine Wankelmütigkeit nur hassen konnte. Und schneller, als ich es mir gewünscht hätte, gab sie mir einen Kuß auf die Wange und verschwand um die Ecke. Ich stand dort, und auf einmal waren die Bäume und die Autos und der Dämmerungshimmel nicht länger unausgesprochen Verbündete und Vertraute, sondern nur mehr ein großes, betriebsames Zugeständnis an meine eigene Bündnisloskeit und Treulosigkeit. Trotzdem, als ich mich dann stockend von dieser merkwürdigen Trauer losriß und in Gang setzte, fühlte ich mich erleichtert. Ich verließ die Hauptstraße, auf der das Restaurant lag, und, die Seitengassen betretend, schlenderte ich durch ein Viertel, in dem ich gerne unterwegs war, denn es war teilweise so desolat, daß man glauben konnte, in einem anderen Land zu sein.
Als ich hinter den Scheibenwischern eines Autos einen Strafzettel sah, hatte ich die lächerliche Idee, ihn einzustecken und ihn für den Besitzer des Wagens zu bezahlen, als ob ich damit etwas gutmachen könnte. Ich spürte das Bedürfnis, augenblicklich Gutes zu tun, aber dann, im Weiterspinnen dieses Gedankens, war es plötzlich so, wie wenn man im Vorlesen eines Satzes den Punkt verpaßt und die Betonung so setzt, als würde der Satz noch weitergehen: Mein Wille zu büßen hatte längst die Glaubhaftigkeit überschritten, und es war mir recht, daß der Druck auf meiner Blase auf einmal unerträglich schien, und ich stellte mich in einen Hauseingang und urinierte. Ich unterbrach mich selbst dabei, noch bevor ich fertig war, weil das Geräusch eines nahenden Autos in meiner Vorstellung das eines Polizeiautos war. Ich knöpfte mir aber absichtlich die Hose so langsam zu, daß, wenn es tatsächlich die Polizei gewesen wäre, man mich zur Rechenschaft gezogen hätte. In Gedanken genoß ich schon meine Hilflosigkeit angesichts der Polizisten, und die Sorgfalt, mit der ich mir die Amtshandlung ausmalte, rührte mich. Unbehelligt weitergehend winkte ich einem Taxi, aber der Fahrer hatte bloß vergessen, beim Einsteigen seines Fahrgasts die Taxilampe auszuschalten, und hielt nicht an. Im nachhinein hätte ich wetten mögen, daß der Fahrer so oder so nicht stehengeblieben wäre. Wie aus Trotz hob ich nicht noch einmal die Hand, als sich ein zweites Taxi näherte. Ich hatte mit einem Mal den Wunsch, jemandem einen Vorwurf zu machen, jemanden zu beschimpfen oder zumindest jemandem zu sagen, daß ich verzweifelt bin, obwohl es gar nicht der Wahrheit entsprach.
Von einem Mann, der ein paar Meter weiter auf der Straße stand, wußte ich schon, ohne ihm ins Gesicht geblickt zu haben, daß er mich ansprechen würde. Er war stark betrunken. Seine Stirn glänzte von Schweiß, und er versuchte, nicht allzu sehr zu schwanken, als er mich nach einem Hotel fragte, das ganz in der Nähe sein sollte. Seltsamerweise hatte ich schon vorher an eben dieses Hotel gedacht, das ein Stundenhotel ist. Ich sagte dem Betrunkenen, daß er es finden würde, wenn er diese Gasse weitergeht, aber als ob er von der schnellen Auskunft enttäuscht wäre, wiederholte er die Frage und fügte hinzu, daß es ein schäbiges Hotel sein soll. Ich sagte ihm nochmals, daß es dort vorne ist, und fügte, mit dem Finger in die Richtung zeigend, hinzu: Da gehören Sie hin. Er bedankte sich und winkte einer jungen Frau auf der anderen Straßenseite zu, die sichtlich auf ihn wartete. Im Weitergehen hatte ich eine Zeitlang Angst, er könnte meinen letzten Satz so verstehen, daß ich ihn selbst als schäbig und also zu dem schäbigen Hotel passend ansehe. Ich erwartete jeden Moment von hinten seine Stimme, die mir so etwas wie: Halt, warte mal … Wie hast du das eben gemeint?, nachrufen würde. Als es nicht dazu kam, hatte ich ein schlechtes Gewissen und das Gefühl, unverdientermaßen davongekommen zu sein.