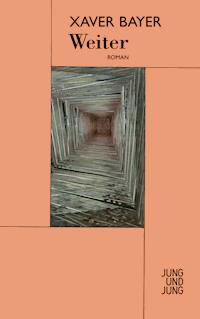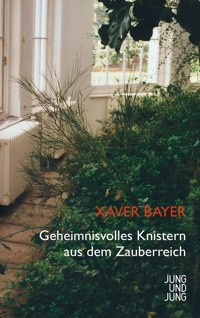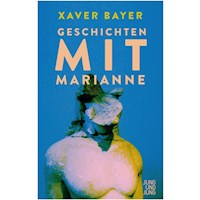Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es beginnt immer bei Null, frisch und unschuldig, mit einem harmlosen Vorhaben, einer nicht ganz alltäglichen Aufgabe oder der Idee zu einem kleinen Abenteuer. Das kann ein Waldspaziergang sein, ein Ausflug zu einem Perchtenlauf, ein Besuch auf einem Flohmarkt oder in einem Swingerclub, eine Prüfung, die als Spiel nur schlecht getarnt ist. Und immer sind es dieselben zwei, er und Marianne, die sich am Ende einer Wirklichkeit ausgesetzt sehen, in die das Unerwartete mit dem ganzen Schrecken eines Alptraums einbricht, der blanke Horror, etwas, das sich ihrer Kontrolle entzieht und dem nicht zu entkommen ist. Auch wenn es sie das Letzte kosten könnte, sie riskieren es, als gäbe es auf dieser Welt nichts mehr zu verlieren.Xaver Bayer erzählt das Ungeheuerliche ohne Rührung und mit einer Neugier, die vor keinen Konsequenzen zurückschreckt. Dieser Kompromisslosigkeit verdankt sich eine Literatur, die unsere Haltung zum Leben und dem, woran wir angeblich hängen, auf Herz und Nieren prüft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
© 2020 Jung und Jung, Salzburg und Wien
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung,Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehaltenUmschlagbild: privatUmschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comeISBN 978-3-99027-175-9
XAVER BAYER
Geschichten mit Marianne
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
I
Versteckt auf den Dächern und hinter manchen Fenstern in der Fußgängerzone im Zentrum der Altstadt, dort, wo die Dichte an Luxusartikelgeschäften, Banken und Nobelrestaurants am höchsten ist, haben seit heute acht Uhr Früh Scharfschützen begonnen, wahllos auf Passanten zu schießen. Außerdem haben Terroristen Geiseln genommen und sich mit diesen in anliegenden Geschäften, Lokalen und Hotels verschanzt. Vorsichtigen Schätzungen zufolge, wie es im Radio heißt, wurden bislang rund dreißig Menschen getötet, eine Zahl, die vermutlich untertrieben ist, denn allein in dem Bereich, der von der Wohnung von Mariannes Eltern, wo wir uns seit gestern Abend befinden, einsehbar ist, können wir einundzwanzig Tote zählen, und die Fußgängerzone verläuft rauf und runter viel weiter, als unser Blick reicht.
Eines der Häuser am Anfang des Einkaufsboulevards ist halb eingestürzt und steht in Flammen, weil sich ein Attentäter in die Luft gesprengt hat, als ein Sonderkommando der Polizei das Dach stürmen wollte. Niemand scheint zu wissen, wo überall Sniper postiert und wie viele Terroristen insgesamt an der Aktion beteiligt sind. Die Innenstadt ist abgeriegelt, es herrscht Ausgangssperre. Von unseren Fenstern aus sehen wir Blutlachen, wo Fußgänger niedergestreckt wurden, manche liegen noch da, andere hat man zu bergen versucht, aber auch auf die Rettungskräfte wird gefeuert, davon zeugt unter anderem ein ausgebrannter Ambulanzwagen. Auch einen toten Kameramann sehen wir. Hubschrauber kreisen seit Stunden über der Stadt. Angeblich haben die Terroristen in der Zwischenzeit einen von ihnen abgeschossen, darüber herrscht jedoch noch Unklarheit in den Medien. Hundertschaften von Polizisten in kugelsicherer Montur und beigezogene Militäreinheiten haben sich in den umliegenden Gassen postiert. Mehrere kleine Panzer haben mittlerweile in der Fußgängerzone Aufstellung genommen. Momentan verhalten sich die Angreifer still. Allerdings ist die Luft von Rauch und Sirenengeheul erfüllt, und immer wieder hören wir Schmerzensschreie von Verletzten.
Heute soll der heißeste Tag des Jahres werden, wie der Wetterbericht bereits seit einer Woche prophezeit, das kommt noch dazu. Der erlösende Regen wird gegen Abend erwartet oder gar erst in der Nacht. Gegenwärtig sind keine Wolken am Himmel. Marianne ist seit geraumer Zeit in der Küche, und ich habe es mir auf einem Sofa gemütlich gemacht. Nur hin und wieder gehe ich an die Fenster und teile ihr mit, wie die Lage ist. Wenn ich sie frage, ob ich ihr denn nicht behilflich sein solle, antwortet sie jedes Mal, es gehe schon, sie habe alles im Griff.
Eine Weile verfolge ich den Live-Stream eines Nachrichtensenders auf Mariannes Tablet, erkenne einmal kurz sogar unser Haus, aber dann denke ich mir, wie absurd, und dass ich das Ganze schließlich auch hautnah haben kann. Also stelle ich mich wieder an die Fenster, äuge auf das Dach und die Fassade des Gebäudes vis-à-vis, und als ich niemanden sehe, strecke ich meinen Kopf hinaus. In dem Augenblick macht einer der Sicherheitsleute vom Juwelier gegenüber dasselbe, er streckt seinen Kopf für einige Sekunden aus der Eingangstür, schon knallt es. Er bricht zusammen, weitere Schüsse fallen. Rauchkartuschen werden in die Mitte der Fußgängerzone geworfen und vernebeln den Abschnitt, offenbar will man den Mann bergen. Da bringt eine sehr laute Detonation ein paar von den Fenstern auf der gegenüberliegenden Häuserfront zum Bersten, Schreie, weitere Salven, und dazu unausgesetzt die Alarmsirenen irgendwelcher Nobelgeschäfte, was mich letztlich veranlasst, die Fenster zu schließen.
«Bist du sicher, dass du keine Hilfe brauchst?», rufe ich in die Küche.
«Ist bald fertig, danke!», kommt Mariannes Antwort.
Also nehme ich ihr Tablet, verbinde es mit den Lautsprechern und wähle eine ihrer Playlists aus. Es ertönen die ersten Takte der Enigma-Variationen Opus 36 von Edward Elgar. Ich schalte wegen des Lärms von draußen lauter, dann schlendere ich ein bisschen durch die Räume der weitläufigen Wohnung. Hohe Plafonds, alles großzügig eingerichtet, hauptsächlich mit alten chinesischen Möbeln, orientalischen Teppichen und indischen Stoffen, hölzernen und steinernen Skulpturen aus Südamerika, afrikanischer Stammeskunst. An den Wänden hängen Bilder bekannter Maler der europäischen und amerikanischen Moderne, und in jedem Zimmer gibt es mindestens eine Regalwand mit Büchern, deren Wert man schon an ihren Rücken zu erkennen glaubt.
Marianne hat sich für diesen Tag sichtlich gut vorbereitet. «Voilà, hier ist das heutige Menü», höre ich sie knapp neben mir und erschrecke, weil ich sie wegen der Musik gar nicht kommen gehört habe. Sie reicht mir ein gefaltetes Blatt Büttenpapier. Ich öffne es und lese den Menüplan, der, in kalligraphischen Lettern geschrieben, eher an eine alte Staatsurkunde oder einen Kodex erinnert:
Hühnerconsommé à l’impériale
Pastete à la Talleyrand
Omelette Tegetthoff
Filet Wellington
Bismarckhering
Kotelett à la Nelson
Filet à la Colbert
Radetzky-Kipferl
Metternich-Pudding
Esterházy-Torte
Dazu gibt es begleitend ausgewählte Weiß-, Rot- und Schaumweine, abschließend Likör und Kaffee, wie ich lesen kann. Zigarren werden gereicht.
«Nicht übel», sage ich und pfeife anerkennend durch die Zähne.
«Du kannst schon Platz nehmen», meint Marianne und verschwindet wieder in der Küche. Ich begebe mich in den Salon, wo der Tisch bereits gedeckt ist. Auch hier werfe ich einen kurzen Blick durch die Fenster, doch nichts hat sich draußen geändert, außer dass jetzt auch noch Paramilitärs beteiligt zu sein scheinen. Man sieht einige vermummte Gestalten umherlaufen, die Phantasieuniformen tragen, Hooligans vielleicht, denke ich.
Und schon ist Marianne mit zwei Champagnerkelchen da. Ich bedanke mich, wir lächeln und stoßen auf unser Wohl an. Marke und Jahrgang flüstert mir Marianne ins Ohr.
«Unvergleichlich», antworte ich, ebenfalls flüsternd, dann setzen wir uns an den Tisch und beginnen mit dem Mahl.
Ich bin überwältigt. Jeder Gang von Mariannes Menü scheint den vorherigen zu übertrumpfen. Wie sie das gemacht hat, ist mir ein Rätsel, die Speisen sind ideal temperiert, und stets ist mein Glas voll. Von allem ist gerade so viel auf dem Teller, dass man des Gerichtes nicht überdrüssig wird.
«Ich habe gar nicht gewusst, dass du so phantastisch kochen kannst», lobe ich Marianne.
«Ich auch nicht», erwidert sie.
Zwischen dem letzten Hauptgericht und der ersten Nachspeise frage ich dann, ob sie mir nicht einmal erzählt habe, dass ihr Vater ein paar Gewehre besitze.
«Und ob.» Sie lacht und führt mich ins Schlafzimmer ihrer Eltern, zieht die Bettlade heraus, und darin liegt ein halbes Dutzend Jagdgewehre, von denen ich zwei an mich nehme.
«Und die Munition?», frage ich.
«Hier, bitteschön, alles voll», sagt Marianne, öffnet den begehbaren Kleiderschrank ihrer Mutter und drückt mir einen Louis-Vuitton-Koffer in die Hand.
«Dankeschön», antworte ich und trage die Gewehre und den Koffer in den Salon.
Während Marianne die Radetzky-Kipferl aus der Küche holt, inspiziere ich die Gewehre. Es handelt sich um zwei Mannlicher Schönauer im Kaliber 6,5×54, österreichisches Qualitätsfabrikat, in tadellosem Zustand, und die Patronen in dem Koffer sind sogar Vollmantelgeschosse. Mittlerweile hat die Musik aus dem Nebenzimmer zum zweiten Lied der Chansons madécasses von Maurice Ravel gewechselt.
Als Marianne mit den nächsten zwei Tellern wiederkommt, lege ich die Waffen beiseite, wir essen bedächtig und lauschen der Musik. Als wir bei der letzten Nachspeise angelangt sind, durchschlägt eine Kugel eines der Fenster und durchbohrt ein Bild von Franz Marc, das über dem Tisch hängt, an dem wir sitzen; das Projektil geht genau durch die Brust des darauf dargestellten Pferdes. Und wenig später klirrt wieder eine Scheibe, und diesmal durchbohrt das Projektil einen Andy Warhol weiter links an der Wand, einen aus der Serie Double Elvis.
«Was für ein komischer Zufall», sage ich, und Marianne nickt.
Sie geht ein weiteres Mal in die Küche und kehrt mit einer kleinen Tasse Kaffee zurück, die sie vor mich auf den Tisch stellt.
«Danke», sage ich und nippe daran.
«Mit Kardamom», fügt sie hinzu.
«Danach schaffe ich aber wirklich keinen Bissen mehr», stöhne ich und wische mir nach dem letzten Schluck mit der Serviette über die Lippen.
«Musst du auch gar nicht», sagt Marianne. Im selben Moment gibt es draußen in der Fußgängerzone eine immense Detonation. Klirrend drückt es die Scheiben der Fenster ins Innere, man hört Geknatter von Maschinenpistolen, und grauschwarzer Rauch zieht in die Zimmer.
«Soll ich dir abwaschen helfen?», frage ich Marianne.
«Nein, danke dir, das kann ja morgen die Putzfrau machen», antwortet sie.
«Wie du meinst», sage ich und wähle eine Zigarre aus der Schachtel, die sie mir anbietet, kappe sie und zünde sie an. Nach ein paar Zügen stehe ich auf, nehme die Gewehre und schiebe jeweils fünf Patronen ins Trommelmagazin. Dann schaue ich mit einer der beiden Waffen in der Hand vorsichtig aus dem Fensterrahmen um die Ecke.
«Möchtest du auch?», frage ich und deute auf das zweite Gewehr.
«Gleich», antwortet Marianne, «ich wasche mir nur noch schnell die Hände», und huscht in die Küche.
«Da fällt mir ein», rufe ich ihr nach, «ich habe dich noch gar nicht gefragt, was ich für das wahrlich lukullische Mahl schuldig bin.»
«Lass gut sein», höre ich sie aus der Küche, «abgerechnet wird später.»
«Wunderbar», sage ich und entsichere die Gewehre.
Am Ende steht Marianne links, ich rechts vom Fenster, gemeinsam blicken wir auf die sich uns fast unterwürfig darbietende Schreckensszenerie. Wir sehen die schwelenden Krater, die zersplitterten Auslagen, die Leichen, die in den Blutlachen wie in einer Sauce liegen, die brennenden Panzer und die verzweifelten Polizisten, wir hören Schüsse und Explosionen und Schreie und Megaphonbefehle und Sirenen und die Hubschrauber, und eine panische Taube fliegt dicht an unserem Fenster vorbei.
«Wer zuerst?», frage ich Marianne.
«Ich!», ruft sie, stellt sich an die Fensterbank und eröffnet das Feuer. Sie kann alle fünf Schüsse abgeben, bevor die Polizisten das Gegenfeuer eröffnen, und nach dem Nachladen drei weitere, bevor sie tot neben mir zusammenbricht. Ein Kopfschuss, wie ich anhand der Hirnmasse, die auf meinen Anzug spritzt, feststellen kann. Was für schönes Haar sie gehabt hat, denke ich noch, dann hole ich tief Luft, trete an ihre Stelle, lege den Gewehrschaft an meine rechte Wange, ziele und atme kontrolliert langsam aus.
II
Ich bin kein Kind von Traurigkeit, deshalb sage ich sofort zu, als Marianne mich fragt, ob ich mit ihr in den Zirkus des Grauens gehen will. Ich reserviere im Internet zwei Sperrsitze, und am übernächsten Abend stehen wir schon vor dem Zirkuswagen beim großen Zelt, wo man die Karten von einem als Vampir verkleideten Mann ausgehändigt bekommt, und trinken Bier aus Dosen, die wir uns bei einer Tankstelle gekauft haben. Die Zirkusleute haben ihr Zelt auf einer Wiese am Rand eines Industriegebiets aufgeschlagen. Wir haben uns auf dem Weg hierher in die Kleinstadt, aus der Marianne stammt, mehrmals verfahren und sind zwischen unzähligen Kreisverkehren, Supermarktparkplätzen und Lagerhallen umhergeirrt, aber jetzt sind wir am Ziel.
Es ist ein kühler Spätsommerabend. Marianne fröstelt in ihrer schwarzen Lederjacke mit dem David-Bowie-Button unter dem linken Revers, und auch mich friert in meinen Sommerschuhen. Nach und nach trudeln die Besucher ein, zum Großteil junge Paare und Grüppchen von Jugendlichen, die ihrer Kleidung und ihren Tätowierungen nach ebenso gut als Publikum eines Gothic-Festivals gelten könnten. Aus dem Zirkuszelt und dem kleineren Zelt davor, wo man Getränke, Hotdogs, Popcorn, Zuckerwatte und andere Süßigkeiten kaufen kann, dröhnt düstere Musik, etwas zwischen Horrorfilm-Soundtrack und gregorianischen Chorälen. Wir rauchen noch eine, dann betreten wir das Hauptzelt durch einen schmalen Eingang, an dessen Seiten an Schnüren Attrappen von Mumien, Schrumpfköpfen und mit Spinnweben überzogenen Skeletten baumeln. Die Kartenabreißerin ist als Zombie kostümiert und trägt Kontaktlinsen, die ihre Augen wie die von Raubtieren aussehen lassen.
Wir setzen uns links in den Mittelgang des Tribünenrunds neben drei Mädchen, die mit ihren Smartphones unaufhörlich Fotos machen und an irgendwelche Freundinnen senden, deren Antworten sie dann wiederum untereinander kommentieren. Die Arena ist in blutrotes Licht getaucht, die Musik noch eine Spur lauter und dramatischer als zuvor, und nachdem die letzten Zuschauer Platz genommen haben, wird es schlagartig finster. Die Musik verstummt, man hört Wolfsgeheul, schaurig pfeifenden Wind, Türenknarren und ein höllisches Gelächter. Dann tritt der Vampirmann, der uns vorher die Karten verkauft hat, in die nun düster-zwielichtige Manege, heißt die Besucher des Zirkus des Grauens willkommen und eröffnet so den Beginn der Vorstellung.
Während der ersten Nummer, einer Seilakrobatik, lasse ich den Blick durch das Zelt schweifen. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen beklommen. Es ist wie in einer Geisterbahn, wenn man nicht weiß, was einen erwartet, aber jeden Moment mit einer erschreckenden Überraschung rechnen muss. Einige Details im Zirkuszelt verraten noch, dass es einmal ein althergebrachtes gewesen ist, dessen Ausstattung mehr dem Staunen und Lachen diente als dem Schauerlichen einer Freak-Show. So ist die kniehohe Balustrade, die die Arena von den Zuschauerreihen trennt, mit bunten Blumen bemalt, und das Innere der Zeltkuppel ist mit weißen Sternen übersät: ein Himmelszelt, das, wie mir bewusst wird, in krassem Gegensatz zu dem Geschehen in der Manege steht.
Dort haben mittlerweile zwei Horror-Clowns in Häftlingskluft das Sagen. Sie treiben allerlei schaurigen Klamauk, der darin gipfelt, dass sie sich einen Jugendlichen aus der ersten Reihe schnappen, ihn in die Arena zerren, ihm einen schwarzen Sack über den Kopf ziehen und ihn an eine eilig herbeigeschaffte Holzwand stellen. Der eine der beiden, der zuvor mit zwei Äxten in den Händen schwankend und torkelnd einen Betrunkenen gemimt hat, schickt sich jetzt an, sie unter Gegröle auf die Holzwand rechts und links vom Kopf ihres Opfers zu schleudern. Ein Aufschrei geht durch das Publikum, so echt wirkt die Bedrohung. Was der junge Mann in der Manege unter dem schwarzen Sack nicht sehen kann, ist, dass die Äxte nicht aus der Entfernung geworfen, sondern vom anderen Horror-Clown übernommen und aus nächster Nähe haarscharf neben seinem Kopf ins Holz geschlagen werden. Das Publikum quittiert die Täuschung mit wieherndem Lachen. Schließlich wird der Jugendliche unter Applaus wieder zurück zu seinem Sitz geleitet.
In der nächsten Nummer tritt ein Gleichgewichtskünstler auf, der, als eine Mischung aus Werwolf und Leiche geschminkt, auf einem Podest zu stampfendem Techno atemberaubende Jongliertricks zum Besten gibt, während er auf mehreren übereinander gestapelten und durch Bretter getrennten Rollen balanciert. Einmal kommt er nach einem Sprung falsch auf und fällt vom Podest. Sichtlich unter Schmerzen klettert er aber sofort wieder hinauf, unternimmt einen zweiten Versuch, und diesmal klappt es, was ihm einen besonders herzlichen Beifall beschert.
Der Mittelpunkt der darauf folgenden Attraktion ist ein am ganzen Körper tätowierter Mann. Er schreitet in betont lässigem Schlenkergang zuerst die vorderen und dann die mittleren Zuschauerreihen ab, und jeder ahnt, dass er Ausschau nach einem Opfer für irgendeine Showeinlage hält. «Hoffentlich nimmt er mich», flüstert mir Marianne ins Ohr, aber die Wahl fällt auf eine Blondine ein paar Sitze neben uns, die er unter dem Gejohle des Auditoriums ins Rampenlicht zerrt. Sie muss auf einem Rollsessel Platz nehmen, wie man ihn aus Büros kennt, und um den Sessel ist ein Seil gebunden, an dessen Ende ein Fleischerhaken befestigt ist. Diesen führt der Tätowierte durch ein Loch in seiner Zunge, dann zieht er den Sessel mit dem Mädchen einmal durch die ganze Manege. Galant küsst er nach der Darbietung ihre Hand und entlässt sie wieder. Danach werden vier Männer von ihm zwangsrekrutiert. Er platziert sie auf vier Stühle, sodass ihre Rücken auf den Knien ihres jeweiligen Nachbarn liegen. Die Stabilität dieser Verschränkung nutzend, entfernt der Tätowierte die Stühle, bis die vier Männer gezwungen sind, allein durch ihre Muskelkraft dieses Körpergebilde aufrecht zu erhalten. Daraufhin holt er vier große Dildos hervor und stellt jedem einen unter das Gesäß. Insbesondere die Frauen im Publikum biegen sich vor Lachen. Der eigentliche Höhepunkt besteht aber darin, dass das Licht angeht und der Tätowierte eine halbstündige Pause ausruft, während die vier Männer immer noch ihre heikle Position zu halten versuchen. Selbstverständlich steht keiner der Zuschauer auf, alle warten, wie lange sie es aushalten werden. Bald schon beginnen ihre Knie zu zittern, und die Figur bricht in sich zusammen. Die Vier werden ausreichend mit Applaus bedacht.
Die Stimmung in der Pause ist gelöst und heiter, in Erwartung dessen, was noch kommen mag. Marianne und ich stehen rauchend am Rand des Zirkusgeländes. Da die Musik nun leiser ist, kann man vereinzelt Grillen hören. Es ist noch einmal kühler geworden, und ich biete Marianne meine Jacke an, aber sie lehnt ab. Bevor die Pause zu Ende ist, holen wir uns noch ein Bier und nehmen dann wieder im Zelt Platz.
Nach einem neuerlichen Musik- und Lichtwechsel fängt die zweite Hälfte der Show an. Eines der Vampirmädchen, die zuvor Popcorn und Zuckerwatte verkauft haben, legt sich auf einen Tisch und jongliert mit ihren durchtrainierten Beinen verschiedene Gegenstände. Später nimmt sie noch ihre Hände dazu, bis eine unüberblickbare Menge an Bällen, Klötzen und Ringen durch die Luft wirbelt. Wir belohnen diese Kunstfertigkeit mit langem Beifall. Dann sind die Horror-Clowns wieder am Zug; sie inszenieren eine Scheinhinrichtung. Auf sie folgt der tätowierte Freak, der sich Spritzennadeln durch Löcher in seiner Halshaut steckt und sich mit seiner Zunge an einem Fleischerhaken an einem Seil hochziehen lässt. Besonderen Eindruck macht seine Darbietung mit einem präparierten Messer, mit dem er sich scheinbar so tief in seinen linken Unterarm schneidet, dass das Blut spritzt. Einzelne Zuschauer halten sich vor Entsetzen die Hand vor den Mund. Danach hat noch einmal der Gleichgewichtskünstler einen Auftritt; diesmal unterläuft ihm kein Fehler, und er verlässt unter Verbeugungen das Arenarund. Als er hinter dem Vorhang verschwunden ist, betritt der Kartenverkäufervampir die Manege. Er kündigt vor dem endgültigen Ende der Vorstellung noch eine letzte Sensation an, weist auf die Möglichkeit hin, nach der Vorstellung für fünf Euro ein Foto mit allen Schaustellern machen zu lassen, und zieht sich dann unter Lüften seines schwarzen Zylinders hinter den Vorhang zurück.
Ein paar Sekunden bleibt es ganz dunkel, man sieht nur die grünen Notausgangsleuchten. Daraufhin beginnen die zwei Horror-Clowns durch die Zuschauertribünen zu streunen. Zum Schein nehmen sie ein paar Jugendliche mit, lassen sie aber dann doch wieder frei, was die Spannung erhöht und jeden im Publikum fürchten lässt, er könnte nun an ihrer statt zum Handkuss kommen. Schließlich bleiben sie, wie auf Verabredung, vor uns beiden stehen, schnappen sich Marianne, die kurz aufschreit, und zerren sie in die Manege. Sie wirft mir dabei noch einen schnellen Blick zu, ihr Gesicht zeigt zugleich freudige Erwartung und starres Entsetzen.
Die beiden Clowns setzen Marianne in einen Zahnarztstuhl in der Mitte der Arena, die wie in einer Prosektur in düster-fahles Licht getaucht ist. Der eine von ihnen schlingt ein dickes Seil um ihren Körper, dann fesselt er ihre Handgelenke an die Armlehnen des Stuhls und stülpt ihr einen schwarzen Sack über den Kopf. Der andere holt eine Box herbei, entnimmt ihr eine lebende Vogelspinne und setzt sie auf Mariannes Oberkörper. Nach einer Weile wird ihr der Sack vom Kopf gezogen, sodass sie das haarige Tier zu Gesicht bekommt. Obwohl Marianne nicht sonderlich erschrocken aussieht, sondern die ohnedies friedfertig wirkende Spinne eher amüsiert und interessiert betrachtet, johlt das Publikum vor gruseliger Wonne. Applaus brandet auf, das Bühnenlicht wechselt wieder zu blutrot. Der eine Horror-Clown nimmt die Spinne von Mariannes Oberkörper und setzt sie zurück in die Box, der andere stülpt erneut den Sack über ihren Kopf, dann ziehen die beiden den Zahnarztstuhl mit der noch immer gefesselten Marianne zurück hinter den Vorhang.
Das Licht geht an, die Musik setzt noch einmal ein, die Vorstellung ist beendet, ein letzter langer Beifall, dann erheben sich die Leute von ihren Sitzen und strömen hinaus. Ich bleibe auf meinem Platz, um mich diesem Gedränge nicht aussetzen zu müssen, und bedaure, kein Foto von Marianne gemacht zu haben, wie sie da im Scheinwerferlicht gefesselt mit der Vogelspinne auf ihrer Brust im Zahnarztstuhl gesessen ist. Ich trinke mein Bier aus und mutmaße, dass Marianne wahrscheinlich nicht durch den Vorhang in der Manege zurückkommen wird, sondern durch einen anderen Ausgang auf der Hinterseite des Zeltes, wo die Wohnwagen der Schausteller parken.
Bald haben die allerletzten Zuschauer die Spielstätte verlassen. Ich sitze allein da, mit der leeren Bierdose in der Hand, und krümme meine Zehen in den Sommerschuhen, weil die Kälte der Wiese unter meinen Füßen durch die Socken dringt. Die Manege ist ganz leer. Ich lege meinen Kopf in den Nacken und schaue in den Sternenhimmel der Zeltkuppel. Ich spüre das Verlangen, dieser Augenblick möge nie vergehen, und auch wenn dieser Zirkus wenig mit denen meiner Kindheit zu tun hat, mit ihren Seiltänzerinnen in bunten kurzen Röcken und den Trapezkünstlern, den Dompteuren, den Kunstreitern und Bodenakrobaten, den drolligen Clowns und Respekt einflößenden Magiern, fühle ich mich dennoch verzaubert.
Bleib noch kurz sitzen, sage ich mir, allein in diesem Zirkuszelt, bleib noch ein wenig und lass die Atmosphäre in dich eindringen, nimm sie für alle Zeit in dich auf, bevor du wieder in die wirkliche Welt trittst. Dann verlasse ich mit einem abschließenden Blick auf die verwaiste Manege, die wirkt, als würde sie nie wieder jemand betreten, das Zelt.