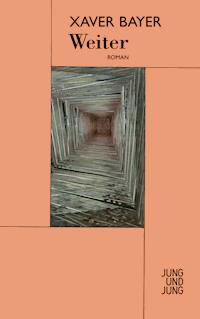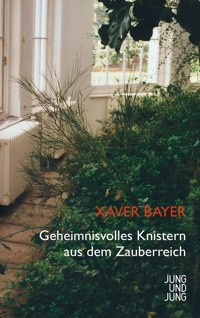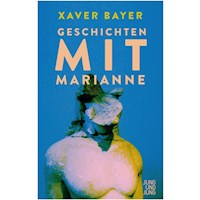Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist Anfang zwanzig. Niemand soll sagen, dass das die schönste Zeit imLeben ist. Die Tage verlaufen in zäher Gleichförmigkeit. Aber warum fällt ihm auch nichts anderes ein, als in Lokale zu gehen, die gerade angesagt sind, sich durch die Stadt treiben zu lassen und auf die Einladung zur nächsten Vernissage zu warten? Einzig die Musik öffnet Freiräume, manchmal zumindest. Sonst sind die Tage von gleichsam rituellen Abläufen geprägt. Er stellt sich eine Zählmaschine vor, die bei jeder Handlung, bei jedem Musikstück, bei jedem Weg anzeigt, das wievielte Mal es gerade ist – und nach 9999 springt sie wieder auf Null. Er nimmt Posen ein: Stilisierung ist eine Möglichkeit, unbestimmte Trauer eine andere. Doch sie überdecken den Riss in diesem Leben, dem jedes Zeichen äusserer Tragik fehlt, nicht lange. Heute könnte ein glücklicher Tag sein bleibt als letzte, durch Zynismus getarnte Hoffnung des Protagonisten einer Generation, für die, wie es einmal hieß, Krieg leichter zu ertragen ist als ein Montagmorgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heute könnte ein glücklicher Tag sein
© 2013 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenISBN E-Book 978-3-99027-108-7
XAVER BAYER
Heute könnteein glücklicher Tag sein
Roman
I.
Spätsommer / Herbst
Laß uns, rief sie, da wir der Zeit nicht nachlaufen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei uns vorbeizieht, fröhlich und zierlich verehren.
Johann Wolfgang Goethe
Wien, nur Wien, du kennst mich up, kennst mich down …
Falco
Ich liege auf dem Balkon von Ninas Wohnung und lese wieder einmal »Hebt den Dachbalken hoch, Zimmerleute«. Aus der Küche kommt leise Musik, und ich schenke mir noch ein Glas Wein ein. Als jemand in der Geschichte eine Zigarette raucht, zünde ich mir auch eine an, dämpfe sie aber nach ein paar Zügen wieder aus und schnippe sie über das Geländer.
Von meinem Platz aus sehe ich in eine gegenüberliegende Wohnung, in der eine alte Frau vor einem Fernseher sitzt, so unbeweglich, daß es aussieht, als wäre sie schon tot. Am Balkon einen Stock höher steht ein Mann im Anzug und telefoniert. Er hält den Kopf dabei leicht gebeugt und gestikuliert mit den Händen, während er redet. Ich versuche, etwas von dem, was er sagt, mitzubekommen, aber weil im Radio gerade »Take on me« läuft, macht Nina die Musik lauter, und ich verstehe nichts mehr, stattdessen proste ich dem Mann zu, aber er verschwindet, wahrscheinlich ohne mich gesehen zu haben.
Als sich Nina neben mich setzt, fragt sie mich, wie spät es ist, und ich schaue auf die Armbanduhr und sage: »Zeit genug«.
Wir trinken noch die Flasche aus, und dann, gegen halb neun, fahren wir zu Freunden von Nina. Zwei junge Frauen, die sich in der Nähe der Stadt ein altes Haus gekauft haben und es jetzt renovieren. Wir sitzen im Garten unter einem Maulbeerbaum, schlagen nach Gelsen, füllen die Gläser nach, rauchen. Später, im Haus, wird über Vampirfilme gesprochen. Ich streichle den Hund, der unter dem Tisch liegt, mit der Sohle meines Schuhs und langweile mich.
Nach Mitternacht brechen wir auf. Wir fahren über leere Landstraßen zurück.
Als wir bei Nina zu Hause ankommen, ist sie eingeschlafen. Ich wecke sie behutsam, und wir sitzen dann noch eine Weile auf dem Balkon. Während wir uns unterhalten, landet unbemerkt eine Gelse auf Ninas Wange, einen Fingerbreit unter dem linken Auge. Ich sehe der Gelse zu, die sich langsam mit Blut vollsaugt. Sie bleibt sogar sitzen, als Nina ihre Zigarette zum Mund führt. Ich sage nichts. Als Nina meint, daß es doch ein ganz angenehmer Abend war, fliegt die Gelse weg, und ich beuge mich vor und küsse ganz leicht ihre Lippen.
Montag. Gegen sechs am Abend ruft Peter an. Er hat eine Einladung zu einer Wohnungsparty. Wir treffen einander um neun, kaufen uns ein Bier, dann fahren wir gemeinsam zu der Adresse. Als wir ankommen, hört man schon Musik und sieht im dritten Stock des Hauses Leute auf dem Balkon. Wir läuten an, es wird geöffnet, wir treten ein. Es sind noch nicht viele Gäste da. Alle halten ein Glas in der Hand. Wir besorgen uns etwas zu trinken, und dann stehen wir wie die anderen herum, und es spielt zum drittenmal hintereinander ziemlich laut »Music sounds better with you«, und ich treffe jemanden, den ich kenne, dem ich aber nichts zu sagen habe. Wir reden trotzdem ein paar Minuten miteinander belangloses Zeug, dann kommt ein Mädchen dazu, dem ich vorgestellt werde, und ich unterhalte mich höflich, aber lustlos. Ihre Stimme ist so krächzend und beschlagen, daß ich beim Zuhören fortwährend den Drang habe, mich zu räuspern.
Später, als schon mehr Leute da sind und die Stimmung schon etwas aufgelockerter ist, komme ich ins Gespräch mit einem Studenten. Er fragt mich zweimal, ob ich glaube, daß man hier etwas rauchen darf, dann verschwindet er für ein paar Minuten auf die Toilette, um mir daraufhin einen Joint zuzustecken, damit ich ihn für ihn anrauche, denn er traut sich hier nicht so recht, wie er sagt. Ich zünde ihn an, und wir rauchen. Währenddessen gesellt sich Peter für ein paar Züge dazu, und wir einigen uns, daß wir beide dasselbe Mädchen hübsch finden, dann geht Peter zurück in die Küche, wo man ihn auf Festen immer findet, und ich stehe wieder allein mit dem Geschichtestudenten da, der gerade beginnt, mir von einer Band zu erzählen, die niemand kennt, dabei verschluckt er ganze Wörter, und obwohl ich nur die Hälfte verstehe, nicke ich und betrachte den Jointstummel, den er bereits seit fünf Minuten zwischen seinen Fingern vergessen hat.
Er wird immer vertraulicher, und nach einer Viertelstunde erzählt er mir, andauernd von Lachanfällen unterbrochen, bei denen er sich krümmt und auf meinen Oberarm klopft, daß er manchmal in einen Supermarkt geht und mit einer langen, dünnen Nadel in Präservativpackungen sticht, nur so zum Spaß. Ich sage ihm, daß das eine sehr lustige Idee ist, tue so, als würde ich jemanden von den Gästen erkennen, lasse ihn stehen und gehe zu Peter in die Küche. Der sitzt gerade vor einem Handspiegel und schiebt mit einer Bankomatkarte Koks zu zwei länglichen Häufchen. Ich überrede ihn, vier daraus zu machen, dann verlasse ich die Küche wieder und stelle mich allein auf den Balkon. Nach einer Weile kommt ein Mädchen heraus und lehnt sich ans Geländer, ohne mich bemerkt zu haben. Auf einmal beginnt sie, hastig ihre Bluse aufzuknöpfen, und entblößt ihre Brust. Ich zünde mir geräuschvoll eine Zigarette an. Sie fährt zusammen, sieht mir erschrocken ins Gesicht, knöpft schnell ihre Bluse wieder zu und geht, ohne ein Wort zu sagen, in die Wohnung zurück.
Als ich fertiggeraucht habe, besorge ich mir noch ein Bier und versuche, mit einem Mädchen eine Unterhaltung zu beginnen. Jedoch ist es, als wäre eine Glasscheibe zwischen uns, so wie in Postämtern oder Banken. Sie redet, und ich gebe vor, ihr folgen zu können, dabei verstehe ich wegen der Lautstärke der Musik nur die Hälfte. Ich sage ihr, daß ich etwas zum Trinken holen will und gleich wiederkomme. Als ich im Vorzimmer stehe, fasse ich stattdessen den Entschluß zu gehen. Ich schließe vorsichtig die Wohnungstür hinter mir und suche im Halbdunkel den Lichtschalter. Versehentlich drücke ich auf die Türklingel und renne, bevor jemand öffnet, eine Stiege tiefer. Ich warte kurz, und als sich nach einer Minute nichts rührt, steige ich die restlichen Stockwerke hinunter, bis mir einfällt, daß ich eigentlich den Aufzug hätte nehmen können. Unten, im Hausflur, uriniere ich zwischen zwei Altpapiercontainer, dann verlasse ich das Haus.
Auf der Straße ist es angenehm warm. Man hört das Gitarrensolo von »Hotel California« aus einem der Fenster der Wohnung, wo die Party stattfindet.
Ich wache um elf Uhr auf. Zu spät, um noch rechtzeitig zur Vorlesung zu kommen. Ich steige aus dem Bett und gehe wie immer zuerst in die Küche, um Wasser zu trinken. Während ich das Wasser kaltlaufen lasse, ärgere ich mich über meine eigene Disziplinlosigkeit. Ich hatte mir gestern noch fest vorgenommen, heute wirklich auf die Universität zu gehen. Eigentlich hatte ich am Montag gut begonnen und war um zwölf bei einem Seminar gewesen. Nur der Professor, der die Veranstaltung halten hätte sollen, tauchte nicht auf. Ich wartete eine halbe Stunde, dann trank ich im Uni-Buffet einen Kaffee und fuhr wieder nach Hause.
Sichtlich waren die paar Bier, die ich gestern auf der Party getrunken hatte, zu viel, denn ich kam nicht früh genug aus dem Bett, und nun sitze ich am Küchentisch und versäume gerade die nächste Vorlesung und habe ein schlechtes Gewissen und Kopfweh.
Ein paar Tage später, in der Wohnung einer Freundin Ninas. Ich sitze in einem bequemen Fauteuil, lasse meine Beine über die Lehne hängen und fülle hin und wieder das Glas nach, das neben der Flasche am Boden steht. Der Ventilator am Plafond des Raumes dreht sich so langsam, daß man die Rotorblätter mit dem Blick verfolgen kann. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich genau auf das Riesenrad. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich damit gefahren bin. Es gibt mitunter nichts Feineres, denke ich, als an einem Sommertag durch den Prater zu schlendern, mit Geld in der Tasche und der Lust, sich mit Bedacht zu betrinken.
Ich stehe auf und drehe die Platte um, die am Ende des letzten Liedes hängengeblieben ist. Nach einer Weile kommt Nina ins Zimmer.
Sie blickt mich eine Zeitlang schweigend an, als würde sie mir etwas vorzuwerfen haben, dann nimmt sie die Uhr in die Hand, die neben der Stereoanlage steht, und betrachtet sie.
Ich frage Nina, ob sie es eilig hat, weil sie auf die Uhr schaut, aber sie antwortet nicht. Ich weiß, daß sie sich ärgert, weil ich mich wieder einmal nicht am Gespräch mit ihrer Freundin beteiligt habe.
»Ist was?« frage ich sie.
»Nichts«, sagt sie.
»Was ist denn?« frage ich noch einmal.
»Vergiß es«, sagt sie, und schaut mich erwartungsvoll an.
»Von mir aus können wir auch gehen«, sage ich.
Doch sie schüttelt nur den Kopf, gibt mir einen Kuß und geht wieder aus dem Zimmer.
Zwei Tage danach. Als ich aufwache, fällt mein Blick zuerst auf die Uhr neben dem Bett, die zwei zeigt, was bedeutet, daß ich mich vor einer halben Stunde mit Nina hätte treffen sollen. Mein zweiter Blick fällt auf die Schuhe, die übereinander am Boden liegen, und dann merke ich erst, daß ich noch Hose und Hemd anhabe, und ich stehe auf, ziehe mich aus und trinke Wasser in der Küche. Dann gehe ich ins Badezimmer, um mich zu rasieren und zu duschen. Als ich damit fertig bin, setze ich mich an den Küchentisch, schalte das Radio ein und zünde mir eine Zigarette an. Ich überlege, was gestern passiert ist. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, daß ich die Mariahilfer Straße in die falsche Richtung gegangen war, anstatt zum Ring zum Westbahnhof, und daß ich das erst merkte, als ich dort war. Ich weiß noch, daß ich wieder umkehrte und irgendwo, auf halbem Weg, ein Taxi nahm. Vorher, fällt mir ein, hatte ich Peter gebeten, mich aus seinem Auto aussteigen zu lassen, weil ich frische Luft brauchte.
Mit der zweiten Zigarette und einem Pfefferminztee kommen die Erinnerungen an ein Mädchen, neben dem ich zu Beginn des Abends in Peters Auto saß. Während vorne Peter und Hannes einen Joint rauchten, küßten wir uns. Und ich weiß noch, daß ich später, in der Nacht, es nicht glauben wollte, daß es der gleiche Tag war, an dem wir uns alle im Café Weidinger trafen. Ich war fest überzeugt, daß sich das einen Tag zuvor abgespielt hatte.
Ich versuche, Nina zu Hause zu erreichen, aber es läuft nur der Anrufbeantworter mit dem Text: »Hallo, ich bin gerade nicht erreichbar, aber wenn du glaubst, daß du mir etwas zu sagen hast, dann sprich jetzt.« Der übliche Piepton, ich lege auf.
Als ich in das Café komme, wo ich mich mit ihr verabredet habe, ist es viertel vor drei, und sie ist nicht mehr da. Ich setze mich trotzdem hin und bestelle mir ein kleines Bier. Nachdem ich den ersten Schluck genommen habe, gehe ich zu den Telephonapparaten im hinteren Teil des Cafés und probiere noch einmal, Nina anzurufen. Ich rede auf den Anrufbeantworter, daß ich verschlafen habe, und daß es mir leid tut, und daß ich mich später wieder melde, aber da schaltet das Gerät schon ab. Ich habe keine Lust, es ein zweites Mal zu versuchen, und rufe bei Peter an. Nachdem ich es eine Zeitlang läuten lasse, meldet er sich. Ich frage ihn, wie es ihm geht, nach gestern. Er sagt, das müßte er eigentlich mich fragen. Ich erkundige mich nach dem Namen und der Telephonnummer des Mädchens, das ich gestern im Auto geküßt habe. Dann reden wir noch eine Weile, sagen »ciao« und legen auf. Als ich zu meinem Tisch zurückkomme, sitzt da Nina und entschuldigt sich für die Verspätung. Sie hat an dem Buch, das ich gerade lese, erkannt, daß das mein Platz sein muß. Sie fragt mich unvermittelt, was ich gestern getan habe. Ich sage: »nichts Besonderes«, und als sie eine Zigarette aus ihrer Packung zieht, gebe ich ihr Feuer.
Als ich Nina dann wie versprochen zum Bahnhof bringe, mich von ihr verabschiede und die Arme um sie lege, merke ich, daß sie mich länger umarmen will als ich sie. Sie fragt mich daraufhin, was ich denn noch vorhabe, daß ich sie so schnell loswerden will. Als ich »nichts« sage, werde ich rot, obwohl ich wirklich nichts geplant habe. Sie blickt mich seltsam an, ich gebe ihr einen Kuß und warte, bis sie eingestiegen ist. Als der Zug losfährt, gehe ich weg, ohne mich umzublicken, weil sie ohnedies nicht am Fenster steht.
Wenig später treffe ich Peter, der ebenfalls nichts zu tun hat. Wir beschließen, einen Ausflug zu machen. Wir fahren stadtauswärts, Richtung Norden. Nach ungefähr einer Stunde halten wir kurz am Rande eines Dorfes, rollen noch ein wenig an Feldern entlang, wo Lagerhallen und Scheunen stehen, und kommen zu einem Sportplatz. Dort steigen wir aus. Das Fußballfeld wirkt kleiner als gewöhnlich. Vor den zwei Toren sind Kreise im Gras, vom Tormann ausgetreten. Der Elfmeterpunkt ist eine kleine Mulde. Wir setzen uns an den Rand des leeren Platzes, essen und trinken etwas, reden. Wir haben auch einen tragbaren Kassettenrekorder mitgenommen. Als wir dann rauchend nebeneinander liegen, ziehe ich den Zettel hervor mit dem Gedicht, das ich gestern aus einem Buch abgeschrieben habe, und lese vor:
Du, ich halte diese festen
Stuben und die dürren Straßen
Und die rote Häusersonne,
Die verruchte Unlust aller
Längst schon abgeblickten Bücher
Nicht mehr aus.
Komm, wir müssen von der Stadt
Weit hinweg.
Wollen uns in eine sanfte Wiese legen.
Werden drohend und so hilflos
Gegen den unsinnig großen,
Tödlich blauen, blanken Himmel
Die entfleischten, dumpfen Augen,
Die verwunschnen
Und verheulten Hände heben.
»Schön«, meint Peter.
»Lichtenstein«, sage ich.
»Schön«, sagt Peter nochmals.
»Ja«, antworte ich.
Auf dem Parkplatz neben dem Sportplatz ist ein alter Bus abgestellt. Wir werfen Pflastersteine in die Scheiben und brechen mit einer Eisenstange die Tür auf. Drinnen schlitzen wir die Sitze auf, zerhauen mit der Stange das Armaturenbrett, reißen die Gepäcksgitter vom Dach.
Ich wache wieder einmal verschwitzt auf. Der Wind bläht die Vorhänge vor den Fenstern. Ich trinke Wasser in der Küche. Es ist kurz nach vier. Während ich das Glas noch einmal vollaufen lasse, überlege ich, wen ich anrufen könnte. Ich suche den Zettel mit der Telephonnummer dieses Mädchens, das ich gestern kennengelernt habe. Ich finde ihn in der inneren Brusttasche meines Sakkos, zusammengerollt und an dem einen Ende etwas mit Blut verschmiert. Als ich mir ins Gesicht greife, spüre ich die Kruste. Im Badezimmer wasche ich mir Mund, Nase und Kinn. Ich gehe wieder in die Küche und wähle die Nummer. Es antwortet nur ein Tonband, besprochen von einer männlichen Stimme. Ich lege auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Am Küchentisch liegt eine Zigarette. Da ich nirgendwo ein Feuerzeug finde, entzünde ich sie an der Herdplatte. Ich blicke auf den Kalender. Samstag. Ich hätte auf Donnerstag getippt.
Es ist ein warmer Tag, und ich gehe Lukas besuchen, in den dritten Bezirk. Das Haus ist der einzige Neubau in der Straße. Auf dem Gehsteig, kurz vor dem Haus, geht ein Mädchen. Weil ich unabsichtlich direkt hinter ihr gehe, dreht sie sich kurz beunruhigt um. Als sie im selben Hauseingang verschwindet, in den ich muß, ist es mir zwar unangenehm, daß ich ihr wahrscheinlich Angst einjage, aber ich folge ihr. Um arglos zu erscheinen, räuspere ich mich und schleife etwas mit den Schuhen, aber als sie merkt, daß ich immer noch hinter ihr gehe, scheint sie sich mehr zu fürchten. Ich bin kurz im Zweifel, ob ich etwas sagen soll wie: »keine Angst« oder so, aber dann traue ich mich nicht. Beim Aufzug habe ich sie eingeholt. Sie schaut mich herausfordernd und ängstlich zugleich an und hat eine Hand in der Tasche, wahrscheinlich um notfalls schnell einen Tränengasspray hervorziehen zu können. Ich lächle höflich, sage »hallo« und bleibe neben ihr stehen, die Hände in den Jackentaschen. In ihren Augen ist ein Anflug von Panik. Als der Lift kommt, halte ich ihr die Tür auf und steige hinter ihr ein. Zu allem Überfluß drückt sie den fünften Stock, wo auch ich hinmuß. Sie sieht mich komisch an, als ich keinen anderen Knopf drücke. Ich presse mich an die Wand des Aufzugs, weil ich die Befürchtung habe, daß sie bei der kleinsten Bewegung ihr Tränengas zum Einsatz bringen könnte. Die Fahrt dauert ewig. Ich biete mich an, ihr wieder die Tür aufzuhalten. Wie als Entschuldigung zeige ich dorthin, wo Lukas wohnt. Sie bleibt nur stehen und schaut, die Hand weiterhin in ihrer Tasche, mir zu, wie ich klingle und wie Lukas mir öffnet und ich schließlich eintrete und die Tür rasch hinter mir zudrücke.
Ich nehme mir ein Bier aus dem Kühlschrank und setze mich zu Lukas ins Wohnzimmer, wo er sich gerade eine Spielshow ansieht und etwas raucht. Während eines Werbeblocks erzähle ich von meiner Begegnung im Aufzug. Lukas meint, daß das Mädchen eine Prostituierte ist, die nebenan mit ihrem kleinen Sohn wohnt.
Anna lerne ich bei der Lesung eines Freundes kennen. Sie kennt ihn, und er stellt mich ihr vor. Ich frage sie nach der Veranstaltung, ob sie einmal mit mir auf einen Kaffee gehen würde, und sie sagt »ja«. Ein paar Tage später rufe ich sie an, und wir machen aus, uns am Abend zu treffen. Wir reden viel und beschließen, uns wiederzusehen.
An einem der nächsten Tage fahre ich mit Anna in das Haus meiner Eltern, das auf dem Land liegt. Wir gehen spazieren, dann sitzen wir im Freien und trinken Wein, dazu essen wir Nüsse, die noch nicht ganz ausgereift sind und bei denen man die Haut abziehen kann.
In meiner Nachbarwohnung lebt eine alte Frau. Ich grüße sie immer höflich, und sie grüßt zurück. Sie scheint direkt darauf zu lauern, begrüßt zu werden. Manchmal, wenn ich gerade nach Hause komme oder die Wohnung verlasse, öffnet sich die Tür der Nebenwohnung, und ihre Stimme schallt herüber. Ich bin einmal im selben Bus wie sie gefahren, ohne daß sie mich gesehen hatte. Als eine andere alte Frau ihr den Behindertenplatz wegschnappte, begann sie fürchterlich zu schimpfen. Ich habe noch nie einen alten Menschen gehört, der so ordinär war. Sie beschimpfte die Frau drei Stationen lang, und als diese aussteigen mußte, wünschte sie ihr noch einen qualvollen Tod. Ich war beeindruckt.
Auf meinem Anrufbeantworter ist eine Nachricht von Judith, aus Berlin. Sie sagt, sie ist eine Woche in Wien, ob wir uns nicht treffen können. Ich habe sie bestimmt zwei Jahre oder länger nicht gesehen. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, daß ich sie in Berlin besuchte. Sie hatte dort eine Theateraufführung. Ich war mit dem Zug gekommen, und sie holte mich ab. Am selben Abend war die Premiere. Es war ein furchtbares Stück, und ich langweilte mich. Als alles vorbei war, gab es die Premierenfeier. Ich saß auf einem Stuhl an der Wand, gleich neben dem Tisch mit den Getränken, und rauchte eine nach der anderen. Die Leute waren furchtbar affektiert, und ich tat alles, damit sie mich nicht mochten. Am nächsten Tag mußte Judith in eine Wohnung am Prenzlauer Berg umziehen. Ich half ihr dabei. Am Abend ging sie ins Theater und nachher auf irgendeine Party, und ich sah mir »Viva Maria« in einem Hinterhofkino an. Nach dem Film kaufte ich mir etwas zu essen und ein paar Dosen Bier und fuhr in die Wohnung zurück. Weil es dort eiskalt war, wickelte ich mich in einen Vorhang und ließ meine Schuhe an. Die Räume waren noch ganz leer, nur die Koffer vom Umzug standen da. Im Kühlschrank waren eine leere Tube Senf und eine Flasche, halbvoll mit Himbeersirup. Ich sah in Judiths Koffer und überlegte mir, ob ich die Briefe lesen sollte, die in einem Plastiksack in einem der Koffer lagen, aber dann freute mich das auch nicht. Ich sah Judiths Bücher durch. In einem fand ich einen Satz angestrichen, den ich mir, damals, als ich das gleiche Buch las, herausgeschrieben hatte. Es war der Satz: Ich hatte das Bedürfnis, jemanden zu lieben, aber wenn ich mir vorstellte, wie das im einzelnen wäre, wurde ich mutlos.
Gegen fünf Uhr morgens kam Judith. Sie war leicht betrunken oder eingeraucht. Ich küßte sie, aber sie wehrte ab. Sie sagte, ihr ist kalt, und dann drehte sie sich auf die Seite, um zu schlafen. Plötzlich wurde ich wütend, stand auf, packte meinen Koffer und sagte, daß ich jetzt gehe. Sie sagte nichts. Als ich bei der Tür war, hoffte ich noch kurz, sie würde mich bitten dazubleiben, aber sie schwieg. So stand ich um halb sechs in Berlin und wußte nicht recht, wohin ich gehen sollte. Schließlich fuhr ich zum Bahnhof und stieg in den Zug nach Wien.
Das war die letzte Erinnerung, die ich an Judith hatte.
Ich treffe sie vor einem Café, an dessen Tür ein Zettel klebt: »Im August und September am Sonntag geschlossen.« Da ich eine Viertelstunde zu früh bin, gehe ich um den Häuserblock und hebe eine Kastanie auf, die noch fest in ihrer Stachelschale steckt und behalte sie in der Hand, um sie Judith zu schenken.
Als sie kommt, merke ich, wie sie sich verändert hat.
Wir gehen in ein anderes Café, und sie erzählt mir von ihren Theaterstücken, und ich merke bald, wie sie mich mit sanften Augen anblickt, aber ich steige nicht darauf ein, weil es mir auf einmal viel zu leicht erscheint, sie rumzukriegen.
Dann kaufen wir uns zwei Flaschen Wein, die wir bei mir zu Hause trinken, während wir uns ein Video ansehen. Wir liegen dabei nebeneinander auf der Couch und tun so, als würden wir nicht bemerken, was unsere Finger miteinander machen.
Als der Film aus ist, küßt sie mich. »Jetzt ist Revolution«, sage ich. Sie blickt mich verwirrt an, ich deute auf die Digitaluhr am Videorecorder, die 18:48 zeigt, und sie lacht.
Ich lasse mir ein Bad ein. Als ich drinnen liege und sie ins Badezimmer kommt, frage ich sie zum Spaß, was sie mir für eine Nacht zahlt, wieviel ihr eine Nacht mit mir wert ist. Sie sieht mich an und sagt: »Du Depp«.
Diesmal ist sie es, die geht.
»Ist dir eigentlich aufgefallen«, sagt Peter, »daß man kaum mehr vernünftige Gespräche führen kann? Man redet im Grunde nur noch über Filme, Musik, Drogen und wer mit wem gevögelt hat, ohne sich für diese Geistlosigkeit zu genieren.«
»Du wirst doch kein Moralist geworden sein«, sage ich und hebe seine Zigarettenschachtel hoch, was soviel heißen soll, wie: »Darf ich eine Zigarette haben?«
»Natürlich bin ich ein Moralist«, erwidert Peter und nickt, »warum sollte ich keiner sein? Und überhaupt: Wer ist kein Moralist?«
Nachdem wir eine Flasche Wein geleert haben, beschließen wir, zu den alten Gasometern zu fahren, wo auch manchmal Raves stattfinden. Peter hat erzählt, daß man in einen hineinklettern und bis auf das Dach gelangen kann. Bei der vorletzten U-Bahnstation, dort wo die Schlachthöfe sind, steigen wir aus. Wir gehen zu Fuß zehn Minuten, bis wir vor den Gasometern stehen. Nacheinander ziehen wir uns über eine Mauer und schlüpfen durch ein Fenster hinein. Innen führt eine Eisentreppe in einer Spirale, die Rundung des Gebäudes entlang, zu einer Luke, durch die man auf ein Vordach kommt. Von dort klettert man eine Leiter hoch und befindet sich auf der Kuppel. Weiter geht es nicht. Schließlich sitzen wir ganz oben und rauchen eine Zigarette. Der Körper ist viel zu erschöpft vom Aufstieg, um Angst zu haben. Aus dem Gasometer nebenan hört man einen dumpfen Bass wummern.
Fast eine Stunde bleiben wir auf dem Dach.
Als wir wieder unten sind und Richtung U-Bahn gehen, ist da ein Gefühl von Unendlichkeit. Später sitzen wir in einem Lokal, mit aufgeschürften Händen und schmutzigem Gewand, glücklich und im stillen Einverständnis, über das Glück zu schweigen.
Am Nachmittag, nachdem Nina gegangen ist, sitze ich allein in der abgedunkelten Wohnung, rauchend. Von draußen hört man das Hämmern eines Arbeiters auf einer Baustelle. Es ist schon kühl draußen. Die letzte Wärme des Sommers hat sich aufgebraucht, und eine neue kommt nicht nach. Ich stelle mir vor, wie ich viel zu selten in den letzten Sommern auf Wiesen lag oder durch die vom Tag aufgeheizten Gassen in der Innenstadt schlenderte. Jedes Jahr aufs neue nehme ich mir vor, dieses Mal den Sommer nicht brachliegen zu lassen, ihn nach besten Kräften auszuschöpfen, und jedes Jahr finde ich mich dann wieder auf der Straße, überrascht vom sichtbaren Hauch, den mein Atem in der Luft hinterläßt, und der Sommer scheint wieder einmal vorübergegangen zu sein, ohne eine Spur zu hinterlassen. Immer sind es nur die Erinnerungen, die das, was war, ersetzen sollen.
Jetzt sitze ich also in einem Raum meiner Wohnung, den man am ehesten als Wohnzimmer bezeichnen könnte, und stecke mir die Zigarette verkehrt, mit dem glühenden Ende zuerst, in den Mund, nur um es einmal auszuprobieren. Es schmeckt unangenehm, gar nicht nach Zigarette, mehr nach Lagerfeuer oder Schwelbrand.
Ich rufe Anna an, auf ihrem Handy. Sie sagt, sie sitzt gerade in einem Café in der Gumpendorferstraße und unterhält sich mit einem Freund. Ich fühle, daß ich störe. Sie sagt, sie meldet sich am Abend bei mir. Als ich aufgelegt habe, zünde ich mir noch eine an, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe zu rauchen.