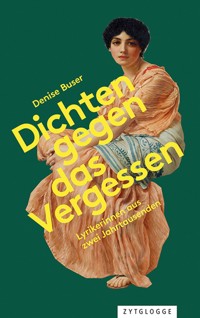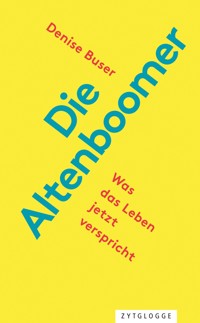
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht mehr durchstarten müssen, Schritttempo tut es auch. Mit dem Älterwerden begeben wir uns auf eine Reise, deren Ziel zwar feststeht, aber nicht der Weg, den wir dabei gehen. Doch warum daraus gleich ein grosses Altersprojekt machen und sich wieder abmühen? Es hindert uns nichts daran, zuerst einmal auszuschlafen und dann darüber nachzudenken. In ihrem wunderbaren Essay stellt uns Denise Buser eine unkonventionelle Reiseroute vor – klug, leichtfüssig und anregend. In einer Mischung aus persönlichen Erlebnissen, lebensphilosophischen Betrachtungen und kulturellen Analysen beleuchtet sie das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven: Wie werden das Alter und die damit verbundene Verletzlichkeit in der Kunst dargestellt? Was bedeutet das für das eigene Älterwerden? Welche Bedeutung kommt dem Herzblut und Engagement im Alter zu? Wie und wo findet man Trost und Hoffnung? Ist Sex im Alter noch ein Thema? Ja, wir werden älter. Chill mal!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
I. Aufmunterung als Vorwort
II. Vergänglichkeit im Bild
1. Akt der alten Frau: Die letzte Kühnheit
2. Je ne regrette rien
3. Schönheit selbst definieren
4. Verletzlichkeit zeigen
Erster Zwischenhalt: Überforderung
III. Filme/Oper
1. Aus der Rolle fallen und improvisieren
2. Totentanz aufführen
3. Kostbare Momente schenken
Zweiter Zwischenhalt: Würde im Alter
IV. Politik/Glaube
1. Herzblut
2. Trost und Hoffnung
V. Ausblick
Bildlizenzen und Abdruckgenehmigungen
Über die Autorin
Über das Buch
Denise Buser
Die Altenboomer
Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
© 2025 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Karin ReberKorrektorat: Philipp Hartmann
Denise Buser
Die Altenboomer
Was das Leben jetzt verspricht
I.Aufmunterung als Vorwort
«Bist du wieder in der Wohnung hinter dem Friedhof untergebracht?», will mein Bekannter aus Berlin beim Wiedersehen wissen.
«Ja, alles ist gleichgeblieben, es gibt nur ein paar neue Gräber.» Oh, der perfekte Auftakt für das Alters-Essay.
Der leicht ironische Unterton betrifft vielleicht die Frage, ob es der richtige Zeitpunkt ist, im 66. Lebensjahr ein Essay über den letzten Lebensabschnitt zu schreiben. Darüber, was die zweitausendsechshundert Jahre alte Zeile der griechischen Dichterin Sappho «alterslos kann man nicht werden» für meine Generation bedeutet, die sich von Babyboomern in Altenboomer verwandelt hat.
Ich muss nicht mehr darüber rätseln, ob ich tatsächlich biologisch, psychologisch, sozial und/oder kulturell alt bin, sondern es geht um die interessantere Frage, was nun werden soll. Überraschenderweise fühlt sich die Frage keineswegs beängstigend an. Im Gegenteil! Als ich neunzehn Jahre jung war und gerade mit dem Studium beginnen wollte, verlor mein Vater seine Arbeitsstelle und sollte nie mehr eine neue finden.
Für mich begannen die Gänge aufs Stipendienamt und die miserabel bezahlte Aushilfsarbeit an der Kasse eines Warenhauses. Der Einstieg in die lang ersehnte Welt des Wissens war anstrengend und verlangte mir wegen fehlenden Verbindungen und eher bescheidenem Talent sehr viel Fleiß ab. So aufregend die nachfolgenden Jahre wurden – und interessant waren auch die schwierigen Zeiten –, sie gingen nicht ohne Beklemmungen, Stress und Unsicherheiten vonstatten. Solchen Sorgen und Krisen kann man im Alter mit größerer Gelassenheit begegnen.
Jeder Blödsinn wurde schon gesagt über das Alter – und natürlich auch jede Weisheit. Der philosophische Coach Seneca schreibt in seinem 18. Brief an den Rat suchenden Lucilius, dass der Arme sorgenfreier sei als der Reiche, weil keine Ungunst des Schicksals ihm noch etwas entreißen könne. Im Reichtum tue man deshalb gut daran, Armut immer wieder einzuüben, um zu erkennen, dass die Beschränkung eigentlich gut auszuhalten sei. «Das bedeutet, den Schicksalsschlägen zuvorzukommen», schreibt Seneca und rät Lucilius noch: «Beginne mit der Armut vertraut zu werden.»1
Senecas Grundlage ist die Gelassenheit gegenüber dem Leben, die Stürme zu akzeptieren, um sie besser zu ertragen. Das Rezept taugt auch für das Alter. «Lasst es [das Alter] uns annehmen und lieben, es ist voller Freude, wenn man es zu nützen versteht»,2 frohlockt Seneca. Chill mal, bringt es die heutige Formel auf den stoischen Punkt.
Was heißt das nun für das heutige Altsein? Wie kann ich es einüben? Wie entdecke ich die Freuden des Alters? Wie kann ich lernen, dass seine Beschränkungen nicht nur zu ertragen, sondern in aller Regel gut auszuhalten sind? Und zwar vor dem Hintergrund, dass das Alter heute so viel länger, die Mentalität alter Menschen insgesamt selbstbewusster, erlebnisoffener, aktiver ist, und die Möglichkeiten, es zu erleichtern, so viel zahlreicher sind.
Manchmal erhellt das Gegenteil den Ausgangspunkt. Auf dieser Spur suchte ich in Bibliothekskatalogen nach Büchern von der Jugend über die Jugend. In einer Pause im Park sah ich ein Bild von Anmut und Lässigkeit, das zwei picknickende junge Frauen auf einer Parkbank neben einer blühenden Glyzinie abgaben. Die eine hatte das Bein unter ihre Sitzfläche gezogen und aß ihren Snack, ohne das Plaudern mit der Freundin zu unterbrechen. Diese befand sich ebenfalls rittlings auf der Bank, so dass sich die jungen Frauen wie auf einer Wippe gegenübersaßen. Ihre Haare hatten sie zu langen Pferdeschwänzen gebunden, die auf und ab hüpfend dem Bild einen symmetrischen Anflug gaben, eine doppelte Lebendigkeit, eine zweifache Geschmeidigkeit, die von der einen zur anderen hin und her sprang.
Das ist das genaue Gegenteil von Alter, ging mir durch den Kopf. Kämen diese jungen Menschen je auf die Idee, ein Essay über die Jugend zu schreiben? Sie leben diese gerade und müssen nicht darüber nachdenken. Würden sie das Wesen der Jugend sezieren, würde zwar ein Zuwachs an Bewusstheit resultieren. Die beiden jungen Frauen begännen vielleicht, ihre Jugend auf eine altkluge Weise zu genießen – so, wie man sich im Alter vorstellt, ihnen zuzurufen: «Hey, kostet diese verrückt kurze Zeit des Aufbruchs mit dem ganzen Wissen um ihre Einzigartigkeit und Unwiederbringlichkeit aus!» Doch ginge der Preis für dieses hyperbewusste Erleben der Jugend nicht unweigerlich auf Kosten der großartigen Entspanntheit und Frische, die nur Jugend ausstrahlt, ohne sie erklären zu müssen?
Den letzten Akt des Lebens begehen wir mit den Erfahrungen, die wir zeitlebens angesammelt haben. Unbekümmertheit ist nicht mehr möglich, dafür wissen wir zu viel. Das ist gut so. Mit zunehmendem Lebenslauf wird ein Kipppunkt überschritten, an dem Bewusstheit nützlich wird und sinnvoll eingesetzt werden kann. Denn der überschäumende Instinkt, mit dem die Jugend Probleme löst, oder auch nicht löst und sie trotzdem überwindet, ist aufgebraucht. Im Alter ist dieser instinktive Problemlösungsautomatismus ausgeleiert. An seiner Stelle hilft uns jetzt der bewusste Umgang mit den gesammelten Erfahrungen, und zwar so sehr – und das ist eine These dieses Essays –, dass er mindestens ebenso wie das experimentelle Gegenwartserleben in der Jugend befriedigend und beglückend sein kann. Es geht darum, Bewusstheit als Genuss zu erkennen und diese Einsicht nach Lust und Laune einzusetzen und zu verfeinern.
Doch warum soll man aus dem allmählichen Ausleiern der Kräfte ein bewusstes Altersprojekt machen und sich wieder abmühen? Es hindert uns nichts daran, zuerst einmal auszuschlafen und dann darüber nachzudenken. Mit dem Ausschlafen hat man bereits die erste Lektion des Genusses bestanden.
Mich hat das Ende des Weckerklingelns von fünfundzwanzigjährigen Schlafproblemen befreit. Zwar haben viele Nächte immer noch große Löcher, aber statt sofort nach Tabletten zu greifen, um irgendwie auf sechs Stunden Notschlaf zu kommen, damit das Pflichtpensum des Folgetags bewältigt werden kann, knipse ich nun die Lampe an und lese in einem Lieblingsbuch oder höre im Dunkeln leise Radio. Es kann bis zu 1,5 Stunden dauern, aber früher oder später klappen die Augenlider sanft zu, und ich erwache erst wieder, wenn die Regeneration abgeschlossen ist. Guten Morgen – die Sonne steht zwischen 8 und 9 Uhr immer noch sehr verjüngt da, der perfekte Start in einen neuen Tag.
Genügend Schlaf ist ein Geschenk, und ich packe es jeden Tag sorgfältig aus.
Das Gute nicht für selbstverständlich nehmen. Das Bewusstsein entwickeln, solche Geschenke als Privilegien des Alters zu erleben. So heißt diese zweite Lektion, und wie gezeigt, kann man sie im Schlaf lernen.
Und noch eine gute Nachricht: Du bist in diesem Altersprojekt deine eigene Lehrmeisterin, bestimmst den Stoff, die Intensität des Lernens und die Länge der Pausen selbst. Haben wir uns in der Jugend nicht so eine Schule erträumt?
Die nächste Lektion heißt das Bächlein-Syndrom. Ich kann mich am Anblick eines glucksenden Bächleins so sehr ergötzen, dass es mir selbst lustig vorkommt. Wasser hat mich schon immer fasziniert. Früher musste es ein Meer sein, doch das bedeutet nicht, dass ich mich heute mit einem Bächlein begnüge. Das Meer zieht mich nach wie vor an, aber das Bächlein ist jetzt eine eigene Genusskategorie geworden, die ich mir tagtäglich verschaffen kann.
Es kommt immer wieder vor, dass mir jemand eine neue Spaziervariante verrät, mit einem noch unbekannten Bächlein, dem Muschelbach beispielsweise. Es durchrieselt mich ein Glücksschauer, wenn ich den neu entdeckten Panta rhei (alles fließt) entlang schlendere und ein Schwarm Nasen eine Weile neben mir herschwimmt, bis die Fische in den Lichtreflexen eines plötzlich einfallenden Sonnenstrahls verschwinden.
Weil ich viel mehr Zeit habe, gehe ich nur noch schöne (Um-) Wege zum Ziel und denke dabei an die jugendlichen Traceurs, die ihren Kitzel gerade aus dem Gegenteil beziehen, indem sie auf schnurgeradem Weg von A nach B alle Hindernisse mit ihrer schieren Sprungkraft überwinden. Mich fordert jetzt die Suche nach der schönsten Route heraus, mag sie auch doppelt so lang sein, um mit dem Fahrrad auf möglichst zusammenhängenden Naturwegen in die Stadt zu gelangen. Bei Regenwetter spaziere ich durch den Park, wo die Tropfen wie ein geplatztes Diamantenkollier auf den Grashalmen zittern. Dafür nehme ich in Kauf, erst bei der übernächsten Tramhaltestelle einzusteigen.
Das zunehmende Alter hat mir noch einen anderen Sinn geschärft. Den Sinn für Entdeckungen von Großartigem fünf Minuten unterhalb der Superlative. Die berechtigte Dominanz von Spitzenwerken in Kunst und Kultur soll hier keine Sekunde in Abrede gestellt werden. Aber ich habe keine Lust auf endlose Warteschlangen mehr, um in die tausendfach geteilte Nähe der Meisterwerke und seltenen Meisterinnenwerke zu gelangen. Denn es gibt berührende Kunstwerke von übersehenen kreativen Menschen (z. B. in kleinen, selten besuchten Museen), faszinierende Wechselausstellungen in nur einer Vitrine, Hervorragendes aus der Provinz – kurz: herrliche Trouvaillen, glücklich machende Zufallsentdeckungen, die es kaum aus Gründen der Qualität nicht oder noch nicht in die große Öffentlichkeit geschafft haben.
Zum ersten Mal habe ich das in einem afrikanischen Museum für moderne Kunst entdeckt, in dem ich stundenlang die einzige Besucherin war. Damals war ich geradezu schockiert über das Missverhältnis der Erstklassigkeit der ausgestellten Kunstwerke und ihrer Unbekanntheit in unseren Breitengraden. Keine zwei Meter vom Hype entfernt oder fünf Minuten unterhalb der Glanzstücke wartet das Hervorragende, das man noch selbst entdecken und fast alleine bestaunen kann.
Den letzten Lebensabschnitt bewusst zu gestalten ist eine Möglichkeit, mit dem herannahenden Tod, der Bilanz über begangene Fehler und persönliche Sternstunden, dem körperlichen Verfall umzugehen. Im Alter Windeln tragen. Als menstruierendes Wesen kennt man es: Die überspielte Verzweiflung in einer wichtigen Geschäftssitzung, damals, wie viele Jahre ist das her, ob die Binde oder der auf die Blase drückende Tampon gerade am Überlaufen ist und die helle Baumwolle des Sommerkleids mit peinvollen Flecken gemustert hat. Wo frau den ekligen Stempel entsorgen soll.
Mehr als ein Jahrzehnt bin ich von dieser Blutpein entfernt und vielleicht auch noch einmal ein Jahrzehnt vom Inkontinenztampon. Zwanzig befreite Jahre – wenn das kein Grund ist, es einmal ausdrücklich zu notieren.
Wenn ich das gesammelte Glück meines bisherigen Lebens zusammenrechne, dann komme ich vielleicht auf gute eineinhalb Jahre am Stück – es hat sich zweifellos gelohnt –, aber ich ahne, dass sich noch ein paar sehr gute Stunden anhängen lassen. Dabei werden mir alle Altersgenoss:innen zustimmen: Zum Glück muss man im Alter nicht mehr durchstarten, Schritttempo tut es auch. Und trotzdem gibt es noch einmal Intensitäten, die dem Alter vorbehalten sind.
Dass Alter nicht nur Verlust, sondern auch eine große Befreiung ist – das ist der rote Faden, der mich interessiert.
In den folgenden Kapiteln gehe ich von drei Überlegungen aus, die anhand von Beispielen aus Kultur, Politik und Glaube beleuchtet werden:
Das Leben ist ein Kontinuum, das Alter ist davon nicht abgetrennt. Auch im Alter können wir lernen und erleben.
Muss man für ein gutes Alter reich sein? Eine Relativierung tut not.
Im Austausch mit der Jugend zu bleiben, tut dem Alter gut.
Endnoten
1Marion Giebel (Hrsg.), Lucius Annaeus Seneca, Briefe an Lucilius, Stuttgart 2020, 18. Brief (11) und (12), S. 61.
2A.a.O., 12. Brief (4), S. 35.
II.Vergänglichkeit im Bild
1.Akt der alten Frau: Die letzte Kühnheit
Es ist das Jahr 1905. Ein junger Maler, der vor kurzer Zeit sein erstes Atelier in Berlin bezogen hat, steht vor der Staffelei mit der noch leeren Leinwand. Ihm gegenüber sitzt eine alte Frau auf einem Biedermeierstuhl. Durch große Fenster strömt das Tageslicht hinein und leuchtet die Sitzende hell aus. Die alte Frau ist nackt. Ihre mächtige rechte Hand bedeckt nicht das Geschlecht, sondern ruht auf dem schön aufgegangenen Brotlaib ihres Bauches. Der junge, konzentriert blickende Mann in Anzug und Krawatte beginnt mit dem Bild «Akt der alten Frau». Sie ist die Putzfrau, die sein Atelier reinigt, und es brauchte möglicherweise mehrere Anläufe, sie zu überreden, ihm Modell zu sitzen – für einen Akt, wie er ihr von Anfang an klarmacht.
Heute existiert nur noch eine Fotografie in Schwarz-Weiß vom Originalbild. Laut der ersten Ehefrau war das Ölgemälde bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in der Autogarage verstaut worden, die bei einem Luftangriff 1944/45 zerstört wurde. Der Maler lebte damals mit seiner zweiten Frau im Exil in Amsterdam, später in New York, wo er 1950 mit 64 Jahren starb.
Akt der alten Frau, Max Beckmann, Berlin 1905 (Gemälde zerstört), Fotografie in S/W; Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Max Beckmann Archiv, Fotograf: unbekannt.
Wie viel Mut und Überwindung braucht es wohl, um als gealterte Frau für ein Aktgemälde stundenlang Modell zu sitzen? Der damals 21-jährige Max Beckmann hat den alten Leib ungeschminkt und ungeschönt gemalt, jedoch mit Augen voller Achtung für das gelebte Leben seines betagten Modells. Auf dem Bild ist die Frau nackt, aber nicht entblößt; sie ist ohne Scham und wirkt in sich ruhend. Diese stille, wie selbstverständliche Nacktheit ist auch auf der Fotografie gut sichtbar.
Die alte Frau schaut dem Maler nicht bei der Arbeit zu, scheint sich aus der vielleicht anfänglichen Befangenheit gegenüber der besonderen Situation gelöst zu haben, hängt eigenen Gedanken nach. Wie alt mag sie tatsächlich sein? Da damals die Menschen schneller alterten, ist sie vielleicht keine sechzig Jahre alt. Sie arbeitet noch immer als Putzfrau im Haushalt des Malers, vielleicht auch in anderen Häusern. Höchstwahrscheinlich hat sie mehrere Schwangerschaften und die nie abbrechende Fron einer Frau aus den unteren Gesellschaftsschichten hinter sich. Das fortgeschrittene Alter schützt sie nicht davor, mit tätiger Arbeit Geld zu verdienen. Ihr Körper gibt das her. Sie wirkt alt, aber einigermaßen gesund. Das Leben wird sich in nicht allzu weiter Ferne abrunden, und bevor sie geht, zeigt sie sich nochmals in ihrer Fülle. So malt sie der Maler, so geht es ihr vielleicht durch den Kopf.
Weshalb hat sich Beckmann für die alte Frau entschieden, warum hat er nicht seine junge künftige Ehefrau mit ihrem schönen Erscheinungsbild gebeten, ihm Modell zu sitzen? Vielleicht interessierte er sich einfach mehr für die zerfließende Landschaft eines alten Körpers, der nicht leicht zu malen ist, will er nicht einfach nur die Banalität des Verwelkens dokumentieren.
Ganz am Rand frage ich mich, inwiefern auch hier der in der Kunstgeschichte typische männliche Blick auf den weiblichen Körper eine Rolle spielt. Immerhin ist Beckmann von den gängigen Vorbildern über Jugend und Schönheit abgewichen. Ein gewisses Flair des jungen Malers für die erotische Mütterlichkeit des Modells schließe ich auch nicht aus.
Es ist schwierig, dem gealterten Körper Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, denn es besteht die Gefahr, dass der Verfall in der Zweidimensionalität eines Bildes stärker hervortritt als in der Wirklichkeit. Das passiert, wenn die Leinwand das Lebendige des Originals, die stumme, aber spannungsgeladene Körpersprache nicht einfangen kann. Das Abbild, fixiert in der Fläche, erscheint dann leblos und falsch (wie die zu krass wirkenden Fotobearbeitungen bei zu eitlen Berühmtheiten).
Beckmann hat es richtig gelöst. Die nackte Putzfrau auf dem Gemälde kommt mir nicht beleidigt vor, obwohl ihr der junge Maler vielleicht unmissverständlich zu verstehen gab, dass ihn gerade die Falten am alten Körpergebirge besonders interessieren. Er hat den verwelkten Körper gemalt und auch die Unverzagtheit der alten Frau, dass sie mit genau diesem Körper noch einige Jahre leben wird. Der Maler hat die Überlegenheit einer alten Frau aus bescheidenen Verhältnissen, die ihr Leben trotz der materiellen Beschränktheit gut gemeistert hat, erkannt und auf die Leinwand gebracht. Er hat diese in sich ruhende, selbstgewisse Körperlichkeit mitgemalt und so für die Würde der alten, nackten Frau einen Ausdruck gefunden.