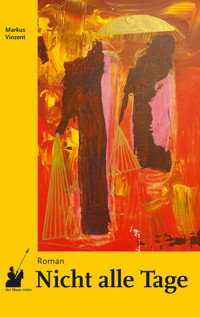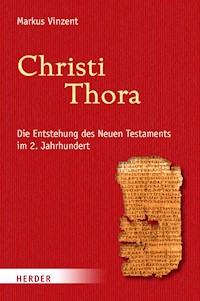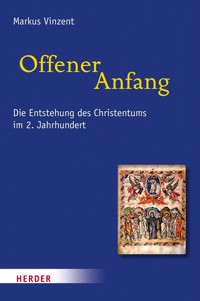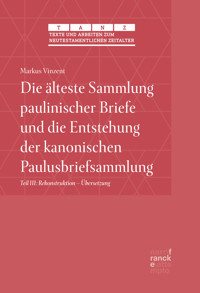
Die älteste Sammlung paulinischer Briefe und die Entstehung der kanonischen Paulusbriefsammlung E-Book
Markus Vinzent
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter (TANZ)
- Sprache: Deutsch
Für die Anfänge des Christentums sind lediglich zwei Sammlungen christlicher Texte bekannt, die als "Neues Testament" bezeichnet wurden - eine vor der Mitte des 2. Jh.s entstandene, die von Markion von Sinope veranstaltet wurde, und die uns bekannte des später kanonischen Neuen Testaments, die aus der Zeit um Irenäus von Lyon gegen Ende des 2. Jh.s zusammengebracht wurde. Der griechische Text der 10-Briefe Sammlung des Paulus, die von den Kirchenvätern dem "Neuen Testament" des Markion von Sinope zugeordnet wird, wird hier erstmals rekonstruiert. In Teil I wird diese Sammlung gegenüber der 14-Briefe-Sammlung des Paulus, die sich im kanonischen Neuen Testament findet, als die ältere erwiesen und in ihrer Sprache und Inhalt gegenüber der jüngeren verglichen. Die Editionsteile rekonstruieren den griechischen Text, der parallel zu dem des kanonischen Textes der zehn Briefe gesetzt ist, versehen mit Apparaten zu den altkirchlichen Zeugen und den signifikanten Varianten, ergänzt mit einer kurzen inhaltlichen Kommentierung zu einzelnen Briefabschnitten und einer lexikographischen Analyse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1413
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die älteste Sammlung paulinischer Briefe und die Entstehung der kanonischen Paulusbriefsammlung
Mit Mark G. Bilby, Jack Bull, K. Lance LotharpUnter Mitarbeit von Günter Röhser
Teil III: Rekonstruktion – Übersetzung (Röm - Phlm)
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381142125
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0939-5199
ISBN 978-3-381-14211-8 (Print)
ISBN 978-3-381-14213-2 (ePub)
Inhalt
Rekonstruktion
4 (Röm)
Titulus und Vorwort
1 Πρὸς Ρωμαίους
Romani sunt in partibus Italiae. hi praeventi sunt a falsis apostolis et sub nomine domini nostri Iesu Christi in legem et prophetas erant inducti. hos revocat apostolus ad veram evangelicam fidem scribens eis ab Athenis.
A. *Titel: Vgl. Tert., Adv. Marc. V 13, praef.: De epistula ad Romanos; vgl. Epiph., Pan. 42 (105 H.): Τετάρτη πρὸς Ῥωμαίους; ibid. (118 H.): Τῆς πρὸς Ῥωμαίους, παρ’ αὐτῷ δ, ἐν δὲ τῷ ἀποστολικῷ α; ibid. (175 H.): Τῆς πρὸς Ῥωμαίους οὕτως γάρ ἐστι παρὰ τῷ Μαρκίωνι κειμένη, ἵνα μηδὲν ὀρθὸν παρ’ αὐτῷ εἴη; vgl. auch den markionitischen Prolog.
B. Die Varianten sind in der kritischen Edition vermerkt.1
C.
Zahn und Harnack geben als Adressat und Titulus ohne Quellenverweis: Πρὸς Ρωμαίους.
Kapitel 1
1,1 [2-4] 5 [6] 7 [8-15]: Brieferöffnung
Die vorkanonische Brieferöffnung ist zwar nicht bezeugt, dürfte aber, wenn man Tertullians Angaben zum Ersten Korintherbrief folgt, auch hier nicht viel anders gelautet haben. Allerdings deutet die bekannte Handschriftenvariante in einschlägigen Zeugen daraufhin, dass im Text keine bestimmte lokale Adressangabe stand, auch wenn sich diese aus dem Prolog erschließen lässt.1
Die kanonische Redaktion, erweitert, wie bereits gewohnt, die Eröffnung, indem sie insbesondere auf die Davidslinie dem Fleisch nach für die Genealogie Christi verweist. Des Weiteren führt die kanonische Eröffnung gegen Ende eine Reihe Information zu Paulus an, mit der auf die solidarische Nähe zwischen ihm und seinen Adressaten hingewiesen wird.
1,1 Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ
1,1 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,
2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις, 3 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα, 4 τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,
5
ἐν τοῖς ἔθνεσιν,
5 δι’ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,
6 ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
7 πᾶσιν ἐν ἀγάπῃ θεοῦ,
χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ.
7 πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι 10 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 11 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, 12 τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 14 Ελλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί· 15 οὕτως τὸ κατ’ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι.
A. *1,1: Vgl. Tert., Adv. Marc. V 5, praef. 1: De epistula ad Corinthios prima. [1] Praestructio superioris epistulae ita duxit, ut de titulo eius non retractaverim, certus et alibi retractari eum posse,communem scilicet et eundem in epistulis omnibus. ♦ *1,7: Vgl. Tert., Adv. Marc. V 5,1-2: [1] … Praestructio superioris epistulae ita duxit, ut de titulo eius non retractaverim, certus et alibi retractari eum posse, communem scilicet et eundem in epistulis omnibus. Quod non utique salutem praescribit eis quibus scribit, sed gratiam et pacem, non dico …Haec cum a deo patre nostro et domino Iesu annuntians communibus nominibus utatur, competentibus nostro quoque sacramento, non puto dispici posse quis deus pater et dominus Iesus praedicetur, nisi ex accedentibus cui magis competant.
B. (1,7) Anstelle von Ῥώμῃ findet sich ἀγάπη θεοῦ in 06, 0139, Or1739mg; om 010, 012 (jeweils mit Lakune). ♦ κυρίου steht auch in Pel, während sich domino nostro findet in der altlateinischen Tradition (89), Rufvar, hingegen nach christo iesu stehend domino nostro in Ambstvar. Was den Titel Ἰησοῦ Χριστοῦ betrifft, vgl. man die altlateinische Tradition, hier liest man iesu christo in 89, Rufvar, Pel.
C.
1. (1,1) Der erste Vers ist nach allen Editoren unbezeugt, gleichwohl nimmt Zahn die Präsenz desselben an und auch BeDuhn führt ihn nach folgendem Textbestand in Klammern gesetzt an: [Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος], wobei er den Brief nach dem Zeugen 012 direkt mit Vers 5a fortschreiten lässt. Hierfür spricht auch, dass diese Eröffnung eng dem lateinisch erhaltenen Prolog entspricht.2
2. (1,2-4) Diese Verse gelten ebenfalls nach allen Editoren als unbezeugt, auch wenn Zahn wiederum ihre Präsenz in unbestimmbarer Form annimmt.3 Harnack verwies bereits auf Origenes’ Johanneskommentar,4 in welchem dieser berichte, dass bei der Diskussion der vorliegenden Verse des Römerbriefes, insbesondere Röm 1,3, Markion „die Erwähnung Davids aus Röm. 1,3 gestrichen“ habe.5 BeDuhn präzisiert, Origenes habe lediglich ausgeführt, „Markion habe die Geburtsgeschichte aus seinem Evangelientext ausgelassen, weil er ’die Geburt aus Maria verworfen habe, was seine göttliche Natur betreffe‘“.6
Nun ist die Terminologie des Origenes recht eindeutig. Wenn er davon spricht, er sei der Meinung (οἶμαι), Markion habe richtige Worte falsch verstanden und die Geburt aus Maria „ausgelassen“ bzw. „gestrichen“ (ἀθετοῦντα), so benutzt er hier einen Terminus der Textkritik, spricht also davon, was seiner Meinung nach eine Textelimination sei, wobei natürlich vorausgesetzt ist, dass Origenes wie Tertullian und vor ihnen Irenäus davon ausgegangen waren, Markion habe eine ältere – eben die von ihnen als korrekt und von uns als kanonisch bekannte – Version bearbeitet, gekürzt und verstümmelt. Dass Origenes vermutlich nicht nur Röm 1,3 im Blick hat, sondern sich das Fehlen auf die Verse 2-4 bezieht, legt auch das Schweigen Tertullians, was diese Verse betrifft, nahe. Hätte er nämlich in Markions *Paulus gelesen, Christus sei durch die „Propheten im Voraus verheißen“ worden „in heiligen Schriften“ und dass er „als Nachkomme Davids“ gekommen sei, wäre ihm dies Wasser auf die Mühlen seiner rhetorischen Tirade gegen Markion gewesen.
Wenn Lieu darauf hinweist, dass Schmid gegen Harnack argumentiere, das Origeneszitat trage nichts aus für die Textkritik,7 verschweigt sie allerdings, dass Schmid in seiner Rekonstruktion Röm 1,2-4 auch nicht für bezeugt hält.8 Wichtig ist die Beobachtung, dass die kanonische Fassung des Präskripts mit 72 Wörtern „zweieinhalbmal so lang wie die zweitlängste [Selbstvorstellung des Paulus] (Gal 1,1-2a mit 26 Wörtern) und mehr als 14 mal so lang wie die kürzeste (1Thess 1,1 mit 5 Wörtern)“ ist und sich „mit der Beschreibung des paulinischen Auftrags in 15,15-21 recht weitgehend überschneidet … Auf diese Weise entsteht eine Inklusion, die noch dadurch verstärkt wird, dass die Entsprechungen sich in den jeweils folgenden Abschnitten (1,8-17 // 15,22-32) fortsetzen“.9 Nachdem all diese Passagen (bis auf 1,16-17) nur für die kanonische Ebene bezeugt sind, bzw. Kap. 15-16 für die vorkanonische Version als abwesend bezeugt ist, wird man folglich die Aufblähung des Präskripts ebenfalls auf die kanonische Redaktion zurückführen, und die Inklusion als Versuch werten, die beiden letzten Kapitel des Römerbriefs als integrale Bestandteile den Lesenden zu suggerieren, was als Strategie bis heute offenkundig weithin funktioniert.
Van Manen verweist darauf, dass die Verse Röm 1,2-6 „mehr als ein unschuldiger Zwischensatz“ sind, wobei Vers 6 das vorwegnehme, „was er noch sagen muss, nämlich: wer die Leser des Briefes sind, an dessen Abfassung er sich macht“. Schon wegen der ungewöhnlichen Länge der Zwischensätze in einer Brieferöffnung denkt er „an Interpolation“ und kommt nach langen Ausführungen zum Schluss: „Wenn wir uns … versichert halten, dass die Adresse des Briefs ihre jetzige Form erhalten hat durch Erweiterung einer älteren und kürzeren, und dass V. 2-6 den Bearbeiter verrät, dann erhebt sich die Frage, ob das Übrige, V. 1 und 7, ganz unverändert übernommen sein wird“.10
3. (1,5) Nach allen Editoren ist der Vers unbezeugt, doch BeDuhn verweist auf den Zeugen 012, der im Anschluss an Vers 1 unmittelbar Vers 5b anschließt.
4. (1,6) Der Vers ist nach allen Editoren unbezeugt, auch wenn Zahn mit seiner Präsenz in irgendeiner unbestimmbaren Form rechnet.
5. (1,7) Wiederum erfolgt hier der Verweis auf die Passage Tertullians, in welcher er auf die Eintönigkeit der Eröffnungen des Paulus in seinen Briefen abhebt. BeDuhn schreibt: „[to those who are in Rome]“. Allerdings ist von Gewicht, dass wiederum in einschlägigen Zeugen die Ortsangabe Rom fehlt und stattdessen ἐν ἀγάπη θεοῦ steht. Gewiss ist nicht sicher, dass die Ortsangabe hier gefehlt hat, jedoch spricht BeDuhn selbst gegen seine eigene Gegenargumentation, wonach Tertullian und Epiphanius diesen Brief als an die Römer gerichtet kennen, wenn er für den markionitischen Ursprung des lateinischen Prologs argumentiert, da dort ja die Adressaten genannt werden, auch wenn dies kein Hinweis auf die Ortsangabe hier bietet. Es kann also durchaus sein, dass die kanonische Redaktion in dem Vers hier die Ortsangabe Rom aus dem Titel eingefügt hat, ein Zusatz, der eben weder Origenes noch dem Zeugen 06 bekannt war, der aber auch in 010 und 012 mit einer Lakune als fehlend gekennzeichnet ist. Allerdings kann man auch umgekehrt argumentieren: „Die Streichung der Ortsangabe diente wahrscheinlich dem Zweck, dem Brief für liturgischen Gebrauch ökumenischen Charakter zu geben“.11 Auch auf Streichung hinzielend geht die Auffassung, wonach das Schreiben als Zirkularschreiben dienen sollte, ein Charakter, den es ursprünglich hatte und wozu es die Streichung wieder machte.12 Beide Hypothesen sind aber wenig überzeugend, weil ihnen zufolge mit mehr Zeugen zu rechnen wäre, die das Fehlen dieser Adresse aufwiesen und nicht gerade die Bilinguen, die der vermutlichen Bilingue der vorkanonischen Sammlung am nächsten stehen. Findet sich die Ortsangabe Rom in der vorkanonischen Version nicht, dann führte die kanonische Redaktion mit der Hinzufügung derselben zu einer Betonung Roms, die wegen der starken Verbreitung dieser redaktionellen Version sich in fast allen weiteren Zeugen findet, die Ausnahmen böten hier noch die Spur zur früheren Version.13
Bereits van Manen hatte die Eröffnung für „nicht ursprünglich“ erklärt14 und schon Völters sah lediglich den Anfang von Vers 1 (allerdings mit Einschluss von δοῦλος) Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ und Vers 7 für ursprünglich.15
6. (1,8-15) Nach allen Editoren sind diese Verse unbezeugt, auch wenn Zahn wiederum mit deren Präsenz in nicht näher bestimmbarer Form rechnet.
Überblickt man die lexikalischen Vergleiche von D. der unbezeugten Verse 8-15 ergibt sich eine weitreichende Übereinstimmung zwischen fehlender Bezeugung und Lexik, die Verse sind folglich der kanonischen Redaktion zuzuordnen und waren in der vorkanonischen Fassung abwesend. Überhaupt hat man schon kritisch zum Inhalt dieser Ausführungen zu Beginn des Briefes geurteilt, zum einen, weil der Text „die übliche Form des Proömiums“ überschreitet, indem Paulus „eigentümlich“ seinen Besuch bei den römischen Christen ankündigt und anstelle seiner „höchst polemischen Ausführungen des Galaterbriefes in neu reflektierter Weise unpolemisch, jedoch mit durchgehend antijüdischer Spitze wiederholt und ausführt“.16 Andererseits hat man auch auf den besonderen Stil dieses Abschnittes verwiesen. Nachdem (wie im vorkanonisch bezeugten Vers 16a) über zehn finite Verben in der 1. Pers. Sg. stehen und „bis einschließlich V. 15“ Paulus „durchweg in Beziehung zu den Adressaten“ spricht (Ausnahme V. 14), liegt hier „eine deutlich erkennbare Kohärenz“ vor, die diesen Teil von den V. 16b-17 unterscheidet.17
D.
(1,1) Παῦλος, der 174 / 158 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 1,1; *1Kor 1,1; 3,22; *2Kor 1,1; *Röm; *1Thess 1,1; *2Thess 1,1; *Laod 1,1; *Kol 1,1. ♦ Die Wendung Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ steht 6 Mal im NT, davon 5 Mal als Verseröffnung, vorkanonisch bezeugt für *1Kor 1,1, vermutlich aber auch stehend in *2Kor 1,1; *Röm 1,1; *1Thess; *2Thess; *Laod; *Kol; *Phil, vgl. zu 1Kor 1,1. ♦ δοῦλος, das 128 Mal im NT steht, ist als Verhältnisbestimmung des Menschen zu Gott oder Christus ein kanonisch semantisch konnotiertes Lexem. ♦ Die Wendung δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ steht noch 1 weiteres Mal, auf der kanonischen Ebene in Kol 4,12. ♦ κλητός steht 12 / 10 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ ἀφορίζω, das 11 / 10 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 1,15.18 ♦ Die Wendung εὐαγγέλιον θεοῦ steht nur hier.
Zur Rekonstruktion: Gemäß dem Kommentar Tertullians zum Ersten Korintherbrief darf man auch hier mit der einfachen Eröffnung wie dort rechnen, die von der kanonischen Redaktion erweitert und verändert wurde.
(1,2) προεπαγγέλλω steht nur noch 1 weiteres Mal auf kanonischer Ebene 2Kor 9,5. ♦ προφήτης, das 157 / 144 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 12,28; 14,32; *1Thess 2,15. ♦ Die Wendung διὰ τῶν προφητῶν steht 3 Mal im NT, Mt 2,23; Lk 18,31, in einem Vers, der in *Ev fehlt; Röm 1,2. ♦ γραφή steht 54 / 51 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers verweist mit seinen ausschließlich kanonisch belegten Elementen (προεπαγγέλλω; διὰ τῶν προφητῶν; γραφή) auf dessen Entstehung durch die kanonische Redaktion, er hat vorkanonisch gefehlt.
(1,3) περί, das 354 / 333 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 8,1; 12,1, vgl. weiter Vers 8, auf derselben kanonischen Ebene stehend. ♦ Die Wendung περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ steht noch 2 weitere Male, 1Koh 5,9. 10. ♦ Der Ausdruck τοῦ γενομένου steht noch 1 weiteres Mal, Apg 1,16. ♦ σπέρμα steht 45 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *1Kor 15,38. ♦ Die Wendung ἐκ σπέρματος steht 3 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Röm 1,3; 11,1; 2Tim 2,8). ♦ Δαυίδ steht 63 / 59 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev. ♦ Der Ausdruck κατὰ σάρκα steht 20 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Gal 4,23; *Röm 8,4. 5.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ; τοῦ γενομένου; ἐκ σπέρματος). Außerdem, wie in C. 2 dargelegt, wäre es schwer verständlich, wenn Tertullian sich diesen Vers nicht zunutze gemacht hätte. Der Vers geht folglich auf die kanonische Redaktion zurück und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,4) ὁρίζω steht 17 / 8 Mal im NT, ausschließlich für die kanonische Ebene belegt. ♦ Die Kombination υἱὸς θεοῦ steht 5 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Mk 1,1; 15,39; Lk 1,35; Joh 19,7; Röm 1,4). ♦ ἁγιωσύνη, steht 3 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ Der kombinierte Ausdruck πνεῦμα ἁγιωσύνης ist Hapax legomenon im NT, er begegnet jedoch in jüdischer Literatur, TestL 18,11, und auf einem jüdischen Amulett.19 ♦ ἀνάστασις, das 44 / 42 Mal im NT steht, vorkanonisch bezeugt für *Ev 14,14; 20,27. 33. 35. 36; *1Kor 15,12. 21. 42 ist.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (ὁρίζω; υἱὸς θεοῦ; ἁγιωσύνη). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,5) ἀποστολή, das 4 Mal im NT steht, findet sich nur auf der kanonischen Ebene. ♦ ὑπακοή steht 16 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ πᾶσιν, das 91 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 24,25; *Gal 6,6; *1Kor 15,28; *Laod 4,6, vgl. weiters Vers 7.
Zur Rekonstruktion: Der Vers wird also bis auf das ἐν τοῖς ἔθνεσιν in der vorkanonischen Fassung gefehlt haben.
(1,6) Die Kombination ἐν οἷς (Neut.) steht 12 Mal im NT, davon 4 Mal als Verseröffnung (Verseröffnung: Lk 12,1; Apg 26,12; Röm 1,6; Kol 3,7; im Vers: Lk 1,78; Apg 11,14; Phil 4,11; 2Tim 3,14; Hebr 6,18; 13,9; 2Petr 2,12; Apk 19,20), ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ Die Kombination καὶ ὑμεῖς steht 64 Mal im NT, davon 8 Mal als kanonische Verseröffnung, vorkanonisch im Vers bezeugt für *Ev 20,21; *Röm 7,4; *1Thess 2,14; *Laod 1,13; vgl. zu 1Kor 5,2. ♦ Die Verbform ἐστε/ἔστε, die 92 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Gal 3,26; 4,6; *1Kor 3,16; 5,7; 10,7; *Röm 8,9; 12,16; *Laod 2,19. ♦ κλητός findet sich 12 / 10 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene.
Zur Abwesenheit: Dieser kurze, vorkanonisch unbezeugte Vers weist Elemente auf, die nur auf der kanonischen Ebene belegt sind (ἐν οἷς; κλητός) und greift mit κλητός das sinntragende Moment des Verses auf. Es ist derselbe Begriff aus Vers 1, der dort auf der kanonischen Ebene steht. Somit wird wohl auch dieser Vers hier auf die kanonische Redaktion zurückgehen und vorkanonisch gefehlt haben. Dass nur *Laod ἐν οἷς vorkanonisch bezeugt, spricht wiederum für die Nähe dieses Briefes zur kanonischen Lexik.
(1,7) πᾶσιν, das 91 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 24,25; *Gal 6,6; *1Kor 15,28; *Laod 4,6, vgl. zuvor zu Vers 5. ♦ Die Verbform οὖσιν, die 10 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 4,8. ♦ Ausschließlich auf der kanonischen Ebene findet sich gerade in den Brieferöffnungen die Wendung τοῖς οὖσιν, Röm 1,7: πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ; 12,3: τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν; 1Kor 1,2: τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ; 2Kor 1,1: τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ; Eph 1,1: τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ]; Phil 1,1: τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, und wiederum in Apg 20,34: τοῖς οὖσιν μετ’ ἐμοῦ. ♦ πατήρ im Singular, der 297 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 1,3; 5,1; *Laod 1,17; 2,18; 4,6; 5,31; 6,2. ♦ Ῥώμη steht 8 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. Allerdings findet es sich im lateinischen Prolog. ♦ Der Ausdruck ἐν Ῥώμῃ steht 3 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Röm 1,7. 15; 2Tim 1,17). ♦ ἀγαπητός steht 64 / 61 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 6,13; *1Kor 1,28. ♦ Zu dem kanonischen κλητός vgl. zuvor zu 1,6. ♦ Die Wendung χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ ist bezeugt für *1Kor 1,3.
Zur Rekonstruktion: Auch wenn der Vers unbezeugt ist, spricht die alternative Lesart ἀγάπῃ θεοῦ und der Hinweis Tertullians auf die Gleichförmigkeit der Brieferöffnungen dafür, den obenstehenden Text vorkanonisch anzunehmen. Umgekehrt stützt die nur auf der kanonischen Ebene belegte alternative Lexik diesen Rekonstruktionsvorschlag.
(1,8) πρώτον / πρῶτος, das 70 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 15,46; *1Thess 4,16; *2Thess 2,3, vgl. weiter unten Vers 16. ♦ Die Kombination πρῶτον μέν steht 5 Mal im NT (2 Mal als Verseröffnung), ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. zu den Stellen 1Kor 11,18. ♦ εὐχαριστέω, das 43 / 38 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt – jedoch nicht im eucharistischen Zusammenhang – für *Ev 10,21. ♦ Die Wendung εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου steht 4 Mal im NT, davon 3 Mal als Verseröffnung, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 1Kor 1,4. ♦ Die Kombination διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ steht 14 Mal im NT, vorkanonisch weiter bezeugt für *Gal 1,1; *Röm 5,21. ♦ Zu περί vgl. zuvor zu Vers 3. ♦ πάντων, das 132 Mal im NT steht, ist vorkanonisch belegt für *Röm 12,18; *Laod 3,8; 4,6; *Kol 1,17. ♦ Die Wendung περὶ πάντων ὑμῶν steht 3 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Joh 13,18; Röm 1,8; 1Thess 1,2). ♦ πίστις, das 257 / 243 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Gal 2,16. 20; 3,11. 26; 5,6; *1Kor 12,9; *2Kor 4,13; *Röm 1,17; 5,1; *Laod 4,5. ♦ Die Formulierung ἡ πίστις ὑμῶν begegnet 7 Mal im NT, nur auf der kanonischen Ebene, vgl. 1Kor 2,5. ♦ καταγγέλλω, das 19 / 18 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Phil 1,17. 18. ♦ ὅλος, das 123 / 110 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 10,27; *Gal 5,3. 9. ♦ κόσμος steht 196 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 12,29; *Gal 4,3; 6,14; *1Kor 1,20. 21. 27; 3,19. 22; 4,9; 6,14; *Laod 2,2. 12; *Kol 1,6; 2,8. ♦ Der Ausdruck ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ steht 1 weiteres Mal auf der kanonischen Ebene in Mt 26,13.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist eine Reihe von ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegten Elementen auf (πρῶτον μέν; vorliegende Semantik von εὐχαριστέω; εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου; περὶ πάντων ὑμῶν; ἡ πίστις ὑμῶν; ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,9) μάρτυς, das 39 / 35 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *2Kor 13,1. ♦ Die Wendung μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός kehrt ohne ἐστιν wieder auf der kanonischen Ebene in Phil 1,8. ♦ λατρεύω steht 23 / 21 Mal im NT, ausschließlich für die kanonische Ebene belegt und ein typischer Begriff der kanonischen Redaktion, abzulesen etwa an der Präsenz des Begriffes spezifisch in den Teilen von Lk, die in *Ev fehlen (Mt 4,10; Lk 1,74; 2,37; 4,8. ♦ Die Wendung τῷ πνεύματί μου steht noch 1 weiteres Mal auf der kanonischen Ebene, 2Kor 2,13. ♦ Die Wendung ἐν τῷ εὐαγγελίῳ steht 7 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 1Kor 9,18. ♦ ἀδιάλειπτος steht als Adverb noch weitere 3 Male im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene in 1Thess (1,2; 2,13; 5,17), das Adjektiv steht 2 Mal, ebenfalls nur auf der kanonischen Ebene (Röm 9,2; 2Tim 1,3). ♦ μνεία findet sich 7 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene (Röm 1,9; Eph 1,16; 1Thess 1,2; 3,6; Phil 1,3; 2Tim 1,3; Phlm 1,4).
Zur Abwesenheit: Auch dieser vorkanonische Vers weist eine Fülle von ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegten Elementen auf (μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός; λατρεύω; τῷ πνεύματί μου; ἐν τῷ εὐαγγελίῳ; ἀδιάλειπτος; μνεία). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,10) πάντοτε, das sich 42 / 41 Mal im NT findet, steht ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ προσεύχομαι steht 104 / 86 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 14,13. 15. ♦ Die Wendung ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου steht 4 Mal im NT (Röm 1,10; Eph 1,16; 1Thess 1,2: hier mit ἡμῶν; Phlm 1,4), jeweils auf der kanonischen Ebene. ♦ δέομαι steht 112 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 12,12; *1Kor 15,24. ♦ Die Form δεόμενος steht 3 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Apg 10,2; 17,25; Röm 1,10). ♦ πως, das 15 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ Folglich findet sich auch die Kombination εἴ πως, die 4 Mal im NT steht, davon 2 Mal als Verseröffnung, ausschließlich auf der kanonischen Ebene (Verseröffnung: Röm 11,14; Phil 3,11; im Vers: Apg 27,12; Röm 1,10). ♦ Die Kombination ἤδη ποτέ steht noch 1 weiteres Mal auf der kanonischen Ebene, Phil 4,10. ♦ εὐοδόω steht noch drei weitere Male, ausschließlich auf der kanonischen Ebene (1Kor 16,2; 3Joh 1,2). ♦ θέλημα, das 65 / 62 Mal im NT steht, vorkanonisch bezeugt für *1Thess 4,3; *Laod 1,9. ♦ Die Form τῷ θελήματι steht noch 1 weiteres Mal auf der kanonischen Ebene in Lk 23,25. ♦ Die unscheinbare Wendung πρὸς ὑμᾶς, die 71 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 2Kor 3,1.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist eine Reihe von Elementen auf, die ausschließlich kanonisch belegt sind (πάντοτε; ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου; δεόμενος; εἴ πως; ἤδη ποτέ; εὐοδόω; τῷ θελήματι; πρὸς ὑμᾶς). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,11) ἐπιποθέω, das 9 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ ὁράω + ὑμᾶς steht 4 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Joh 16,22; Röm 1,11; Phil 1,27; Hebr 13,23). ♦ μεταδίδωμι, das 5 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ χάρισμα, das 18 / 17 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *1Kor 7,7; 12,9. ♦ πνευματικός, das 28 / 26 Mal im NT begegnet, ist vorkanonisch bezeugt für *1Kor 10,3. 4; 12,1; 14,1; 15,46; *Röm 7,14; *Laod 6,12. ♦ στηρίζω findet sich 16 / 13 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (ἐπιποθέω; ὁράω + ὑμᾶς; μεταδίδωμι; στηρίζω). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,12) Die Wendung τοῦτο δέ ἐστιν steht 3 Mal im NT, davon 2 Mal als Verseröffnung, jeweils auf der kanonischen Ebene (Verseröffnung: Joh 6,39; Röm 1,12; im Vers: 1Petr 1,25). ♦ συμπαρακαλέω ist Hapax legomenon im NT. ♦ Die Kombination τοῦτο δέ steht 32 Mal im NT, 28 Mal als Verseröffnung, immer auf der kanonischen Ebene, vgl. 2Kor 9,6. ♦ Die Wendung ἐν ὑμῖν steht 89 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ Die Wendung ἐν ἀλλήλοις steht 4 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Mk 9,50; Joh 13,35; Röm 1,12; 15,5, in einem Vers, der in *Röm fehlt). ♦ Die Form ἀλλήλοις steht 11 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene, vgl. zuvor Gal 5,13. ♦ Der Ausdruck πίστεως ὑμῶν steht 7 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene (Röm 1,12; 2Kor 10,15; Phil 2,17; Kol 2,5; 1Thess 3,2. 10; 1Petr 1,9). ♦ Die Kombination τε καί steht 51 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 1Kor 1,30.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (τοῦτο δέ ἐστιν; ἐν ὑμῖν; ἐν ἀλλήλοις; ἀλλήλοις; πίστεως ὑμῶν; τε καί). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,13) Die Wendung οὐ θέλω δέ steht noch 1 weiteres Mal, auf der kanonischen Ebene, 1Kor 10,20. ♦ Die Kombination θέλω δὲ ὑμᾶς steht 5 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. zuvor zu Vers 7,32. ♦ ἀγνοέω, das sich 23 / 22 Mal im NT findet, ist vorkanonisch bezeugt für *1Kor 10,1; 12,1. ♦ πολλάκις, das sich 19 / 18 Mal im NT findet, steht ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ προτίθημι steht nur noch weitere 2 Mal, vorkanonisch bezeugt für *Laod 1,9. ♦ Die unscheinbare Wendung πρὸς ὑμᾶς, die 71 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 2Kor 3,1. ♦ κωλύω, das 27 / 23 Mal im NT steht, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ ἄχρι, das 55 / 49 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *1Kor 15,25; *2Kor 3,14. ♦ δεῦρο steht 9 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ τινα (Nom. / Akk. Neut. oder Akk. Fem. / Mask. Sg.), das 46 Mal im NT steht, immer auf der kanonischen Ebene. ♦ καρπός steht 71 / 66 Mal im NT, vorkanonisch wohl in *Ev 6,43; 21,30. ♦ Die Form σχῶ steht 5 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 2Kor 2,3. ♦ Die Wendung ἐν ὑμῖν steht 89 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ Die Kombination καθὼς καί steht 28 Mal im NT, in Lk 24,24, in einem Vers, der in *Ev fehlt, jedoch vorkanonisch bezeugt für *Ev 11,1; *1Kor 14,21b [= 1Kor 14,34]; *1Thess 2,14; *Laod 5,25. 29; *Kol 1,6. ♦ λοιπός, das sich 60 / 55 Mal im NT findet, vorkanonisch bezeugt für *Paulus.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (οὐ θέλω δέ; θέλω δὲ ὑμᾶς; πολλάκις; πρὸς ὑμᾶς; κωλύω; δεῦρο; τινα; σχῶ; ἐν ὑμῖν). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt. Darüber hinaus zeigt die Bezeugung von προτίθημι in *Laod die Nähe dieses *Deuteropaulinums zur kanonischen Lexik.
(1,14) Ἕλλην steht 29 / 25 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Gal 2,3; *1Kor 1,22. ♦ Die Kombination τε καί steht 51 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 1Kor 1,30. ♦ βάρβαρος, das 6 Mal im NT steht, findet sich jeweils auf der kanonischen Ebene. ♦ σοφός, das 24 / 20 Mal im NT steht, vorkanonisch bezeugt für *Ev 10,21; *1Kor 1,25; 3,18. 19. ♦ ἀνόητος findet sich 6 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 24,25. ♦ ὀφειλέτης steht 7 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Gal 5,3. ♦ Die Verbform εἰμί, die 130 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 21,8.
Zur Abwesenheit: Der kurze, vorkanonisch unbezeugte Vers weist Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (2 Mal τε καί; βάρβαρος). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,15) τὸ κατά steht noch 1 weiteres Mal, auf der kanonischen Ebene, 2Kor 7,11. ♦ Die Kombination von bestimmtem Artikel + κατά im Akkusativ findet sich 49 Mal im Neuen Testament, ausschließlich auf der kanonischen Ebene (Lk 2,39, in einem Vers, der in *Ev fehlt; 8,4; 19,47, wiederum in einem Vers, der in *Ev fehlt; 14 Mal in Apg; Röm 1,15; 8,12. 28; 9,5. 11; 11,21. 24; 16,5, in einem Vers, der in *Röm fehlt; 1Kor 16,19; 2Kor 7,11; 10,7; 11,28; Gal 4,29; Eph 1,15; 4,24; 5,33; 5,6. 21; Phil 1,12; Kol 3,22; 4,7. 15; 1Tim 6,3; Tit 1,1. 9; Phlm 1,2; Hebr 11,7; Jak 3,9; 1Petr 1,3). ♦ Die Wendung κατ’ ἐμέ steht 4 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Röm 1,15; Eph 6,21; Phil 1,12; Kol 4,7). ♦ πρόθυμος steht nur noch weitere 2 Male auf der kanonischen Ebene. ♦ Zum kanonischen ἐν Ῥώμῃ vgl. zuvor zu Vers 7. ♦ εὐαγγελίζομαι, das 58 / 54 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt in *Ev 9,6; *Gal 1,9. 16; *1Kor 15,1; *Laod 2,17.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (τὸ κατά; Die Kombination von bestimmtem Artikel + κατά im Akkusativ; κατ’ ἐμέ; πρόθυμος; ἐν Ῥώμῃ). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
1,16-18: Das Evangelium – eine Kraft Gottes
Diese vorkanonische Kernpassage des Eröffnungskapitels ist gut bezeugt und nur wenig durch die kanonische Redaktion erweitert worden. Wie im Abschnitt zuvor, wird auch hier die Verbundenheit zur jüdischen Tradition durch den Hinweis auf Habakuk durch die kanonische Redaktion hergestellt.
16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ καὶ Ἕλληνι·
16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι·
17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν.
17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.
18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,
18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,
A. *1,16-17: Vgl. Tert., Adv. Marc. V 13,2: Itaque et hic, cum dicit, Non enim me pudet evangelii, virtus enim dei est in salutem omni credenti, Iudaeo et Graeco, quia iustitia dei in eo revelatur ex fide in fidem, sine dubio et evangelium et salutem iusto deo deputat, non bono, ut ita dixerim secundum haeretici distinctionem, transferenti ex fide legis in fidem evangelii, suae utique legis et sui evangelii. Vgl. Hab 2,4 LXX: ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται. ♦ *1,18: Vgl. Tert., Adv. Marc. V 13, 2-3: [2] Quoniam et (et om Harnack) iram (dei add Kroymann; om Harnack von Soden) dicit revelari de caelo super impietatem et iniustitiam hominum qui veritatem (<in> add Kroymann Harnack; om von Soden) iniustitia detineant. [3] Cuius dei ira? Utique creatoris. Ergo et veritas eius erit cuius et ira quae revelari habet in ultionem veritatis.
B. (1,16) Post εὐαγγέλιον add τοῦ Χριστοῦ in 062, 018, 020, 025, 044, 104, 630, 1175, 1241, 2464, M; om in P46, 01, 02, 03, 04, 06*.c, 012, 33, 81, 1505, 1506, 1739, 1881, lat, sy, co. ♦ εἰς σωτηρίαν om in 012. ♦ Post Ἰουδαίῳ pm τε πρῶτον in Tertullian; πρῶτον om in 03, 012, sa, Ephr, und in der altlateinischen Tradition in 77.1 ♦ (1,18) θεοῦ om in 1908.
C.
1. (1,16-17) Hilgenfeld verweist auf Tertullian als Zeugen für diese beiden Verse im obigen Zuschnitt. Außerdem bemerkt er, dass das in der kanonischen Fassung stehende Zitat von 2Kor 4,13, eine „bequeme Waffe“ gegen Markion darstellt, will aber nur das καθὼς γέγραπται als fehlend sehen, nicht aber das Zitat selbst. Dieser Logik ist nur schwer zu folgen, stellt doch der Inhalt und nicht der Verweis die eigentliche Waffe dar. Nach Zahn ist der obige Text bezeugt; was jedoch das τε πρῶτον betrifft, schwankt seine Meinung: „Ἰουδαίῳ [τε πρῶτον oder doch πρῶτον] καὶ Ελληνι“.2 Harnack gibt den obigen Text (ohne τε) als bezeugt3 und verweist darauf, dass Tertullians direkter Anschluss von Vers 18a an den obigen Text ausschließe, dass der unbezeugte Vers 17b in seiner Vorlage stand. Schmid schließt sich Harnack an, rechnet aber mit der Möglichkeit, dass auch das τε noch im Text stand. BeDuhn folgt ebenso Harnack, meint aber, dass auch das Schriftwort folgte, wenn er in Klammern in seiner Übersetzung den Text voraussetzt: [καθὼς …]. Lieu hält es für weniger gesichert, dass Hab 2,4 auch hier zu stehen kam.4
2. (1,17) Den eschatologischen Charakter des Verses hat Finamore herausgestellt.5 Der Schriftvers Hab 2,4 LXX wurde bereits *Gal 3,4 angeführt, allerdings als Hinweis darauf, dass der Gerechte aus einem Glauben leben wird, der dem Gesetz unterworfen ist, aus welchem uns Christus herausgekauft hatte. Dieser Deutung wird mit der Anführung des Verses auf der kanonischen Ebene geradezu widersprochen.6 Während auf der vorkanonischen Ebene, konsistent mit *Gal 3,4, das Evangelium als die Offenbarung und Christus als der Offenbarer gesehen wird, der aus dem Glauben in den Glauben führt, ist es auf kanonischer Ebene jetzt das Gesetz (Gal 3,4) bzw. sind es die Propheten (Hab 2,4), in Kontinuität zu welchen Christus die Gerechtigkeit offenbart und in den Glauben führt. Wilckens hat folglich den antithetischen Charakter dieses und des nächsten Verses hervorgehoben und spricht von einer „grundsätzlichen Antithese gegenüber dem Offenbarungsanspruch der Tora!“7
3. (1,18) Von Soden zeigt, dass die Emendation in unnötig ist, da iniustitia als instrumenteller Ablativ gelesen werden kann. Hilgenfeld verweist auf das Zeugnis Tertullians für diesen Vers. Zahn sieht im Text nicht Ἀποκαλύπτεται ὀργὴ θεοῦ, sondern nur ὀργή bezeugt, ebenfalls sieht er das πᾶσαν unbezeugt. Harnack folgt ihm in beidem und verweist darauf, dass nach ὀργή das θεοῦ auch in der Minuskel 47 gefehlt habe (ob dies ein Irrtum Harnacks ist, da diese Nummer eine Evangelienminuskel bezeichnet), der Genitiv fehlt hingegen in der Minuskel 1908 aus dem 11. Jh.8 Schmid klammert darum sowohl θεοῦ wie auch πᾶσαν wegen der fehlenden Bezeugung ein. BeDuhn verweist jedoch, was θεοῦ betrifft, darauf, dass Tertullian ja wenig später die Frage Cuius dei ira? stellt und leitet daraus ab, dass das θεοῦ darum im Text gestanden habe. Doch diese Frage Tertullians verrät m. E. gerade das Gegenteil. Erst das Fehlen hat die interpretierende Frage provoziert, der Begriff dürfte also tatsächlich nicht im Text gestanden sein. Zur exegetischen Frage des Zornes Gottes, allerdings ohne auf Tertullian oder Markion einzugehen, kommt Finamore zu sprechen.9 Detering gibt den Text wie oben.10
4. (1,18-2,29) Walker betrachtet Röm 1,18-2,29 als Interpolation.11
D.
(1,16) ἐπαισχύνομαι steht 11 Mal im NT, vorkanonisch in *Ev 9,26. ♦ εὐαγγέλιον, das 79 / 76 Mal im NT steht, vorkanonisch bezeugt für *Gal 1,6; 2,2. 14; *1Kor 4,15; 9,14; 15,1; *Röm 1,16; 2,16; *Laod 1,13; 6,15; *Kol 1,5; *2Thess 1,8. ♦ Die Wendung δύναμις γὰρ θεοῦ steht nur hier. ♦ σωτηρία findet sich 50 Mal im NT, vorkanonisch in *Ev 19,9; 21,13; *Röm 1,16. ♦ Die Wendung εἰς σωτηρίαν steht 12 Mal im NT, nur hier vorkanonisch nach Tertullian bezeugt. ♦ παντί, das 59 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 12,48; 19,26; *Röm 1,16; 10,4; *Kol 1,16. ♦ πιστεύω, das 265 / 243 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 1,21 (τοὺς πιστεύοντας); 15,11; *Röm 1,16 (τῷ πιστεύοντι); 10,4 (τῷ πιστεύοντι); *2Thess 2,12 (οἱ μὴ πιστεύσαντες); *Laod 1,13 (πιστεύσαντες). ♦ Ἰουδαῖος, das 250 / 195 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 4,24; *1Kor 9,20; 15,20; *Röm 1,16; 2,29; *1Thess 2,14. ♦ Vgl. zur Wendung παντὶ τῷ πιστεύοντι die Parallele Apg 13,39.12♦ Zu πρώτον / πρῶτος vgl. zuvor zu Vers 8. ♦ Die Wendung τε πρῶτον καί steht 3 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene, vgl. weiter unten Röm 2,9. ♦ Ἕλληνι steht noch 1 weiteres Mal, auf der kanonischen Ebene in Röm 2,10. ♦ Ἕλλην, das 29 / 25 Mal im NT steht, vorkanonisch bezeugt für *Gal 2,3; *1Kor 1,22, vgl. weiter oben zu Vers 14.
Zur Rekonstruktion: Der Text, weithin gestützt von der Lexik, folgt dem Zeugnis Tertullians unter Auslassung des unbezeugten τε πρῶτον, das auch lexikalisch nur für die kanonische Ebene belegt ist. Unsicher ist das εἰς σωτηρίαν, das zwar durch Tertullian bezeugt ist, jedoch in 012 fehlt und, da es weitere 11 Mal im NT nur auf der kanonischen Ebene steht, vielleicht auch im vorkanonischen Text gefehlt haben könnte. Da es jedoch nur in dem einen handschriftlichen Zeugen fehlt, wird es hier unter Anzeige der Unsicherheit im vorkanonischen Text geführt.
(1,17) δικαιοσύνη, das 97 / 92 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Röm 1,17; 3,21; 5,21; 8,10; 10,3. 4; *Phil 3,9. ♦ Die Wendung ἐν αὐτῷ (Neut.) steht 4 Mal im NT, weiter vorkanonisch bezeugt für *Laod 6,20. ♦ ἀποκαλύπτω steht 33 / 26 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Röm 1,17. 18; *2Thess 1,7, 2,3. ♦ Die Form ἀποκαλύπτεται steht 4 Mal im NT (Lk 17,30; Röm 1,17. 18; 1Kor 3,13) und ist weiter vorkanonisch bezeugt im nachfolgenden Vers 18. ♦ Die Wendung ἐκ πίστεως steht 23 Mal im NT, weiter vorkanonisch bezeugt für *Gal 3,11; *Röm 5,1; 14,23. ♦ Die Wendung εἰς πίστιν steht nur hier. ♦ Die Formulierung καθὼς γέγραπται, die 25 Mal im NT steht, davon 10 Mal als Verseröffnung, ist nur in *1Kor 1,31 mit vorangestelltem ἵνα vorkanonisch bezeugt, vgl. dort. ♦ ζάω, das 171 / 140 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 24,5; *Gal 2,20; *1Kor 9,14.
Zur Rekonstruktion: Der Text, gestützt von der Lexik, folgt dem Zeugnis Tertullians. Wie der Vergleich der Lexeme zeigt, besteht eine Übereinstimmung zwischen Bezeugung und Lexik bzw. zwischen fehlender Bezeugung und Lexik.
(1,18) ἀποκαλύπτω steht 33 / 26 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Röm 1,17. 18; *2Thess 1,7, 2,3. ♦ Die Form ἀποκαλύπτεται steht 4 Mal im NT (Lk 17,30; Röm 1,17. 18; 1Kor 3,13) und ist weiter vorkanonisch bezeugt im voranstehenden Vers 17. ♦ ὀργή steht 37 / 36 Mal im NT und ist weiter vorkanonisch bezeugt in *Laod 2,3. ♦ ἀπό, das 711 / 646 Mal im NT steht und ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Gal 1,1. 6; 4,24; *1Kor 1,3; 7,10; *2Kor 3,18; 7,1; 12,8; *Röm 1,18; *1Thess 4,3; *2Thess 1,7. 9; *Laod 3,9). ♦ οὐρανός, das 300 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Gal 1,8; *1Kor 8,5; 15,47; 5,1. 2; 12,2; *Röm 1,18; *2Thess 1,7; *Laod 1,10; *Kol 1,5; *Phil 3,20. ♦ Die Wendung ἀπ’ οὐρανοῦ steht 7 Mal im NT (Lk 17,29; 21,11; 22,43; Röm 1,18; 1Thess 4,16; 2Thess 1,7; 1Petr 1,12), in Lk 23,41, in einem Vers, der in *Ev fehlt, jedoch vorkanonisch weiter bezeugt für *Ev 21,11; *2Thess 1,7. ♦ πᾶσαν, das 53 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ ἀσέβεια findet sich nur 6 Mal im NT, nur hier vorkanonisch bezeugt. ♦ Die Wendung ἐπὶ (πᾶσαν) ἀσέβειαν steht nur hier. ♦ ἀδικία, das 27 / 25 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 16,9; *Röm 1,18; *2Thess 2,12. ♦ ἀλήθεια, das 112 / 109 Mal im NT steht, ist ein beliebter Begriff der kanonischen Redaktion, der dennoch zwei Mal vorkanonisch bezeugt ist. ♦ κατέχω, das 19 / 18 Mal im NT steht, ist vorkanonisch weiter bezeugt für *Ev 4,42.
Zur Rekonstruktion: Der Text folgt dem Zeugnis von Tertullian, gestützt von der Lexik, insbesondere fällt auf, dass das unbezeugte πᾶσαν auch sonst vorkanonisch nicht bezeugt ist, das heißt, wohl auf die kanonische Redaktion zurückgeht.
1,[19-20] 21-22 [23-32]: Inkonsequente Erkenntnis Gottes
Auch wenn die nachfolgende Passage vorkanonisch unbezeugt ist, sprechen doch der narrative Zusammenhang und die Lexik dafür, dass einige Teile dieses Abschnittes vorkanonisch vorhanden waren, auch wenn sich der genaue Wortlaut nicht mehr mit Sicherheit herstellen lässt. Die kanonische Redaktion hat hier i.W. die Konkretisierung mit Blick auf die moralischen Laster vorgenommen und den Lasterkatalog selbst deutlich erweitert.
19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους·
21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ’ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.
21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ’ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.
22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν.
22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,
23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.
24 Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 26 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, 27 ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 28 καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, 30 καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας· 32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.
A. Die Verse sind vorkanonisch unbezeugt.
B. (1,31) Post ἄστοργος add ἀσπόνδους in 012, 04, 062, 018, 020, 025, 044, (33), 81, 104, 365, 630, 1175, 1241, 1505, 1881, 2464, M, vg, sy.
C.
1. (1,19-32) Alle Editoren stimmen überein, dass diese Verse unbezeugt sind.1 Hilgenfeld notiert: „Beachtenswerth ist es, dass er [Tertullian] von hier aus sogleich zu II,2 überspringt, ohne aus dem Abschnitt I,19/31 irgend eine Waffe zu entnehmen. Dieser Umstand spricht für das Fehlen dieses Abschnitts, weil es kaum erklärlich ist, daß Tertullian sich die weitere Ausführung der göttlichen Strafgerechtigkeit in der vorchristlichen Geschichte der heidnischen Menschheit, die Anerkennung einer natürlichen Gotteserkenntnis des Menschen (V. 21. 31) u.s.w. gegen die gnostische Lehre von einem erst durch Christus geoffenbarten Gott sollte entgehen gelassen haben. Er geht ja überdieß mit dem Ausdruck ‚etiam adjiciens‘ zu C. II über, was ebenso, wie bei Gal. 3, 14 und 26, auf eine unmittelbare Verbindung hinweist“.2
Zahn rechnet dennoch mit der Präsenz der Verse in unbestimmbarer Textform. Harnack, der wiederum von der Position ausgeht, dass der Text des *Paulus von Markion redigiert und gekürzt wurde, ist der Meinung, was diese Verse betrifft, dass sie „sehr wahrscheinlich getilgt“ waren.3 Schmid hält die Verse schlicht für unbezeugt. BeDuhn verweist darauf, dass Harrison die Verse 1,19-2,1 als Interpolation betrachtet und *Röm die ursprüngliche Fassung des Briefes bewahrt hat.4 BeDuhn wendet allerdings ein, dass Tertullian in Adv. Marc. IV 25,10 rhetorisch ausführt, Markioniten und andere Häretiker behaupteten, die Heiden würden Gott von Natur aus erkennen (Atque ita Christus ignotum deum praedicavit. Hinc enim et alii haeretici fulciuntur, opponentes creatorem omnibus notum, et Israeli secundum familiaritatem et nationibus secundum naturam. Et quomodo ipse testatur nec Israeli cognitum se?). Dieser Hinweis, der verbunden ist mit Tertullians Zitat von Jes 1,8, bietet jedoch kaum einen Anhalt dafür, dass ihm die hier diskutierten Verse aus Gal 1,19-2,1 in der vorkanonischen Fassung vorgelegen waren.
Deutlicher ist die Diskussion bei Origenes. In seinem Kommentar zum Römerbrief führt er zunächst in I 18,2 den Vers Röm 1,24 an, um dann in I 18,3 zu erklären, dass „Markion und alle, die von seiner Schule wie eine Schlangenbrut herkommen, es nicht wagen, die Lösung dieser Dinge zu berühren, nicht einmal mit ihren Fingerspitzen, da sie das Alte Testament wegen solcher Themen verworfen hätten, wo immer sie auch solche Dinge darin gelesen hätten.“5 Demnach fragt Origenes nicht nur „rhetorisch, wie Markioniten mit Röm 1,24 umgegangen sind“,6 sondern er sagt ausdrücklich, dass Markion diesen Vers gemieden hatte, er also nicht in seinem Paulustext stand.
Diese Deutung wird gestützt von den Ausführungen des Origenes in seinem Werk De Oratione (XXIX 12-13, PG 11,537 B-D), in welchem er die Verse Röm 1,22-24 zitiert und dann ausführt, dass man sie denjenigen entgegenhalten und vorlesen soll, die den Schöpfergott von dem guten Gott trennen wollen. Ähnlich hält Origenes auch seinen kanonischen Text den Markioniten entgegen in De Princ. II 5.
2. (1,25) Van Manen ist die Duplikation zu Vers 23 aufgefallen: 23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας: ἀμήν. Er hält den zweiten Vers, auch mit der „unangemessenen Weise“, den „Schöpfer“ zu preisen, für das Zeugnis einer späteren Hand.7
3. (1,26-27) Diese Verse wurde bereits in der Forschung diskutiert,8 und van Manen hielt Vers 26 „überdies“ für „eine matte Wiederholung von V. 24“.9
4. (1,29-31) Diesen traditionellen Lasterkatalog sieht Weisse als Zeugnis einer späteren Hand10 und van Manen meint: „So schreibt niemand, der sich frei bewegt, sondern nur jemand, der sich an übernommene Worte gebunden glaubt. V. 29-31 ist eine anderswoher entlehnte Liste, die ursprünglich nicht zu V. 28 gehörte, sondern durch unsern Redaktor daran angeknüpft wurde“.11
5. (1,32) Als „sekundäre Glosse“ wird der Vers bezeichnet von Fitzmyer.12
D.
(1,19) διότι, das 26 / 23 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 21,28. ♦ γνωστός findet sich 17 / 15 Mal im NT, ausschließlich für die kanonische Ebene belegt, insbesondere für die Apostelgeschichte. ♦ Die Form γνωστόν steht 10 Mal im NT, davon 4 Mal als Versanfang in der Apg, außerhalb unserer Stelle hier überhaupt nur in der Apg. ♦ φανερός, das 22 / 18 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 8,17; *Gal 5,19; *Röm 2,28. ♦ Die Form φανερόν steht 6 Mal im NT, vorkanonisch wohl bezeugt für *Ev 8,17. ♦ ἐν αὐτοῖς steht 21 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 6,17 (in Abänderung formuliert die kanonische Version μετ’ αὐτῶν); *Gal 3,12. ♦ Die Wendung ὁ θεὸς γάρ steht 3 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Röm 1,19; 14,3; Phil 2,13). ♦ φανερόω, das 54 / 49 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *2Kor 2,14; 3,3; 4,10. 11; 5,10; *Röm 3,21; *Kol 3,4. ♦ αὐτοῖς (Dat. Mask. / Neut. Pl.), das 543 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Gal 3,12; *2Thess 2,11, vgl. weiter Vers 24. ♦ Die Form ἐφανέρωσεν steht 4 Mal im NT, ansonsten auf der kanonischen Ebene (Joh 2,11; 21,1; Röm 1,19; Tit 1,3).
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Wendungen auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene begegnen (γνωστός/γνωστόν; ὁ θεὸς γάρ; ἐφανέρωσεν). Der Vers scheint auf die kanonische Redaktion zurückzugehen und vorkanonisch gefehlt zu haben.
(1,20) ἀόρατος steht 5 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Kol 1,15. ♦ Zu ἀπό, das 711 / 646 Mal im NT steht, vgl. zuvor zu Vers 7. ♦ κτίσις, das 20 / 19 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *2Kor 5,17. ♦ νοέω steht 14 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ ποίημα, das 2 Mal im NT steht, findet sich vorkanonisch bezeugt für *Laod 2,10. ♦ καθοράω ist Hapax legomenon im NT. ♦ ἀΐδιος steht nur noch 1 Mal auf der kanonischen Ebene (Jud 1,6). ♦ θειότης ist Hapax legomenon. ♦ Zum Infinitiv εἶναι, der 125 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 9,33; *1Kor 10,6; *Laod 1,12; *Phil 1,23; 2,6, vgl. weiter Vers 22. ♦ Die kürzere Wendung εἰς τὸ εἶναι steht 8 Mal im NT und ist vorkanonisch bezeugt für *Laod 1,12.13 ♦ αὐτούς (Akk. Mask. Pl.), das 340 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *2Thess 2,10, vgl. weiter die Verse 24. 26. 28. ♦ ἀναπολόγητος steht noch 1 Mal auf der kanonischen Ebene (Röm 2,1).
Zur Abwesenheit: Auch dieser vorkanonisch unbezeugte Vers weist Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene begegnen (νοέω; ἀΐδιος; ἀναπολόγητος). Darüber hinaus begegnen zwei Elemente, die vorkanonisch nur für *Laod bezeugt sind (ποίημα; εἰς τὸ εἶναι) und auf die Nähe dieses *Deuteropaulinums zur kanonischen Sprache hinweist.
(1,21) Zu διότι vgl. Vers 19. ♦ γιγνώσκω, das 256 / 222 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 1,21; 2,8. 16; 3,20; 8,3; *Röm 7,7; 11,34. ♦ Die Form γνόντες steht 5 Mal im NT, unsicher vorkanonisch bezeugt für *Gal 4,9 in ähnlicher Formulierung (γνόντες θεόν), ansonsten Mk 6,38; Lk 9,11; Gal 2,9; 4,9. ♦ Die Kombination γινώσκω + τὸν θεόν steht nur hier und drei weitere Mal im Ersten Johannesbrief (1Joh 4,6. 7. 8). ♦ οὐχ, das 105 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *Röm 10,3; *Phil 1,17; 2,6. ♦ Die Wendung (οὐχ) ὡς θεόν steht nur hier. ♦ δοξάζω steht 68 / 61 Mal im NT und ist vorkanonisch bezeugt für *1Kor 6,20. ♦ Die Form ἐδόξασαν steht 4 Mal im NT, nur kanonisch belegt (Mt 9,8; 15,31; Apg 11,18; Röm 1,21). ♦ εὐχαριστέω, das 43 / 38 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt – jedoch nicht im eucharistischen Zusammenhang – für *Ev 10,21. ♦ ματαιόω, das 4 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *1Kor 3,20. ♦ διαλογισμός steht 14 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *1Kor 3,20. ♦ αὐτῶν (Gen. Fem. / Mask. / Neut. Pl.), das 502 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 3,19; 10,5. 7; *2Kor 3,15, vgl. weiter Verse 24. 26. 27. ♦ σκοτίζω steht 8 / 5 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 23,45. ♦ ἀσύνετος steht 5 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene.
Zur Rekonstruktion: Auch dieser Vers ist vorkanonisch unbezeugt; doch wie bereits die Verseröffnung andeutet und die weitere Lexik (bis auf das seltene ἀσύνετος) zeigt, kann der Vers vorkanonisch gestanden sein. Das wird durch die narrative Einbindung in den argumentativen Kontext gestärkt.
(1,22) φάσκω steht 3 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene. ♦ Die Form φάσκοντες steht nur noch 1 weiteres Mal auf der kanonischen Ebene in Apg 24,9. ♦ Zum Infinitiv εἶναι vgl. zuvor zu Vers 20. ♦ σοφός, das 24 / 20 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 10,21; *1Kor 3,18. 19. ♦ Die Wendung εἶναι σοφοί steht nur hier. ♦ μωραίνω, das 4 Mal im NT steht, ist vorkanonisch belegt für *1Kor 1,20.
Zur Rekonstruktion: Auch bei diesem vorkanonisch unbezeugten Vers fällt auf, dass selbst ein so seltenes Verb wie μωραίνω vorkanonisch bezeugt ist, auch dieser Vers scheint darum und wegen des narrativen Zusammenhangs wohl bereits vorkanonisch gestanden zu sein.
(1,23) ἀλλάσσω, das 6 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *1Kor 15,52. ♦ ἄφθαρτος, das 8 Mal im NT steht, ist vorkanonische bezeugt für *1Kor 15,52. ♦ ὁμοίωμα, das nur 6 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Röm 8,3; *Phil 2,7. ♦ φθαρτός, das 6 Mal im NT zu finden ist, steht ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ πετεινός steht 15 Mal im NT, nur für die kanonische Ebene belegt. ♦ τετράπους findet sich nur noch zwei weitere Male auf der kanonischen Ebene (Apg 10,12; 11,6). ♦ ἑρπετόν, das nur 4 Mal im NT steht, findet sich wiederum nur auf der kanonischen Ebene.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Begriffe auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (φθαρτός; τετράπους; ἑρπετόν), dann fällt die Semantik von ὁμοίωμα auf, die der kanonischen entspricht. Der Vers wird demnach auf die kanonische Redaktion zurückgehen.
(1,24) παραδίδωμι, das 134 / 119 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 5,5, vgl. weiter unten die Verse 26 und 28. ♦ Die Form παρέδωκεν steht 17 Mal im NT (3 Mal Mt, 2 Mal Mk; Lk 23,25; 2 Mal Joh; 2 Mal Apg; Röm 1,24. 26. 28; 8,23; Eph 5,2. 25; 2Petr 2,4), jeweils auf der kanonischen Ebene. ♦ ἐπιθυμία, das 40 / 38 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 22,15; *Gal 5,24; *1Thess 4,5. ♦ ἀκαθαρσία, das 11 / 10 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 5,19. ♦ ἀτιμάζω, das 7 Mal im NT steht, ist nur kanonisch belegt. ♦ Zu αὐτοῖς (Dat. Mask. / Neut. Pl.) vgl. zuvor zu Vers 19.
Zur Abwesenheit: Dieser vorkanonisch unbezeugte Vers weist einige Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (παρέδωκεν; ἀτιμάζω). Der Vers scheint eher ein Produkt der kanonischen Redaktion zu sein und vorkanonisch gefehlt zu haben.
(1,25) ὅστις, das 165 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 8,3; *Gal 2,4; 4,24. 26; 5,19; *2Thess 1,9; *Phil 3,7. ♦ Die Form οἵτινες steht 60 Mal im NT (davon 15 Mal als Verseröffnung), Lk 1,20; 9,30; 15,7 in Versen oder Versteilen, die in *Ev fehlen, vorkanonisch bezeugt für *Gal 2,4; *2Thess 1,9. ♦ μεταλλάσσω steht nur noch 1 Mal im nächsten Vers. ♦ ψευδής steht 6 / 3 Mal im NT, möglicherweise in *2Thess 2,9 vorkanonisch bezeugt, während ψεῦδος 11 / 10 Mal im NT steht und vorkanonisch bezeugt ist für *2Thess 2,9 und *Laod 4,25. ♦ σεβάζομαι ist Hapax legomenon im NT. ♦ λατρεύω steht 23 / 21 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ κτίσις, das 20 / 19 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *2Kor 5,17. ♦ παρά, das 217 / 194 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 7,37 und *Gal 1,8. 12; *1Kor 3,19; *Röm 2,13; 12,16; *2Thess 1,6. ♦ κτίζω findet sich 15 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Laod 2,10. 15; 3,9. ♦ εὐλογητός, das 8 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *2Kor 1,3. ♦ ἀμήν steht 175 / 130 Mal im NT und ist vorkanonisch bezeugt nur als Substantiv τὸ Ἀμήν für *2Kor 1,20.
Zur Abwesenheit: Auch bei diesem vorkanonisch unbezeugten Vers begegnen Elemente, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene begegnen (μεταλλάσσω; λατρεύω; nicht substantivisches ἀμήν). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,26) διὰ τοῦτο, das 59 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *2Thess 2,11. ♦ παραδίδωμι, das 134 / 119 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev und *1Kor 5,5, vgl. zuvor Vers 24, weiter unten Vers 28. ♦ Die Form παρέδωκεν steht 17 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene, vgl. zuvor zu Röm 1,24. ♦ πάθος steht nur 4 Mal im NT, ausschließlich für die kanonische Ebene belegt. ♦ ἀτιμία, das sich nur 7 Mal im NT findet, hat vorkanonisch vielleicht in *1Kor 11,14 gestanden. ♦ Die Kombination τε γάρ steht 5 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene (Röm 1,26; 7,7; 14,8; 2Kor 10,8; Hebr 2,11). ♦ θῆλυς, das nur 5 Mal im NT steht, ist nur für die kanonische Ebene belegt, vgl. der nächste Vers. ♦ μεταλλάσσω steht nur noch 1 Mal im voranstehenden Vers. ♦ φυσικός steht nur 3 Mal im NT, immer auf der kanonischen Ebene, 1 Mal im nächsten Vers und weiter in 2Petr 2,12. ♦ χρῆσις steht nur hier und im folgenden Vers. ♦ Zu παρά vgl. zuvor zu Vers 25. ♦ φύσις, das 16 / 14 Mal im NT steht, findet sich nur in der Briefliteratur und ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 4,8; *Röm 2,14; *Laod 2,3. ♦ Die Wendung παρὰ φύσιν steht noch 1 weiteres Mal auf der kanonischen Ebene, Röm 11,24.
Zur Abwesenheit: Der vorkanonisch unbezeugte Vers weist wiederum ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegte Elemente auf (παρέδωκεν; πάθος; τε γάρ; θῆλυς; φυσικός; παρὰ φύσιν). Der Vers ist ein Produkt der kanonischen Redaktion und hat vorkanonisch gefehlt.
(1,27) ὁμοίως steht 33 / 30 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ Die Kombination τε καί steht 51 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. 1Kor 1,30. ♦ ἄρσην steht 12 / 9 Mal im NT, ausschließlich für die kanonische Ebene belegt. ♦ ἀφίημι steht 22 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ Zum kanonischen φυσικός vgl. zum voranstehenden Vers 26. ♦ χρῆσις steht nur hier und im voranstehenden Vers. ♦ θῆλυς, das nur 5 Mal im NT steht, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. den voranstehenden Vers. ♦ ἐκκαίω und ὄρεξις sind Hapax legomena im NT. ♦ ἀλλήλων, das 107 / 100 Mal im NT begegnet, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 6,2; *Röm 12,10. ♦ ἀσχημοσύνη steht nur noch 1 Mal auf der kanonischen Ebene (Apk 16,15). ♦ κατεργάζομαι steht 25 / 22 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ ἀντιμισθία steht nur noch 1 Mal auf der kanonischen Ebene (2Kor 6,13). ♦ πλάνη steht 13 / 10 Mal im NT, vorkanonisch 1 Mal bezeugt für *2Thess 2,11. ♦ ἀπολαμβάνω steht 14 / 10 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *1Kor 15,38.
Zur Abwesenheit: Wie im zweiten Teil des voranstehenden Verses, begegnen in diesem vorkanonisch unbezeugten Vers eine Reihe von ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegten Elementen (ὁμοίως; τε καί; ἄρσην; ἀφίημι; φυσικός; θῆλυς; ἀσχημοσύνη; κατεργάζομαι). Der Vers dürfte demnach auf die kanonische Redaktion zurückgehen und vorkanonisch gefehlt haben.
(1,28) Die Verseröffnung καὶ καθώς steht als Kombination 12 Mal im NT, davon 6 Mal als Verseröffnung, vorkanonisch als Verseröffnung bezeugt für *Ev 6,31. ♦ δοκιμάζω, das 25 / 22 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 12,56; *1Kor 3,13. ♦ ἐπίγνωσις steht 21 / 20 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Röm 10,2. ♦ παραδίδωμι, das 134 / 119 Mal im NT steht, als Begriff auch der vorkanonischen Ebene, vgl. zuvor Verse 24, 26. ♦ Die Form παρέδωκεν steht 17 Mal im NT, jeweils auf der kanonischen Ebene, vgl. zuvor zu Röm 1,24. ♦ ἀδόκιμος, das 8 Mal im NT steht, ist nur für die kanonische Ebene belegt. ♦ νοῦς, ein Begriff, der 25 / 24 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Röm 11,34 und in gleicher Formulierung für *1Kor 2,16. ♦ Der Infinitiv ποιεῖν steht 25 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene (4 Mal Mt; Mk 2,23; 10 Mal Joh; 6 Mal Apg; Röm 1,28; 7,21; Jak 4,17). ♦ καθήκω steht nur noch 1 weiteres Mal auf der kanonischen Ebene (Apg 22,22).
Zur Abwesenheit: Dieser vorkanonisch unbezeugte Vers weist Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt sind (παρέδωκεν; ἀδόκιμος; ποιεῖν; καθήκω).
(1,29) πληρόω, das 91 / 87 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 5,3. 14; *Röm 8,4 und 13,8. ♦ πάσῃ (Dat. Fem. Sg.), das 44 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *2Thess 2,9. ♦ ἀδικία, das 27 / 25 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Ev 16,9; *Röm 1,18; *2Thess 2,12. ♦ πονηρία steht 7 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 11,39; *Laod 6,12. ♦ πλεονεξία, das 10 Mal im NT steht, ist ausschließlich auf der kanonischen Ebene belegt. ♦ κακία, das 11 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ μεστός steht 10 / 9 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ φθόνος steht 9 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Gal 5,21 und *Phil 1,15. ♦ φόνος findet sich 10 Mal im NT, vorkanonisch bezeugt für *Ev 23,19. 25. ♦ ἔρις, das 15 / 9 Mal im NT steht, ist vorkanonisch bezeugt für *Gal 5,20; *Phil 1,15. ♦ δόλος, das 11 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ κακοήθεια und ψιθυριστής sind Hapax legomena im NT.
Zur Rekonstruktion: Auch dieser Vers weist Elemente auf, die ausschließlich auf der kanonischen Ebene stehen (πλεονεξίας; κακία; μεστός; δόλος). Er wird ein Produkt der kanonischen Redaktion gewesen sein und vorkanonisch gefehlt habe.
(1,30) κατάλαλος steht 2 Mal im NT, auch das andere Mal auf der kanonischen Ebene (Jak 4,11), ebenso das verwandte Verb καταλαλέω, das 8 Mal im NT steht und so auch das Nomen καταλαλιά. ♦ θεοστυγής ist Hapax legomenon. ♦ ὑβριστής steht nur noch 1 Mal auf der kanonischen Ebene (1Tim 1,13). ♦ ὑπερήφανος steht 5 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene. ♦ ἀλαζών steht nur noch 1 Mal auf der kanonischen Ebene (2Tim 3,2). ♦ ἐφευρετής ist Hapax legomenon im NT. ♦ γονεύς, das sich 21 / 20 Mal im NT findet, ist 1 Mal vorkanonisch bezeugt für *Laod 6,1. ♦ ἀπειθής steht 7 / 6 Mal im NT, ausschließlich auf der kanonischen Ebene, auch das verwandte Nomen ἀπείθεια, das 8 / 7 Mal im NT steht, findet sich nur auf dieser Ebene, und das Verb ἀπειθέω, das sich 22 / 14 Mal im NT findet, steht etwa nur 1 Mal im Lukasevangelium, in Lk 1,17, in einem Vers, der in *Ev fehlt.
Zur Abwesenheit: Im Unterschied zu den voranstehenden vorkanonisch unbezeugten Versen, die u. a. vorkanonische Lexik aufwiesen, besticht dieser Vers mit kanonischer Lexik (κατάλαλος/καταλαλέω/καταλαλιά; ὑβριστής; ὑπερήφανος; ἀλαζών; ἀπειθής/ἀπείθεια), er wird darum wohl gänzlich auf die kanonische Redaktion zurückgehen und vorkanonisch gefehlt haben. Das in *Laod vorkanonisch bezeugte γονεύς weist auf die Nähe des *Deuteropaulinums zur kanonischen Lexik hin.
(1,31) ἀσύνετος, das 5 Mal im NT steht, findet sich ausschließlich auf der kanonischen Ebene, vgl. weiter oben zu Vers 21. ♦ ἀσύνθετος ist Hapax legomenon. ♦ ἄστοργος steht nur noch 1 Mal auf der kanonischen Ebene (2Tim 3,3). ♦ ἀνελεήμων ist wiederum Hapax legomenon. ♦ Die Variante ἀσπόνδους ist nochmals auf kanonischer Ebene zu finden (2Tim 3,3).