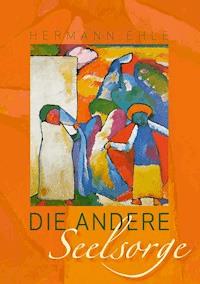
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Die Wüste weint - Sie möchte ein Garten sein". Dieses Beduinenwort kann gut unsere gegenwärtigen kirchlichen und gesellschaftlichen Befindlichkeiten in ein Bild setzen, zugleich aber auch eine Vision entwerfen und die zentrale Frage nach der Seelsorge stellen – eben einer "Anderen" Seelsorge. Wir stecken in einer unübersichtlichen Landschaft und tappen unsicheren Schritts durch wirtschaftlich, finanziell und politisch gefahrvolles Terrain. Religiös und kirchlich sind viele von uns am Verdursten. Unsere Kirchenleitungen versuchen bei den zurückgehenden Ressourcen an Personal und Finanzen in aller Eile Maßnahmen zu ergreifen, indem sie größere territoriale Seelsorgeeinheiten schaffen. Was bei all dem aber auf der Strecke bleibt, ist die Frage nach der Seelsorge. Wo bleibt der Mensch und die Menschlichkeit? Und vor allem: Wo bleibt in all dem Gott und das Evangelium Jesu?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich allen Frauen und Männern, die in ihrem Alltag Andere in „Freude und Hoffnung, in Trauer und Angst“ begleiten.
* * *
Ich danke allen, die mir im Laufe meines Lebens mit ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und mit ihrer kritischen Einrede zur Seite waren. Ich danke auch den Vielen, die in diesem Werkbuch zu Wort gekommen sind, ob ich mich noch ausdrücklich auf sie beziehen konnte oder ohne Erinnerung im Einzelnen – eine Publikation war nie geplant- mich ihrer Einsichten bedient habe.
PAPST FRANZSKUS SAGT IN SEINEM APOSTOLISCHEN SCHREIBEN VOM 24. NOVEMBER 2013 EVANGELII GAUDIUM:
"DIE FREUDE DES EVANGELIUMS erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer - und immer wieder - die Freude. In diesem Schreiben möchte ich mich an die Christgläubigen wenden, um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von dieser Freude geprägt ist, und um Wege für den Lauf der Kirche in den kommenden Jahren aufzeigen".
Am 01. August 2015 ist eine Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz erschienen GEMEINSAM GEMEINDE SEIN.
Mein Text war zu diesem Zeitpunkt fertig, sodass ich im Buch keine Verweise mehr anbringen konnte. Diese Erklärung aber deckt sich voll mit den Ansätzen in meinem Buch.
Das Bild auf der Titelseite von Wassily Kandisky (1888 – 1944)
Improvisation 6
Inhaltsverzeichnis
Kapitel VORWORT
I Die "Andere" Seelsorge
Die Felder sind reif zur Ernte
Die "Andere" Seelsorge
Die Bergpredigt
Ein Blick ins Evangelium
Der Stammtisch
Erzählen – Die kleinen Geschichten – Kontakte
Wahlverwandtschaften
Mit Jesus unterwegs
Lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast
Die Botschaft Jesu – Eine Annäherung
Laien in die Bütt
Warum habt ihr solche Angst?
Gastfreundschaft - Überraschende Gäste
Konflikte lösen
Selig die Frieden stiften
Neue Bewegungen entstehen
Leere Kirchen verkaufen
Doping
Das Gespenst des Kapitalismus
Worauf es am Ende ankommt
Drei unterschiedliche Kirchenbilder
Eine Zusammenfassung
II Eucharistie, Beichte und Gebet
Feiern
Wortgottesfeiern
Beichten – doch wie?
Du musst beten
Vater unser
Beten - doch wie - Das Reich Gottes
Der Engel des Herrn
Religion - Wie kann man das erfahren?
Ein Jahrhundertereignis - das 2. Vatikanische Konzil
Révision de vie
Wortgottesfeiern "light"
Kirche im Kleinen
Kapitel Seelsorge versteht die menschlichen Antriebe
Angst und Vertrauen
Zwei grundverschiedene Verhaltensweisen
Unsere leidigen Unterschiede - Wenn das Leben…..
Überleben - Selbsttherapie
Sexualität - Religion und Eros
Mutterschoß
Zentrum der Persönlichkeit - das SELBST
Liebe bei selbstverwirklichenden Menschen
Der Engpass
Das Gespräch
Kapitel Die soziale Gruppen- und Gemeinwesenarbeit
Eine Zeitenwende – Das 2. Vatikanische Konzil
Soziale Gruppen und Gemeinwesenarbeit
Methode einer künftigen Seelsorge - GWA
Ein Persönlichkeits-Check
Beseelen statt Befehlen
Der Franziskus Coup
Kapitel Hinführung zur Spiritualität, zur Welt der Symbole und der Kunst
Spiritualität
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Der Isenheimer Altar - Eine Therapie
Bilder und Symbole - Evangelien
Musik als Dialog zwischen Mensch und Gott
Irrlehrer – 2 Timotheus – Freiburger Münsterportal
Kapitel Der "heile" Seelsorger
Gesund werden und gesund bleiben – Salutogenese
Die Ausbildung von Kopf und Herz – Das SELBST
Meditieren – Das Leben vertiefen und weiten
Die Stärkung der Mitte – Sternennacht
Hilfe zur Selbsthilfe – Kleine Übungen…..
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
Kapitel Der gut organisierte Seelsorger
Was heute, morgen und auch weit danach zu tun ist
Täglich Anforderungen begegnen – Schmerzgrenze
Die Drei-Minuten-Regel – Endlich aufgeräumt
Baustellen bewältigen – Mind-Mapping
Der Tagesplan
Den Tag planen
Referate hören – Diskussionen folgen
Texte strukturieren – Mt 16, 21-27
Linien – Verknüpfungen entdecken – grafische Darstellung
Gremien
Sitzungen – Lust oder Frust
Der Weg durch die Wüste – Strukturieren
Sachregister
Personenregister
Schriftstellenregister
Bildnachweis
„Die Wüste weint – Sie möchte ein Garten sein“.
Die ‚Andere Seelsorge’
Bevor Sie zu lesen beginnen – ein Überblick
„Die Wüste weint – Sie möchte ein Garten sein“: Dieses Beduinenwort kann gut unsere gegenwärtigen kirchlichen und gesellschaftlichen Befindlichkeiten in ein Bild setzen, zugleich aber auch eine Vision entwerfen und die zentrale Frage nach der Seelsorge stellen – eben einer „Anderen“ Seelsorge.
Wir stecken in einer unübersichtlichen Landschaft und tappen unsicheren Schritts durch wirtschaftlich, finanziell und politisch gefahrvolles Terrain. Religiös und kirchlich sind viele von uns am Verdursten. Unsere Kirchenleitungen versuchen bei den zurückgehenden Ressourcen an Personal und Finanzen in aller Eile Maßnahmen zu ergreifen, indem sie größere territoriale Seelsorgeeinheiten schaffen.
Was bei all dem aber auf der Strecke bleibt, ist die Frage nach der Seelsorge. Wo bleibt der Mensch und die Menschlichkeit? Und vor allem: Wo bleibt in all dem Gott und das Evangelium Jesu?
Der Prophet aus Nazareth
Damit aber sind wir unversehens bei den uralten Fragen, die schon die Propheten Israels und das Evangelium – vor allem aber Jesus von Nazareth – mit Nachdruck gestellt haben.
Das allererste überlieferte Evangelium, das Markusevangelium, erzählt, wie der Prophet aus Nazareth „Seelsorge“ versucht hat – übrigens auch in einer gänzlich unübersichtlichen Situation. Wir sehen: Er fing einfach dort an, wo die Not und Ohnmacht am größten waren. Dafür hat er Leute und Freunde als Mitarbeiter gewonnen, die selber von der Not betroffen waren.
Jesus hat nicht zuerst auf Institutionen geschaut – wie interessanterweise heute auch Papst Franziskus – sondern zuallererst auf die Not der Menschen. Und die war riesengroß! Wir sehen: Jesus tritt immer dort auf, wo die Not war: Hunger, Krankheit, Verwirrung, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Tod und Schuld.
Die Not der Menschheit
Muss also nicht jede Seelsorge unter Menschen beim Dienst beginnen, den „die Not der Menschheit bestimmt, nicht unser Geschmack?“, wie es Alfred Delp im „Angesichts des Todes“ bereits 1945 formuliert hat? Wie es gerade immer wieder und mit aller Eindringlichkeit Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben EVANGELII GAUDIUM vom 24.11.2013 auf dem Hintergrund seiner lateinamerikanischen Erfahrung heraus tut. Ich selber versage mir, in diesem vorliegenden Buch im Einzelnen auf EVANGELII GAUDIUM einzugehen. Mein Buch war bereits fast fertig als ich gesehen habe, dass der Papst in die ähnliche Richtung denkt, wie ich es in meinem Buch vorschlage. Ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, dieses Apostolische Schreiben zu studieren und in die Praxis der Seelsorge einzuführen.
In allen Jahrhunderten haben viele Orden ähnlich angefangen – man denke nur an Franziskus und seine „Minderen Brüder“ oder an Ignatius von Loyola und seine Jesuiten – Beide gehören bekanntlich zu Papst Franziskus. Weltweit gibt es eine beachtliche Reihe von Initiativen und Konzepten, die zur Praxis Jesu zurückkehren wollen und in den vergangenen Jahren erfolgreich in dieser Richtung experimentiert haben: Die Christliche Arbeiterjugend, die Brüder von Taizé oder etwa gar die „ozeanische“ Theologie von Winston Halapuas, vor allem aber die Basisgemeinden in Lateinamerika, Asien und Afrika – von deren „Postkolonialen Theologie“ ganz zu schweigen.
Gerade aber gar die Methode der Sozialen Gruppen- und Gemeinwesenarbeit – wie sie in den Slums von Chicago entwickelt wurde und wie ich sie im Buch an zentraler Stelle (Seite →) präsentiere – zeigt sehr praktische Möglichkeiten auf, wie man Menschen „aus der Not der Wüste in den großen Garten“ begleiten kann.
Eine neue Art von „Bürgergesellschaft“
Wenn sich die Diözesanleitungen künftig noch stärker auf den institutionellen Rahmen – die so genannten größeren „Seelsorgeeinheiten“ – konzentrieren, wird die „Basis“ die Seelsorge wohl selber übernehmen müssen: Taufe und Firmung wird zunehmend mehr die Basis, wie dies deutlich das Zweite Vatikanische Konzil (1962 – 1965) autoritativ gelehrt hat. Und diese Basis ist überall, wo Menschen leben: Im Alltag, in der Familie, in unserer Straße, am Arbeitsplatz, im Treppenhaus, über den Gartenzaun, in der Freizeit, im Verein, beim Stammtisch, beim Einkaufen – wo auch immer. Was in der Politik und in der Soziologie als „Bürgergesellschaft“ favorisiert wird, das wird sicher auch für die Kirchen „Politik“ werden müssen. Dazu möchte ich mit meinem Buch aus langjähriger seelsorglicher Erfahrung heraus beitragen und vor allem eines erreichen: Dass das Evangelium und seine umwälzenden Einsichten im Getriebe unserer „postmodernen“ Zeit nicht dem Vergessen anheimfallen.
I. Die „Andere“ Seelsorge
In Zukunft werden in der Hauptsache Laien vor Ort die Seelsorge übernehmen müssen, weil die wenigen Priester dazu in den übergroß gewordenen Seelsorgeeinheiten allein zeitlich kaum noch in der Lage sein werden. In allen Ländern der Dritten Welt ist das schon seit jeher Alltag. Und hat nicht das Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965) – und sogar das postkonziliare Kirchenrecht von 1983 – die Getauften und Gefirmten an seinen Anfang gestellt und zur Basis der Kirche erklärt? Hier stellt sich natürlich die Frage, wie dazu Leute ohne theologische Ausbildung in der Lage sein sollen. Kommt damit die Botschaft des Evangeliums nicht ins Hintertreffen und in eine Schieflage? Doch hier sei an das Motto der Brüder von Taizé erinnert, das diese ihren jungen Besuchern aus aller Welt mit auf den Weg geben: „Lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast, und sei es noch so wenig!“
Wie kommt hier auch noch das Evangelium hinein
Im ersten Kapitel werden Beispiele für die „Andere Seelsorge“ aus dem Alltag aufgezeigt. In jeder Gemeinde findet sich spontan so viel konkreter Sinn und so viel Erfahrung für das, was vor Ort nottut, so dass nur noch die Frage bleibt: Wie kommt hier auch noch das Evangelium hinein – ein Kernanliegen übrigens von EVANGELII GAUDIUM, wie es etwa im IV. Kapitel I. „Die gemeinschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Kerygmas“ Nr. 177 ff. eindringlich herausgestellt wird.
Aus langer Erfahrung weiß ich, dass in jeder auch noch so kleinen Gruppe immer irgendjemand da ist, der eine gewisse Nähe zum Evangelium hat und unvermittelt einen „Samen“ aus dem Evangelium aus seiner Tasche ziehen und ohne Pathos in die Runde streuen kann.
Wie die Apostel sollen die Menschen mit dem Evangelium in der Hand ausschwärmen, denn „die Felder sind reif zur Ernte“ (Joh 4,35). So hat es offensichtlich Jesus selber gesehen und gänzlich ungelehrte Leute unter die Menschen geschickt, die nur das Herzen am rechten Fleck haben und ganz nahe bei den Menschen sein mussten.
Regelmäßige Bibelgespräche, andere Zusammenkünfte – selbst der Stammtisch – sind alles Gelegenheiten, wo Menschen zusammenkommen, erzählen, auf einander hören, sich in einander hineinversetzen und auf diese Weise die entscheidende „Empathie“ erleben: Kirche als Erzähl-, Aktions- und Feiergemeinschaft!
Kirchen zu verkaufen
In manchen Diözesen hat man angefangen, Kirchen zu verkaufen, in denen kein regelmäßiger Gottesdienst mehr stattfindet, weil kein Priester mehr am Ort ist. Wer kann es verantworten, wenn diese unschätzbaren Geschenke unserer Kultur- und Glaubensgeschichte einfach wegrationalisiert werden?
Immer wieder kann ich erleben, wie Menschen sich rein zufällig und nebenbei in diesen – angeblich „unnützen“ – Kirchen treffen, miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen. Was mag dabei ohne großen Aufwand an Seelsorge geschehen! Wo sonst noch gibt es diese offenen und zweckfreien Räume, wo man jenseits aller Hektik und allem Leistungsdruck einfach „da sein“, miteinander reden und still werden kann? Wo man angenommen und sich geborgen fühlen darf – eine unschätzbare Grunderfahrung von Religion? Gebäude, die in unseren Dörfern weit über andere hinausweisen und den Mittelpunkt ihrer Feste markieren.
II. Eucharistie, Beichte und Gebet in der „Anderen“ Seelsorge
„Events“
Junge Leute fahren gelegentlich nach Taizé oder zum Weltjugendtag nach Köln, Madrid oder Rio. Etwas zum Feiern muss es jedenfalls sein, ein „Event“! Die Heilige Eucharistie in unseren Gemeinden dagegen läuft bei Vielen aus der nachwachsenden Generation – und statistisch gesehen auch an 90 Prozent der Getauften – fast vollständig am Horizont vorbei. Bedeutet das nun, dass die Heilige Messe überhaupt nichts mehr zum Feiern ist, Fußballspiele und andere „Events“ aber schon? Müssen wir vielleicht erst wieder von anderen Feiern im kleinen und großen Kreis lernen – auch von den überaus sinnenfrohen Feiern der östlichen Riten, in der Mission oder gar anderer Religionen? Wir brauchen ohne jeden Zweifel eine neue religiöse Feierkultur, in der Leben und Glauben wieder ineinander greifen. War da nicht auch einmal etwas in unseren Dörfern und Städten, etwas von deren rauschenden Festen im Laufe des Jahres?
Wortgottesfeiern
Auch die oft problematisierten Wortgottesfeiern könnten – gestaltet von den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern – einen entscheidenden Beitrag zur besseren Verschränkung von Glauben und Alltag liefern. Gerade auf diesem Gebiet ist eine Öffnung der Kirche, ein „Aggiornamento“, notwendig: Glauben und Leben müssen wieder zusammenfinden. Nur ein breites Feld des engagierten Suchens und Experimentierens wird hier weiterhelfen. Genug Interessierte wären dafür da – wenn man sie nur ließe.
Beichte
Auch die Form der Beichte muss neu überdacht werden. Warum gehen so viele Menschen schier unbegreiflich mehr und von fern her zum Psychotherapeuten als zum Beichten – wie ich das hautnah in unserem kleinen Dorf erleben kann? Die Psychologie sucht die Motive der Menschen zu verstehen – darum auch in meinem Buch der breite Ansatz bei der Motivationstheorie von Abraham Maslow. Erst mit dem Nachdenken über die Motive besteht die Möglichkeit, Menschen aus ihren Fesselungen zu lösen. Was allein heilt und erlöst, ist die Zuwendung – jemand, der uns kennt und liebt, vergibt, der uns heilen will und uns einen neuen Weg aufmacht, in dem wir verstehen und verstanden werden, in dem wir wieder einander vertrauen und lieben, im Frieden leben dürfen . Überall, wo Menschen zusammenkommen und offen – nicht hinter einem trennenden Gitter und flüsternd – miteinander umgehen, kann man auch wieder „beichten“, offen und gegenseitig in einer „Versammlung des Herrn“ – „berichten“ und Heilung erfahren, vielleicht dann auch einmal wieder „amtlich und sakramental“.
Beten
Beten ist die grundlegendste Äußerung jeder Religion. Doch wie? Beten als ein Muss, als Pflicht? Wie lange habe ich das selber so gehalten – unterbrochen nur, wenn ich in der Klemme saß und Beten als einziger Ausweg offen blieb. Dahinter steht ohne Zweifel die tiefe Überzeugung, dass ein „Größerer als wir selber sind“ (Teilhard de Chardin), der die Macht hat, etwas „machen“ und auch die Not wendet kann. „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer!“ (Mt 9,13; 12,6), die immer neue Rede Jesu vom „Abba“, dem guten Vater und einem Gott voll Erbarmen und Gnade, der seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen (vgl. Mt 5,45) und der weiß, was wir brauchen (vgl. Mt. 6,32).
Beten geschieht sinnvoll und heilend nur von „Angesicht zu Angesicht“ wie es etwa die alten Psalmen tun. Der Himmel geht auf und heraus strömt eine Erfahrung von Fülle und Leben, Güte und Verstehen, Verzeihen und Gnade, Nähe und Geborgenheit. Immer wieder stehe ich mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit in den großen Hallen unserer Kirchen, vor ihren bergenden Nischen, ihren Stätten der Andacht, geborgen wie in einem „Mutterschoß“ eines liebenden, erbarmenden und „umarmenden“ Gottes.
Für diese Erfahrungen brauche ich nicht komplizierte Erläuterungen gelehrter Theologen. Diese Erfahrung wächst fast von selber aus den Bildern unserer Seele, die schon in den allerersten Begegnungen mit unserer Mutter und unserem Vater und im kleinen Kreis unserer Familie lebendig geworden sind. Wo das freilich in unserem Leben gefehlt hat, muss es über geistliche Übungen, Meditation, andere Brücken und vor allem über die Begegnung mit anderen Menschen und auch den Texten unserer großen Beter und Mystiker nachgeholt werden.
III. Gute Seelsorge versteht die menschlichen Antriebe
Die Verhaltensforschung – Konrad Lorenz, Irenäus Eibl-Eibesfeldt etwa – unterscheidet zwischen zwei grundverschiedenen Verhaltensweisen: Dem Konkurrenzkampf und der Kommunikation.
Nach den Gesetzen der Biologie ist es charakteristisch, dass der Mensch „Not“-wendig und immer „begehrt“. Aus diesem „Begehren“, diesen “Begierden“ entstehen unsere „Bedürfnisse“, unsere "Motive".
Die Bedürfnisse
Diese Bedürfnisse ordnen sich nach Abraham Maslow – einem Vertreter der Humanistischen Psychologie – gemäß einer „Hierarchie der Vormächtigkeit“ in zwei Stufen:
Die niederen Bedürfnisse: Nahrung und Fortpflanzung – Revier, Besitz und Sicherheit – und schließlich drittens Gesellung, Rang und Status.
Die höheren Bedürfnisse – die so genannte „Selbstverwirklichung“ – in den Formen von Kommunikation, Kooperation und dem unstillbaren Bedürfnissen nach Transzendenz, nach dem, was über unseren Alltag weit hinausgeht, auf Gott zu.
Die niederen Bedürfnisse sind – ganz wie die Instinkte der Tiere – für das Überleben bestimmt und bleiben stark und resistent: „Vormächtig“. Sie werden immer als egoistisch und feindlich erlebt, als gierig und böse – „agonal“ – und bedürfen deshalb der Humanisierung, wenn sie nicht in permanenten Kampf und in Streit ausarten sollen. Kooperation hingegen – das „affiliative“ Verhalten, vom lateinischen, filius/filia“, Sohn oder Tochter – öffnet das Tor zum Miteinander, zum gegenseitigen Beistand, zur „Familialität“, zum Vertrauen, zu Mitleid, Kommunikation, Kooperation und Liebe.
Die höheren Bedürfnisse setzten die Befriedigung der niederen voraus. Anders können sie sich gar nicht zeigen. Aus diesem Grund muss es vorrangige Aufgabe eines jeden Einzelnen, jedes Staates und jeder Politik sein, diese Grundbedürfnisse sicherzustellen -deren Hauptaufgabe! Erst dann kann der Mensch beginnen, sich gesund zu entwickeln, sein „Ich“ und sein befreiendes „SELBST“ auszubilden und zur „Humanisierung“ und zur vollen „Menschwerdung“ vorzudringen. Das ist vor allem die Öffnung zur Welt des Geistigen, in die der „niedere“ Mensch integriert, geheilt und zu einem „höheren“ Menschen – „vollkommen, wie der Vater im Himmel“ (Mt 5,48) – werden kann.
Das Evangelium
Wenn man das Evangelium auf den zentralen Punkt bringt, dann wird deutlich, dass Jesus mit seiner Botschaft und seinem Verhalten alternativlos auf diese „affiliative“ Seite der menschlichen Natur gesetzt hat. Warum sollte es also nicht möglich sein, unsere Mitmenschen nicht mehr in allerlei feindselige Kategorien zu zerteilen: In Linke und Rechte, in Progressive und Konservative, in Inländer und Ausländer, in Gute und Böse. Ein Traum Jesu und der Propheten Israels würde sich erfüllen. Eine neue Welt könnte entstehen, in der niemand mehr vergessen, auf die Seite gedrängt oder gar verfolgt und getötet wird, und auf diese Weise voll in seiner schöpferischen Individualität bestehen bleiben kann. Würde nicht genau hier die Problem-„Löser“ der alltäglichen Basis liegen, wie sie der Pastoraltheologe Matthias Sellmann vorschlägt: „Immer mehr Firmen, Verwaltungen oder Vereine nutzen das Wissen der Nicht-Experten von außen für die Lösung bestimmter interner Probleme“ – "interaktive Wertschöpfung" wird das genannt. (Herderkorrespondenz 3/2014 auf Seite 138 ff.)
Die Sexualität
Einen grundlegenden Gegensatz gibt es allerdings: den von Mann und Frau. Kein Weg führt an der Erkenntnis vorbei, dass wir bis in die Knochen von der Sexualität bestimmt sind. Diese Sexualität aber entfaltet sich auch nach den Stufen der Bedürfnisskala von Abraham Maslow. Wer hier auf den „vormächtigen“ Bedürfnissen stehen bleibt, dessen Sexualität wird notwendig räuberisch, besitzergreifend und herrisch und gar – weit zurückgeblieben – pädophil. Erst auf der Stufe der höheren Bedürfnisse taucht eine neue und heilsame Qualität auf: Die kognitiven Bedürfnisse von Neugier, Lernen, Einsicht, Wissen, Verstehen. Erst hier kann die Sexualität als kommunikativ, kooperativ und schöpferisch erfahren werden. Erst auf dieser letzten Stufe entfaltet sich die Sexualität zuinnerst als geistig, spirituell und mystisch – ein Segen für die gesamte Gesellschaft, für Religion und Kirche und vor allem für den Einzelnen selbst. Nur hier lässt sich auch der Zölibat diskutieren und – negativ gewendet – jeder Missbrauch verstehen. Erst hier kann sich das ICH als Menschlichkeit und aus einer tiefen Geborgenheit in einem "Größeren als wir selber sind" (Teilhard de Chardin) entfalten.
Erst hier kann eine innere Reifung und Ganzwerdung – ein Prozess der Individuation (C. G. Jung) – stattfinden und der Weg zum „SELBST“ aufgetan werden. Erst dieser Weg kann uns psychisch und religiös weit machen wie Jesus und uns selbst zu einem Christen werden lassen – wie es schon die Kirchenväter gezeichnet haben. War diese Form von „Humanisierung“ des Einzelnen und der menschlichen Gesellschaft nicht ein Hauptanliegen Jesu und seines Evangeliums?
Das alles bleibt – aus den genannten Gründen – eine durchgängige Aufgabe der Seelsorge, diesen "Individuationsprozess" zu ermöglichen, zu begleiten und den Menschen zum Dialog, zur Sozial-, Gesprächs- und religiösen Kompetenz fähig zu machen. Doch wo bleiben jetzt die Probleme mit dem Leid, dem Kreuz und vor allem dem Tod? Gerade auf diese Fragen muss unausweichlich eine Antwort gegeben werden. Doch wie?
V. Die soziale Gruppen- und Gemeinwesenarbeit
Die soziale Gruppen- und Gemeinwesenarbeit (GWA) hat ihren Ursprung in den Slums von Chicago und wurde von Professor Richard Hauser und seiner Frau Hephziba in London wissenschaftlich bearbeitet. Ich habe diese Methode 1970 in Ottawa während einer Weltkonferenz der Internationalen Landjugendbewegung (MIJARC) kennen ge-lernt und danach zusammen mit unseren Freunden aus der Katholischen Landjugendbe-wegung Deutschlands und Mitarbeitern von Richard Hauser in unsere Bewegung einzu-führen versucht. Bereits in Ottawa ist uns klar geworden, dass damit für die Not-Gebiete jeder Art auf dieser Erde ein Weg von unten her aus Krisen und Verwerfungen aufge-zeigt war.
Sehen – Urteilen – Handeln
Unserer CAJ- und KLJB-Methode des „Sehen – Urteilen – Handeln“ kam dieser An-satz passgenau entgegen, ganz besonders aber auch dem Prinzip der Katholischen Sozi-allehre von der „Subsidiarität“, der Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, der Eigenverantwortung jedes Einzelnen und jeder kleinen Gruppe von unten her. Nach dieser Lehre der Subsidiarität übernimmt die Basis einer Gesellschaft ihre Aufgaben und Problemlösungen zu allererst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahr – soweit das irgendwie möglich ist. Erst dann, wenn das alles von „Unten“ her nicht mehr zu schaffen ist, muss die „Obere“ Ebene tätig werden. Subsidiarität kann – so gesehen – der Weg aus vielen gegenwärtigen Krisen unserer Gesellschaft hierzulande, in der Kirche, in der “Dritten“ Welt und gerade auch bei uns selber sein.
Zusammen mit den Betroffenen
Die Gemeinwesenarbeit funktioniert nur – und darauf hat von Anfang an schon der Begründer der Christlichen Arbeiterjugend, Joseph Cardijn (1882-1967) bei seiner Seelsorge an jungen und kirchenfernen Industriearbeitern in Belgien hingewiesen: In Gemeinschaft und zusammen mit den Betroffenen! Auch Jesus ist vor 2000 Jahren in dem glaubensfernen, wirtschaftlich, sozial, politisch und menschlich armseligen Galiläa genau diesen Weg gegangen. „Beseelen statt befehlen“ – mit dieser Devise haben zwei Priester der französischen Arbeiterjugendbewegung JOC ihre Erfahrungen mit ihren „Arbeitsgemeinschaften“ in einem kleinen Buch dargelegt (3. Auflage 1963): „Beseelen statt befehlen“. So muss die Seelsorge heute und vor allem in der nächsten Zukunft lauten. Unsere Gemeindereferenten hätten damit eine entscheidende Rolle nicht zuerst in der Rolle des Institutionsführers, in der Vermittlung dogmatischer, liturgischer und kircheninstitutioneller Inhalte, sondern ähnlich wie die sogenannten „Gemeinwesenarbeiter“ und geistigen Einflussführer durch das Begleiten sozialer und religiöser Prozesse.
Kapitel V – VII: Die Welt der Spiritualität, der Symbole und der Kunst – Der heile Seelsorger als Hilfe zur Selbsthilfe bei Stress und Erschöpfung – Der gut organisierte Seelsorger
Praktische Hilfen für den Alltag der Seelsorge
In den letzten drei Kapiteln unseres Buches werden vor allem praktische Hilfen für den Alltag der Seelsorge vorgestellt. Wer das Heil aus dem Geist des Evangeliums vermitteln will, muss selbst „heil“ sein. Heil im Hebräischen aber heißt heil ‚ganz’ und im Lateinischen ‚salus’. „Salvator“ nennt die Kirche Jesus, den Propheten und „Heiland“ aus Nazareth. Deshalb gilt es zuerst, die Bedingungen für eine gesunde innere Entwicklung im eigenen Leben herzustellen - zum Beispiel mit kleinen, in den Alltag eingebauten Übungen, meditativen und gar auch Körperübungen oder auch kleinen Kneipp-Anwendungen und allem, was einfach durchzuführen ist und nicht viel Zeit kostet, sich in der Wirkung aber als erstaunlich hilfreich erweist. Meine Erfahrung: Wer auf derartige im Alltag verankerte leibseelische Anwendungen verzichtet, tut sich fortschreitend schwer, seine Mitte zu finden.
Stärkung der Mitte
Die „Stärkung der Mitte“ ist der erste Schritt nicht nur in jeder Psychotherapie, sondern auch in jeder individuellen Entwicklung. Dieser Weg beginnt mit der Ausbildung eines reichen inneren Lebens, mit der Pflege des Erlebens von Natur, Kunst und Kultur. Hinzu kommt die bewusste Wahl der Augenblicke einer ruhigen Innenschau. Die Fähigkeit, sich Momente der inneren Ruhe zu verschaffen, die Unbefangenheit gegenüber anderen Menschen und die Toleranz gegenüber anderen Auffassungen sind positive Kräfte, die wir auf diesem Weg auf erstaunliche Weise ausbilden können. Meditation, leibseelische Verfasstheit – „HARA“ von Professor Dürckheim gar etwa – und eine ganze Reihe von alltäglichen Übungen und das alles ohne vertrackte „Esoterik“ helfen auf dem Weg zur Mitte und vor allem auch zu Gott.
Ordnung und Struktur in der andrängenden Flut von Informationen und Aufgaben
Der gute Seelsorger sollte auch in der Lage sein, Ordnung und Struktur in die alltäglich andrängende Flut von Informationen und Aufgaben zu bringen. Jeder, der das Ordnen und Strukturieren seiner Gedanken, Abläufe, Materialien und Aufgaben gelernt hat, gewinnt die notwendige Souveränität auch in anderen Lebenslagen. Unterschätzen Sie das Ganze nicht! Ihre Umgebung – und sicher auch Sie selber – werden es Ihnen danken.
Quadrat, Kreis und Dreieck
Am Beispiel einer Mind-Map etwa zeige ich, wie man mit Hilfe von Visualisierungen sich einen Durchblick durch seine Situation verschaffen, Prioritäten setzen und gleichzeitig verinnerlichen kann. Im meinem Buch verwende ich zur Veran „schau“lichung neben Bildern aus der Kunstgeschichte, in der Hauptsache immer wieder drei grafische Figuren mit allen ihren Varianten: Das Quadrat, den Kreis und das Dreieck. Diese drei sind mit der „Synästhesie“ von Form-Farbe-Musik (Wassily Kandinsky, dem Begründer der abstrakten Malerei) unübersehbar in den Vordergrund gerückt. Nehmen Sie zusätzlich dazu auch noch die Archetypenlehre von C. G. Jung.
Mit Hilfe dieser Dreiheit von Quadrat, Kreis und Dreieck lassen sich mit wenigen Symbolen komplexe Inhalte veranschaulichen, übersichtlich darstellen und als Methode zur Strukturierung von Ideen und Texten verwenden. Voll zur Wirkung kommen diese Symbole aber erst bei der sogenannten „Sprechzeichnung“. Diese Methode habe ich 1957 während meiner religionspädagogischen Ausbildung von Professor Bruno Dreher/Bonn kennengelernt. Sprechzeichnen bedeutet, mit Hilfe einer großflächigen Schreibtafel/Flip-Chart während eines Vortrages Strichgrafiken gleichzeitig sprechend und zeichnend zu präsentieren. Aus vielem Unterrichten und Vorträgen weiß ich, welche Faszination von diesem Livesprechzeichnen ausgehen kann. Diese Methode führt in ihrer Wirkung weit über die reine Verstandesebene und die Buchstabenschrift hinaus. Sie nimmt den Zuschauer mit auf eine meditativ-schöpferische Reise und erschließt ihm überraschende Zusammenhänge und Einsichten. Aus diesem Grund habe ich im vorliegenden Buch zu meinen textlichen Darlegungen auf der linken Seite immer wieder auf der rechten Seite zusätzlich Bilder und Strichgraphiken angeboten und oft gar noch - gemäß der „Synästhesie“ von Wassily Kandisky - mit Farben versehen. Versuchen Sie es! Lassen Sie sich auch nicht durch manche Wiederholungen stören, vor allem aber auch nicht durch meinen ständigen Rekurs auf die Motivationstheorie von Abraham Maslow. Diese Theorie ist für mich im Lauf der Jahre grundlegend und ungemein hilfreich zur Interpretation von Phänomen geworden. In meinen Darlegungen erleben Sie auch etwas von der „coherence“ der „Salutogenese“ von Aaron Antonovsky: Alle Erscheinungen hängen im Innersten miteinander zusammen. Vergessen Sie nie: Unsere Altvorderen haben - weit weg von der Buchstabenschrift - schon in den steinzeitlichen Höhlen ihre Vorstellungen in Bilder gefasst und auch die Architekten ihre Pläne immer schon in ihre technischen Zeichnungen.
Zur Form des Buches
Entdecken Sie immer wieder, wie Bildung mit „Bild“ zusammenhängt. Sagen wir doch: „Ich muss mir ein „Bild machen“. NB: Ich habe während meiner wissenschaftlichen Ausbildung drei Semester Kunst- und Kulturgeschichte im Nebenfach studiert.
Die Form meines Buches – links der Text, rechts das Bild – soll es nebenbei ermöglichen, mit dem Lesen an jeder Stelle des Buches anzufangen. Jeder soll sich das aussuchen können, was ihm im Augenblick wichtig ist. Er muss nicht thematisch geordnet lesen und braucht auch keine großen wissenschaftlichen Vorkenntnisse mitbringen. Über einen wachen Verstand und ein Lexikon – auch Wikipedia oder Google etc. – lassen sich selbst sperrige Begriffe nachlesen. Über diese Form meines Buches können Sie im Übrigen auch Sitzungen, pastorale Runden und Referate vorbereiten und abhalten.
Meine grafischen Darstellungen helfen Ihnen - das sei noch einmal eigens herausgestellt - sich selber als Wanderer in ganz neue Welten hinein zu erfahren, Wanderer/Pioniere statt Siedler! Hat nicht auch Jesus stets in Bildern und Gleichnissen zu den Menschen gesprochen? Hat nicht die Kirche des Mittelalters fortwährend mit der „biblia pauperum“- der „Bibel der Armen“ - gearbeitet, wie sie es in ungezählten Kirchen eindrucksvolle Fresken dartut.
Die Zielgruppe
Zielgruppe sind neben den professionellen Seelsorgern – Pfarrer, Gemeindereferenten und Personen mit theologischer Ausbildung – in erster Linie die „Alltagsseelsorger“ (Doris Nauer), die vielen Menschen ohne formale kirchliche Beauftragung, ohne Amt und Bezahlung, „Laien“ als die „Anderen" Seelsorger in der eigenen Familie, in der Kneipe, am Arbeitsplatz und wo auch immer. Alle sind angesprochen, die im Alltag anderen Menschen zur Seite stehen und sich der Sorgen, Nöte, Freuden und Leiden der Menschen um sich herum annehmen: Die sogenannten Ehrenamtlichen neben den professionell bestellten Hauptamtlichen.
Zu meiner Person
Wichtig zum Verständnis meiner „Anderen Seelsorge“ ist meine Biographie. Ich habe mein gesamtes theologisches und philosophisches Studium und meine Priesterweihe unter den strengen Vorgaben Pius XII. und seiner Sicht der Kirche als einer „acies ordinata“ - einer geordnete Schlachtreihe - durchschritten und aus Überzeugung gelebt. Ich habe als Kaplan im ersten Jahr meines pastoralen Dienstes (in einer 12.000 Seelen großen Augsburger Pfarrei) das erste Auftreten des neugewählten Johannes XXIII. „live“ am Fernseher meines Chefs miterlebt. Ich habe seine überraschenden „Ausritte“ und seine unbekümmerte Amtsführung verfolgt. Ich habe sein noch überraschenderes 2. Vatikanisches Konzil in allen Phasen mit seinem „Aggiornamento“ und viele damit verbundenen Befreiungen von angstbesessenen Fesselungen hautnah erfahren. Ich habe in unterschiedlichen pastoralen Feldern gearbeitet. Ich habe - und das war für mich am meisten prägend - fünf Jahre lang die Stelle des Bundeskuraten der Katholischen Landjugend Deutschlands innegehabt, alle deutschen Diözesen und unsere europäischen Mitgliedsbewegungen in vielen Besprechungen und Konferenzen bis in die Weltebene hinein „live“ kennengelernt. Roman Bleistein SJ. - der führende Jugendpädagogiker damals - hat genau diese Jahre der Gesellschaftsrevolte von 1968 bis 1973 als die schwierigsten Jahre der Jugendseelsorge bezeichnet. Ich war in der neu aufkommenden Demokratiebewegung vom allzuständigen Beauftragten der Bischofskonferenz für die katholische Landjugend zu einem von 12 stimmberechtigten Mitgliedern eines Bundesverbandes geworden, die seinerseits mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein agiert haben. Das alles ist seit 1973 in meine Zeit als Pfarrseelsorger und Dekan und - jetzt - in meine reflektierende Rückschau als lange gedienter Seelsorger eingeflossen. Das alles ist - ich bin als Pensionist immer pastoral noch voll aktiv - der Boden, auf dem ich bis heute mitten in einer Dorfpfarrei und einer kleinstädtischen Pfarreiengemeinschaft lebe.





























