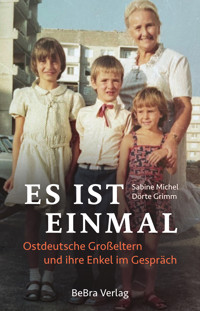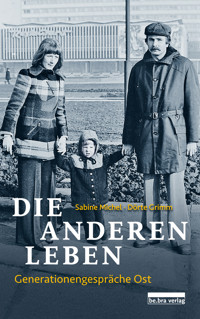
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wenn der Staat DDR kritisiert wird, fühlen sich oft auch die Menschen kritisiert, die in ihm gelebt haben. Das macht Gespräche innerhalb von Familien über ihr Leben in der DDR so schwierig. Viele schweigen bis heute, doch in ihrem Schweigen wächst die Wut.Auf Initiative der Filmemacherinnen Sabine Michel und Dörte Grimm wagen Kinder und Eltern aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen erstmals eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Diese Gespräche ermutigen, neu und ohne Vorwürfe miteinander ins Gespräch zu kommen. Zugleich helfen sie, aktuelle politische Entwicklungen in Ostdeutschland anders und besser zu verstehen, in dem sie den Blick öffnen für die Spätfolgen des Lebens in insgesamt drei politischen Systemen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Michel / Dörte Grimm
Die anderen Leben
Generationengespräche OST
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos,
in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
ebook im be.bra verlag, 2020
© der Originalausgabe:
be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2020
KulturBrauerei Haus 2
Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin
Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin
Umschlag: typegerecht berlin (Titelfoto: © Sabine Michel)
Fotografien im Innenteil: © Ute Mahler / OSTKREUZ, aus der Serie »Zusammenleben«
ISBN 978-3-8393-0150-0 (epub)
ISBN 978-3-89809-179-4 (print)
»Dies ist ein Buch, dem jeder sich selbst hinzufügt.Beim Lesen schon beginnt die Selbstbefragung.«
Christa Wolf
im Vorwort zu »Guten Morgen, du Schöne« von Maxie Wander
Inhalt
Vorwort
»Du lernst, nicht weiter nachzubohren«Annett und Klaus-Dieter
»Der Druck wird immer größer, immer Jagd, immer präsent sein« Michael und Gerd
»Ich wollte, dass du ein glückliches Kind bist« Anja und Ingrid
»Ich hatte dann noch einige Männer«Sandra und Annegret
»Ich fühle mich nicht wie ein Nazi«Simon, Dirk und Josephine
»Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen«Mara und Dietmar
»Ich war schon sehr kritisch durch meine Mutter«Katrin und Brigitte
»Ich bin in diesem Land nicht zu Hause«Mirko und Herbert
»Dass sie einfach mal sagt, das hast du aber gut gemacht«Kristina und Sibille
»In unserer Generation ist das nicht das Gefühl«Susann und Monika
Zu den Fotografien von Ute Mahler
Glossar
Dank
Die Autorinnen
Unseren Kindern, die uns Fragen stellen werden.
Sabine Michel & Dörte Grimm
Vorwort
Seit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung stehen Menschen mit ostdeutschen Biografien vor den Herausforderungen einer gesamtdeutschen Gegenwart, die in ihrem identitätsstiftenden Selbstverständnis noch immer zu begreifen ist.
Mit der rasanten Installation westdeutscher Strukturen nach 1990 ist die Auseinandersetzung mit der Zeit des Lebens in der DDR sowohl gesellschaftlich als auch innerhalb der Familien weitgehend ausgeblieben. Wenn es Auseinandersetzungen mit der DDR-Vergangenheit gab, dann oft aus westdeutscher Sicht, die viele Ostdeutsche nicht als die ihre empfanden und in der ihr Anderssein meist als minderwertig und selbst verschuldet behandelt wurde. Dass die Zeit nach 1989 nicht nur Öffnung und viele Möglichkeiten, sondern auch massive persönliche Einschnitte für jeden Einzelnen bedeutete, fand lange kaum Eingang in die gesamtdeutsche Erzählung.
Im »Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit« heißt es 2019, dass sich über die Hälfte der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse fühlen. Die letzte Bundestagswahl hat auch im Osten des Landes schockierende Wahlergebnisse hervorgebracht. Die demokratischen Strukturen der Bundesrepublik werden von einem erheblichen Teil der Bevölkerung als hohl empfunden und eine fremdenfeindliche, nationalistische Partei feiert Erfolge. Aus Sicht des Westens sollte die Wende 1989 den Osten in die westliche Wertegemeinschaft integrieren. Droht das zu scheitern? Im Osten haben sich das Erbe zweier Diktaturen und die Kränkung der Nachwendejahre in einem Teil der Gesellschaft zu einer demokratieskeptischen Haltung vermischt, die sich nun gegen den nächst »Schwächeren«, die Geflüchteten, das »Fremde« entlädt. Fragen nach dem Warum und Woher werden lauter und dringender. Wir brauchen generationenübergreifende, ehrliche Gespräche, die an die »DNA« Ostdeutschlands herangehen, in deren Diversität sich jede und jeder wiederfinden kann und die mit Schlagwörtern wie Stasi, Unrechtsstaat, Täter und Opfer nicht zu fassen sind.
In einer Szene ihres Dokumentarfilms »Zonenmädchen«, der ihren und den Werdegang ihrer Schulfreundinnen vor und nach dem Mauerfall skizziert, sitzt Sabine Michel mit ihrer Mutter an einem Tisch. »Nicht mal mir hast du erzählt, dass dein Vater Nazi war«, sagt sie zur Mutter. Die antwortet: »Wie willst du denn dann dastehen! (…) Hat eben auch fest gemacht. Hat eben auch härter gemacht. Ich war ein überängstliches Kind und ich wollte so sein wie die anderen.«
Diese Antwort ist ein exemplarischer Ausdruck der DDR-spezifischen Vereinnahmung des Privatlebens. Michels Eltern sind in der DDR mit ihren antifaschistischen und internationalistischen Idealen sozialisiert worden, haben die Wende als Lehrer durch- und überlebt und sind seit nunmehr dreißig Jahren offiziell Bundesbürger. Sie haben ihre Tochter liebevoll und ganz im Sinne der familiarisierten Struktur des sozialistischen Staates erzogen. Eine Auseinandersetzung mit ihrem Leben in der DDR hat bis heute nicht stattgefunden. Eine Kommunikation der Tochter mit ihren Eltern über den wirklichen DDR-Alltag als Fortwirken und ständige Neukonsolidierung autoritärer hierarchischer Strukturen mit wenig Toleranz gegenüber Veränderungen oder Neuerungen, über einen Antifaschismus als Teil der DDR-Staatsideologie und damit als Loyalitätsfalle und über den Versuch des Einzelnen, sich damit irgendwie zu arrangieren, ist immer noch schwer. Diese Filmszene war für Sabine Michel der Beginn der Auseinandersetzung mit der generationenübergreifenden andauernden Sprachlosigkeit in Ostdeutschland.
Dörte Grimm hat an der Seite ihrer Mutter in den Neunzigerjahren den Niedergang und Abbau eines großen Textilbetriebes miterlebt. Der Obertrikotagenbetrieb »Ernst Lück« in Wittstock ist durch die Dokumentarfilme von Volker Koepp bekannt geworden. Hier haben einmal 2 800 Menschen gearbeitet; 1992 wurde der Betrieb eingestellt. Dörte Grimms Mutter musste damals als Produktionsleiterin mehrere Hundert Arbeiterinnen und Arbeiter kündigen. Sie tat es, gegen ihre Überzeugung, und wurde dafür von ihren ehemaligen Kollegen und Kolleginnen angegriffen. Am Ende verlor sie selbst ihre Arbeit. Dieser doppelte Schmerz wirkt bis ins Heute; Kommunikation darüber ist emotional und schwierig. Als 2018 anlässlich des fünfzigsten Betriebsjubiläums das Wittstocker Museum die Türen zu einer Ausstellung öffnete, stellte man fest, dass das betriebseigene Archiv verschwunden war. Von fünfzig Jahren Betriebsgeschichte blieb kaum etwas; nichts, worauf man stolz verweisen, den Kindern erzählen konnte.
Dörte Grimm war zwischen 2016 und 2018 Vorsitzende des Vorstands der »Perspektive hoch drei«. So nennt sich eine Gruppe jüngerer Ostdeutscher der »Dritten Generation Ostdeutschland«, die sich vor zehn Jahren zusammentaten, als sie merkten, dass der Diskurs über Ostdeutschland medial und gesellschaftlich fast ausschließlich von Westdeutschen geführt wurde. Das wollten sie ändern, um Erfahrungen und Wissen von und über diese Generation in der gesamtdeutschen Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Dörte Grimm drehte über Vertreter ihrer eigenen Generation einen Dokumentarfilm: »Die Unberatenen. Ein Wendekinderporträt«. Als sie den Film, in dem auch persönliche Archivaufnahmen ihrer Kindheit zu sehen sind, ihren Eltern zeigte, verließen beide wortlos das Zimmer. Auch hier: Gefühlsstau.
Wenn der Staat DDR kritisiert wird, fühlen sich oft auch die Menschen kritisiert, die in ihm gelebt haben. Das macht Gespräche, auch innerhalb von Familien, über ihr Leben in der DDR so schwierig. Wenige Fragende nehmen eine Differenzierung zwischen Staatsform und alltäglichem Leben vor, aber auch nur wenigen Antwortenden gelingt es, eine Distanz zwischen eigenem Leben und dem Land, in dem sie gelebt haben, herzustellen.
In diesem Buch dokumentieren wir zehn Dialoggespräche zwischen ehemaligen »Wendekindern« – den zwischen 1970 und 1985 in der DDR Geborenen – und ihren Eltern. In ihnen kommen Menschen zu Wort, die von bis zu drei deutschen Staats- und Gesellschaftsformen geprägt wurden. Sie tauschen sich mit ihren Kindern aus und beginnen so auf ganz individueller Ebene eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Wohl wissend, dass es das Wendekind und die Eltern nicht gibt, haben wir Familien aus möglichst unterschiedlichen politischen, beruflichen und sozialen Schichten der DDR und heute der BRD ausgewählt – Familien aus Staats- und Kirchennähe sowie in verschiedenen Familienkonstellationen: eine alleinerziehende Lehrerin, die Mitglied der SED war; ein damals parteiloser LPG-Mitarbeiter; ein ehemaliger Major des Ministeriums für Staatssicherheit, heute erfolgreicher Mitarbeiter einer Bonitätsprüfstelle; eine Verwaltungsmitarbeiterin aus oppositionellen kirchlichen Kreisen; eine gelernte Löterin, die heute als Gebäudereinigungskraft arbeitet; eine Psychologin; eine Immobilienverwalterin, die SED-Mitglied war und sich heute »Reichsbürgerin« nennt – im Gespräch mit ihren Kindern, die Taxifahrer und Soldat der Bundeswehr sind; Kinder, die lange im Ausland lebten; Kinder, die den elterlichen Betrieb übernahmen; Kinder, die sehr erfolgreich alle Chancen für sich zu nutzen wussten; Kinder, die heute noch in Umschulungen stecken, und Kinder, die nicht mehr mit ihren Eltern reden können. Der Anspruch auf eine wie auch immer geartete »Vollständigkeit« wird nicht erhoben.
Insgesamt gestaltete es sich nicht einfach für uns, Familien zu finden, die miteinander ins Gespräch kommen wollten. Theoretisch wussten wir um die Hürden aus unseren eigenen Familien, doch wie schwer es tatsächlich fast allen fallen würde, sich zu erinnern und über diese Erinnerungen zu reden, ohne zu streiten, hat uns sehr berührt. Deshalb haben wir uns für eine Anonymisierung der Gesprächspartnerinnen und -partner in diesem Buch entschieden. Sie tragen hier andere Namen als im Leben. Wir haben überzeugt und ermutigt, waren aber auch immer wieder mit Absagen konfrontiert, manchmal erst kurz vor dem Gespräch. So dauerte es länger, als wir dachten, bis wir die zehn Gespräche geführt hatten. Sie fanden in allen Teilen Deutschlands statt. Was fast alle Familien miteinander verbindet, ist, dass diese Art von Dialog über ihre Vergangenheit zuvor noch nie stattgefunden hatte.
In der öffentlichen Nachwende-Auseinandersetzung erhielt der Osten lange Zeit ein einseitiges Image, das die negativen Folgen des Umbruchs in den Mittelpunkt stellte. Wendekinder erlebten, dass der gesellschaftliche Diskurs über ihre Eltern vor allem negativ belegt war und ist. Ostdeutsche galten und gelten oft immer noch als Jammerossis, schlimmstenfalls wurden sie als SED-Hörige oder Stasispitzel verunglimpft. Darüber zu reden schien lange die Scham über eigene Verfehlungen und die erlebten Ungerechtigkeiten zu vertiefen. Die Familien schweigen oft bis heute, doch in ihrem Schweigen wächst die Wut. Exemplarisch dafür untersuchte Sabine Michel für ihren Dokumentarfilm »Montags in Dresden« Biografien im Epizentrum der seit 2014 stattfindenden Pegida-Demonstrationen.
Obwohl wir beide Filmregisseurinnen sind, haben wir uns für diesen Gesprächsband entschieden, das Medium zu wechseln. In unseren Dokumentarfilmen verstehen wir uns als Interpretinnen einer Gegenwart, wie wir sie wahrnehmen. Auf dem Papier hingegen steht das gesprochene Wort im Zentrum der Aufmerksamkeit, verdichtet sich die Essenz der Botschaft noch einmal in anderer Form – das hat uns gereizt. Die Gespräche werden begleitet von möglichst genauen Beschreibungen der Familien und unseren Beobachtungen und Erinnerungen an ihre Zusammentreffen. Das Eigentliche, das Wesentliche durchscheinen zu lassen, die Eltern und Kinder in ihrem jeweils Besonderen zu erkennen, darum ging es uns. Der Stil eines klassischen Gesprächsbandes wird so aufgebrochen, Impulse unserer filmischen Arbeiten fließen ein und ergänzen den sachlichen Informationsgewinn.
Um in die Zukunft blicken zu können, müssen wir die Vergangenheit begreifen. Basierend auf unseren beruflichen und privaten Erfahrungen des generationenübergreifenden Dialogs und in der Tradition der Oral History, haben wir versucht, Familien in die direkte konfrontative Auseinandersetzung eintreten zu lassen. Wir hoffen, dass diese komplexen Gespräche den Blick auf die DDR-Bevölkerung, die bis heute häufig als homogene Masse wahrgenommen wird, weiten und ein tieferes Verstehen der gegenwärtigen gesamtdeutschen Pluralität ermöglichen werden. Das individuelle Selbst-Begreifen kann so als eine bis in die Gegenwart notwendige innerfamiliäre Herausforderung sichtbar werden, die private und gesellschaftliche Beziehungsmuster und -brüche widerspiegelt, die exemplarisch sind für die Suche nach einem gesamtdeutschen kollektiven Selbstverständnis. Die Gespräche geben Einblicke in Familien und damit in die »Seele« Ostdeutschlands. Sie erzählen von alten und neuen Sehnsüchten, Dazugewonnenem, Verlusten, aber auch von alten und neuen Ängsten und Enttäuschungen. Dafür haben wir überwiegend Eltern und Kinder mit komplizierteren Geschichten und eher schwierigerem Zugang zueinander ausgewählt. Natürlich gibt es viele ostdeutsche Familien, in denen die Generationen gut miteinander kommunizieren. Für dieses Buch erschien es uns wertvoll, darauf aufmerksam zu machen, welche Hürden und Probleme es zu bewältigen gilt und mit welchen Spätfolgen von insgesamt drei deutschen Staatsformen, Mauerfall, Transformation und Nachwendezeit wir es heute zu tun haben.
Die in diesem Buch wiedergegebenen Gespräche können als individuelle Möglichkeit und als Ermutigung verstanden werden, in den Familien neu und ohne Vorwürfe miteinander das Gespräch zu beginnen. Bestenfalls sind sie Handwerkszeug, um aktuelle politische Entwicklungen in Ostdeutschland »anders zu lesen«, zu verstehen und beeinflussen zu können.
Sabine Michel und Dörte Grimm
April 2020
»Du lernst, nicht weiter nachzubohren«
Annett (*1971) und Klaus-Dieter (*1951)
Sabine Michel
Ich bin lange mit dem Zug gefahren, zweimal umgestiegen. Annett holt mich vom Bahnhof ab. Sie ist kleiner, als ich dachte, mit gewellten dunklen Haaren und warmen, ebenfalls dunklen Augen. Wir fahren noch einmal fast zwanzig Minuten in ihrem familienfreundlichen Kombi. Unser Ziel: ein Dorf in Westdeutschland mit typischen Einfamilienhäusern und gepflegten Gärten. Ab und an ein Auto auf der Gegenspur. Vor dem Haus stehen Kinderfahrräder, Roller und Spielzeug liegen über die Wiese verstreut. Es ist still, ein warmer Sommerabend. Die Schwalben fliegen hoch.
Annett und ihr Mann Dirk haben drei Kinder. Die beiden haben sich Anfang der Neunzigerjahre beim Lehramtsstudium in Annetts Heimatstadt Dresden kennengelernt. Er war damals einer der ersten Studenten aus den alten Bundesländern. Nach Studienende ziehen beide nach Westdeutschland, Annett will auf keinen Fall in Dresden bleiben. Sie arbeiten als Lehrer, Dirk wird Schuldirektor und erhält das Angebot einer Auslandstätigkeit in Asien.
Die kalligraphischen Zeichnungen an den Wänden erzählen von dieser Zeit. »Ich wollte immer ganz weit weg, nicht ein bisschen Fremde, sondern ganz fremd«, erzählt Annett. Asien ist ein Traum für sie. Einziger Wermutstropfen: Annett findet selber keine Arbeit, bleibt zu Hause und kümmert sich um Kinder und Haushalt. »Anfänglich war das absurd für mich. Ich bin doch in der DDR damit aufgewachsen, dass alle Frauen selbstverständlich arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen. Für meinen Mann war das normaler, dass ich zu Hause blieb.«
Annett braucht fast ein Jahr, um sich in diese für sie neue Art des Zusammenlebens hineinzufinden und die angenehmen Aspekte genießen zu können. Annett und Dirk leben mit ihren ersten beiden Kindern vier Jahre im Ausland. Als sie zurück in Deutschland sind, bekommen sie noch ein Kind. Die Jüngste ist jetzt drei Jahre alt. Heute arbeitet Annett wieder mit halber Stundenzahl als Lehrerin. Als ich sie wegen eines Gesprächs mit ihrer Mutter oder ihrem Vater angesprochen habe, hat sie lange gezögert.
Annett wächst mit ihrer berufstätigen Mutter und ihrem Stiefvater in Sachsen auf. Ihre Mutter arbeitet in der Verwaltung, er als Polizist; beide sind Mitglied der SED. Ihr leiblicher Vater lebt in Berlin und arbeitet im Ministerium für Staatssicherheit. Auch Annetts Mutter beginnt drei Jahre vor dem Mauerfall für die Staatssicherheit zu arbeiten. Nach dem Mauerfall wird sie arbeitslos und alkoholkrank und ist es bis heute. Ihr Stiefvater ist nun in einem Wachunternehmen tätig. »Ich konnte mich nie richtig auf meine Mutter verlassen. Es war für Momente schön und dann war sie wieder abwesend und ausschließlich mit sich beschäftigt. Hier hat sie uns noch nie besucht.«
Wir stehen in Annetts und Dirks Garten, schauen auf das angrenzende Feld. Der Mauerfall kommt überraschend für sie und stellt Annetts bisheriges Leben auf den Kopf. Annett wird für kurze Zeit Mitglied der PDS, der Nachfolgepartei der SED.
»Mehr aus Trotz, als immer mehr Leute für die schnelle Wiedervereinigung und die D-Mark auf die Straße gingen. Eine kurze Episode. In der DDR wäre ich sicher irgendwann in die SED eingetreten. Ich habe nichts kritisch hinterfragt. Ich war aktiv als FDJ-Sekretärin und bin dann auch kurz vor der Wende noch zum FDJ-Treffen in Berlin gewesen.«
Schon vor ihrem Asien-Aufenthalt haben Annett und ihr Mann dieses Haus gebaut. Es sticht unter den anderen Einfamilienhäusern im Ort heraus, ist höher, mit ungewöhnlichem Grundriss und sehr großen Fenstern. Von einem Flur, in dem viele Schuhe, vor allem Kinderschuhe, bunt durcheinanderliegen, gelangen wir über eine Treppe in den Wohnbereich, einer Art kombiniertem Küchen- und Wohnraum; ein großer Tisch steht einladend in der Mitte. Blickfang ist ein großes Fenster, das sich nicht öffnen lässt, aber eine weite Aussicht in die Landschaft erlaubt. Ich muss an eine Kommandozentrale denken. Den Überblick behalten.
Als Annett Mitte der Neunzigerjahre als Lehramtsanwärterin ihr Vorstellungsgespräch im Bildungsministerium in S. hat, wird sie von den westdeutschen Beamten gefragt: »Als Sie studiert haben, wurde der Lehrstuhl für Anglistik in Dresden gerade erst aufgebaut, meinen Sie denn, dass Ihre ostdeutsche Ausbildung den Standards entspricht?« Die Frage haut sie damals um. An ihrer westdeutschen Schule ist sie die erste Ostdeutsche und sechsundzwanzig Jahre alt. Der Altersdurchschnitt bis dahin: über fünfzig, vorwiegend Männer und ausschließlich Westdeutsche.
Annett kauft sich damals ein Paar Doc Martens, findet das schick zu Kleidern. Vielleicht hat sie auch das Gefühl, auf sicherem Fuß stehen zu müssen, um sich zu behaupten. Einer ihrer Kollegen sagt zu ihr: »Ja, die Kollegen aus dem Osten kommen gleich mit den Springerstiefeln, das passt ja!« Heute fühlt sich Annett nicht mehr fremd hier. Ihre Kollegen aus dem Westen – mittlerweile sind sie alle mehr oder weniger so alt wie sie – denken ähnlich über die Welt. Die Wende ist dabei eine sehr abstrakte Angelegenheit. Manche von ihnen waren bis heute nicht im Osten, höchstens mal in Berlin. Und für Annett ist der Osten mittlerweile auch weit weggerückt.
»Die Bundesrepublik Deutschland ist meine Heimat, aber ich wüsste, ich könnte auch woanders leben. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Aber hier bin ich angekommen. Ich bin anerkannt und ich merke auch, dass etwas zurückkommt. Wir haben so viel in unserer Hand. Ich habe eine Aufgabe: dass ich den Schülern klarmachen muss, wir leben in keiner sicheren Welt, die ist nicht von alleine sicher. Aber ihr könnt es steuern. Umweltfragen gehören dazu, aber auch Bildung. Ich habe ein paar Flüchtlingskinder in der Klasse und erlebe die zielstrebiger als manch andere. Ich versuche, die zu unterstützen. Ich sehe mich da in der Verantwortung. Wenn der Kapitalismus keine Lösung ist, der Sozialismus ist es auch nicht.«
Annett hat nach anfänglichem Zögern einem Gespräch mit ihrem leiblichen Vater, Klaus-Dieter, zugestimmt. Klaus-Dieter wurde 1951 geboren. Seine Mutter war Weberin und Mitglied der SED, sein Vater arbeitete in drei Schichten in der Wismut, im Uran-Abbau. Klaus-Dieter wird zu Protokoll geben: »Ich brauchte kein Geld, um meinen Traum vom Studieren, Sportsegeln und Motorradfahren zu erfüllen.«
Das DDR-System wird in seiner Familie als sozial und gerecht empfunden. Schon während des Abiturs wird Klaus-Dieter Kandidat der SED und studiert anschließend Informationsverarbeitung. Nach dem Studium wird er im Ministerium für Staatssicherheit in der Abwehr Wirtschaftsspionage eingestellt. Für ihn eine schlüssige Entscheidung.
Annett steht vor dem großen Fenster und schaut auf die langsam dunkel werdende Landschaft. Welchen Einfluss hatte die berufliche Entwicklung ihres Vaters damals auf Annett? Ihre Eltern lernen sich auf der EOS kennen und trennen sich kurz nach dem Studium. Da ist Annett zwei Jahre alt. Ihr Vater zieht nach Berlin, ein Karriereschritt nach oben. Er leitet dort eine Hauptabteilung. Mit seiner zweiten Ehefrau hat er noch drei Kinder bekommen.
Annett hat trotzdem regelmäßig Kontakt mit ihm. »Ich habe ihn damals als in sich ruhenden, sehr selbstbewussten Mann erlebt. Er hat dem Staat DDR vertraut, an das System geglaubt, so wie ich auch. Und das erschien mir absolut glaubwürdig. Mängel wurden als etwas in naher Zukunft Abzustellendes benannt. Über seine und meiner Mutter Tätigkeit bei der Stasi habe ich nicht nachgedacht und es auch nicht hinterfragt. Du lernst, nicht weiter nachzubohren. Nach dem Mauerfall meine Mutter darauf anzusprechen, endete eigentlich immer in einer sehr emotionsgeladenen Situation, weil sie meinte, sie müsse sich jetzt rechtfertigen und verteidigen. Ich wollte sie irgendwann nicht mehr in diese Situation bringen. Die Wende hat beide ins Wanken gebracht. Dann stellst du solche Fragen nicht.«
Es ist dunkel geworden. Annetts Vater wird morgen aus einer Stadt im Osten anreisen und, sicher pünktlich um zehn Uhr, an ihrer Tür klingeln. Freut sie sich auf das Gespräch? Klaus-Dieter steht kurz vor der Pensionierung und hat sehr eigene politische Ansichten entwickelt, die Annett stark irritieren. »Von Verschwörungstheorien erzählt er mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, Pegida und Putins Politik steht er wohlgesonnen gegenüber. In letzter Zeit denke ich immer öfter, dass unser Leben in der DDR und die Jahre danach doch viel mit unserem Leben heute zu tun haben. Dass es längst nicht so vergangen ist, wie es mir lange in meinem Alltag hier tief im Westen schien. Das ist ein starker Impuls für mich, dieses Gespräch mit ihm zu führen. Für mich liegt die Zeit in der DDR wie unter Glas. Ich schaue darauf, ich sehe mich auch, aber ich komme nicht ran.«
Es ist Morgen. Klaus-Dieter hat wirklich pünktlich vor Annetts Tür gestanden. Vater und Tochter haben sich freundlich begrüßt, Annett hat ihm einen Kaffee gekocht und nun sitzen sie sich an dem großen ovalen Tisch in der »Kommandozentrale« gegenüber. Er trägt ein dunkelrotes T-Shirt und olivfarbene Hosen eines bekannten Outdoor-Labels. Solche Hosen haben unter dem Knie einen versteckten Reißverschluss, man könnte sie überall spontan kürzen, wenn es zu warm wird. Ein bei Rentnern beliebtes Kleidungsstück.
Vater und Tochter gehen vorsichtig miteinander um, oft sehen sie sich nicht im Jahr, Alltag haben sie nicht zusammen. Und nun dieses Gespräch. Beide wirken aufgeregt, wobei Klaus-Dieter das routinierter überspielt. Er fragt nach seinen Enkeln, spricht über die Fahrt und dann über den Kaffee – bis Annett ihn mit ihrer ersten Frage überrumpelt. »Was hast du damals eigentlich gearbeitet?«
Die Frage steht für einen Moment im Raum. Es ist keine typische Anfangsfrage, so konkret überrascht sie ihren Vater. Klaus-Dieter nimmt noch einen Schluck Kaffee, dann erklärt er etwas zu sachlich: »Ich war am Schluss vom Dienstgrad her Major und stellvertretender Abteilungsleiter.« Er schaut Annett an, doch sie schweigt, wartet. »Dann ist das System implodiert und die Welt brach für mich zusammen, weil das, wofür man gelebt hat, wie man erzogen wurde, woran man auch geglaubt hatte, an die Richtigkeit dieser Gesellschaftsordnung und die Möglichkeit, die Unzulänglichkeiten zu verändern … weg war. Eine Welt, für die ich mich engagiert habe. Das war kein Achtstundenjob, ich hab es aus Überzeugung gemacht. Und dann verstehst du, dass alles umsonst war.«
Annett rutscht unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Nimmt ihre offenen schulterlangen Haare im Nacken zusammen, lässt sie wieder fallen. An diesem Punkt scheinen sie schon oft gewesen zu sein. Heute setzt Annett ihre eigene Geschichte dagegen. »Ich hatte damals einen Freund, das war eine recht intensive Beziehung. Der war damals gerade bei der Armee. Neben seiner Kaserne war eine Russenkaserne und da gingen allerlei Gerüchte herum. Da lag ziemliche Anspannung in der Luft. Er wusste um die Berufe meiner Eltern und hat sich aus politischen Gründen von mir getrennt. Damals ging er, als ehemaliges SED-Mitglied, in die DSU, eine rechtskonservative Partei. Das war mein erster persönlicher Crash in der Zeit.«
Klaus-Dieter wirkt überrascht. So viel Offenheit kennt er von seiner Tochter nicht. »Das wusste ich nicht.«
Annett reagiert nicht, sie erzählt einfach weiter. »Ja, und dann begann mich sehr schnell zu nerven, dass es nur noch um das Materielle und nicht mehr um das Ideelle ging. Da bin ich PDS-Mitglied geworden. Ich fand Gregor Gysi ganz toll. Später hat sich das dann gelegt, als ich sah, was das alles für alte Leute waren. Ich habe mich also erst mal auf die Hinterbeine gestellt und gesagt: ›Euch geht es nicht um die Idee, sondern um den materiellen Zuwachs.‹ Dass sich mit den Veränderungen aber auch eine Weite für den eigenen Horizont auftun könnte, darauf bin ich damals nicht gekommen.«
Annett geht während ihres Studiums für ein Semester in die USA und überwindet ihre anfängliche Scheu vor allem Unbekannten. Sie lernt Menschen kennen, die ganz anders sind als sie und mit denen sie trotzdem ins Gespräch kommt, die sie offen annehmen, obwohl sie aus der »GDR« stammt. Sie fasst Mut und probiert Dinge aus, vor denen sie vorher zurückgeschreckt ist. »Nach dem Jahr in Amerika habe ich mir mehr zugetraut. Ich kam zu der Erkenntnis, dass es viele Möglichkeiten für ein Leben gibt und dass ich es selber in der Hand habe. Du musst nicht warten, bis einer kommt – kümmere dich mal selber! Ich habe dort gesehen, dass ich mit vielen, auch andersdenkenden Menschen umgehen kann. Dass ich denen etwas zu erzählen habe. Dass die mich mögen können. Was denken andere von mir, das war mir immer ganz wichtig.«
Klaus-Dieter hat oft genickt, er weiß, wie man Empathie und Zugewandtheit in einem Gespräch erzeugt. Er will etwas sagen, doch Annett redet weiter. »Zu Schulzeiten war ich nicht unbedingt der Gruppen- oder Cliquenmensch. Ich fand das faszinierend, wenn es so etwas gab, aber ich gehörte nicht dazu. Ich wusste nicht, wie ich mich da hätte einbringen können.«
Annett ist auf der EOS FDJ-Sekretärin, erledigt zuverlässig alle Aufgaben. Wenn sich keiner findet, macht sie es eben selber. Die Lehrer mögen sie, unter ihren Mitschülern ist sie als systemtreu bekannt. Sie wird geachtet, aber findet keinen Anschluss an einen der existierenden Freundeskreise.
»Je mehr Abstand ich von zu Hause hatte und je mehr Selbstsicherheit ich gewann, wurde das automatisch anders. Bis hin zu der Erkenntnis: Es ist eigentlich wurscht, was andere von dir denken.«
Jetzt unterbricht Klaus-Dieter sie. »Ich finde mich da in vielen Worten selber wieder. Thema Selbstwertgefühl: Muss ich etwas darstellen nach außen oder kann ich so sein, wie ich will. Diese Frage habe ich mein ganzes Leben mit mir herumgetragen. Ich wollte keinem wehtun. Ich sein – aber ein Guter sein.«
Da Annett schweigt, spricht er weiter. »Mein Vorbild war die humanistische Gesellschaftsordnung. Und das sehe ich heute noch genauso. Nur der Störfaktor Mensch funktioniert in so einem System nicht. In meiner Ausbildung spielte Geld keine Rolle. Meine Eltern hatten kein Geld dafür. Ich habe während des Studiums ein Leistungsstipendium bekommen und konnte damit ganz ordentlich als Student leben. Das war meine Motivation, für diesen Staat DDR da zu sein. Das hab ich als lebenswert empfunden, mit all den Einschränkungen.«
Klaus-Dieter ist schon mit sechzehn in die SED eingetreten und hat erlebt, dass er nun plötzlich nicht nur unter Schülern tonangebend ist, sondern auch Lehrern anscheinend ebenbürtig entgegentreten kann. Das hat sich später noch durch seine berufliche Position verstärkt. Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit sind alle mit Vorsicht begegnet. Auch gegenüber seinen Frauen und seinen Kindern gibt er lange den Ton an.
Klaus-Dieter hat sich seine Geschichte gut zurechtgelegt, man spürt, dass er sie bis hierhin oft schon erzählt hat.
Annett fragt zögernd, weich fast: »Ging das denn in dem Beruf, ein Guter sein?«
Klaus-Dieter wehrt sofort ab. »Wieso? Ich war doch der Gute! Ich habe doch beim MfS für das Gute gekämpft! Das überwiegt alles am Ende. Und dass da Höhen und Tiefen eine Rolle spielen, das ist eben das Leben. Damit muss man klarkommen, damals und heute. Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe, weil ich das gut fand. Und dass mir danach einige ans Fell wollten, damit muss ich leben. Mein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer.«
Anfang 1990 kündigt Klaus-Dieter seinen Dienst beim Ministerium für Staatssicherheit und tritt aus der SED aus, er sieht hier nun keine Zukunft mehr. Nach einer kurzen Anstellung in der Kontrollabteilung im Konsument Warenhaus auf dem Berliner Alexanderplatz wird er erfolgreicher Wirtschaftsprüfer in einem Forderungsmanagement. Das Unternehmen wird von ehemaligen Außenhändlern der DDR gegründet, die das Thema Risikomanagement aus dem DDR-Außenhandel kennen. Klaus-Dieters langjährige Tätigkeit beim MfS interessiert dort niemanden, im Gegenteil: Er hat anscheinend beste Vorrausetzungen im neuen gesellschaftlichen System mit seinen beruflichen Erfahrungen aus dem alten.
Da Annett wieder schweigt, fügt Klaus-Dieter hinzu: »Wir haben als Ossis einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Wessis: Wir mussten unsere Vergangenheit aktiv überdenken und korrigieren. Aus dieser Sicht sehen wir die aktuellen Themen, die uns bewegen, viel kritischer als die, die noch niemals irgendeine Veränderung vollzogen haben. Die heutige politische Situation bereitet mir große Sorgen. Wie sich die Welt politisch entwickelt und wie die Menschen nichts tun. Deswegen gibt es Pegida. Das sind keine Nazis, sondern so alte Säcke wie ich, die die Wende durchgemacht haben und die Politik in diesem Land sehr kritisch sehen und die ausgegrenzt werden von diesen Wessis.«