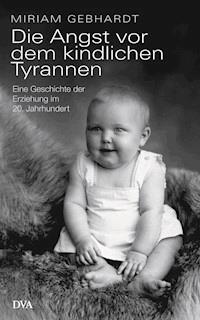Miriam Gebhardt ist Journalistin und Historikerin und lehrt als außerplanmäßige Professorin Geschichte an der Universität Konstanz. Neben ihrer journalistischen Arbeit, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und verschiedene Frauenzeitschriften, habilitierte sie sich mit einer Arbeit über die Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert, auf der Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen (2009) beruht. Sie ist Autorin zahlreicher weiterer Bücher, darunter Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet (2011), Die Weiße Rose (2017) sowie zuletzt Wir Kinder der Gewalt (2019). Ihr Bestseller Als die Soldaten kamen (2015) über die Vergewaltigungen nach dem Zweiten Weltkriegs in Deutschland durch die Soldaten der Siegerarmeen wurde breit besprochen und in mehrere Sprachen übersetzt. Miriam Gebhardt lebt in Ebenhausen bei München.
Erziehung zwischen Liebe und Angst – eine Geschichte der elterlichen Verunsicherung
Wie viel Nähe braucht ein Kind? Darf ich mein Baby beruhigen, wenn es weint, oder muss es lernen, sich selbst zu beruhigen? Und was muss ich tun, damit mein Kind endlich durchschläft? Nach der Geburt des ersten Kindes stellen sich Eltern stets die gleichen Fragen und suchen Rat bei Ärzten, Hebammen und Erzieherinnen. Jede Generation stützt sich dabei auf andere Elternratgeber, doch das einflussreichste Buch der deutschen Erziehungsgeschichte war über Jahrzehnte Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, ein Buch, das Distanz und Disziplin predigte, um den Nachwuchs abzuhärten und Eltern davor zu bewahren, sich von ihren »kindlichen Tyrannen« manipulieren zu lassen. Bis in die sechziger Jahre galt die strenge Parole: »Kinder nicht küssen!«
Auf beeindruckend breiter Quellenbasis, darunter zahlreichen Elterntagebüchern, zeigt die Historikerin Miriam Gebhardt, wie stark die Angst um das Kind und die Angst vor dem Kind Erziehungsfragen geprägt haben. Und sie macht deutlich, wie sehr dieses Erbe der Verunsicherung bis heute viele deutsche Debatten um den richtigen Umgang mit Kindern dominiert.
»Erkenntnissatte Studie über die Erziehung des 20. Jahrhunderts.« Die Zeit
»Hilfreicher als viele Ratgeber.« Bücher
Miriam Gebhardt
Die Angst vordem kindlichen Tyrannen
Eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: aus dem Privatarchiv der Autorin
Satz und Layout: Boer Verlagsservice, Grafrath
ISBN: 978-3-641-03723-9V002
www.dva.de
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Einleitung
I. – Das beobachtete Kind
1. Vom bürgerlichen Tagebuch zum Weblog
2. Von Menschen und Säuglingen – Vorgeschichte
3. Ein Tagebuch geht in Serie
4. Der Arzt als Erzieher
5. Rigide Normen, gelassene Eltern
6. Eine Erziehung zum Untertan?
II. – Das kontrollierte Kind
1. »Bäbis« Gleichschaltung durch geordnete »Schreizeiten«
2. Hildegard Hetzer führt zu neuen Ufern
3. Was heißt »nationalsozialistische« Frühsozialisation?
4. Mit Johanna Haarer durch die Generationen
5. Sozialisationsziel »Lebensbemeisterung«
6. Die deutsche Mutter, der stolze Vater und ihr erstes Kind
7. Nichts schwieriger als Säuglingspflege
8. Haarer meets Spock
9. Somatisierung der Eltern-Kind-Beziehungen
10. Unser Kind in der DDR
III. – Das eigene Kind
1. Mutterliebe
2. Das gebundene Kind – eine neue Anthropologie
3. Frühsozialisation bei den 68ern
4. Psychoboom
5. Pädagogisierung der Kindheit
6. Alternatives Modell und Neue Mütterlichkeit
7. »Ein Bub ist uns versagt geblieben«
Die Macht der Familie und die Macht der Experten – Resümee
Nachwort zur Neuauflage
Danksagung
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Personenregister
Vorrede
Die Arbeit an diesem Buch hat bei mir ein Gefühl der Verwunderung hinterlassen; Verwunderung darüber, wie sehr in diesem Land alle Erziehungsdebatten von Angst geprägt sind. Sicher haben Eltern immer Sorgen um ihre Kinder, sie befürchten nicht nur in Deutschland, dass nicht alles optimal läuft bei der Erziehung und Betreuung, dass der eigene Nachwuchs den Anschluss verpassen und den gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen könnte. Bemerkenswert an der deutschen Diskussion der letzten Jahre ist jedoch: Eltern scheinen sich nicht nur um ihr Kind zu ängstigen, sondern auch vor ihrem Kind. Die Angst vor dem eigenen Kind ist so groß, dass Experten Eltern versprechen müssen, sie vor ihrem Kind zu beschützen. Monatelang stand eine Schrift des Kinder- und Jugendpsychiaters Michael Winterhoff ganz oben auf den Bestellerlisten, die als Patentrezept für den Umgang mit dem Kind Strenge, Konsequenz und klare Grenzen verordnete.1 Autorität und Disziplin scheinen neuerdings wieder die wichtigsten Erziehungsinstrumente zu sein. Abgesehen von der Frage der Berechtigung solcher Ratschläge – das will ich als Historikerin nicht beurteilen – ist das Bild vom Kind, mit dem die mehr oder weniger ausgewiesenen Fachleute die geforderte Strenge begründen, doch erstaunlich.2 Winterhoffs erstes Erfolgsbuch heißt Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Damit ruft der Autor ein vertrautes Argument unserer Großeltern und Urgroßeltern auf – die Warnung vor dem kindlichen Tyrannen oder dem Kleinen Haustyrannen. Die Zeitschrift Stern verkaufte im Jahr 2005 eine ihrer Titelgeschichten mit der Headline »Die kleinen Tyrannen. Wie Kinder ihre Eltern dressieren und wie Mütter und Väter kontern können«. Auf dem Cover ließ ein kleines Ungeheuer die Peitsche über seinen vor Angst schlotternden Eltern kreisen. Auch die Bildsprache des Spiegel-Titels »Wie viel Mutter braucht das Kind?« im Februar 2008 ging in diese Richtung. Gezeigt wurde ein überdimensionales Kleinkind, das eine winzige und völlig verhuschte Mutter mit fester Faust gepackt hielt.3 Kinder werden, so konstatiert die Zeitschrift Eltern, hierzulande als »Bonsai-Terroristen«, »Saddam Husseins im Taschenformat« oder »Kotzbrocken« bezeichnet.4
Solche Titelgeschichten, Formulierungen und Abbildungen sind nicht allein damit zu erklären, dass sie die Auflage steigern. Sie verweisen vielmehr auf latente Einstellungen in der Gesellschaft. Die Haltung zum Kind ist offensichtlich nicht nur von realen Befürchtungen um die Zukunft der nächsten Generation bestimmt. Der Diskurs um die kindliche Tyrannei bringt mehr zum Vorschein als die Angst der Mittelschicht vor der familialen Deklassierung – in ihrer Eigenwahrnehmung fühlen sich Eltern ohnmächtig gegenüber ihren omnipotenten Zwergen.
Die Angst der Eltern vor dem Versagen im Umgang mit unberechenbaren und unkontrollierbaren Kindern erklärt auch die Sehnsucht nach klaren, möglichst strikten Expertenanweisungen. Ratgeber oder Ratgebersendungen wie Die Super Nanny, durch die das Publikum das Gruseln lernt, erfreuen sich großer Beliebtheit und sorgen für gute Quoten. Lautstark wird die staatliche und institutionelle Einmischung in die zentrale Aufgabe der Familie, die Versorgung und Erziehung ihrer kleinen Kinder, gefordert. Im Dezember 2007 hat die Bundesregierung beschlossen, Eltern und Kinder künftig stärker zu beaufsichtigen. Zur Vorbeugung von Verwahrlosung und Misshandlung sollen Säuglinge und Kleinkinder von Geburt an bis ins Alter von vier Jahren regelmäßig einem Arzt vorgestellt werden. Bei Verdachtsmomenten ist eine Meldepflicht geplant, außerdem sollen Hebammen, Mediziner, Behörden und Polizei enger kooperieren. Die Anregung der SPD-regierten Länder, außer neuen Pflichten auch neue Rechte, nämlich Kinderrechte, im Grundgesetz zu verankern, wurde nicht aufgegriffen.5
Es vergeht kein Monat, ohne dass sich ein Sozialisationsexperte dafür ausspricht, es müsse endlich ein Elternführerschein eingeführt werden. Vor zwanzig Jahren hoffte man zumindest in alternativen Erziehungsmilieus noch auf eine Rückkehr zu »natürlichen« Methoden, zu Spontanität und Intuition im Umgang mit Kindern jeden Alters. Eltern sollten sich nicht von Experten zur Hilflosigkeit erziehen lassen.6 Heute ist keine Rede mehr von Autonomie und Eigenverantwortung der Eltern oder gar der Kinder im Sozialisationsprozess. Nach Meinung des bekanntesten deutschen Sozialisationsexperten, Klaus Hurrelmann, sind zwei Drittel der Eltern gar nicht oder nur sehr eingeschränkt in der Lage, ihre Sprösslinge selbstständig zu erziehen. Diese Meinung teilen viele.7 Die Regierung hat mit dem Modellprojekt »Pro Kind« zur intensiven Betreuung sozial schwacher Erstgebärender reagiert.8
Die Expertenhörigkeit gibt zu denken, wenn man weiß, dass Eltern nicht erst seit gestern, sondern seit der Aufklärung informiert und seit dem späten 19. Jahrhundert immer intensiver und mit immer professionelleren Medien instruiert wurden. Die Klage der Fachleute über die Unfähigkeit der Eltern, mit den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Anforderungen an die Sozialisation der Kinder Schritt zu halten, müsste eigentlich als Erstes auf sie selbst zurückfallen. Daran zeigt sich, wie blind der Ratgeberdiskurs für seine eigene Geschichte ist. Es wird der Anschein vermittelt, als sei die wissenschaftliche Kindererziehung ein Produkt der Gegenwart, das nur endlich eins zu eins von den Familien beachtet werden müsse. Das Fortschrittsdenken der Expertise verstellt die Möglichkeit einer kritischen Bilanz des bislang Erreichten. Der geschichtslose Erziehungsdiskurs fragt kaum danach, wodurch Experten ihren qualitativen Wissensvorsprung vor der Restgesellschaft gerechtfertigt sehen. Allgemein gesagt: Die immer lauter werdende Forderung nach mehr Normativität und Führung in der Frage der familialen Sozialisation, der sich sogar Historiker anschließen, hat offensichtlich nicht nur fachliche Hintergründe.9 Es geht zugleich um ein gesellschaftspolitisches Thema, um die öffentliche Führungsrolle des Neuen Bürgertums, das sich nicht zuletzt bei der Kindererziehung durch die Bevorzugung von Privatschulen hervortut.
Ein weiteres Phänomen der aktuellen Diskussionen neben der Ängstlichkeit und der Expertengläubigkeit ist die Verlegung des kritischen Zeitpunkts im Sozialisationsprozess auf immer frühere Zeitpunkte. In den letzten zwei Jahrzehnten diskutierten Sozialisationsexperten, wie wichtig peer groups und Selbstsozialisation für das Aufwachsen seien.10 In den 60er und 70er Jahren hatte sich die Gesellschaft vor allem mit Chancengleichheit in Schule und Ausbildung beschäftigt. Heute ist die früheste Kindheit von alles entscheidender Bedeutung. Die Aufwertung der ersten Lebensjahre liegt im wissenschaftlichen Großtrend des Naturalismus, der die biologischen Grundlagen des menschlichen Daseins betont, der Denken, Fühlen, Handeln, Geschlechterverhältnisse, Temperamentsfragen usw. mit Biologie erklären möchte. Dazu gehört auch die Ansicht, schon die ersten Beziehungserfahrungen im Säuglingsalter wirkten sich auf die hirnanatomischen Strukturen aus, mit weitreichenden Konsequenzen für das ganze Leben.11 Ein wichtiges Thema ist die Rückdatierung der kognitiven Kompetenzen des Kindes in die ersten Lebensstunden, ja sogar in die vorgeburtliche Zeit, in der Hoffnung, noch früher in den Lauf der Entwicklung eingreifen zu können.12 Aber nicht nur Naturwissenschaftler beschäftigt die erste Lebenszeit zunehmend – auch Geisteswissenschaftler, vor allen Dingen psychoanalytisch denkende, sind auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Das hat dazu geführt, dass neuerdings wieder Identitätstheorien und Gesellschaftstheorien auf Vorgänge in der frühesten Kindheit abgestützt werden.13
Sind die bislang angesprochenen Eckpunkte der erziehungspraktischen und sozialisationstheoretischen Debatten internationale Phänomene, so hat der Boom des Themas aber auch ein spezifisch deutsches Gesicht – ein Nachholbedarf ist spürbar. Es gibt einige Anomalien in diesem Land, die erst allmählich ins Bewusstsein dringen. Sie lassen sich anhand von auf den ersten Blick disparaten Erscheinungen benennen: Dazu gehören die erst sehr spät einsetzende und bis heute internationalen Standards hinterherhinkende adäquate Schmerzbehandlung bei Früh- und Neugeborenen14; eine vergleichsweise niedrige Fremdbetreuungsquote und das späte Einsetzen außerhäuslicher Bildung und Schulung mit den entsprechenden Konsequenzen auf Frauenerwerbstätigkeit und weibliches Einkommensniveau15; eine besonders schlechte psychosoziale Betreuung von Müttern und Kindern bei postnataler Depression und anderen Interaktionsproblemen im Säuglingsund Kleinkindalter16; über viele Jahre eine erhöhte Säuglings- und Müttersterblichkeit im Vergleich mit anderen Industrienationen17; und ein besonders hoher Anteil an Erwachsenen, die ausdrücklich keine Kinder wollen18. All diese Problemfelder haben eine Schnittmenge: Die Haltung zum Kind und zum Kinderkriegen. Wirkt da ein spezifisch deutsches Erbe? Das wird eine Hauptfrage dieses Buches sein.
Wo das sicherlich schon jetzt bejaht werden muss, ist beim Thema Erinnerungskultur und Kindheit, ein weiteres Fragment der aktuellen Debatten. Selbst die Geschichtswissenschaft, sonst eher um sichere Distanz zu ihren Untersuchungsobjekten bemüht, beteiligt sich neuerdings an der Identitäts- und Erinnerungsarbeit, die eine Generation der jetzt in die letzte Lebensphase eintretenden Deutschen auf ihre Kindheit zurückverweist. Es war sicherlich ein Novum, als im Jahr 2005 eine Gruppe von Historikern, begleitet von Psychoanalytikern, einen internationalen Kongress zu einem lebensgeschichtlichen Thema ausrichtete: Es ging um die eigene Kindheit in den Kriegsjahren, und es kamen 600 Teilnehmer.19 Eine derart offene Anknüpfung an persönliche Erfahrungen der heute 60- bis 70-jährigen Wissenschaftler mit so großer Resonanz in der Fachwelt und in der Medienöffentlichkeit wäre zwanzig Jahre früher kaum denkbar gewesen.20 Die gewachsene Wertschätzung von Narrativität, von Subjektivität und der seit Jahren anhaltende Erinnerungsboom haben dazu beigetragen. Ein Oral-History-Projekt unter vielen, die sich mit Kriegskindheit befassen, hat sich nur der Alterskohorte der 1943 geborenen Historiker verschrieben – übrigens ausschließlich männliche Vertreter ihres Fachs. In dessen Verlauf hat sich bereits eine Art informeller Konsens darüber gebildet, dass diejenigen, die in der NS-Zeit Kinder waren, mit einer besonderen psychischen Ausstattung ins Leben geschickt worden seien. Dazu gehören neben den Traumatisierungen durch den Krieg die Abwesenheit und häufig der Verlust des Vaters.21
An diesem Sachverhalt ist nichts falsch. Man kann allerdings fragen, ob eine andere Zusammensetzung der Sprechergruppe, zum Beispiel eine stärkere Beteiligung von Frauen, zu einer anderen Sichtweise auf die eigene Kindheit geführt hätte. Es gab immerhin schon einmal einen Anlauf, die früheste Kindheit in der deutschen NS-Geschichte zu verorten, der allerdings weniger Resonanz ausgelöst hatte; damals waren es Frauen ungefähr der gleichen Jahrgänge, die ihre eigene und die Kindheit der Deutschen nicht in erster Linie durch äußere Faktoren beeinträchtigt sahen, den Krieg und den Kriegsfolgen, sondern durch innere. Gemeint war die Einverleibung nationalsozialistischen Gedankenguts in die Familienbeziehungen, in die frühkindliche Erziehung, letztlich in die Psyche selbst. Diese Perspektive auf die eigene Kindheit, die auch eine Suche nach den ideologischen Restbeständen in den familialen Weitergabeprozessen ist, hat bis heute einiges Unruhepotenzial. 22 Im historischen Mainstream liegt sie nicht.
Die Kindheit spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Erklärung der Welt. Man könnte sagen, wie eine Gesellschaft auf das Kind blickt, so blickt sie auf sich selbst. »Die Auffassung von der Welt schließt die Auffassung vom Wesen der Kindheit ein.«23 In den berühmten Arbeiten zur Kindheit aus den 60er und 70er Jahren von Philippe Ariès und Lloyd deMause stand die Haltung zum Kind sinnbildlich für den jeweiligen Zivilisationsstand einer Kultur. Auch Edward Shorters Arbeit griff auf ein solches Modernisierungsnarrativ zurück.24 Die momentan wachsende Aufmerksamkeit für die Geschichte der Kindheit im 20. Jahrhundert hat einen ganz anderen Ursprung: Es geht um das eigene Leben, die eigene Kindheit, geprägt von den Erfahrungen der Großeltern und Eltern; um das »mentale Gepäck« der Generationen, das notgedrungen mitgeschleppt wird, wie der Historiker Jürgen Reulecke es nennt25, und um die »unbewusste Tradierung seelisch unverdauter Inhalte« des Psychoanalytikers Tilman Moser. 26
Nimmt man all diese Aspekte zusammen, stellt sich die Frage: Hat die heutige Diskussion um familiale Erziehungskompetenz und frühkindliche Entwicklung mit diesen unverdauten historischen Erblasten zu tun? Gibt es einen deutschen »Sonderweg« in der kulturellen Weitergabe zwischen den Familiengenerationen des 20. Jahrhunderts?
Noch liegen die Diskussionsfäden unverknüpft nebeneinander: Hier die Klage über einen als krisenhaft empfundenen Zustand in der Gegenwart, dort eine überwiegend traurige Rekapitulation der eigenen Vergangenheit. Jede Generation verfasst sich ihren eigenen Kindheitsmythos und kleidet ihn in einen mehr oder weniger passenden Mantel: Generation Golf, Generation Reform, Kriegskindheit, Vaterlosigkeit etc. Dabei besteht die Gefahr einer eindimensionalen Generationengeschichtsschreibung, die sich als Abfolge von Einheiten gibt, in der jede für sich wie eine Insel im Ozean der Zeit schwimmt. Erst über eine Untersuchung der Weitergabe von kulturellen Deutungsmustern in der Generationenfolge über Kindheitskonzepte, über Erziehungspraktiken und allgemeine Sozialisationsvorstellungen wird diese Kluft zwischen Gegenwärtigem und Vergangenem überwunden, die »Kommunikationssperre« zwischen den Generationen aufgehoben und der Blick frei gemacht für eine Geschichte der frühkindlichen Erziehung im 20. Jahrhundert.27
Einleitung
Die Symbolik der frühesten Kindheit
Auf der übergeordneten Ebene geht es in diesem Buch um ebenjene Prozesse der Entstehung, Tradierung und Veränderung kultureller Sinnzusammenhänge in der Generationenkette. Die frühkindliche Sozialisation ist der erste Schritt der kulturellen Weitergabe, sie bildet die »Grundlagen jeder Kulturtradition«. Deshalb geht es hier nur um sie. Sobald sich der Kodex elementarer Lebensregeln der Kindheit ändert, deutet das auf einen »grundlegenden Wandel des kulturellen Normensystems und der Wissenskultur einer Gesellschaft hin«. Die Historiker Lothar Gall und Andreas Schulz meinen in diesem Zusammenhang den großen Umbruch in der Zeit der Aufklärung, als sich die menschliche Natur von einer gott- und naturbestimmten in eine wissenschaftlich und technisch veränderbare und perfektionierbare transformierte.1 Auch an kleineren historischen Maßstäben gemessen weist ein diesbezüglicher Normenwandel auf gesellschaftlichen Wandel hin: In der frühkindlichen Sozialisation konstruiert und reproduziert sich das Kulturelle – jedenfalls in einer Zeit, die an das Entwicklungsparadigma glaubt und daran, dass alles, was am Anfang des Lebens passiert, für das weitere Leben von Belang sei. Die Evolutionsvorstellung ist freilich die Voraussetzung dafür, dass wir die frühkindliche Sozialisation so wichtig nehmen und meinen, den Lebensanfang zeichne eine »magische Kraft«2 aus, hier liege der Schlüssel für die Einübung der grundsätzlichen Deutungsmuster und Handlungsformen einer Gesellschaft.
Säuglinge und Kleinkinder verkörpern aufgrund ihrer »Neuheit«, ihrer noch nicht oder nur eingeschränkt entwickelten kognitiven und sprachlichen Reaktionsmöglichkeiten eine ideale Projektionsfläche für das Selbstbild, die Phantasien und Zukunftsentwürfe einer Gesellschaft.3 Deshalb sind die Vorstellungen zur Frühsozialisation hoch symbolisch für ihr Sinngefüge. Auch wenn wir heute nicht mehr glauben, das Säuglingspflegesystem repräsentiere den Sozialcharakter einer Gesellschaft – so nehmen wir doch an, dass die dazugehörigen Vorstellungen auf das Menschenbild weisen, auf die Position des Menschen in der Welt und letztlich auf den gesellschaftlich definierten Sinn seines Daseins.4
Mit den etwas hölzernen Begriffen »Menschenbild« und »Haltung zum Kind« sind zwei Kategorien gemeint, die für die Geschichte der Kindheit und der Sozialisation grundlegend und untrennbar verbunden sind. Das Menschenbild (oder Ethnotheorie) ist Ausgangspunkt aller Alltags- und Wissenschaftstheorien, die das Wesen des Menschen und damit des Kindes und seiner Entwicklungsaufgaben betreffen.5 Sozialpsychologen haben versucht, aus Menschenbildern Werthaltungen abzuleiten, die zum Beispiel auf antidemokratische Einstellungen zulaufen könnten. Das Bild vom Kind ist ein wesentliches Element des Menschenbildes. Es beinhaltet Entwicklungstheorien, Annahmen über elementare Anlagen bzw. Einwirkungsmöglichkeiten und Erziehungsaufgaben, über die Ziele der Entwicklung, über die Beziehung zwischen Mensch und Welt. Die kulturvergleichende Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von Konzeptualisierungen des Selbst und der Person-Umwelt-Beziehung. So macht es einen gravierenden Unterschied, ob eine Kultur glaubt, Kinder für die Welt zurichten zu müssen, oder ob es dem Kind selbst freisteht, die Welt zu erkunden und nach seinen Vorstellungen mit zu gestalten.
Ein anderes Beispiel: Im frühen 20. Jahrhundert vertraten westliche Wissenschaftler die Auffassung, Kinder im Säuglingsalter seien asozial, passiv und empfindungslos. Diese Vorstellung hat sich in Deutschland besonders lange gehalten. Das wirkte sich ganz konkret so aus, dass in Deutschland noch bis in die 70er Jahre hinein Früh- und Neugeborene ohne Narkose operiert bzw. schmerzhaft behandelt wurden, da man glaubte, das Kind empfinde doch nichts. Aber nicht nur für die Medizin war dieses Grundverständnis folgenschwer, es betraf ganz unmittelbar auch das Verhalten bei der Betreuung des Kindes. Solange den Tränen eines schreienden Kindes keine Bedeutung zugeschrieben wurde, hatte es auch keinen Sinn, ihm Trost zu spenden.
Die Werte einer Gesellschaft gehen ein in Symboliken, nehmen Gestalt an in langlebigen Bildern wie dem des »kindlichen Tyrannen« oder der »Affenliebe«. Und sie realisieren sich in den Vorstellungen und Methoden der Versorgung und Erziehung, unter anderem bei Fragen des Ernährungsrhythmus, der Ruhezeiten, die ein Kind einhalten soll, der sogenannten Sauberkeitserziehung oder der richtigen Dosis an Umweltreizen, die man ihm zumuten kann. Am Beispiel des »kindlichen Tyrannen« lässt sich das verdeutlichen: Die Metapher kann unterschiedliche Bedeutungen transportieren, unterschiedlich bedrohlich sein, mit unterschiedlichen Konsequenzen einhergehen. Im Deutschland der 30er und 40er Jahre wurde mit der kindlichen Tyrannei ein gemeinschaftsschädigendes Individuum assoziiert. Diese Argumentation konnte zu einem ernsten Problem werden, da sie Eltern keinen Spielraum ließ; zur selben Zeit warnten in den USA Experten ebenfalls vor dem kindlichen Tyrannen, aber mit ganz anderen Argumenten. Ein kindlicher Tyrann fühle sich selbst nicht wohl in seiner Haut und stehe seinem eigenen Glück im Weg. Ansonsten sollten die amerikanischen Eltern tun, was sie für richtig hielten.
In dem Moment, in dem Erwachsene Kinder bekommen, stehen sie vor der Situation, entweder ihre eigenen Erfahrungen und familialen Traditionen für modellhaft zu halten und sie fortzuführen oder sich davon abzuwenden und für neue Konzepte zu erwärmen. Änderungen oder Kontinuitäten bei den familialen Sozialisationsmustern sagen deshalb etwas über die Beständigkeit und Flexibilität einer Gesellschaft aus.6 Die Grundannahme in diesem Buch ist, dass die Geschichte der frühkindlichen Sozialisation auch eine neue Sichtweise auf die kulturelle Dynamik im 20. Jahrhundert ergeben kann. Die Methode der Unterteilung der deutschen Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert in Generationen, die unterschiedlich leistungsbereit und leistungsfähig gewesen seien, je nachdem, ob ihre Geburt vor oder nach 1945 lag, wie jüngst vom Historiker Hans-Ulrich Wehler vorgeschlagen, hat genau an dieser Stelle einen blinden Fleck: Es wird nicht klar, wie es zu einer Unterbrechung der intergenerationalen Weitergabe von Erziehungsnormen kommen konnte, die Generationen stehen völlig losgelöst im Raum.7
Im Alltagsdenken wird zwischen Familienpraxis als etwas »Natürlichem« und der Welt der Expertise und der Politik unterschieden.8 Dieser etwas bemühten Trennung von öffentlichen Erziehungsvorstellungen und privatem Erziehen stelle ich eine andere Sichtweise entgegen: Ich unterstelle eine Verbindung von Alltagspraxis und Expertise, von subjektiver Erfahrung und Diskurs, von Privatem und Öffentlichem. Säuglingspflege und Kleinkinderziehung gehören zum »primären Alltags- und Kulturwissen«, das sowohl bewusst eingeholt als auch vorbewusst durch sozial Erlerntes innerhalb und außerhalb der Familie übernommen wird und das auch wieder zurückfließt in das Expertenwissen.9 Gerade für den Bereich der Frühsozialisation weiß man, dass Experten ihre Erfahrungen mit eigenen Säuglingen und Kleinkindern zu wissenschaftlichem Wissen umformuliert haben und auf diese Weise alltägliche Praxis diskursiv und autoritativ machen konnten. Insofern ist die Alltagsauslegung ein genauso wesentliches Element des Sozialisationsdiskurses wie die professionelle Wissensproduktion. An der Schnittstelle von Gesellschaft und Individuum oder Diskurs und Verarbeitung sind Veränderungen und Brüche erwartbar. Bei den wechselseitigen Rückflüssen kommt es immer wieder zu Veränderungen, Korrekturen, Annahmeverweigerungen.10 Diese Brüche sind es, auf die es letztlich ankommt, denn an ihnen entscheidet sich die Frage des geschichtlichen Wandels.
Die Versuchung, die Familienerziehung im 20. Jahrhundert als eine Privatangelegenheit zu verteidigen, wie die französische Historikerin Martine Segalen sagt, weil »jede familiale Zelle als einzigartig und unabhängig von kulturellen Einflüssen [...]« betrachtet wird, war vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus sicherlich besonders groß.11 Durch die Verbindung des gesellschaftlichen und familialen Wissens mit den individuellen Auslegungen und Handlungsspielräumen will dieses Buch den politisch umkämpften Graben zu überbrücken suchen. Es geht, erstens, um die Frage der gesellschaftlichen Sinnzuweisungen im Zusammenhang mit der frühkindlichen Versorgung und Erziehung und deren historisches Erbe und, zweitens, um die Frage der individuellen Spielräume; was haben Mütter und Väter aus den vorhandenen Optionen ausgewählt und wann bestand in der Weitergabesituation zwischen den Generationen die Möglichkeit, aus den vorgebahnten Pfaden auszuscheren? Es geht, um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, letztlich um die Chance des Wandels im Spannungsfeld von eigener Erfahrung, gesellschaftlichen Deutungsangeboten und Transmissionsdruck in der Familie. Die Klammer ist das Wissen. Meine Frage ist: Was konnten Eltern über ihre Aufgabe der Versorgung und Erziehung kleiner Kinder zu einem gegebenen Zeitpunkt wissen? Und wie haben sie dieses Wissen ausgelegt und gegebenenfalls modifiziert?
Das konkrete Vorhaben dieses Buches sieht also so aus: Um herauszufinden, wie der dominante Diskurs zur frühkindlichen Sozialisation im 20. Jahrhundert aussah, werden die wichtigsten Expertentexte analysiert. Anschließend nehme ich in den Blick, wie das Wissen der Fachleute, der Kinderärzte, Psychologen und Pädagogen, in subjektives Wissen »übersetzt« wurde.12 Schließlich stellt sich die Frage, wie das Wissen über die Generationenkette in den Familien durchgereicht beziehungsweise verändert wurde – wann waren die historischen Zäsuren?
Es ist nicht leicht, für den Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern immer sauber zwischen Erziehung und Sozialisation zu trennen, also zwischen den gezielten und den unbeabsichtigten Maßnahmen, die dazu beitragen, dass aus einem Neugeborenen eine »sozial handlungsfähige Persönlichkeit« wird.13 Mangels besserer Alternativen verwende ich den Begriff Sozialisation als Sammelbegriff, so wie es dem eher pragmatischen angelsächsischen Wortgebrauch von »socialisation« entspricht. Gemeint sind alle Aspekte der Versorgung, Betreuung, Erziehung und Beziehungsgestaltung von Eltern und Kindern, die beim Aufwachsen in der Familie sozial und kulturell bedeutsam sind. Dazu gehört mehr als das, was Eltern aktiv zur Erziehung ihrer Kinder leisten.14 Gemeint sind auch alle Grundhaltungen zum Kind, Vorstellungen von seinem Wesen, seinem Geschlecht und seinem Daseinszweck. Das alles konkretisiert sich in der Haltung zum Kind, im Umgang und in den Erziehungsvorstellungen.
Bei der Einschätzung der Geschichte der Kindheit und kindlichen Sozialisation im 20. Jahrhundert in Deutschland hat sich eine Sichtweise etabliert, wonach die Nachkriegsjahre und dann die Reformära ab Mitte der 60er Jahre einen großen Fortschritt brachten im Sinne von wachsender Autonomie des Kindes und Demokratisierung familialer Beziehungen.15 Die Trümmerzeit wurde als Moment der »Kontrolllücke« beschrieben, in der Kinder die Chance hatten, eine Zeit lang weitgehend frei von elterlicher Autorität aufzuwachsen, weshalb eben diese »Kinder« später ihre ersten Freiheitserfahrungen zum Reformprogramm erheben konnten.16 Es schloss sich eine Phase der Verbesserung des Lebensstandards, der geographischen und sozialen Mobilität sowie der Bildungsexpansion an, die einen breiten zweiten Individualisierungsschub auslöste.17 Diese Entwicklung kam an ihren Kulminationspunkt im Jahr 1968, als die Kinder der »Kontrolllücke« mit ihren Erziehungsreformen ambivalente Phänomene erzeugten: einen wenn nicht antiautoritären, so doch zumindest demokratischeren Beziehungsstil, aber auch eine pädagogisierte oder gar psychologisierte Kindheit; intimere Eltern-Kind-Beziehungen, die aber auch selbstsüchtigen Bedürfnissen der Eltern Vorschub leisteten, und den »narzisstischen Sozialisationstypus«; und in der Gegenwart in den Worten des Sozialisationsforschers Klaus Hurrelmann eine »überemotionalisierte Wertschätzung des Kindes«, andere reden von »kindlichen Tyrannen«.18 Dieser insgesamt eher pessimistischen Bilanz stehen kaum positive Beschreibungen gegenüber. Niemand würde es wagen, eine Fortschrittsgeschichte der Familienbeziehungen im 20. Jahrhundert zu erzählen. Der einem demokratischen Staat angemessenen Veränderung im Erziehungsstil unter dem Schlagwort »Vom Gehorsam zum Aushandeln« wird kaum noch applaudiert.19 »Vielleicht gibt es etwas in der bitteren Welt der Erwachsenen, das sie immer meinen lässt, Kinder würden jetzt mehr verwöhnt als in der Zeit, als sie selbst noch jung waren«, vermutete ein spitzfindiger Kindheitsforscher. 20 Man kann es auch so sagen: Das eigene Aufwachsen scheint so identitätsstiftend zu sein, dass andere Formen des Aufwachsens fast grundsätzlich abgelehnt werden.
Das Buch wird dieser Fortschritts- und Niedergangsmythologie im 20. Jahrhundert auf den Zahn fühlen; und zwar für die Vorstellungen in der frühkindlichen familialen Sozialisation, also für die wichtige und grundlegende Phase, bevor Kinder in den Kriegstrümmern »Räuber und Gendarm« spielen und Erfahrungen in Freiheit sammeln konnten.
Die Geschichte der frühesten Kindheit im 20. Jahrhundert ist ein bislang weitgehend unbestelltes Feld.21 Das mag mit der »merkwürdigen Körperlosigkeit« zusammenhängen, wie sie der Kindheitsforscher Ulf Preuss-Lausitz bei den meisten Theorien des Aufwachsens beanstandet. Sie befassen sich zu selten mit der Frage, wie gestillt oder abgehärtet wurde, wie sich vorbewusste gesellschaftliche Vorstellungen in den Körper des Kindes einschreiben konnten.22 Besonders die Geschichtswissenschaft hat darüber hinaus sicher auch ein Problem mit einem Thema, das sich vordergründig hauptsächlich im Privaten zwischen Müttern und Kindern abspielt. Zudem gibt es wenig Theorieangebot für die historische Erforschung der frühkindlichen Sozialisation. Eine Ausnahme bildet die Psychoanalyse, die im Grunde alles Nachdenken über die erste Lebenszeit und ihre Folgen dominiert, sei es in der vergleichenden Völkerpsychologie, der Anthropologie, in den Sozialwissenschaften oder der Geschichte. Die bekannteste Annäherung an die Untersuchung von Kindheit und Gesellschaft war die Autoritarismusforschung.23
Auch wenn das Autoritarismusparadigma weltweit angewendet wurde, zuletzt etwa bei der Erforschung des Rechtsradikalismus in der DDR, so bleibt es doch vor allem mit dem Nationalsozialismus verbunden. Gleich nach dem Krieg hatte die Information Control Division des amerikanischen Militärregiments in Deutschland ein psychiatrisches Gutachten der deutschen Familie erstellt, in der Hoffnung, so etwas über die ideologische Verlässlichkeit potenzieller politischer Funktionsträger herauszufinden. Bertram Schaffner von der Columbia University fasste nach seinen Hausbesuchen und Befragungen einige Eckpunkte der deutschen Familienerziehung jener Zeit zusammen, die bis heute das Bild von damals prägen: Die deutsche Familie gründe auf einem konsequent patriarchalen Modell, in dem die Mutter auch in Erziehungsfragen nur als Repräsentantin des Vaters agieren dürfe, offen gezeigte Zärtlichkeit verpönt sei und das Kind vom ersten Lebenstag an durch ein striktes Regelwerk an Disziplin, Fleiß, Pflichterfüllung, Gehorsam, Ordnungsliebe, Reinlichkeit, starre Männlichkeits- und Weiblichkeitsideale, Familienloyalität, Passivität gegenüber den Stärkeren und Nationalstolz gewöhnt werde.24 Der psychiatrische Gutachter schlussfolgerte, eine Entnazifizierung der Deutschen müsse bei der väterlichen Gewalt und dem kindlichen Gehorsam ansetzen.25
Schaffners Studie war keine bloße Momentaufnahme, sie bezog die Geburtsjahrgänge bis 1890 mit ein, und die Ergebnisse scheinen nicht aus der Luft gegriffen. Als unbefriedigendes erkenntnistheoretisches Instrument hat sich aus Sicht der Geschichtswissenschaften jedoch das zugrunde liegende Paradigma des Autoritarismus herausgestellt.
Auf die Probleme der klassisch psychoanalytischen Grundannahmen des Autoritarismuskonzepts ist mehrfach hingewiesen worden: das nicht mehr aktualisierte bürgerlich-patriarchale Familienbild als theoretische Grundlage, das Primat der Ökonomie, die schon frühzeitige Nichtbeachtung der voranschreitenden psychoanalytischen Theoriebildung.26 Nicht nur waren die vorausschauenden empirischen Ergebnisse enttäuschend, das von der klassischen Psychoanalyse gelieferte Menschenbild, wonach ein überzeitlich und überkulturell ablaufender Inkorporierungsprozess der elterlichen Autorität mit einer neuralgischen Stelle während der ödipalen Phase automatisch zu bestimmten Sozialisations- bzw. Autoritätstypen führe, wird den Vorstellungen der Geschichtswissenschaft von Entwicklung und Wandel nicht gerecht. Auch in der Psychoanalyse selbst steht diese Theorie unter der Kritik des Zeitverzugs.27
Dennoch hat es zahlreiche Versuche gegeben, deutsche Sozialisationsgeschichte mit ihrer Hilfe zu erklären. Zu den kuriosesten Wiederbelebungsversuchen des Autoritarismuskonzepts gehörte der Einfall des westdeutschen Kriminologen Christian Pfeiffer im Jahr 1999, gewalttätigen Rechtsradikalismus in den neuen Bundesländern der Sauberkeitserziehung in den DDR-Krippen anzulasten. Eine abwegige Einlassung, die die neuere psychoanalytische Theoriebildung schlichtweg verschlafen hat.28
Die wichtigste Fortentwicklung der psychoanalytischen Theorie ist die Bindungstheorie. Im Unterschied zum Autoritarismusparadigma begründete das Bindungsparadigma die Zusammenhänge zwischen Sozialisationsnormen und Persönlichkeitsentwicklung nicht mehr mit der autoritären Triebunterdrückung beim Kind (»Töpfchensitzen«), sondern mit der quasi natürlichen, aber störanfälligen Bindungsqualität zwischen Mutter und Kind. Die Bindungstheorie war und ist eine der einflussreichsten Konstrukte der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie seit den 40er Jahren und bietet bis heute einen wichtigen Orientierungspunkt.29 Nicht die mehr oder weniger brachiale Unterdrückung von Trieben zugunsten der Forderungen der Welt, sondern die intuitiv ablaufenden gefühlsmäßigen Interaktionen zwischen Kind und Betreuungsperson wurden zur Voraussetzung einer Erfolg versprechenden Persönlichkeitsentwicklung erklärt. Der Psychoanalytiker, der einen entscheidenden Beitrag zur Etablierung dieser Theorie geleistet hat, selbst ein »geschädigtes« Internatskind, war der Brite John Bowlby. Seine Beobachtungen der Folgen von Mutter-Kind-Trennungen aufgrund des Zweiten Weltkriegs hatten die Erkenntnis geliefert, dass eine rein auf den Körper abzielende Pflege nicht ausreiche. Der Säugling brauche, um zu überleben, ein Mindestmaß an emotionaler Zuwendung. Das erklärte Bowlby mit natürlichen Bindungswünschen des Kindes. Die 1951 im Auftrag der Weltgesundheitsbehörde geschriebene Populärfassung seiner Theorie, Mütterliche Fürsorge und seelische Gesundheit, machte ihn und seine Gedanken weltberühmt. In den 60er Jahren tat die Disziplin den entscheidenden Schritt, indem sie die Bindungsqualität innerhalb bestehender Mutter-Kind-Beziehungen zu messen begann. Es entstanden Testverfahren und Skalen ähnlich wie in der Autoritarismusforschung. 30
Die Bindungstheorie hat schon vor Jahren eine zweite Annäherung an das Problem des frühkindlichen Aufwachsens in der NS-Zeit ermöglicht. Mit dem Schwenk vom Primat der väterlichen Autorität auf das Primat der mütterlichen Bindung, der Abwendung vom ödipal-autoritären und der Hinwendung zu präödipal-bindungstheoretischem Denken konnten erstmals Fragen nach den konkreten Beziehungen zwischen Mutter und Kind in den ersten drei Lebensjahren gestellt werden.
Es ist zu vermuten, dass der Anstoß dazu aus lebensgeschichtlichen Erfahrungen der damit befassten Psychoanalytikerinnen kam. Anita Eckstaedt war wahrscheinlich die erste deutsche Psychoanalytikerin, die das heiße Eisen der spezifisch deutschen Rahmenbedingungen der frühkindlichen Sozialisation angefasst hat. Nach einer Arbeitstagung zu den psychischen Auswirkungen von Krieg und Verfolgung in Psychoanalysen im Jahr 1980 schrieb sie, Analytiker könnten in ihrer Praxis häufig beobachten, dass Erfahrungen mit dem Totalitarismus in der Kindheit durch Übertragung in der nächsten Generation als Erkrankung wiederkehrten: »Im ›Dritten Reich‹ war versucht worden, eine Kluft zwischen Eltern und Kindern einzurichten. Es war zum Beispiel die Parole ausgegeben worden: ›Schenkt Hitler ein Kind!‹ Diese Distanz ist durch das spätere Schweigen der ›ersten Generation‹ bestehen geblieben.«31
Wenig später traten die Psychoanalytikerinnen Sigrid Chamberlain und Ute Benz an, diese Beobachtung aus der therapeutischen Praxis historiographisch zu untermauern.32 Als Informationsquelle über die frühkindliche Erziehung in der NS-Zeit benutzten sie die berühmte Schrift der Ratgeberautorin und Nationalsozialistin Johanna Haarer, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind.33 Der wichtigste deutsche Elternratgeber, der erstmals 1934 erschien und zu einem Longseller bis 1987 wurde, lieferte ihnen mehr als genug Anhaltspunkte für eine bindungstheoretische Argumentation, die vergleichsweise populär geworden ist: Die Haarer’schen Ratschläge zur Säuglingspflege und zur frühkindlichen Erziehung in der NS-Zeit hätten einem gesunden und gewissermaßen »normalen« Bindungsverhalten zwischen Mutter und Kind entgegengestanden. Somit habe es das nationalsozialistische Sozialisationsmodell von Anfang an darauf angelegt, die allzu enge Mutter-Kind-Bindung zu sprengen, um den Nachwuchs leichter loseisen und für die politische Sache – Hitlerjugend, Partei, Armee – einspannen zu können.
Die Überzeugungskraft der Bindungstheorie ist so groß, dass sie heutzutage weder benannt noch begründet werden muss, sie gehört zum Common Sense. Trotzdem gilt für sie das Gleiche, was gegen die auf das klassische Triebmodell zurückgehende Autoritarismustheorie eingewendet werden kann: Auch sie ist ein Kind ihrer Zeit und sollte, selbst wenn ihr Erklärungsmodell uns heute sympathischer sein mag, auf ihre Vorannahmen und ihre kulturellen und historischen Bezüge hin überprüft werden. Sie als Maßstab für die Beurteilung der historischen Interaktionen zwischen Müttern und Kindern anzulegen, kann anachronistisch sein. Erstens wird unterstellt, eine natürliche, kulturell konstante Anthropologie programmiere Mütter und Kinder auf ein bestimmtes Bindungsverhalten. Damit stellt sich für die Historiographie aber die Frage, warum Frauen früher von ihrer angeblichen Verhaltensdisposition abgewichen sind. Zugespitzt ausgedrückt: Haben Mütter bis zur »Erfindung« der Bindungstheorie von ihrer eigentlichen Natur nichts gewusst und unendliche Generationen von Kindern zur Bindungsschwäche verurteilt? Offensichtlich treten mit der Bindungstheorie als geschichtswissenschaftlicher Kategorie die gleichen Probleme auf wie mit den klassisch-triebtheoretischen Sozialisationstheorien. Sie verführen zu einem statischen und letztlich ahistorischen Modell ohne Chance auf Wandel.
Zweitens schaffen Untersuchungen auf bindungstheoretischer Grundlage neuen Erklärungsbedarf.34 Die damals in Deutschland kursierenden Vorstellungen zum Umgang mit Kleinkindern waren alles andere als exklusiv. Sie standen im Kontext einer internationalen »psychologisch-naturwissenschaftlichen Revolution« und waren keineswegs eine Erfindung des Nationalsozialismus. Mehr noch: Sie waren auch nach 1945 noch lange nicht aus der Welt. Das heißt aber, dass man der NS-Frühsozialisation auf diesem Weg keine Einzigartigkeit zusprechen kann.
Um solche theoretischen Klippen zu umschiffen, soll hier nicht mit der Psychoanalyse argumentiert, sondern über sie gesprochen werden. Dafür gibt es noch einen handfesteren Grund: Wer psychoanalytisch oder psychohistorisch vorgeht, will von den Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen reden. Damit kommt etwas ins Spiel, was die Geschichtswissenschaft nicht leisten kann, nämlich die Wirkung bestimmter Erfahrungen auf das Innere der Menschen zu ermessen. Aus den Befunden zur frühkindlichen Sozialisation im 20. Jahrhundert Schlüsse abzuleiten auf einen deutschen Sozialcharakter, muss ich anderen überlassen. In diesem Buch geht es um die kulturellen Konstrukte bei den Vorstellungen zum Wesen des Kindes. Es geht um das Menschenbild und die dazugehörigen Vorstellungen von der Mensch-Umwelt-Beziehung; es geht um die daraus abgeleiteten Vorstellungen zum Umgang mit dem Kind; und es geht um die Haltung der Eltern zum Kind konkretisiert im Bereich der Beziehung und um die Erziehungsvorstellungen der Eltern. Dabei wird die Herausforderung darin bestehen, die speziellen Vorstellungen der Deutschen in den zeitgenössischen größeren Sinnzusammenhängen zu sehen und so letztlich die Frage zu beantworten, ob es eine besondere deutsche Hypothek gibt für die Haltung zum Kleinkind.
Ein weites Feld wird vermessen: Es reicht in seinen Anfängen zurück ins 18. Jahrhundert und endet in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die DDR wird, wenn auch weniger eingehend, mit berücksichtigt.35 Wo es sinnvoll und möglich ist, bildet der Westen, besonders die US-AMERIKANISCHE Situation, einen Referenzpunkt.
Im 19. Jahrhundert wurde es im Bürgertum mehr und mehr üblich, auch die Säuglingspflege und Kleinkinderziehung nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten. Drei Schübe lassen sich in der einschlägigen Wissensentwicklung beobachten: Zunächst eine »erhöhte Produktion medizinischen und pädagogischen Gebrauchswissens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, die sich ungebrochen fortsetzte bis in die unmittelbare Gegenwart«. Dann die Verwissenschaftlichung und Pädagogisierung der frühen Kindheit um 1830/1850, die in der Institutionalisierung der Kindheitsforschung, in privaten und öffentlichen Einrichtungen der Kindererziehung und in der Professionalisierung der Kinderpädagogik zum Ausdruck kamen, schließlich eine »naturwissenschaftlich-psychologische Revolution der Wissenskultur um 1880/1900«, die der Erforschung der Kindheit neue Fundamente verlieh und reformpädagogische Experimente auslöste. 36
Familienleben und Kinderziehung wurden zunehmend zur expertengeleiteten Alltagserfahrung. Die traditionellen Formen der Kindererziehung gerieten gegenüber populären Unterweisungen in die wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr und mehr ins Hintertreffen. In vielen Fällen waren es die gebildeten bürgerlichen Eltern selbst, das heißt im 19. Jahrhundert vor allem Väter, die Neues in den Wissenskreislauf über kindliche Entwicklung einspeisten. Umso mehr sich diese Kenntnisse verbreiteten, umso größer wurde die Notwendigkeit, sich das Wissen auch anzueignen: »Unverkennbar verlagert sich dabei der Zeitpunkt der Vermittlung elementaren Wissens in allen gesellschaftlichen Schichten immer tiefer in die frühe Kindheit hinein.«37
Eine Möglichkeit, sich der neuen Erkenntnisse zu versichern, war das Schreiben darüber. In diesem Zusammenhang entstand ein Genre der expertengeleiteten individuellen Verarbeitung von Wissen über frühkindliche Erziehung, das im Mittelpunkt des Buches stehen wird – das Elterntagebuch. Ein Elterntagebuch ist, ganz allgemein gesagt, ein Dokument, das schon während der Schwangerschaft, bei der Geburt eines Kindes oder später angelegt wird, um darin in chronikalischer Form mehr oder weniger ausführlich über das Wachsen und Werden des Kindes, aber auch über die eigenen Gefühle und Wahrnehmungen der schreibenden Mütter bzw. Väter zu berichten.
Es ist die Besonderheit dieser im Großen und Ganzen bislang unerschlossenen historischen Quelle, dass sie es möglich macht, einen Ort aufzusuchen, an dem sich Diskurs und Praxis idealtypisch verschränkten: Das Elterntagebuch lag und liegt wie ein Scharnier zwischen den Vorstellungen der Expertise und denen der Eltern. Denn es gab von Anfang an Anleitungen zum Ausfüllen der Elterntagebücher, sozusagen Modellelterntagebücher. Darin fanden die Schreibenden exakte Vorgaben an die Tagebuchführung – und dadurch auch an die praktische Seite der Umsetzung der entsprechenden Vorstellungen, die das Tagebuchschreiben anleiteten. Durch gezielte Fragen und Rubriken konnten die Experten den Blick der Eltern direkt auf die kritischen Punkte bei der frühkindlichen Entwicklung und auf die Desiderate einer modernen, wissenschaftlichen frühkindlichen Sozialisation und Erziehung lenken. Diese Eckdaten sind uns heute noch selbstverständlich: das erste Lächeln, die ersten Schritte, die ersten Worte …
Experten, überwiegend Ärzte, später Psychologen als zweitwichtigste Fachgruppe, sammelten zunächst selbst in Form von Beobachtungstagebüchern Wissen und Erfahrungen im Kontext der frühkindlichen Sozialisation. Sie institutionalisierten ein Genre, das zur Etablierung und Verbreitung von Normen höchst geeignet war, dann riefen sie Eltern auf, sich dieser Form zu bedienen, schließlich »sammelten« sie diese Schriften wieder ein, um daraus neues Wissen zu generieren.
Das Elterntagebuch als Ensemble von Schreibregeln und Sozialisationsnormen ergänzt ein anderes praxisnahes Wissensmedium, den Elternratgeber.38 Wissenschaftshistorische Arbeiten speziell zur Pädiatrie und zur Kinder- und Entwicklungspsychologie runden das Bild der frühkindlichen familialen Sozialisationsnormen ab, so wie die Expertise sie sich wünschte. Doch was haben die Eltern daraus gemacht?39 Wie vertrugen sich die vermittelten Ratschläge zur frühkindlichen Erziehung und Sozialisation mit den familial weitergegebenen Vorstellungen und den aktuellen Erfahrungen der Eltern in der Erziehungssituation? Die Zusammenführung der Normen mit den individuellen Elterntagebüchern in diesem Buch soll uns dorthin führen, wo sich das gesellschaftliche Wissen sozial und subjektiv gefiltert in der Praxis beweisen musste.40
Methodisch folgte daraus die Entscheidung, die Tagebücher nicht als beliebige Steinbrüche zu behandeln, sondern sie in ihrer Einzigartigkeit der lebensweltlichen Konkretisierung ernst zu nehmen.41 Sie sind eine soziale Praktik, die den Sozialisationsprozess strukturiert und letztlich mit geformt hat.42 Und sie funktionieren als ein Medium der normativen Weitergabe zwischen den Generationen: Es bilden sich darin nicht nur die Deutungsgewohnheiten der Elterngeneration ab, sondern auch Normen und Werte, die an die Kindergeneration adressiert werden können, die das Konvolut normalerweise eines Tages erbt, nämlich genau dann, wenn sie selbst Kinder bekommt.
Die verwendeten Tagebücher stammen zu einem kleinen Teil aus dem Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen, 90 Prozent hingegen sind mir aus privatem Besitz von Familien anvertraut worden. Dazu wurden nach dem Prinzip der möglichst flächendeckenden regionalen Verteilung Anzeigen in überregionalen und regionalen Zeitungen geschaltet sowie in einem Frauenmagazin.43 Insgesamt kamen auf diesem Weg 50 Familien zusammen, die im Zeitraum zwischen 1892 und 2003 mit einer recht ausgewogenen Verteilung über die Jahrzehnte und die beiden deutschen Staaten 73 Elterntagebücher geführt haben. Es gab Familien, die mehrere Tagebücher für Geschwisterkinder beisteuern konnten, und in einigen wenigen Fällen auch Familien, in denen über mehrere Generationen hinweg Tagebuch geführt wurde. Das so gefundene Quellenmaterial ist also nicht systematisch entstanden, die Auswahl traf der Zufall der Meldung interessierter Tagebuchbesitzer.
Der Bevölkerungsausschnitt, der sich so fassen ließ, ist natürlich ein besonderer. Wir haben es mit Müttern und Vätern mit einer hohen Bildungskompetenz und mit ausreichenden materiellen und zeitlichen Ressourcen zu tun, um sich derart intensiv mit der Entwicklung ihrer Kinder auseinandersetzen zu können. Fast alle haben einen akademischen Ausbildungstitel, die Berufe der Eltern verteilen sich auf den öffentlichen Dienst, auf selbstständige und angestellte kaufmännische Berufe und auf freischaffende oder angestellte Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich. Zwei Adelsfamilien im ländlichen Bereich bilden die Ausnahme eines ansonsten mittel- bis großstädtischen Milieus.
Diese soziale Begrenztheit bei recht hoher Homogenität bedeutet nicht nur eine Beschränkung der Aussagekraft dieser Quellen. Zwischen Anfang des 20. Jahrhunderts und den späten 60er Jahren verbreitete sich das vor allem von der Medizin und der Entwicklungspsychologie neu formulierte Wissen über den Säugling und das Kleinkind in der Gesellschaft. Die Gruppe der Elterntagebuchschreiber war dafür prädestiniert, als erste von diesem neuen Wissen zu profitieren, sie kann als eine Erziehungsavantgarde bezeichnet werden.44
I.
Das beobachtete Kind
Was konnten Eltern über die Aufgabe der frühkindlichen Sozialisation wissen, was wussten sie und was haben sie daraus gemacht? Seit der Aufklärung war in diesen Fragen eine Gesellschaftsschicht tonangebend, das Bürgertum, das seither alle Diskussion in Sachen Familie und Erziehung dominiert und seine Zielvorgaben für vorbildlich, wenn nicht sogar für verbindlich erklärt.1 Diese bürgerliche Schicht begann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch Normen der frühkindlichen Sozialisation zu formulieren und in der Alltagspraxis zu reflektieren. Ein geeignetes Medium, das dabei institutionalisiert und seither unaufhaltsam wichtiger wurde, war der Erziehungsratgeber für Eltern; das andere Medium, das mehr und mehr der Selbstkontrolle der elterlichen Sozialisationsleistungen diente, war das Elterntagebuch. Über einen langen Zeitraum fielen diese beiden Aufgaben, die Anleitung und die Verschriftlichung der Erfahrungen, zusammen: Einerseits half das Tagebuch dabei, durch systematische Beobachtung etwas über die Sozialisationsaufgabe herauszufinden, andererseits wurde es zur – oft von Experten vorgelegten – auch käuflich zu erwerbenden und auszufüllenden Modellvorlage für Eltern und half bei der Erfüllung der normativen Erwartungen in der Erziehungspraxis. Im Lauf des 20. Jahrhunderts hat es als privates Kontroll- und Reflexionsmedium immer weitere Kreise erreicht.2 Wenn heute frischgebackene Eltern Weblogs führen, greifen sie diese alte bürgerliche Tradition auf – und beschäftigen sich teilweise immer noch mit denselben Themen: das erste Lächeln, die ersten Schritte …
1.Vom bürgerlichen Tagebuch zum Weblog
Die Gestaltung der Tagebücher gibt bereits einigen Aufschluss über die sich verändernden elterlichen Vorstellungen von Frühsozialisation. Eine gedruckte Tagebuchvorlage Unser Kind aus dem späten 19. Jahrhundert, die ausgefüllt werden sollte, zielte noch ganz auf bürgerliche Repräsentation. Hier wurde die teure Atelieraufnahme des Kleinkindes (Baby auf Bärenfell) zur Schau gestellt, und selbstverständlich kam auch das Personal hier und da vor. Seit den 30er Jahren tauchten schmucklose Exemplare auf, vom Vater handgetippt, in die nicht nur die Entwicklung des Kindes, sondern auch die der Frontlinie im Zweiten Weltkrieg eingetragen wurden.3 Ein Kuriosum ist ein Tagebuch aus den 40er Jahren, in dem zwar die Namen der Ärzte, aber nicht der des Kindes notiert ist – in dieser Zeit hatte die medizinische Expertise den größten Einfluss auf das Schreiben über das Kind. Eine sachlich-funktionale Anmutung hat auch das gedruckte Mehrzwecktagebuch von 1970, das gleichzeitig als Adressbuch, Kalender, Perioden-, Schwangerschaftskalender, Vorsorge- und Mutterpass, Ratgeber, Ahnenpass, Einkaufszettel und Impfkalender verwendbar war.4 Typisch für das linksalternative Milieu und dessen Zugang zur Kinderfrage ist ein Exemplar aus den 70er Jahren, das in dieser Zeit sicherlich millionenfach gekaufte ›chinesische‹ Modell mit Stoffbezug und Lederecken und farbig bedruckten Seiten, in das die Mutter schon zu Beginn der Schwangerschaft ihre Gefühle einzutragen begann.5 Ein im Handel erworbenes Beispiel aus den 80er Jahren war aufwendig illustriert, was die Mutter ästhetisch reizvoll gefunden haben mag. Die vorgegebenen Rubriken ignorierte sie konsequent – Ausdruck des gewachsenen Selbstbewusstseins der Eltern.6 Schon Äußerlichkeiten der Tagebücher dokumentieren also, wie unterschiedlich die Schwerpunkte bei den frühkindlichen Sozialisationsvorstellungen in den letzten hundert Jahren gesetzt wurden.
Ein durchgängiges Motiv der Tagebuchschreiber, abgesehen von Beobachtung und Kontrolle, war das der sozialen Repräsentation. Nicht erst die Webblogs dienen der stolzen Selbstdarstellung glücklicher Elternschaft, auch die bürgerlichen Lederalben mit Familienwappen auf dem Deckel waren mehr als rein private Erinnerungshilfen. 7 Im linksalternativen Milieu der 70er Jahre hat man sich davon ganz bewusst abgewandt und betont informelle Tagebücher geführt, zum Beispiel linierte Losezettelsammlungen.8 Eine eigene Untersuchung wert wären auch die eingeklebten Fotografien, die sich bald vom legendären Baby-auf-Bärenfell-Motiv wegzubewegen begannen. Auch hier lassen sich Trends erkennen: Kind auf dem Arm der Mutter, beide in eine ferne Zukunft blickend (typisch für die NS-Zeit); das Großmutter-Enkel-Motiv unter dem Weihnachtsbaum oder das vermutlich wichtigste Motiv: Kleinkind auf dem Topf, typisch für die 50er und 60er Jahre. Nicht zu vergessen die Väter, die sich immer weniger genant mit dem Säugling abbilden ließen. Fotos waren aber nicht die einzigen Beigaben der Elterntagebücher. Daneben finden wir Wiegekarten, Zeichnungen, eingeklebtes Werbematerial, getrocknete Blumen, die der Vater von der Front geschickt hat, Hand- und Fußumrisse des Kindes, die erste abgeschnittene Haarlocke, das erste Ultraschallbild und vieles mehr.
Die hier zu untersuchenden Tagebücher setzen, bis auf die ersten Tagebuchvordrucke aus der Kaiserzeit und ein Exemplar aus dem Jahr 1904, um den Ersten Weltkrieg herum ein.9 Zu diesem Zeitpunkt hatte die Modernisierung der Säuglingspflege Fahrt aufgenommen, die Erwartung an die Eltern, sich auf die Frühsozialisation zu konzentrieren, war gestiegen. Ein weiterer Zeitumstand war, dass die Lebensläufe fragiler wurden, biographische Einschnitte wie zum Beispiel Berufswechsel, Trennungen, Wohnortwechsel nahmen enorm zu. Dieser Umstand verstärkte das Interesse an identitätsstiftenden sozialen Praktiken wie Autobiographien oder Tagebüchern.10 Abgesehen von den sachlichen und technischen Aspekten der Reproduktion und Säuglingspflege (Ahnentafeln, Wiegetabellen, Impftermine, ärztliche Kontrollen u. Ä. wurden integriert oder beigefügt), wuchs den Elterntagebüchern immer mehr die Funktion der Erinnerungshilfe zu.
Unter dem Eindruck von Schwangerschaft, Geburt und den fundamentalen Veränderungen des eigenen Lebens und dem des Kindes liegt der Gedanke offenbar nahe, diese Momente für die Zukunft in Schrift und Bild zu dokumentieren. Ganz allgemein gesprochen, hilft das Elterntagebuch nicht nur dabei, die verstreichende Zeit einzuteilen, sondern auch, sie erinnerbar zu machen.11 Was als erinnerungswürdig galt, ist variabel, doch der grundsätzliche Impuls bleibt der Gleiche: Einerseits sollte die eigene Fortpflanzung und der Positionswechsel in der Generationenfolge dokumentiert werden und andererseits wollte man die Veränderungen des Kindes dem unaufhaltsamen Voranschreiten der Zeit entreißen. Die Eltern hofften, durch die Niederschrift einmalige und kostbare Erfahrungen festhalten zu können; man kann gleichzeitig sagen, durch die Tagebücher wurden bestimmte Ereignisse überhaupt erst bedeutsam und erinnerungswürdig. Jedenfalls rechneten die Schreibenden damit, dass sie später einmal gerne an diese früheste Phase ihrer Elternschaft zurückdenken würden. »Vielleicht, wenn Papi und ich alt sind, erinnern wir uns gern an die Zeit, als Du kamst.«12
Die Zeit wird im Lauf des 20. Jahrhunderts als immer flüchtiger wahrgenommen. So war eine Mutter im Jahr 1981 bereits nach vier Monaten froh darüber, die Eindrücke der ersten Wochen nachlesen zu können, da sie schon so sehr von der Gegenwart überdeckt seien.13 Fragt sich, ob sich die Hoffnung der Schreibenden auf einen zukünftigen Erinnerungswert ihrer Notizen erfüllt hat. Oftmals verloren die einstmals ausgewählten Momentaufnahmen mit der Zeit an Wert. Einige Eltern bemerken heute enttäuscht, dass sie hauptsächlich technische Angaben, Fütterungszeiten, Gewichtszunahme und Ähnliches eingetragen haben und wenig Qualitatives. Ob und wie stark die Tagebuchinhalte erinnert werden, hat natürlich auch mit der zwischenzeitlich erfolgten autobiographischen Bearbeitung und Einschätzung dieser Lebensphase zu tun. So gestand eine Interviewpartnerin, dass sie sich für ihr in den 80er Jahren als junge Frau von 23 Jahren geschriebenes Tagebuch heute schäme und sich nicht an seinen Inhalt erinnern lassen wolle. In anderen Fällen identifizierten sich Menschen noch Jahrzehnte später mit der Lebensphase als junge Eltern, was sich zum Beispiel in einer nochmaligen Abschrift des Tagebuchs oder auch in der engagierten Mitarbeit an meinem Forschungsprojekt äußern konnte.
Das 20. Jahrhundert war mindestens ebenso ein Jahrhundert der Eltern wie ein »Jahrhundert des Kindes« (Ellen Key). Sie haben sich in ihrer Rolle immer intensiver bemüht und dabei wertgeschätzt und unersetzlich gefühlt. Mit dem Elterntagebuch schufen sich Mütter und Väter auch selbst ein Monument. Es war eine Option auf Unsterblichkeit, denn damit schrieben sie sich auf immer in die Erinnerung ihrer Kinder ein oder versuchten es zumindest. Das Babytagebuch bietet in dieser Hinsicht eine besonders günstige Gelegenheit, denn das Beschriebene entzieht sich weitgehend der kritischen Überprüfung. Das heißt, die Autorinnen/Autoren hatten alle Möglichkeiten der Selbststilisierung. Das reicht von den Nachweisen der eigenen Gewissenhaftigkeit bei der Gesundheitsvorsorge und Säuglingspflege über die dokumentierten Erfolge etwa beim Toilettentraining bis hin zu expliziten Liebesbekundungen an das Kind.
In manchen Fällen standen hinter dem Bedürfnis, dem Kind ein Bild von sich selbst zu entwerfen, auch ganz handfeste Gründe, zum Beispiel die Angst vor dem eigenen vorzeitigen Ableben:
»Nun noch eines, du lieber neuer Mensch, wer wir sind, wirst Du bis dahin selbst sehen, ehe diese Zeilen in Deine Hände gelegt werden, wer wir waren, auch das wird sich, wenn es so einen Wert hatte, Dir offenbart haben. Sollte aber uns nicht vergönnt sein, Dich im Leben zu begleiten, bis Du alles selbst erfassen kannst, dann sollen diese Zeilen Dir zeigen, wer Deine Mutter war. Nur einmal schreibe ich es nieder, ich liebe dich unbeschreiblich!«14
Elterntagebücher sollen eben nicht nur die Erinnerungen der Erwachsenen bewahren, sondern auch die Erinnerung des Kindes steuern. Dabei ging es auch darum, die Zeiten, in die das Kind hineingeboren worden war, auf Papier zu bannen.
»Groß ist die Zeit, in der Du das Licht der Welt erblickt hast. Sechs Jahre ist Adolf Hitler an der Macht. Er hat Deutschland aus tiefster Not empor geführt zu einer neuen Blüte. Er hat das tausendjährige Sehnen nach einem Grossdeutschland erfüllt und nun standen die Neider um unsere Einigkeit und unseren Emporstieg auf und brachen einen Krieg vom Zaun. […] Jede grosse Zeit erfordert grosse und harte Menschen, gross im Können, im Charakter und im Glauben. […] Wenn Du an Deinem 16. Geburtstag diese Tagebuchblätter erhältst, dann fängst du schon an selbständig zu werden in Deinem Denken und Handeln. […] Zeige Dich Deiner Vorfahren würdig! Auch Du bist ein Glied in der grossen Geschlechterreihe, dem Geschlecht der B. Du sollst sein und bleiben ein guter Deutscher [geschwärzt] und ein überzeugter Katholik. Deine Eltern«15
Im Jahr 1964 übernahm eine Mutter für ihren Sohn die Rolle der Chronistin seines Lebens. Sie gab regelmäßig ihre Einschätzung der Stimmung im Lande ab, der deutschen Parteienlandschaft, einzelner Figuren wie Ludwig Erhard, Franz Josef Strauß und des verstorbenen John F. Kennedy sowie der weltpolitischen Lage, nicht ohne sich dabei für ihre angebliche Oberflächlichkeit bei dem implizit mitlesenden Ehemann zu entschuldigen:
»Später wird man wahrscheinlich mal sagen, daß die Jahre 64/65 politisch sehr bedeutsam gewesen sind. China zündete die erste Atombombe und in Moskau musste Chruschtschow von der politischen Bühne abtreten […] Alle glauben, daß die 750 Millionen gelben Bewohner Asiens der Welt noch einige Schwierigkeiten bereiten werden. Die einzige Möglichkeit, dieses Volk im Zaum zu halten, ist die hoffentlich stetige militärische Überlegenheit der USA.«16
Die politischen Einordnungen haben nicht nur chronistischen Charakter, sie eignen sich auch, wie im klassischen Tagebuch, zur Selbstreflexion der Schreibenden und transportieren Aufträge an die Nachkommen. Die letztgenannte Mutter sah den Sinn ihres Lebens darin, das Leid anderer Menschen zu erkennen und zu lindern – ein Anliegen, das sie an ihre Söhne weitergeben wollte -, auch in Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands und ihrer »schrecklichen Dummheiten und Verblendung«, die »solches Grauen auslösen« und vor deren Wiederkehr sie sich fürchtete.17
Neben der Hoffnung auf eine spätere Würdigung der liebevollen Sorge kristallisiert sich im Untersuchungszeitraum der Dialog mit dem Kind als immer wichtigeres Motiv der Eltern heraus. Da das Kind aber im Verlauf des 20. Jahrhunderts zunehmend schon im Bauch der Mutter als autonome Person betrachtet wurde, setzte ein scheinbares Gespräch über das Medium Schwangerschaftstagebuch ein. In einem Text von 1978 verschränken sich die Motive: Die Autorin wollte einerseits dem Kind seine Geschichte erzählen, da sie von der lebensgeschichtlichen Bedeutung der frühesten Kindheit ausging, andererseits suchte sie fast von Beginn der Schwangerschaft an den Segen des Kindes für ihre Erziehungsbemühungen, als wollte sie die noch nicht aushandelbaren Entscheidungen und die noch nicht mitteilbaren Gedanken stellvertretend mit dem Tagebuch besprechen:
»… ich will anfangen, Dir Deine Geschichte aufzuschreiben, die jetzt noch sehr eng mit mir, meiner Geschichte zusammenhängt. Ich habe es mir oft gewünscht, meine Mutter hätte so ein Buch geschrieben, ich ahne nur, welche Hilfen es mir vielleicht gegeben hätte, mich besser zu erkennen, mich als Kind, das auch durch diese geborgene schöne Zeit, das später immer wieder herbeigesehnte Nirwana – so sagen einige – geprägt wurde. […] Ich weiß nun gar nicht, wer Du werden wirst, ob Du einmal ähnliche Wünsche – eben mehr über die Zeit, an die sich allgemein schlecht oder gar nicht zurückerinnert wird, zu erfahren. Doch ich werde schreiben, denn ich hoffe, dass Du einmal Interesse haben wirst, wenn nicht schrieb ich’s auch für mich, wahrscheinlich würde ich sonst auch viel von diesem Erlebnis, Dich zu erwarten, vergessen. […] Ich würde dich gerne öfter mit Kindern zusammenbringen, mir scheint, du hättest es nötig, dich mehr daran zu gewöhnen. Oder magst Du Deine Ruhe?«18
Ein Dialog wurde aber nicht nur zwischen Eltern und Kind ermöglicht. Gelegentliche Einträge des Personals strotzen vor Plattitüden, die den Arbeitgebern gefallen sollten. In einem Fall kommunizierten die Eltern direkt miteinander auf der Ebene des Textes. Im anderen haben beide Eltern getrennt voneinander Tagebücher geführt, fast wie in einem Wettbewerb. Aber auch wenn nur ein Elternteil schrieb, ist der andere hörbar. Wie streng die Zensur des implizit mitlesenden Ehemanns sein konnte, verdeutlicht folgendes Zitat einer Mutter, die 1965 ihren Sohn versehentlich beim Duschen verbrüht hatte:
»Mein süßer Schnackl, Schon die ganzen letzten Tage drängt es mich, Dir etwas sehr Schlimmes zu sagen, hatte aber Angst davor und war zu feige, nicht [sic] nachträglich von Papi noch furchtbar zusammengeschimpft zu werden. […] Glaub mir, Putzchen, ich hätte nichts lieber getan als in die Erde zu versinken vor Scham über meine Unachtsamkeit und wegen der schlimmen Schmerzen, die ich Dir bereitete. […] Ich sehn mich einerseits wegen dieser Geschichte richtig zusammengeschimpft zu werden, andererseits bin ich zu feige, Papi nachträglich nochmals in Angst und Aufregung zu versetzen.«19
Der imaginierte Leserkreis dieser Texte war noch weiter gesteckt. Im Jahr 1920 entstand in einem Hamburger Pastorenhaushalt ein Tagebuch, das neben anderen Adressaten auch den Einen hatte. Es berichtet über die Geburt und das Aufwachsen des Kindes in geradezu hymnischen Tönen. »O hoffnungsvoller Frühling. In neuem Leben erwacht die Natur – zum Leben wirst auch Du bald erwachen, kleine Menschenknospe […].«20
2. Von Menschen und Säuglingen – Vorgeschichte
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts, als die ersten bürgerlichen Elterntagebücher entstanden, erweiterte und spezialisierte sich das »Wissen über die anthropologischen Bedingungen und den sozialen Verlauf der frühen Kindheit« immer mehr. Zum zentralen Motiv des Diskurses wurde dabei die Idee der Perfektibilität, der »Vervollkommnungsfähigkeit und Bildbarkeit des Menschen«21. Auf diese Vorstellung gründet die Tradition des Elterntagebuchs.22
Seit dieser Zeit gewöhnten sich die gebildeten Klassen an, über ihre Kleinkinder zu schreiben, manchmal sogar ausschließlich über sie.23
»Fand doch mein Vater Friedrich Adolf unter allem Getümmel in der Welt Ruhe und Humor genug, um im Namen seines kleinen Erstgebornen ein Tagebuch anzulegen, in welches alles, was sein Säuglingsleben berührte, wie geringfügig es war, sorgfältig eingetragen, namentlich aber die wahrgenommenen Fortschritte in seiner körperlichen und geistigen Entwicklung unter feuriger Dankbezeugung zu Gott stark hervorgehoben wurden. Wann das Knäblein zuerst seine Eltern angelächelt, wie es dann ein in der Stube herumfliegendes Vöglein aufmerksam mit seinen Blicken verfolgt und dadurch seine Sehkraft documentirt, und sonderlich, wie es angefangen habe, an der Aussprache der schweren Worte: Mama und Papa zu studiren, dies alles stand in dem Büchlein.«24
Diese Aufzeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert stehen im Zusammenhang mit einer langfristigen und diskontinuierlichen Entwicklung hin zur kindzentrierten Gesellschaft. Grundsätzlich können sie als Symptom der »Entfaltung privaten Lebens«, einer neuen »Individualisierung der Kindheit« und Emotionalität, der Ausgliederung der Kindheit als einer separaten Welt und als erwachendes Interesse für die Formung des menschlichen Geistes gelten – Entwicklungen, die freilich einen langen Vorlauf bis zurück ins 16. Jahrhundert hatten.25 Man kann den Vorstellungswandel in Hinblick auf das Wesen des Kindes daran ablesen, dass Kindern im Gegensatz zu früher nunmehr nicht allein eine Anlage zur Reifung, sondern eine Fähigkeit zur Entwicklung zugesprochen wurde, was eine Grundvoraussetzung der »Strategien der sozialen Reproduktion«26 des sich als kulturelle Leitfiguration aufschwingenden Bürgertums war. Als der Glaube an die Erbsünde an Kraft verlor, »verwandelten sich die Kinder von verderbten, mit dem Urbösen behafteten Wesen zu Engeln, zu Botschaftern Gottes in einer ermatteten Welt der Erwachsenen. Man sah sie zunehmend ausgestattet mit der Fähigkeit zu Entwicklung und Wachstum, und die Antriebskraft dafür war nun nicht mehr in erster Linie Gott, sondern die Natur. Die Kunst der Kindererziehung bestand jetzt in der Beachtung der Natur, man ließ dem Wachstum freien Lauf und zwang die Zweige nicht mehr in die gewünschte Form und Richtung.«27
Diese Hinwendung »von der spirituellen Gesundheit eines Kindes hin zur Sorge um seine individuelle Entwicklung«28 ließ es vor allem gebildeten Vätern lohnenswert erscheinen, ihre Säuglinge und Kleinkinder zu beobachten und darüber regelmäßig Buch zu führen.
Das bürgerliche Elterntagebuch wurde von verschiedenen intellektuellen Moden oder Diskursen inspiriert. Etwa vom Postulat der Beobachtung, der Empirie. Nicht ein fiktives Kind, wie im Falle des Rousseau’schen Emile, sondern das reale Kind sollte beschrieben werden. So hat der deutsche Philosoph Dietrich Tiedemann seit 1781 dokumentiert, wie sich bei seinem Sohn willkürliches und unwillkürliches Verhalten, Mensch und Tier allmählich voneinander trennten.
Die Philanthropen wirkten an der pädagogischen Theoriebildung für die früheste Kindheit mit. Sie riefen ausdrücklich dazu auf, mittels der Tagebuchführung die geistige Entwicklung des Kindes zu protokollieren. Ihrer Auffassung nach musste die früheste Erziehung auf die Sinne der Kinder gerichtet sein, über die sie sich die Welt erschließen könnten.29 Johann Heinrich Campe, Herausgeber des Braunschweigischen Journals, veröffentlichte 1789 zum Zwecke der Veranschaulichung der »natürlichen« Erziehung einige Erziehungstagebücher, die auf ein Preisausschreiben hin angefertigt worden waren.30 Soll die Intention dieser frühen Elterntagebücher beschrieben werden, so ging es vor allem um intellektuelle Neugierde. Persönliche, gar emotionale Äußerungen finden sich darin kaum.31 Die Väter traten hinter den Text zurück, dokumentierten bloß, seien es auch Äußerungen des Schmerzes oder des Glücks bei ihrem Kind:
»Das Mädchen fängt an, sich zu fürchten, nicht vor der Finsterniß, wohin ich sie oft trage, sondern vor ganz unbedeutenden Gegenständen, z. B. wenn ich sie in die Nähe des Bögelteppichs bringe, so fährt sie zurück, und ist durch nichts zu bewegen, ihn anzurühren.«32
Der Habitus des forschenden Vaters hat dem Genre Elterntagebuch bis weit ins 20. Jahrhundert einen Stempel aufgedrückt.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts findet die Idee der Entwicklung des Kindes analog zu anderen Entwicklungen in der Natur immer mehr Anhänger. Der Historismus interpretierte die Entwicklung des Menschen als Blaupause der Entwicklung der Menschheit. Vom Verständnis des kindlichen Werdegangs erhoffte man sich allgemeine Einsichten in den Gang der Geschichte der Völker. Im Jahr 1856 veröffentlichte der Thüringer Arzt Berthold Sigismund ein Buch, das auf der Beobachtung seiner eigenen Kinder und jener »sinniger Mütter« basierte. Er nannte es einen Versuch »genetischer Anthropologie« und hoffte, »doch manchen Eltern die Freude an der Entwicklung ihrer lieben Kleinen durch ein wissenschaftliches Interesse erhöhen« zu können.33
Sigismunds Buch ist erwähnenswert, da es noch lange gültige anthropologische Vorstellungen über die erste Lebenszeit zusammentrug. Etwa die vom »dummen Vierteljahr« nach der Geburt als einer Zeit, die von instinkthaften Prozessen und dem »dumpfen