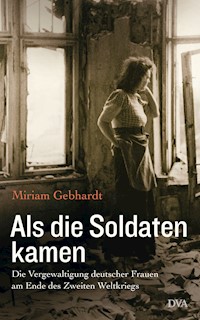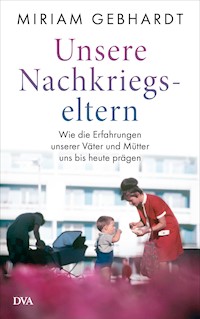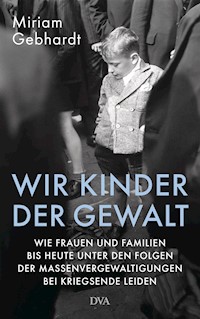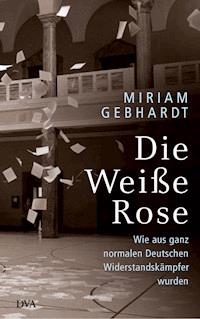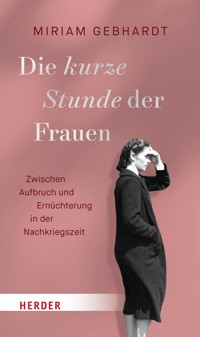
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für keine Phase in der deutschen Geschichte wurden Frauen nachträglich mehr bewundert als für die Nachkriegszeit. Hinter dem Glorienschein sind ihre privaten Hoffnungen auf einen Neubeginn und die Freiheitsmomente zwischen Trümmern und Wiederaufbau verschwunden – aber auch die persönlichen Kosten der belastenden Lebensumstände und die Enttäuschungen über die alten Machtverhältnisse, die sich rasch wieder einstellten. Die Historikerin und Autorin Miriam Gebhardt beschreibt das Lebensgefühl deutscher Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg eindringlich, persönlich und mit viel Empathie. Dazu hat sie in bis dahin unerreichter Dichte die Selbstzeugnisse von Frauen ausgewertet und stellt konsequent deren Erleben in den Mittelpunkt. Sie zeigt, warum sich die meisten Frauen auch nach der Gründung der BRD und der DDR letztlich nicht aus alten Rollenmustern befreien konnten, wie es einigen gelang, neue Wege einzuschlagen – und wie diese Erfahrungen unser Familien- und Privatleben bis heute prägen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miriam Gebhardt
Die kurze Stunde der Frauen
Zwischen Aufbruch und Ernüchterung in der Nachkriegszeit
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: geviert.com, Andrea Wirl, Schmiechen
Umschlagmotiv: © mauritius images/World Book Inc.
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN Print 978-3-451-39938-1
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83182-9
Inhalt
Vorwort: Die kurze Stunde der Frauen
1. Unschuldsvermutung
2. Gewalterfahrung
3. Trümmersaga
4. Überlebenssicherung
5. Arbeitsmoral
6. Politische Schwestern
7. Lebensentwürfe im Kalten Krieg
8. Kinder großziehen
9. Ehemänner und andere Träume
Nachwort: Hüterinnen der Flamme
Anhang
Über die Autorin
Vorwort: Die kurze Stunde der Frauen
Als Luise Stieber im Jahr 1944 erfährt, dass ihr Mann an der Front vermisst wird, legt sie ein Tagebuch für ihn an. Er soll später einmal nachlesen können, wie es seiner Frau und den zwei Kindern am Bodensee in den letzten Kriegsjahren ergangen ist. Den Gedanken, er könnte gefallen sein, schiebt sie weit von sich. Sie beschließt, seinen Gärtnereibetrieb um jeden Preis am Leben zu erhalten. Die Pflanzen sollen sie miteinander verbinden, doch der Kraftaufwand ist immens. Der Betrieb wird gleich dreimal von Bomben zerstört. Sie verliert ihre Wohnung. Das erste Ausweichquartier muss sie mit Wehrmachtssoldaten teilen, das zweite mit den Amerikanern. Von der Verwandtschaft kommt keine Hilfe, die Konkurrenz will ihr die Anbauflächen abjagen, und die Bank verweigert den Kredit für neue Glashäuser. Das Unternehmen habe schließlich keinen Chef mehr. Auch die Kinder überfordern sie ohne die Autorität eines Vaters. Der Sohn muss zwischendurch ins Heim. Immer wieder schreibt Luise Stieber: »Das ist fast zu viel für eine Frau.« »Ich verkrafte das nicht mehr.« »Ich bin keine Natur zum selbstständig Handeln und bin nun doch gezwungen dazu.« Die Anfang Vierzigjährige wird krank vor Erschöpfung, doch immer wenn sie aufgeben möchte, denkt sie an ihr großes Ziel: ihren Mann mit ihrem Einsatz für seine Gärtnerei zu überraschen, wenn er zurückkehrt. Drei lange Jahre kämpft sie, dann verändert sich ihre Tonlage. Sie merkt, dass sie inzwischen etwas von dem Geschäft versteht. »Allzu viel Lehrgeld muss ich nicht mehr bezahlen. Und bin unabhängig von allen. Stehe auf eigenen Füßen.«1 Erzählt uns Luise Stiebers Tagebuch also die Geschichte einer Emanzipation?
Ihr selbst wäre dieses Wort wohl nicht eingefallen. Sie versteht sich immer nur als die Frau des Gärtners, die in seinem Auftrag handelt. Was sie erlebt, ist für sie ein Schicksal, das ihr die Zeit aufgezwungen hat: die Notwendigkeit der Selbstermächtigung.
Wenn wir uns heute mit den Frauen der Nachkriegszeit beschäftigen, hören wir oft Heldinnengeschichten: Erst befreien sie mit bloßen Händen das Land von den Trümmern des Kriegs, dann tragen sie kraft ihrer reinen Herzen dazu bei, das Land von seiner moralischen Schuld zu reinigen. Nebenher retten sie ihre Angehörigen über die Hungerjahre, helfen der Ökonomie auf die Beine, ziehen die Kinder groß, und schlussendlich treten sie großzügig in die zweite Reihe zurück, damit ihre Männer wieder die erste Geige spielen können. Zur Belohnung erhalten sie, früher als Frauen in vielen anderen Ländern, die Gleichberechtigung. Das Jahr 1949, als die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik ihre Verfassungen verkünden, wird zugleich zum Stichjahr für die formale Gleichberechtigung von Frau und Mann in Deutschland. Zum ersten Mal gilt sie vorbehaltlos und uneingeschränkt. Das war mehr als ein Etappenziel, möchte man meinen.
Heute, zum 75. Jubiläum der Verfassungen in West und Ost, beschleichen mich allerdings Zweifel daran, wie nachhaltig dieser Schritt war. Denn wenn wir uns in der Zeitachse weiterbewegen, ist die kurze Stunde der Frauen bald vorbei. Die Politik verschleppt nach 1949 die geforderte Umsetzung der Gleichberechtigungsnorm. Es bedarf noch vieler Zwischenschritte, bis verheiratete Frauen überhaupt nur ein eigenes Konto eröffnen dürfen oder selbst entscheiden können, ob und wie viel sie arbeiten. Die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft kehrt in den 1950er Jahren rasch zum bürgerlichen Ehemodell zurück, in dem der Mann arbeitet und die Frau höchstens etwas »dazuverdient«.
Die DDR macht zwar schneller Nägel mit Köpfen. Für den sozialistischen Staat ist die erwerbstätige Frau nämlich nicht nur ein wirtschaftliches Muss, sondern gehört auch zum ideologischen Auftrag des Kommunismus. Aber die Emanzipation bemisst sich im Osten einzig und allein an der Präsenz der Frauen in der Landwirtschaft und Industrie, nicht an der weiblichen Repräsentanz in den wirtschaftlichen und politischen Leitungsgremien oder an der partnerschaftlichen Aufgabenteilung im Haushalt und bei der Kindererziehung. Der Fortschritt bewegt sich auch hier im Krebsgang: hauptsächlich seitwärts und nur ein bisschen vorwärts.
Natürlich gibt es beiderseits des Eisernen Vorhangs Ausnahmeerscheinungen wie die furchtlose Unternehmerin und Kunstfliegerin Beate Uhse oder die Justizministerin Hilde Benjamin. Doch wo sind die vielen anderen abgeblieben? Was wurde aus den zahllosen Kämpferinnen der Frauenausschüsse, was aus den Medienschaffenden, die im Auftrag der Besatzungsmächte das Land demokratisieren sollten? Wir haben viel gehört von der sagenhaften Belastbarkeit der sogenannten Trümmerfrauen, aber warum landeten so viele von ihnen in der Müttererholung, und warum hängt dieser Generation heute der Ruf an, ihre Kinder wenig liebevoll und sich selbst mit ungeheurer Härte behandelt zu haben? Der aktuelle Hype um die Nachkriegsfrauen in Film, Buch und Feuilleton ist, wie mir scheint, vom realen Leben unserer Mütter und Großmütter doch noch ein ganzes Stück entfernt.
Auf eine Kurzform gebracht, werden die Nachkriegsfrauen heute für etwas gefeiert, für das sie damals ohnehin zuständig waren, nämlich die Bewältigung der Alltagsnot. Darüber sind die weniger schillernden Aspekte ihrer Geschichte offenbar unter den Tisch gefallen: ihre bodenlose Erschöpfung, die Zumutung (oder das Glück?), Arbeit und Verantwortung wieder abzugeben, als die Männer aus dem Krieg zurückkehrten, aber auch die spezifisch weiblichen Gewissensfragen im Nachgang des Nationalsozialismus. Der satt zufriedene Blick auf den angeblichen Glanz der »Trümmerfrauen« scheint die Widersprüche der damaligen Geschlechterordnung zu verdecken – vor allem die für uns heute so wichtige Frage: Wann und woran ist seit dem Neubeginn im Jahr 1949 die faire Verteilung von Arbeit und Leben, von Freiheit und Bindung denn gescheitert? An den Männern, an der Systemkonkurrenz oder an den weiblichen Bedürfnissen?
Mein persönliches Interesse an diesem Buch gilt dieser Frage. Einerseits waren die Frauen nach dem Krieg anscheinend bewunderungswürdige Pionierinnen der Frauenemanzipation, weil sie vorübergehend das Land wieder in Betrieb nahmen. Andererseits sind viele – freiwillig und unfreiwillig – rasch wieder von der Bildfläche verschwunden. Wie ging das vonstatten? Ich glaube nicht an das feministische Märchen, »das« Patriarchat habe den Frauen ihre Freiheiten wieder aus der Hand geschlagen. Ich gehe davon aus, gemeinsam geteilte Vorstellungen waren dafür verantwortlich, dass sich Frauen und Männer doch wieder auf ihre angebliche Wesensart besannen. Die Kirchen predigten Anstand und Fruchtbarkeit, das ließ nicht viel Spielraum bei der Suche nach neuen Rollen. Der Staat glorifizierte die sogenannten weiblichen Tugenden, und die westdeutsche Gesellschaft als Ganzes suchte das Heil in der bürgerlichen Familie. Deshalb gab es dort keine Infrastruktur für erwerbstätige Mütter. Und auch in der DDR konnten Frauen ihre Kinder erst sehr viel später in Tages- und Wochenheimen unterbringen, was ihnen zudem oftmals sehr wehtat. Welche Wahlmöglichkeiten hatten sie (und ihre Männer) unter diesen Umständen? Waren die sprichwörtliche Kälte der Erziehung der Nachkriegszeit, der oft fehlende Körperkontakt zwischen Eltern und Kind eine zwangsläufige Folge dieser Situation?
Der sogenannte Frauenüberschuss nach 1945 aufgrund der Gefallenen und der Kriegsgefangenen ließ es so aussehen, als könnten nicht alle Frauen einen Mann »abbekommen«. Deshalb ist die ikonisch gewordene Nachkriegsfrau alleinstehend. Gleichzeitig galt eine Frau ohne Mann recht bald als defizitäres Wesen. Es war einfach beschämend, ohne männlichen Begleitschutz in der Öffentlichkeit dastehen zu müssen. Im Restaurant konnte es vorkommen, dass eine einzelne Frau vom Ober abgewiesen wurde, bei der Wohnungssuche wurde sie benachteiligt, weil sie womöglich einen »unsittlichen Lebenswandel« führte, und »ledige Mütter« standen erst recht außerhalb des eingehegten Gartens bürgerlicher Sittlichkeit. Wie war also die Situation für eine verwitwete Frau anders zu lösen als durch eine schnellstmögliche neue Heirat? Es wäre schön zu glauben, was am 8. August 1947 zu diesem Thema im Frauenfunk des Bayerischen Rundfunks zu hören war: »Diesen neuen Frauentyp nennt man ›Junggesellin‹. Der Hauptunterschied zwischen einer alten Jungfer und einer nicht mehr jungen Junggesellin ist wohl, dass die alte Jungfer immer noch mit ihrem Schicksal hadert, während die Junggesellin sich in der Welt einrichtet, so gut es geht. Sie hat jedenfalls einen Beruf, ist unabhängig von der Fürsorge irgendwelcher Verwandten, hat ihre eigenen Freunde und Bekannten, denkt nicht immer, die andern Frauen hätten es besser, und hat möglichst auch ein eigenes Zuhause.«2 Doch gelang den Frauen dieser Akt der Selbstberuhigung?
Eine weitere Paradoxie fasziniert mich heute an den Nachkriegsfrauen: Sie gründeten damals zahllose politische Organisationen, glaubten sogar, die Zeit sei reif für reine Frauenparlamente, denn die Männer hätten durch Krieg und Nationalsozialismus abgewirtschaftet. Frauen kämpften für Frieden und gegen die Wiederbewaffnung, für die paritätische Teilhabe in der Politik und für gleiche Löhne. Doch die meisten Aktivistinnen stammten aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus, fanden keine jüngeren Nachahmerinnen und mussten erleben, dass ihre Politik als alltagspraktisches Gedöns verniedlicht wurde. Haben sie sich deshalb ins Private zurückgezogen?
Das Jahrzehnt nach 1945 war, das scheint mir bis hierhin klar zu sein, ein Brennpunkt für weibliche Selbstwirksamkeit, aber auch für Ambivalenzen und Selbstvorwürfe. Es war die hohe Zeit der zupackenden, hemdsärmeligen Trümmerfrau und gleichzeitig die Inkubationszeit einer neuerlichen Verherrlichung von Ehe, Familie, Mütterlichkeit. Selten klafften Vorstellung und Realität so weit auseinander. Es waren die Frauen, die mit den Widersprüchen umgehen mussten. Gerade noch sollten sie sich im Nationalsozialismus vom Ideal der deutschen Mutter überzeugt zeigen, schon wurden sie wieder dafür gebraucht, in den Fabriken, Bauernhöfen und Handwerksbetrieben das Eisen aus dem Feuer zu holen, nur um ein paar Jahre später die alte Leier zu hören, dass Frauen ihrem Wesen nach friedfertig, zurückhaltend und bescheiden aufzutreten hätten.
Wie fanden sich die Frauen in diesem Wertechaos zurecht? Auf den folgenden Seiten kommen einige von ihnen zu Wort. Sie sprechen zu uns durch die Zeugnisse, die sie hinterlassen haben. Die ausgewählten Quellen, Tagebücher und Briefe aus der Zeit stellen zwar keine quantitative Repräsentativität dar, aber sie können plausible Geschichten erzählen, und sie beleuchten die Selbstreflexion der Frauen vor dem damaligen Deutungshorizont. Daraus entstehen facettenreichere Figuren als die der ikonischen Trümmerfrau. Sie werden sich nicht in Schwarz und Weiß nachzeichnen und auch nicht in die ideologischen Schubladen des Kalten Kriegs einordnen lassen, sondern es werden Frauen sein aus Fleisch und Blut, die uns zu einem realistischeren Bild der deutschen Geschichte nach 1945 verhelfen.
1 Luise Stieber, Tagebuch, 16.3.1947, Deutsches Tagebucharchiv (DTa), Sig. 1002.
2 Guten Morgen, liebe Hausfrau, 18.8.1947, zit. nach Annegret Braun, Frauenalltag und Emanzipation. Der Frauenfunk des Bayerischen Rundfunks in kulturwissenschaftlicher Perspektive (1945–1968), Münster 2005, S. 84.
1. Unschuldsvermutung
Geschichten vom Kriegsende in Deutschland beginnen meistens mit einem wahren Höllengemälde: Ganze Städte liegen in Schutt und Asche, Brücken, Straßen und Felder sind zerstört, Industrieanlagen unbrauchbar, Menschen irren durchs Land auf der Suche nach ihren Angehörigen, nach ihrer alten oder einen neuen Heimat. Wer noch ein Dach über dem Kopf hat, hungert und friert trotzdem. In diesem allgemeinen Elend der Nachkriegszeit ragt eine Figur deutlich heraus: die Frau, die versucht, alles zusammenzuhalten, die das Überleben sichert. Sie heilt Wunden, geht auf Hamsterfahrt, ergattert Kohlebriketts, krempelt die Ärmel hoch und greift zur Schaufel, um den Schutt wegzuräumen und das Land wieder aufzubauen. Es war die berühmte Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum »Tag der Befreiung« am 8. Mai 1985, die das Vermächtnis dieser Nachkriegsfrauen tief im kollektiven Bewusstsein verankert hat: »Den vielleicht größten Teil dessen, was den Menschen aufgeladen war, haben die Frauen der Völker getragen. Ihr Leiden, ihre Entsagung und ihre stille Kraft vergisst die Weltgeschichte nur allzu leicht. Sie haben gebangt und gearbeitet, menschliches Leben getragen und beschützt. Sie haben getrauert um gefallene Väter und Söhne, Männer, Brüder und Freunde. Sie haben in den dunkelsten Jahren das Licht der Humanität vor dem Erlöschen bewahrt. Am Ende des Kriegs haben sie als erste und ohne Aussicht auf eine gesicherte Zukunft Hand angelegt, um wieder einen Stein auf den anderen zu setzen, die Trümmerfrauen in Berlin und überall.«1
Nicht zuletzt in dieser Rede wurde der Beitrag der Frauen nach der Kapitulation geradezu mystifiziert. Die Trümmerfrau ist seither eine Ikone, eine menschliche Antwort auf die unmenschlichen Zeiten. Sie half dabei, das Selbstbild der Deutschen zu reinigen. Mit ihrer Hilfe schien es möglich, die großdeutschen Fantasien, die Sehnsüchte nach einem unermesslich großen Land, das von einer »reinen Rasse« beherrscht würde, und die Verbrechen, die das alles motivierte, vergessen zu machen. Das Trümmerfrauennarrativ rückte, bewusst oder unbeabsichtigt, die Deutschen ein Stück weit auf die Seite der Guten, der Opfer. Denn wen möchte im Angesicht der trauernden und zugleich hart zupackenden Berlinerin nicht das Mitleid überkommen?
Doch bevor wir uns in Andacht und Respekt vor ihrer Aufbauleistung verbeugen, wollen wir uns die Zeit direkt nach dem Krieg näher ansehen. Denn am Anfang war nicht die Zerstörung der deutschen Städte und Infrastruktur, am Anfang waren die Trauer um Hitler und der zerstobene Traum von einem nationalsozialistischen Weltimperium.
Die Niederlage als Verlusterfahrung
Wir wollen nicht vergessen, selbst diejenigen, die zu jung waren, um Verantwortung für die Verbrechen der Nazis und den Angriffskrieg der Deutschen tragen zu müssen, waren oftmals bis zum Schluss von der Sache überzeugt gewesen. So wie Dorothee Karguth, die 1932 in Köln geboren worden und mit zwei Jahren nach Berlin gekommen war. Sie beklagt in ihren Erinnerungen an die Nachkriegszeit, dass sie eine Leidtragende des Nationalsozialismus sei.2 Ihr Vater sei arbeitslos geworden, weil er noch nicht »entnazifiziert« werden konnte, als sei das nur ein lästiger Behördenakt. Er hatte bei der IG Farben gearbeitet und im Russlandfeldzug Partisanen erschossen. In seinem Vokabular hieß das »die Wälder durchkämmen und die Banditennester ausräuchern«. Jetzt handelt er auf dem Schwarzmarkt, was für die Teenagertochter beschämend ist. Eine Nachbarin im Westerwald, wohin es sie nach Kriegsende verschlagen hatte, legt ihr nahe, sich für den Vater zu schämen. »Schlimm, wenn man PG [Parteigenosse] war«, raunt sie auf der Straße, wenn sie das Mädchen oder deren Mutter vorübergehen sieht. Für Karguth fühlt sich das alles unfair an.
In der Schule muss sie umlernen und neu lernen, zum Beispiel christliche Weihnachtslieder. Auch das ist für sie eine Zumutung. Bis dahin hatte sie nur die Lieder des Bund Deutscher Mädel (BDM) gekannt. Die Verbrechen der Deutschen werden ihr auf drastische Weise zur Kenntnis gebracht. Sie sieht mit ihrer Schulklasse einen Film über ein Konzentrationslager. »Das war ›Order‹ der französischen Besatzungsmacht. Reeducation? Direkt da fing es wohl schon an.« Ihr Vater wird in den Nachkriegsjahren immer schweigsamer. Er sei, so deutet es die Tochter, zu stolz, um einzugestehen, »dass seine NS-Weltanschauung und das glorreiche ›Tausendjährige Reich‹ ruhmlos zugrunde gegangen waren«. Darüber sei er depressiv geworden, wie viele Männer nach Kriegsende. Die Nazizeit hat jedoch nicht nur ihn verändert, sondern die ganze Familie, denn jetzt hat die Mutter auf einmal Oberwasser. Für die Tochter bedeutet das Kriegsende alles in allem, sich in einer neuen Umgebung einzurichten, in einer veränderten sozialen Position und in einer neuen Familiendynamik. Vom Zauber des Neubeginns spürt sie erst mal nichts.
Aus der ehemaligen Schülerin wird eine Heranwachsende, die Lebensmittel beschaffen und verarbeiten muss. Das schließt mit ein, dass sie als 15-Jährige einem verletzten Reh, das sie in einem Wald gefunden hat, die Schlagader öffnet und ihm an Ort und Stelle das Fell abzieht. Sie und ihre Geschwister müssen von klein auf Stallhasen versorgen, Futter schneiden und Schwerstarbeit in der Landwirtschaft leisten.
Aber ist Dorothee Karguth deshalb ein von den Zeitläufen »missbrauchtes« Mädchen, wie sie es uns nahelegt? Erst politisch verführt in der Hitlerjugend, dann in jungen Jahren von den Eltern als »Arbeitstier« ausgebeutet, gegen ihren Willen mit 15 Jahren zu einem Haushaltsjahr auf einem Hof verdonnert, bevor sie endlich mit 17 Jahren die Ausbildung zur Kinder- und Säuglingsschwester antreten darf? Der selbstmitleidige Blick passt damals ins Gesamtbild. Die meisten Deutschen glaubten noch, als der Krieg vorbei war, die Hitlerdiktatur sei gar nicht so schlecht gewesen und Deutschland um einen verdienten Sieg betrogen worden. Eine beliebte Fangfrage lautete: Wäre Adolf Hitler nicht als der beste Führer aller Zeiten in die Geschichte eingegangen, wenn er den Krieg gewonnen hätte? Wenn überhaupt eine Schuld der Deutschen eingestanden wurde, dann sah man sie bei der SS und den Parteibonzen. Bestimmt nicht bei den Frauen.
Besonders sie hielten sich zugute, mit den gewaltsamen Seiten des »Dritten Reichs« nichts zu tun gehabt zu haben. Schließlich hätten sie als unpolitisch gegolten und seien von den Machtpositionen ferngehalten worden. Sie fühlten sich, wie Dorothee Karguth, eher als Opfer der Umstände denn als Urheberinnen. Dabei lässt sich in Tagebüchern von Mädchen und Frauen aus der NS-Zeit und kurz danach nachlesen, dass sie sehr wohl fest hinter den militärischen und ideologischen Zielen des Regimes gestanden hatten. Sie waren natürlich auch Betroffene, wenn Familienangehörige an der Front fielen, vermisst wurden oder bei Bombardierungen starben, sie litten natürlich auch unter den andauernden Einschränkungen, die ein Krieg mit sich bringt, wenn sie zum Beispiel für viele Monate zum Reichsarbeitsdienst und zum Kriegshilfsdienst eingezogen wurden. Auf Ausbildungszeiten und Lebenspläne nahm der NS-Staat keine Rücksicht. Wenn sie Pech hatten, kamen sie nicht mehr dazu, einen Schulabschluss abzulegen, oder erhielten nur den als »Puddingabitur« herabgestuften Abschluss auf einer Frauenoberschule, der dem erhofften Berufsweg eine andere Richtung geben konnte. Dennoch standen auch die Frauen oft hinter dem Krieg und glaubten bis zum Schluss an die ominöse »Wunderwaffe«, mit deren Hilfe Deutschland doch noch siegen würde. Bei der Kapitulation am 8. Mai 1945 überwog das Gefühl des Verlusts.
Margrit Riegraf, Pfarrerstochter aus Stuttgart, die zu dem Zeitpunkt im Kreis Schwäbisch Hall lebt, schreibt als 16-Jährige in ihr Tagebuch: »Wer hätte das vor sechs Jahren gedacht! Stolz und siegesfreudig zogen sie aus, und nun! Doch wie tapfer haben sie zuerst gesiegt und dann ausgehalten. Und was hat die Heimat auch durchhalten müssen. Wenn man daran denkt, kann man nicht glauben, dass es umsonst gewesen ist. Unser liebes Vaterland ist zwar eine Stätte der Verwüstung, und den Krieg haben wir verloren, aber unser Volk muss wieder einmal wie schon so oft in die Tiefe steigen, dass es sich auf sich selbst besinnt. Dann wird diese schwere Zeit auch ihren Segen haben. Vielleicht geht auch in anderer Beziehung wieder ein Morgenrot für uns auf. Zwischen Amerika und Russland soll es nicht stimmen. Käme es zwischen ihnen zum Krieg, würden wohl die ›amerikanisch-deutschen‹ Soldaten mit amerikanischer Ausstattung Großes leisten können. [...] Die Liebe zu Deutschland geht einem erst in seinem Unglück auf.«3 Mit anderen Worten: Da jongliert eine geistig schon mit dem nächsten Krieg.
Auch die Schülerin Thea Dietrich glaubt noch im April 1945 an den deutschen »Endsieg«: »Gott sei Dank habe ich noch so viel Optimismus und Glaube an einen deutschen Sieg! Kann die Gerechtigkeit zulassen, dass ein Volk wie das deutsche von brutalen Feinden mit den schändlichsten Mitteln ausgerottet werden soll? [...] Auch ich würde dem Werwolf beitreten, so könnte ich doch meine Liebe zum Vaterland beweisen.«4
Das sind bei Weitem keine Einzelfälle. Gabriele Strecker, Ärztin, Journalistin und Politikerin in Bad Homburg, erzählt in ihrer Autobiografie, wie sich die Frauen, die sie nach Kriegsende zur Diskussion bei sich zu Hause empfing, erst einmal über ihre eigenen Verluste beklagten, über die zerstörten Städte, die Einquartierungen, die Lebensmittelrationierung, und wie sie weniger gesprächig wurden, wenn es um ihre eigene Teilnahme an Nazifrauenorganisationen oder ihre zeitweilige Bewunderung für Adolf Hitler ging. Der Gesamteindruck sei ein »merkwürdiges Gemisch von Selbstmitleid, schlechtem Gewissen, trotzigem Aufbäumen und so viel gutem Willen, am Aufbau mitzuhelfen«, gewesen.5
Die eingebildete Verantwortungslosigkeit passte zum Bild, das der Nationalsozialismus von den Aufgaben der Frauen gezeichnet hatte: Ihre Stellung war die der treuen Kameradinnen an der Seite der Männer. Sie hatten ihren Anteil an der großen Sache zu erfüllen, in erster Linie als Mütter erbgesunder Kinder, aber auch als Ausbilderinnen beim BDM, als Führerinnen beim Reichsarbeitsdienst, als Psychologinnen bei der Selektion nicht »lebenstüchtiger« Kinder in Kinderheimen, beim Bearbeiten der deutschen Scholle, als Ehefrauen der Aufseher der Konzentrationslager, als aufopferungsvolle Krankenschwestern der versehrten Soldaten und so fort. Diese Rollenzuschreibung als Zuarbeiterin und Sorgende begrenzte eine sehr aktive Teilnahme an den Projekten des »Reichs«. Sie entlastete die Frauen im Nachhinein aber auch, denn ihren Part hatten sie in der zweiten Reihe gespielt, oder sie waren als Lückenbüßerin eingesprungen.
In frühen Analysen des NS-Herrschaftssystems hieß es, der Nationalsozialismus sei eine Ausgeburt der Moderne gewesen, was die individuelle Verantwortung der (weiblichen) Bevölkerung sehr reduzierte. Dann hieß es, die NS-Zeit sei eine Ausgeburt der patriarchalen Herrschaft gewesen, in der Frauen ebenfalls ohnmächtig gewesen seien. So oder so, die Frauen schienen bei Kriegsende dafür prädestiniert, eine ganz neue Rolle zu übernehmen, nämlich die der reinigenden und heilenden Kraft.
Nur eine Frau
Erst später fing die Gesellschaft an, die Rolle der ganz normalen Frauen in Krieg und Nationalsozialismus ernsthafter zu untersuchen. Zunächst fiel der Blick nur auf die offensichtlichen Täterinnen, etwa die KZ-Aufseherinnen oder Parteifunktionärinnen. Eine der bekanntesten und, wenn man so will, spektakulärsten Figuren war Ilse Koch. Obwohl sie »nur« die Ehefrau des Kommandanten des KZ Buchenwald war, wurde sie die »Kommandeuse« genannt. Ihre Geschichte stand für das ultimative Böse. Die Amerikaner klagten sie 1947 wegen Kriegsverbrechen an und warnten die Soldaten und Angehörigen der Besatzungsverwaltung mit ihrer Geschichte vor den angeblich verschlagenen deutschen Frauen. Der amerikanischen Bevölkerung zu Hause hielt das Beispiel Ilse Kochs vor Augen, welche Dimensionen die Verbrechen der Deutschen gehabt hatten und wie groß der Feind war, den man jetzt unter Kontrolle halten müsse. Der deutschen Öffentlichkeit gereichte Ilse Koch paradoxerweise zur Entlastung – im Vergleich zu dieser »Bestie« und »Hexe« war der normale Durchschnittsmensch und erst recht die normale Durchschnittsfrau geradezu ein Ausbund an Moral und Anstand gewesen.
Ilse Koch war eine Überzeugte. Sie trat schon 1932 in die NSDAP ein, heiratete im KZ Sachsenhausen einen geschiedenen und vorbestraften SS-Mann – Karl Otto Koch, der dort Kommandant war – und trat selbst in die Organisation ein. Diese Entscheidung war alles andere als privat, denn wer in den »Orden« Heinrich Himmlers einheiraten durfte und wer es wert war, sich mit einem SS-Mann fortzupflanzen, entschied die SS. Selbst der Termin und das Zeremoniell der Hochzeit wurden festgelegt. Emotionaler Höhepunkt war der Moment, in dem SS-Angehörige mit Fackeln dem Brautpaar Spalier standen.
Ilse Koch, die 1906 in einfachen Verhältnissen in Dresden geboren wurde, berauscht die Aussicht auf sozialen Aufstieg, und sie nutzt die steile Karriere ihres Mannes für das eigene Wohlleben. Als Karl Otto Koch nach verschiedenen Stationen in anderen Konzentrationslagern im Jahr 1937 Kommandant von Buchenwald wird, bezieht sie eine Villa direkt am Zaun. Dort bekommt sie drei Kinder und lässt es sich gut gehen. Die Hausherrin hält Häftlinge als Hausangestellte, feiert und geht, genauso wie ihr Mann, fremd. Ein scheeler Blick eines Häftlings auf ihren Reichtum oder auf ihre üppige Figur reicht, um den Übeltäter zu denunzieren und den Wachmannschaften auszuliefern. Wenn sie es so will, wird er ausgepeitscht, wobei sie gerne zusieht, auch wenn die Sache mit seinem Tod endet.
Eines Tages ist es vorbei mit den Lustbarkeiten, denn den Parteigenossen ist nicht entgangen, dass sich die Kochs am »Volkseigentum« bereichern. Die Eheleute bestehlen die KZ-Häftlinge, und anstatt das Diebesgut abzugeben, wie es Vorschrift wäre, verwenden sie es für den eigenen Bedarf oder bestechen damit andere Funktionäre. Im Jahr 1943 werden Karl Otto und Ilse Koch verhaftet. Er wird wegen Hehlerei und Wehrkraftzersetzung im KZ Buchenwald hingerichtet, sie bleibt 16 Monate in Untersuchungshaft.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt beginnt die Legendenbildung. Es kursieren Gerüchte, es habe im Hause Koch Gebrauchsgegenstände wie Lampenschirme und Buchhüllen aus gegerbter Menschenhaut gegeben. Obwohl sich das nie beweisen lässt, trägt die Schauergeschichte dazu bei, dass Ilse Koch von der US-Armee als Kriegsverbrecherin erneut verhaftet und vor Gericht gestellt wird. Im August 1947 erhält sie als einzige weibliche Angeklagte im Buchenwald-Hauptprozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wäre sie in der Untersuchungshaft nicht schwanger geworden – von wem, ist nicht bekannt –, hätte ihr womöglich die Todesstrafe gedroht. Sie legt Revision ein, und ihr Urteil wird aus formaljuristischen Gründen auf vier Jahre verkürzt. Doch schon beim Verlassen des Kriegsverbrechergefängnisses in Landsberg wartet erneut ein Haftbefehl auf sie. Diesmal kommt sie vor ein deutsches Gericht, das sie wegen Anstiftung zum Mord, versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Bis zum Schluss beteuert sie in Briefen an ihre Kinder, Anwälte und Unterstützer ihre Unschuld. Sie wähnt sich als Opfer einer jüdischen Verschwörung und der »Siegerjustiz«.
Ilse Koch sagt im Prozess gegen das ehemalige Lagerpersonal und die Häftlinge von Buchenwald zu ihrer eigenen Verteidigung aus. Sie blieb bis zu ihrem Tod eine unbelehrbare Antisemitin.
Ilse Koch bleibt eine glühende Antisemitin. Selbstzweifel kommen ihr nicht, soweit wir wissen. Denn sie hat ein schlagendes Argument auf ihrer Seite: Sie war doch nur eine Frau. Für Ilse Koch war Ilse Koch immer nur eine liebevolle Mutter und ergebene Ehefrau gewesen.6 Am 1. September 1967 nimmt sie im Frauengefängnis Aichach den Strick.
Je tiefer die Forschung in die NS-Zeit eintaucht, desto mehr Frauen entdecken wir, die von der Aussicht auf sozialen Aufstieg und auf eigene Wirksamkeit betört wurden. Zum Beispiel bei der »Kolonisation« der Gebiete im Osten. Sie träumten gemeinsam mit den Männern den Traum von den endlosen Weiten, die es zu besiedeln, »rassisch« zu bereinigen und mit deutschem Wesen zu tränken gelte, und sie ließen sich zum Osteinsatz beordern oder meldeten sich freiwillig. Dadurch trugen sie zur »Lebensraum«-Politik bei. Abgesehen davon, dass in der nationalsozialistischen Ideologie auch die Funktion der Mutter und Ehefrau politisiert und instrumentalisiert war, trägt das Argument, »nur« eine Frau gewesen zu sein, heute nicht mehr.
Im Namen der Wissenschaft (und des Führers)
Auch in Hildegard Hetzers Selbstsicht gibt es keine Schatten. Sie wird 1899 in die komfortable Welt einer großbürgerlichen Wiener Familie hineingeboren. Ihre Eltern führen sie in Kunst, Kultur und Geselligkeit ein, bezahlen Privatlehrer und Gouvernanten sowie lange Wochen in der Sommerfrische. Sie begleitet ihren Vater, einen Anwalt, auf die Pirsch und lernt dabei viel über die Natur. Nach dem Abitur will sie das Gut ihres Vaters in Kroatien übernehmen, doch nach dessen Verlust bei Kriegsende 1918 absolviert sie stattdessen eine Ausbildung zur Sozialfürsorgerin. Sie wirkt als Horterzieherin auch in Wiener Problembezirken und erarbeitet zusammen mit den berühmten Wiener Psychologen Karl und Charlotte Bühler Entwicklungstests. Ihre Forschungsobjekte sind die Kinder, die im sogenannten Glashaus leben. Das Glashaus ist die städtische Verwahrstelle für Kinder, die an Heime oder Adoptiveltern vermittelt werden sollen. Seinen Namen hat es von den Zimmern mit gläsernen Wänden, durch die Studierende und Fachleute die Kinder Tag und Nacht beobachten und begutachten können.
Von Wien aus geht Hetzer ins westpreußische Elbing an die Pädagogische Akademie, wo sie als Professorin für Psychologie und Sozialpädagogik Volksschullehrer ausbildet. Laut ihren Memoiren wird sie nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten wegen politischer Unzuverlässigkeit entlassen, findet allerdings sofort wieder Arbeit als Expertin für Kindesmisshandlung und als Psychologin in einem »Sonderkindergarten« für psychisch auffällige Kinder in Berlin. Nach kurzer Zeit wird sie von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt als Erziehungsberaterin dienstverpflichtet.
Interessant ist, dass sie in ihrer Selbstdarstellung bis zu diesem Punkt keinerlei Interessenkonflikte zwischen ihrer Wissenschaft und der eugenischen Politik des Staates erwähnt. Wahrscheinlich sind da keine, obwohl der Nationalsozialismus im Umgang mit »Erbkrankheiten« – eine Schublade, in die von der Norm abweichende Kinder nur allzu schnell kommen – keine Gnade kennt.
Der nächste Einsatzort Hetzers ist ab 1942 das Gaukinderheim Brockau in Posen, wo polnische Waisenkinder zusammengefasst werden, die bei der »Umsiedlung« ihre Eltern verloren hatten oder ihren Eltern entrissen worden waren. Hildegard Hetzers Aufgabe ist es, die Kinder zu begutachten und zu entscheiden, ob sie aufgrund ihrer Konstitution und geistigen Entwicklung »eingedeutscht« werden könnten. Der deutsche Staat ist hungrig nach mehr Menschenmaterial. Wenn die Kinder relatives Glück haben, kommen sie in ein deutsches Heim oder werden im Reichsgebiet zur Adoption angeboten. Wenn sie kein Glück haben, kommen sie in ein Lager und werden unter Umständen ermordet. Vierzig Prozent erleiden das zweitere Schicksal.
Obwohl Hildegard Hetzer in einem Schreiben des Reichsinnenministers Heinrich Himmler namentlich für diese Aufgabe ausgewählt worden war, bekundet sie in ihrer Autobiografie, von diesen Hintergründen ihrer Gutachtertätigkeit nichts gewusst zu haben.7 Sie habe nicht gemerkt, dass es sich um polnische Kinder handelte, sondern geglaubt, verwahrloste deutsche Kinder vor sich zu haben, die einfach nur schlecht Deutsch sprachen. Sie beschreibt, wie schwierig es gewesen sei, die Kinder zu befragen, da sie oft nichts über ihre Herkunft gewusst hätten. Ein Kleinkind, das sie begutachten sollte, habe beispielsweise ein Muttergottesbild um den Hals getragen, sei aber beschnitten gewesen. So habe die Psychologin annehmen müssen, dass es aus einem Getto stammte und, um sein Leben zu retten, als Christ getarnt worden sei. Was aus diesem wahrscheinlich jüdischen Jungen wurde, verrät sie nicht, dafür berichtet Hetzer, dass sie ein stark entwicklungsverzögertes Kind eines »volksdeutschen« Wehrmachtssoldaten vor dem Arzt des Gesundheitsamtes versteckt habe, damit es nicht als »lebensunwert« eingestuft wurde. Ihr Eingreifen sei jedoch nicht immer erfolgreich gewesen, gibt sie zu, was sie damals schwer bedrückt habe. Nach zweieinhalb Monaten endet dieser Einsatz, Hetzer soll die Erziehungsberatungsstelle in Posen aufbauen. Auch in dieser Zeit will sie von allen Besprechungen und Dienstschreiben mit politischem Inhalt ferngehalten worden sein.8
Hetzer engagiert sich insgesamt zweieinhalb Jahre in der rassistischen Bevölkerungspolitik, dann erst meldet sie sich krank und lässt sich von einem ihr bekannten Psychiater in Berlin zur »Erholung« ins Erzgebirge schicken. Von dort aus kommt sie aufgrund einer schweren Depression in eine Psychiatrie im Harz. Es fällt auf, was Hildegard Hetzer in ihren Erinnerungen weggelassen hat: Sie reflektiert mit keinem Wort ihre Tätigkeit im Nationalsozialismus, sondern überlässt es uns beim Lesen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch erwähnt sie nicht, dass ihre Bewerbung bei ihrer ehemaligen Arbeitsstelle in Wien nach Kriegsende abgelehnt wird mit Hinweis auf ihre Tätigkeiten im NS-System. Im Gegenteil stellt sie es so dar, als sei ihr Leben nach Kriegsende bruchlos weitergegangen mit der Berufung als Professorin an die Pädagogische Hochschule in Weilburg an der Lahn und später an die Universitäten in Marburg und Gießen.
Ihre ehrenvolle Wiedereingliederung in die Wissenschaft und Lehre und in die deutsche Gesellschaft verdankt sie ihren Kontakten in der Fachwelt und einem für sie vorteilhaften Entnazifizierungsverfahren, bei dem sie selbst als ihre eigene Kronzeugin auftreten darf. Am Ende wird ihre unbeirrbare Ignoranz mit dem Bundesverdienstkreuz belohnt. Doch es ist hier nicht der Ort, den fragwürdigen Umgang der Gesellschaft und der Wissenschaft mit den nationalsozialistisch Belasteten zu diskutieren. Wir wollen vielmehr herausfinden, wie sich Frauen nach 1945 zu ihrer NS-Vergangenheit gestellt haben.
Hetzer wie auch Koch zeigten sich weder reuig noch beschämt. Die Psychologin und die Ehefrau des KZ-Kommandanten hatten sich an entgegengesetzten Polen weiblicher Wirksamkeit im Nationalsozialismus schuldig gemacht. Die eine hochprofessionell, die andere wie beiläufig. Aber auch ganz »normale« Frauen hätten nach dem Ende des Nationalsozialismus Anlass gehabt, mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Frauen haben an ihrer Position, ob in der Familie, im Staat, in der Kriegswirtschaft oder sogar in der Wehrmacht und in den Konzentrationslagern, ihren Beitrag für das verbrecherische System geleistet. Das Bild der unpolitischen Frau, ihre scheinbar passive Rolle in der braunen Ideologie, ihre Bedeutung für den Wiederaufbau und die erhoffte moralische Gesundung des Landes verdeckten diese Tatsachen. Zudem wurden manche Frauenaktivistinnen, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Intellektuelle nach der »Machtergreifung« 1933 tatsächlich verfolgt und aus ihren Positionen gejagt. Das wirkte für viele andere Frauen wie ein Alibi.
Ganz normale Frauen
Ein Beispiel für weibliche Kollaboration und nachträgliches Leugnen jeder Verantwortung ist auch die Geschichte von Johanne Eilers. Die 1888 geborene Tochter eines Schmiedes bestritt über lange Jahre der Internierung durch die Alliierten hinweg nicht nur ihre Schuld, sie ging sogar so weit, ihrem Opfer die Schuld zu geben. Eilers trat im März 1933 in die NSDAP ein und brüstete sich später damit, als eine der Ersten in ihrem Stadtteil von Langen bei Bremerhaven die Hakenkreuzfahne gehisst und ihre drei Söhne im »nationalen Geist« erzogen zu haben.9 Sie ist so überzeugt von der Sache, dass sie mehrere Mitglieder nationalsozialistischer Organisationen denunziert, die in ihren Augen zu lethargisch und zu wenig überzeugt sind oder verbotenerweise in Geschäften jüdischer Inhaber einkaufen. Dabei macht die zweifache Witwe selbst vor dem NSDAP-Ortsgruppenleiter nicht halt. Ihren Verleumdungen, so konnte rekonstruiert werden, gingen immer persönliche Streits voraus. Wahrscheinlich hat sich die Frau auf diese Art und Weise an ihren Mitmenschen selbst für kleinste Reibereien gerächt.
Im Januar 1944 begegnet Johanne Eilers auf dem Hof ihrer Schwägerin dem invaliden Rentner und Gelegenheitsarbeiter Georg Meyer. Der 1875 geborene Kommunist ist bereits bei der Gestapo aktenkundig. An diesem Morgen wirkt er verärgert, weil er gerade erfahren hat, dass sein Enkel eingezogen werden soll. Er glaubt nicht daran, dass dieses Opfer noch Sinn hat, und sagt zu Eilers und ihrer Schwägerin, Deutschland gehe wie im Ersten Weltkrieg militärisch unter. Wenige Wochen später berichtet Eilers dem Ortsgruppenleiter der NSDAP in einem Brief ausführlich über das Gespräch. Sie fordert ihn auf, Meyer zu ermahnen, dass er mit Frauen, die gerade ihre Söhne im Krieg verloren hätten, nicht auf diese Weise sprechen dürfe. Der fast 70-jährige Georg Meyer wird deshalb am 14. Juni 1944 hingerichtet. Zwei Jahre später erstellt seine Tochter Strafanzeige gegen die Denunziantin. Eilers erklärt sich für völlig unpolitisch, streitet alles ab, und als sich ihre Verurteilung abzeichnet, behauptet sie sogar, ihr Opfer habe sich selbst belastet. Das erste Urteil der Spruchkammer Bremerhaven fällt am 28. August 1948. Die 59-jährige Eilers wird zu sieben Jahre Arbeitslager dafür verurteilt, dass sie den Arbeiter wegen angeblich wehrkraftzersetzender Äußerungen denunziert hat. Dass Eilers empfindlich bestraft wird, hängt mit ihrer fehlenden Reue zusammen. Die Richter lassen nicht gelten, dass sie als Frau von Haus aus unpolitisch gewesen sein will. Sie unterstellen ihr, sich durch ihr Verhalten einen Vorteil erhofft zu haben.
Entnazifizierung der Frauen
Die Besatzungsarmeen hatten erwartet, dass in deutschen Frauen mehr stecken konnte als nur harmlose Hausfrauen und Mütter. Sie hielten die weibliche Bevölkerung sogar für besonders gefährlich. Schon vor Kriegsende hatten amerikanische Untersuchungen vor dem hohen Organisationsgrad der Frauen und der notorischen weiblichen Hitlerbewunderung gewarnt. Immerhin war ein Drittel der Frauen in einer der NS-Gliederungen. Frauen waren genauso wie Männer Teil der idealisierten »Volksgemeinschaft« gewesen, die im Krieg gegen den »Feind« gestanden hatten. Sie waren für die Rüstungsindustrie mobilisiert und massenhaft in den Reichsarbeitsdienst eingezogen und im Luftschutz, an der Flak, aber auch an der Front beim Roten Kreuz eingesetzt worden. Frauen erlebten in der Kriegsgesellschaft, wenn auch keine Emanzipation im klassischen Sinne, so doch Gelegenheiten, zu wirken und sozial aufzusteigen.10 Nachdem das NS-Regime gestürzt war – so befürchteten die Amerikaner –, hätten gerade diese Frauen ihren Lebensinhalt verloren und würden womöglich die neuen Machthaber im Land bekämpfen und der Demilitarisierung und Demokratisierung im Weg stehen. Das Hauptquartier der alliierten Streitkräfte SHAEF (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force) hielt diese Gefahr für so groß, dass Soldaten nicht nur jeder Kontakt mit Zivilistinnen verboten war, damit sie nicht zum Geheimnisverrat verführt werden könnten. Auch sollten möglichst alle Führerinnen des BDM, des Reichsarbeitsdienstes sowie andere Funktionärinnen im Hitlerstaat unter automatischen Arrest gestellt werden.
Der BDM wurde als eine Brutstätte militaristischer Erziehungsmethoden betrachtet und genauso ernst genommen wie die NS-Frauenschaft (NSF), der Frauendachverband der NSDAP. Ein Aufgabenbereich der NSF war es immerhin gewesen, Frauen zu künftigen Müttern von körperlich tüchtigen und ideologisch zuverlässigen Untertanen zu erziehen – sprich, bei den Frauen konnte, so glaubte man, das Problem bei der Wurzel gepackt werden. Auch wenn das nicht alle Verantwortlichen bei den westlichen Alliierten für richtig hielten, wurden auch Luftwaffenhelferinnen in Kriegsgefangenschaft genommen, SS-Helferinnen, Gestapo- und SD-Angestellte sowie Mitarbeiterinnen des »Lebensborn«, Führerinnen des BDM und der NSF und nicht zuletzt Ehefrauen von hochrangigen Nazis.11
Bei den Amerikanern war hierfür das CIC (Counter Intelligence Corps) zuständig. Der Auftrag hieß, Spionage zu verhindern und zu entnazifizieren. Aus der ersten Phase sind nur Gesamtzahlen bekannt: Zwischen dem 21. und 23. Juli 1945 wurden 85 000 Personen verhaftet. Die Verhaftungsquote betrug im Mai 1945 200 Personen am Tag, im August schon 700. Im Dezember 1945 saßen 128 0000 Menschen im Internierungslager, im März 1946 137 000, im November 1946 insgesamt 170 000.12 Die Sowjets sperrten 189 000 Menschen in zehn Lager ein. Die Aussichten der Inhaftierten unterschieden sich je nach Besatzungsmacht. Die Amerikaner entließen schon zum Jahreswechsel 1945/46 die Hälfte und übergaben im Jahr 1947 die Lager den Deutschen. In den sowjetischen Lagern waren die Lebensbedingungen so schlecht, dass ungefähr ein Drittel der Gefangenen an Hunger, Kälte und Infektionskrankheiten starb.