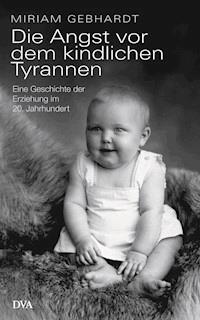23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch der Bestsellerautorin von »Als die Soldaten kamen«
Nicht nur sowjetische Armeeangehörige wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs zu Vergewaltigern, alle vier Besatzungsarmeen verübten massenhaft Verbrechen an deutschen Frauen. Die Opfer dieser sexuellen Kriegsgewalt rangen oft ein Leben lang mit seelischen Problemen, Kinder, die aus den Vergewaltigungen hervorgingen, wurden quasi mit einer Erbschuld geboren, Familien litten vielfältig – und zum Teil bis heute – unter der belastenden Vergangenheit. Anhand bewegender Fallgeschichten zeigt Miriam Gebhardt, welch tiefe Spuren die massive Gewalterfahrung in den Jahren von 1945 bis 1955 in der deutschen Gesellschaft hinterlassen hat. Oft bestimmte das Kriegsende ein Familienschicksal, das bis in die heute erwachsene Enkelgeneration nicht überwunden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Nicht nur sowjetische Armeeangehörige wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs zu Vergewaltigern, alle vier Besatzungstruppen verübten massenhaft Verbrechen an deutschen Frauen. Die Opfer dieser sexuellen Kriegsgewalt rangen oft ein Leben lang mit seelischen Problemen, Kinder, die aus den Vergewaltigungen hervorgingen, wurden quasi mit einer Erbschuld geboren, Familien litten vielfältig unter der belastenden Vergangenheit. Anhand bewegender Fallgeschichten zeigt Miriam Gebhardt, welch tiefe Spuren die massive Gewalterfahrung in den Jahren von 1945 bis 1955 in der deutschen Gesellschaft hinterlassen hat. Oft bestimmte das Kriegsende ein Familienschicksal, das bis in die heute erwachsene Enkelgeneration nicht überwunden ist.
Zur Autorin
Miriam Gebhardt ist Journalistin und Historikerin und lehrt als außerplanmäßige Professorin Geschichte an der Universität Konstanz. Neben ihrer journalistischen Arbeit, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und verschiedene Frauenzeitschriften, habilitierte sie sich mit einer Arbeit über Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen. Eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert (2009). Sie ist Autorin mehrerer Bücher, darunter Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet (2011) sowie Alice im Niemandsland. Wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor (2012). Ihr Bestseller Als die Soldaten kamen (2015) über die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde breit besprochen und in mehrere Sprachen übersetzt. Miriam Gebhardt lebt in Ebenhausen bei München.
Miriam Gebhardt
Wir Kinder der Gewalt
Wie Frauen und Familien bis heute unter den Folgen der Massenvergewaltigungen bei Kriegsende leiden
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © akg-images/Paul Almasy
Gestaltung und Satz: DVA/Andrea Mogwit
ISBN978-3-641-18891-1V000
www.dva.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Eleonore S. – Ein »Franzosenkind« sucht die Liebe
Kindheiten im Nachkrieg
Maria K.singt »Silent Night« und findet Halt bei den Nonnen
Eine »erstaunlich unempfindliche« Generation?
Klara M.pflegt die von Sowjets verschleppte Mutter und springt vom Turm
Erziehung zur Abhärtung
Marianne F.ist seit der Vertreibung wie aus der Zeit gefallen
Gefahr und Moral zwischen Krieg und Befreiung
Karl T.wollte immer nur, dass es für seine Mutter vorbei sei
Sex und Angst und die Folgen bis heute
Hinweis für Betroffene
Dank
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Vorwort
Als mein erstes Buch über die Massenvergewaltigungen in Deutschland nach 1945 erschien, wurde ich nach Köln in die Talkshow »Maischberger« eingeladen. Wir Gäste, die wir auf den Sofas im roten Fernsehstudio Platz nehmen durften, waren eine bunte Gesellschaft: Erhard Eppler, Jahrgang 1926, der noch als junger Mensch in der Wehrmacht gekämpft hat, Niklas Frank, Jahrgang 1939, dessen Vater Hans Frank als ein Haupttäter des NS-Regimes hingerichtet wurde, Nico Hofmann, Jahrgang 1959, der die von ihm verfilmte Geschichte eines dreijährigen jüdischen Jungen im KZ Buchenwald erzählte, und Elfriede Seltenheim, Jahrgang 1931, die als Teenagerin nach Kriegsende von alliierten Soldaten vergewaltigt worden war. Siebzig Minuten lang sprachen wir eher nach- als miteinander, doch in einem Punkt waren wir uns alle einig: Die Geschichte ist nicht vergangen. Unabhängig davon, wie alt sie bei Kriegsende gewesen waren, auf welcher Seite der Front sie standen, ob sie verfolgt worden waren oder zu den Verfolgern gehörten – die Jahre zwischen 1933 und 1945 haben bei vielen Deutschen tiefe Spuren hinterlassen. Bis heute.
Auch Karl T. versuchte an diesem Abend, der Sendung mit dem wuchtigen Titel »Das Erbe von 1945 – deutsche Schuld, deutsche Opfer« vor dem Fernseher zu folgen. Der Anspruch, durch die Auswahl der Themen und Gesprächspartner sowohl der deutschen Schuld als auch den deutschen Opfern gerecht zu werden, ließ ihn jedoch ratlos zurück. Am nächsten Tag setzte sich der Finanzberater an den Computer und schrieb den Verantwortlichen beim Sender einen Brief. Leider, meinte er, sei es doch wieder nur ein pflichtschuldiger Durchlauf durch die deutsche Schuld- und Opferdiskussion geworden. Erhofft habe er sich etwas ganz anderes, erhofft habe er sich Antworten auf die Frage, was diese heillose Geschichte mit den Deutschen gemacht habe. »Aus mir hat sie sehr viel gemacht, bewegt mich heute noch, und es gibt eine Menge anderer, denen es ähnlich geht. Wir haben jetzt nämlich diese Bilder im Kopf!«
Als Sohn einer Frau, die bei Kriegsende in Berlin elf Mal von Angehörigen der Roten Armee vergewaltigt worden war, fragte sich Karl T. zurecht, wie er die ganz unterschiedlichen Geschehnisse am Ende des Zweiten Weltkriegs für sich in Einklang bringen sollte, von der Shoah über die Leiden der Soldaten an der Front bis zur sexuellen Gewalt durch die Siegertruppen. Ich kann seine Überforderung verstehen, weshalb ich ihn auch gebeten habe, mir ein Interview zu seiner Lebensgeschichte zu geben. Dieses Buch soll Menschen wie ihm, den Kindern der Gewalt, Raum für ihre Bilder im Kopf schenken.
Doch auch wenn hier die Nachfahren der deutschen Kriegsgeneration im Mittelpunkt stehen, heißt das nicht, dass die Leiden der primären Opfer des Nationalsozialismus und des deutschen Vernichtungskrieges in den Hintergrund treten dürfen. Je länger die Zeit seit 1945 fortschreitet und je weiter die Forschung vorankommt, desto mehr müssen wir lernen, auch mit den Ambivalenzen der Erinnerung umzugehen. Es ist eben unmöglich, die Jahre zwischen 1933 und 1945 zu rekonstruieren, ohne die Verantwortung der Deutschen, allen voran an der Ermordung der europäischen Juden, anzuerkennen. Es ist aber auch nötig, den Folgen gewaltsamer Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse auf Seiten der nichtverfolgten Deutschen Rechnung zu tragen. Der Umgang mit der NS-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg fordert einen nie endenden Lernprozess, der uns befähigt, die Spannung und Unbequemlichkeit auszuhalten, dass wir die Menschen von damals nicht immer ordentlich in Täter und Opfer unterteilen können.
Dieser Prozess wurde und wird neben den individuellen Variablen – also wie schwer betroffen, wie verletzlich oder robust die betreffende Person ist – auch von der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Probleme beeinflusst. Alle, die den Krieg überlebt haben, haben ihn auf unterschiedlichste Art und Weise »metabolisiert«, wie es die bekannte Traumapsychologin Luise Reddemann ausdrückt.1 Zu verschiedenen Zeiten, aufgrund wechselnder politischer Bedingungen oder gesellschaftlicher Anlässe, treten bestimmte Themen und mit ihnen Verwundungen in den Vordergrund, und das wirkt sich wiederum auf die Verarbeitungsweisen der Betroffenen aus: Für die Deutschen, die nicht unter der Verfolgung im Nationalsozialismus zu leiden gehabt hatten, standen in den ersten Jahren nach dem Krieg die eigenen Verwundungen im Mittelpunkt. Dabei waren auch Verdrängung und Selbstmitleid mit im Spiel. Später, seit den siebziger Jahren, trat der Nation der Täter das Verbrechen an den Juden in seinem ganzen Ausmaß ins Bewusstsein. Seit den neunziger Jahren wurde wieder zunehmend des Schicksals der deutschen Mehrheitsgesellschaft gedacht, der Bombardierungen, des Verlusts von Heimat oder des vaterlosen Aufwachsens.
In den zehner Jahren unseres Jahrhunderts kehrte ein bis dahin fast vollständig verschüttetes Thema an die Oberfläche zurück – die Massenvergewaltigung durch die Sieger- und Besatzungstruppen in Deutschland. Direkte Gewalt erfahren haben nach meiner Schätzung mindestens 860 000 Personen. Doch betroffen waren davon viel mehr Menschen: allen voran die Familien der Opfer, besonders ihre Nachkommen, aber auch die Nachbarn und sonstigen Mitwisser, die oft mit Abwehr auf das Problem reagierten, die Ärzte und Pfarrer, die eingeweiht, aber nicht immer hilfreich waren, die Behörden, die mit den rechtlichen Folgen rangen. Die sexualisierte Kriegsgewalt zeitigte letztlich Auswirkungen auf die ganze Nachkriegsgesellschaft.
Momentan ist viel von der Generation der Kriegskinder die Rede. Doch »Kriegskindheit« ist eine mäandernde Kategorie. Mal sind die Geburtenkohorten gemeint, die während des Krieges Kinder waren, unabhängig davon, ob und wie direkt sie vom Krieg beeinträchtigt wurden. Mal sind die Nachkommen der Menschen gemeint, die Akteure des Krieges waren. Während die Kinder der Flüchtlinge und Vertriebenen sehr direkt vom Kriegsverlauf betroffen waren, müssen für die meisten Menschen der Generation »Kriegskindheit« die indirekten Folgen des Krieges als prägend betrachtet werden: Der Verlust von Angehörigen, die Verschlossenheit der Eltern bezüglich ihrer eigenen Erfahrungen im Krieg, die Verleugnung der Verstrickung in den Nationalsozialismus, der weitverbreitete harte Erziehungsstil zu jener Zeit und nicht zuletzt die Sexualdelikte der Siegerarmeen, all das hat sich für sie ineinander verschachtelt.
In diesem unübersichtlichen Feld von Generationenerfahrungen ist der Begriff, den ich für mein Buch wählen möchte – »Kinder der Gewalt« –, ein Versuch, die speziellen Erfahrungen der Kinder der Vergewaltigungsopfer zu fassen und in das Gesamtbild der Kriegskindheit zu integrieren. Im internationalen Forschungskontext beginnt sich für sie der Begriff »children of war« zu etablieren, der jedoch nicht gut in die deutsche Sprache übertragbar ist, da »Kriegskinder«, wie gesagt, auf ein sehr viel weiteres Bedeutungsfeld verweist.2 Kinder, die aus Vergewaltigungen entstanden sind oder auch »nur« von Vergewaltigungsopfern der Siegerarmeen in Deutschland aufgezogen wurden, sind eine Untergruppe der sogenannten Besatzungskinder, von denen im westlichen Teil des Landes zwischen 1945 und 1955 knapp 80 000 amtlich registriert wurden. Manche Forscher glauben indes, es könnten bis zu 400 000 gewesen sein.3
Die Kinder der Gewalt können vor Kriegsende, unmittelbar bei Kriegsende, in den späteren Besatzungsjahren und sogar noch in den sechziger Jahren gezeugt worden sein, wenn ihre bei Kriegsende vergewaltigte Mutter spät noch einmal ein Kind zur Welt gebracht hat. Sie gehören mithin der Generation der Kriegskinder im generativen Sinne an, aber auch der Nachkriegsgeneration, die wir heute als Achtundsechziger bezeichnen, und sogar den Babyboomern. Ihre Biografien wurden durch eine spezifische Kriegsfolge, die Massenvergewaltigung durch Siegertruppen, in besonderem Maße geprägt.
Wie einschneidend, zeigt eine erste statistische Erfassung der psychischen Leiden dieser Personengruppe: Demnach tragen sie generell ein deutlich höheres Risiko, psychisch zu erkranken. Zu den Stressoren gehörte das im Vergleich zur Normalbevölkerung vielfach erhöhte Risiko, eigene traumatische Erfahrungen wie Kindsmissbrauch, sogar Vergewaltigungen zu durchleben. Spätere psychische und psychosomatische Erkrankungen lassen sich aber auch auf die häufigen Wechsel der Bezugspersonen beziehungsweise Phasen der Heimunterbringung, auf die ambivalente Beziehung zu den Müttern, die fehlenden leiblichen und die ablehnenden Ziehväter, die Abhängigkeit von potentiell feindlichen und missbräuchlichen Familienangehörigen und die Erfahrungen der Diskriminierung und Stigmatisierung im sozialen Umfeld zurückführen.4
In den Lebensgeschichten dieser Personengruppe überlagern sich Themen, mit denen viele deutsche Nichtverfolgte als Folge des Krieges zu kämpfen hatten. Deshalb kann ihr Schicksal, wiewohl es ein besonders drastisches war, als paradigmatisch für eine ganze Generation gelten. Die Kinder der Gewalt mussten im besonderen Maße erfahren, was es heißt, nicht »in Liebe empfangen«, sondern oft schon im Mutterbauch als belastend, bedrohlich, fremd wahrgenommen worden zu sein. Sie mussten erleben, was es heißt, sich ein Leben lang zu fragen, wer der eigene Erzeuger war, was es heißt, immer wieder verpflanzt zu werden, bei Fremden aufzuwachsen, soziale Ausgrenzung oder Stigmatisierung zu erleben, was es heißt, die Mutter oder beide Eltern unter einem namenlosen Geheimnis leiden zu sehen und erst spät und bruchstückhaft Erschreckendes aus der eigenen Familiengeschichte zu erfahren.
Überrascht hat mich bei den Interviews, die ich für dieses Buch geführt habe, dass trotz der schweren Lebenswege keiner der Zeitzeugen, die exemplarisch für die Generation der Kinder der Gewalt stehen können, den Begriff »Trauma« für sich in Anspruch genommen hat. Das fand ich umso erstaunlicher, als es inzwischen fast schon Mode geworden ist, von sich als Traumatisierte zu sprechen oder sich gar als »Überlebende« eines Traumas zu bezeichnen, wie die neueste Sprachregelung für viele Gewaltopfer ist. Das hat mich in meiner Auffassung bestärkt, dass der populärwissenschaftliche Trend, eine ganze Geburtenkohorte zu Traumaopfern zu erklären, in die Irre führt. Teil einer Generation zu sein ist noch kein Ausweis von Traumatisierung. Nicht nur unterschieden sich die Gefahren und Erfahrungen, denen die Kinder der Gewalt ausgesetzt waren, beträchtlich, sie hatten auch unterschiedlich ausgeprägte persönliche Ressourcen, um mit den Auswirkungen des Krieges umzugehen. Umgekehrt können gebrochene Lebensläufe, Ängste und Depressionen auch von anderen individuellen und kollektiven Faktoren ausgelöst worden sein als Gewalterfahrungen zu Kriegszeiten. Die Tendenz, allen und jedem großzügig das Etikett »Kriegstrauma« umzuhängen, unabhängig davon, zu welcher Nation Menschen gehörten, ob sie Nazis waren oder Verfolgte, Männer oder Frauen, Kinder oder Erwachsene, kann außerdem zu Beliebigkeit und gar zu Relativierung und Aufrechnung führen. Das wird dem Einzelnen und seiner individuellen Lebensgeschichte nicht gerecht und nützt höchstens jenen, die in Wahrheit hinter die Anerkennung der deutschen Schuld zurückwollen.
Meine Studie geht daher mit dem medizinisch-psychologischen sowie dem populären Traumabegriff sparsam um und stellt eher die transgenerationalen Prozesse in den Vordergrund, die auch ohne den Krankheitswert eines Traumas schon belastend genug sind: die Ablehnung des Kindes oder die Überfürsorglichkeit, das Schweigen der Familie oder die Stigmatisierung durch das Umfeld, die offenen Identitätsfragen und der Verlust der Kindheit durch die Notwendigkeit, viel zu früh Verantwortung für das eigene Leben und für Familienmitglieder zu übernehmen.
Die Männer und Frauen, die ich für dieses Buch interviewt habe, haben sich bei mir von sich aus gemeldet, um vom Leben ihrer Mütter, ihrer realen und imaginierten Väter und ihren eigenen Werdegängen zu erzählen. Mir war es wichtig, ihre individuellen Geschichten in den Vordergrund zu stellen und als Ganzes stehen zu lassen, anstatt nur einzelne Aussagen zur Illustration bestimmter Gesichtspunkte zu verwenden. So wechseln sich in diesem Buch ausführliche Falldarstellungen mit allgemeineren Quellen ab, die bei der historischen Einordnung des Einzelfalls in das Große und Ganze helfen sollen. Auf diese Weise werden die individuellen Spuren der Gewalt in die Geschichte Nachkriegsdeutschlands eingebettet, was uns davor bewahrt, alles über einen Kamm zu scheren und anachronistisch auf Phänomene zu reagieren, die wir uns heute so nicht mehr vorstellen können, die aber damals fast schon normal waren.
Einleitung
Das Aufeinandertreffen der deutschen Zivilbevölkerung mit den einmarschierenden Siegergruppen am Ende des Zweiten Weltkriegs war begleitet von massenhafter sexueller Gewalt. Dabei spielte es keine Rolle, ob sich die Menschen auf der Flucht befanden, ob sie evakuiert waren, in zerstörten Städten oder auf Bauernhöfen lebten, ja, nicht einmal, ob sie aus einem Konzentrationslager befreit worden waren. Niemand war vor den vergewaltigenden Soldaten der Siegermächte sicher. Es kam nicht darauf an, ob Frau oder Mann, Kind oder Greisin, reich oder arm, krank oder gesund, nationalsozialistisch überzeugt oder im Widerstand aktiv, schuldig am Völkermord oder unbelastet, treffen konnte es theoretisch jede und jeden. Wir haben Zeugnisse von sexueller Gewalt in allen Gegenden Deutschlands, gegen Knaben, Männer, Mädchen und Frauen. Die Zahl der weiblichen Opfer lag erheblich höher, aber sie ist auch etwas leichter zu ermitteln, da das ohnehin schon tabuisierte Thema sexualisierter Gewalt bei männlichen Opfern noch mehr verschleiert wurde.
Wie ich in meinem Buch »Als die Soldaten kamen« dargelegt habe, drohte die Gefahr eines gewaltsamen Übergriffs von allen Seiten. Die Idee, die sich bis heute hält, dass die Massenvergewaltigung vorrangig ein Problem der Flüchtlinge und Vertriebenen im Osten und der Berliner gewesen sei, ist falsch. Sicherlich waren die Gebiete im Osten und in Berlin aufgrund des Kriegsverlaufs besonders gefährdet, aber sie standen auch unter besonderer Beobachtung, denn es handelte sich um die Einflusssphäre der Roten Armee, vor der die Deutschen am meisten Angst hatten, nicht zuletzt dank der Durchhaltepropaganda von Joseph Goebbels. Lange bevor die Wehrmacht kapituliert hatte, hatte es der Propagandaminister nämlich heraufbeschworen: Die Rache der Sowjets werde fürchterlich sein, und sie werde vor allem über die deutsche Frau hereinbrechen. Die damaligen rassistischen Vorurteile gegen die bolschewistischen »Untermenschen« trugen ihr Übriges dazu bei, dass viele noch heute davon überzeugt sind, nur die »Russen« (gemeint sind natürlich die Soldaten der Roten Armee) hätten vergewaltigt, wohingegen die Amerikaner nichts als Wohltaten verteilt hätten.
Nach meiner Hochrechnung kam es zwischen Kriegsende 1945 und 1955, als die Besatzungszeit vorbei war, zu knapp 900 000 Vergewaltigungen durch Soldaten der siegreichen Armeen. Etwa ein Drittel davon dürfte auf das Konto der Westmächte gehen, auf Amerikaner, Briten, Franzosen und deren Verbündete wie die Kanadier. Der Versuch, heute die genauen Anteile der Verbrechen zu quantifizieren, ist allerdings unmöglich und im Übrigen auch müßig. Kriegsverlauf, Truppenstärken, besetzte Gebiete und Größe der Zivilbevölkerung waren nicht vergleichbar, sodass am Ende nur eines festzuhalten bleibt: Die Uniformen unterschieden sich, die Taten nicht.
Es geschah am helllichten Tag, nachts bei Hausdurchsuchungen, auf offenem Feld, in Kellern und Unterständen, in Almhütten und Gutshäusern, in Krankenhäusern und Offizierskasinos, in Mannschaftswagen und in spontan eingerichteten Vergewaltigungsräumen. Die Taten wurden sehr oft in der Gruppe verübt, die Soldaten standen gegenseitig Schmiere, vermittelten einander Erfolg versprechende Adressen, sie scherten sich nicht um Zuschauer, aber sie schlugen auch allein und in aller Heimlichkeit zu. Sexuelle Gewalt ging nicht nur vom »schwarzen Mann« aus, sie wurde von Weißen und Schwarzen gleichermaßen verübt. Und, ein weiteres Vorurteil, das überwunden werden muss: Sie ereignete sich nicht nur zwischen Unbekannten.
Die kriegsbedingte sexuelle Gewalt spielte sich im ganzen Spektrum sozialer Kontakte ab: beim Missbrauch von Abhängigen (zum Beispiel der zahlreichen deutschen Sekretärinnen, Dolmetscherinnen oder Bedienungen der Besatzungsverwaltungen), bei Übergriffen gegen Mitbewohner (etwa bei der Einquartierung von Soldaten in Privathäusern), bei der Zusammenarbeit mit dem Personal von Hilfsorganisationen oder medizinischen Einrichtungen (zum Beispiel Krankenschwestern), bei der Notprostitution sowie natürlich bei überfallartigen Angriffen auf völlig fremde Frauen und Männer im öffentlichen Raum. Es kam zu Vergewaltigungen bei Tanzveranstaltungen, privaten oder geschäftlichen Verabredungen, in Büros.
Allerdings bewertete die damalige Gesellschaft diese verschiedenen Formen der sexuellen Gewalt nicht alle gleich. Opfer, die ihre Vergewaltiger kannten und in irgendeinem persönlichen Verhältnis zu ihnen gestanden hatten, wurden nicht als Opfer anerkannt. Sie galten als Verführerinnen und wurden als Personen mit angeblich fragwürdiger Moral selbst für ihr Schicksal verantwortlich gemacht und gebrandmarkt.
Die wechselnden Szenarien, in denen sich die Übergriffe ereigneten, bestätigen zwei Thesen zu den Ursachen der massenhaften militärischen Sexualgewalt – dass es dabei sowohl um die Demoralisierung und Zerrüttung des gegnerischen Kollektivs, in dem Fall der Deutschen, ging als auch um Homogenisierung und männliche Verbandelung in der eigenen Gruppe. Deshalb traf die sexuelle Gewalt sogar eigene Verbündete, zum Beispiel Britinnen und Franzosen auf Seiten der US-Armee oder Polinnen auf Seiten der Roten Armee, und dauerte weit über den eigentlichen militärischen Konflikt hinaus.5 Auch wenn das nicht Thema dieses Buches ist, muss an dieser Stelle betont werden, dass nicht nur die Soldaten der Alliierten sexuelle Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ausübten, sondern dass selbstverständlich auch Angehörige der deutschen Wehrmacht eine Spur der sexuellen Gewalt durch die eroberten und besetzten Gebiete gezogen haben.6
Inwieweit der zweite Zweck der Gewaltakte bei Kriegsende, die Verbrüderung der Soldaten durch gemeinsam verübte Verbrechen, erfüllt wurde, kann hier nicht beurteilt werden. Das erste Ziel, Zwietracht und Entsolidarisierung in der besiegten Bevölkerung zu säen, wurde jedenfalls erreicht. Denn die Deutschen reagierten auf die sexuelle Gewalt ähnlich, wie wir es heute noch in Konflikten anderswo erleben – mit der Ächtung der eigenen Opfer. Auf der Basis einer altväterlichen Sexualmoral, die Frauen grundsätzlich für sexuell unberechenbar und leichtfertig hielt und die davon ausging, dass Frauen den Übergriff im Zweifelsfall selbst gewollt oder zumindest selbst verschuldet hätten, fanden weibliche Opfer von Sexualstraftaten damals nur schwer Gehör (die Hürden der männlichen Opfer wurden schon erwähnt).
Zusätzlich belastet wurde der Umgang mit den Folgen der sexualisierten Gewalt durch den konservativen Sittlichkeitsdiskurs der Nachkriegszeit, mit dessen Hilfe sich Deutschland von den materiellen und immateriellen Beschädigungen in Kriegs- und NS-Zeit moralisch regenerieren wollte. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft herrschte ein Klima, das alles sozial Randständige und sexuell Auffällige ausgrenzte und als Bedrohung für die Wiedergesundung der Gesellschaft mit Hilfe der bürgerlichen Familie bekämpfte. Und nicht zuletzt hatten vergewaltigte Frauen immer wieder mit dem Vorwurf zu kämpfen, sie hätten sich mit dem »Feind« verbrüdert und seien dem eigenen Volk in den Rücken gefallen. So gerieten Vergewaltigungsopfer gleich in mehrfacher Hinsicht in Verdacht – sich sexuell ungehörig benommen zu haben, der sittlichen Gesundung Deutschlands zu schaden und den eigenen Männern gegenüber illoyal gewesen zu sein.
Für Vergewaltigungsopfer stand also einiges auf dem Spiel, wenn sie von der Gewalt, die sie erfahren hatten, berichten wollten: ihre Glaubwürdigkeit, ihr Ruf und, falls sie verheiratet waren, ihre Ehen. Es überrascht daher nicht, dass es vielen, wahrscheinlich den meisten, ratsam erschien, über das Erlittene zu schweigen. Denn die betroffenen Frauen und Männer mussten nicht nur den Mut aufbringen, die Beschämung und Verletzung gegenüber oftmals wenig mitfühlenden Dritten einzugestehen, sie mussten in Kauf nehmen, dass ihr gesamtes Leben durchleuchtet wurde. Bei Frauen, die etwa schon einmal im Gespräch mit einem Besatzungssoldaten gesehen worden waren, galt es als ausgeschlossen, dass sie sich nicht freiwillig sexuell angeboten hatten, bei Männern wurde die sexuelle Orientierung überprüft. Ein Beispiel aus Bad Kissingen: Einem 48-jährigen Zahnarzt, der von vier amerikanischen GIs missbraucht worden war, wurde erst geglaubt, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass er nicht homosexuell war.7 Wäre er schwul gewesen, hätte er offenbar definitionsgemäß kein Gewaltopfer sein können. Angesichts solcher Fallgeschichten wird ersichtlich, warum die oben erwähnte Zahl von knapp 900 000 Opfern zwangsläufig deutlich zu niedrig gegriffen ist. Da viele Opfer schwiegen oder ihnen nicht geglaubt wurde und da die Quellenlage äußerst schwierig ist, sind die Zahlen, die sich heute noch ermitteln lassen, wohl nur die Spitze des Eisbergs.
Die Opfer wurden, wie wir auch in unseren Fallgeschichten weiter unten sehen werden, oft körperlich schwer verletzt, sie erlitten manchmal bleibende gesundheitliche Schäden, sie konnten sich mit Geschlechtskrankheiten infizieren, und sie hatten oft lebenslange seelische Probleme infolge des brutalen Ereignisses. Dazu kam die Erfahrung sozialer Stigmatisierung als »Ami-Liebchen«, »Russenhure« und wie die anderen herabwürdigenden Namen für Frauen lauteten, die sich – angeblich freiwillig – mit Besatzungssoldaten einließen. Besonders schwer hatten es jene Frauen, die infolge einer Vergewaltigung schwanger wurden. Wenn ihnen nicht gestattet wurde – oder sie keinen illegalen Weg fanden – abzutreiben, konnten sie kaum verstecken, was passiert war, selbst wenn sie das Kind nach der Geburt weggaben. Auch eine spätere Ehe konnte das gesellschaftliche Ansehen dieser Frauen meist nicht wiederherstellen.
Und ihre Kinder? Sie wurden mit einer Erbschuld geboren. Wenn sie selbst ein Resultat der Gewalt waren, mussten sie mit einem schrecklichen Zeugungsakt und dem schamerfüllten Schweigen über den leiblichen Vater leben. Doch auch für Kinder, die lange nach der Vergewaltigung der Mutter gezeugt worden waren, war das Aufwachsen mit einem Opfer sexualisierter Gewalt häufig eine Bürde, an der sie bis heute tragen.
Diese lang andauernde Belastung der Kinder der Gewalt ist der Anlass für dieses Buch. Nach dem Erscheinen von »Als die Soldaten kamen«, meines ersten Buches, in dem ich mich auf die Spuren der sexuellen Gewalt nach dem Zweiten Weltkrieg begeben hatte, meldeten sich bei mir Dutzende von Menschen, die oftmals erst durch meine Publikation von dem Schicksal ihrer Mütter und Großmütter erfahren hatten beziehungsweise deren diesbezügliche Ahnung sich erst durch die Lektüre zu bestätigen schien. Manche baten um Hilfe bei ihren Recherchen, andere wollten sich bedanken dafür, dass sie sich mit ihrer Familiengeschichte nun nicht mehr so allein fühlten. In einigen Fällen waren die Schreiber nachträglich zutiefst verstört über ihre eigene Ignoranz, denn sie hatten den Geschichten ihrer Mütter oder Großmütter von sexuellen Übergriffen, besonders wenn es sich um westliche Soldaten gehandelt hatte, lange Zeit schlicht keinen Glauben schenken wollen. Jetzt kam ihnen auf einmal zu Bewusstsein, wie unrecht sie ihren Angehörigen damit getan hatten. Gerade deshalb, und weil es so offensichtlich wurde, wie sehr die alten Geschichten meinen Briefpartnern noch heute auf der Seele lagen, schien es mir angeraten, einige von ihnen zu treffen. Es wurden ausführliche Begegnungen.
Die Interviews im privaten Umfeld der Gesprächspartnerinnen und -partner gaben mir wichtige Einblicke. Schon erste flüchtige Eindrücke offenbarten die Übereinstimmungen im Leben dieser Kinder der Gewalt. Eine Auffälligkeit bei meinen Hausbesuchen war zum Beispiel eine gewisse Ähnlichkeit der Wohnstile. Die Wohnungen waren oft dicht möbliert, jeder Quadratzentimeter Wand mit Bildern gefüllt, Memorabilien aus der Familienvergangenheit, plüschige Sofas, Kissen und Stofftiere, die wirkten, als sollten sie die Bewohner beschützen. Es schien mir, als wollten die Befragten keine Leerstellen zulassen, und ich fragte mich, ob dies Ausdruck eines Bedürfnisses nach Schutz und Geborgenheit sein könnte. Eine der Befragten bestätigte mir, dass sie sehr zurückgezogen lebe, kaum die Wohnung verlasse und die heiteren Farben ihrer Einrichtung als Stimmungsaufheller brauche.
Eine andere Gesprächspartnerin sagte mir offen, dass sie große Schwierigkeiten habe, allein zu bleiben. Sie wisse bis heute nicht, wie sich Geborgenheit anfühle: »Wie wollen Sie sich geborgen fühlen, wenn Sie als Kind gar nicht gelernt haben, wie schön das ist?« Die Stofftiere, die sie in ihrer Wohnung umgaben, sollten ihr dabei helfen. Sie erklärte mir auch, dass es ihr wichtig sei, ihren Mann bei unserer Begrüßung dabeizuhaben, allein wollte sie mir nicht gegenübertreten. Zwei weitere Befragte ließen sich während des Interviews von ihren Töchtern unterstützen, die bei der Gelegenheit neue Details über ihre Familiengeschichte erfuhren. Das weist auf den Stress hin, den die Befragten noch heute verspüren, wenn sie über die Geschehnisse nach dem Krieg sprechen.
Ein Interviewter wohnte in einem Familienmuseum: Die Wohnung war fast durchgängig mit Möbeln und Bildern aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet. Da sich der Betreffende auch intensiv mit Genealogie beschäftigt, da er alleine lebt und keine Nachkommen hat, wirkte es, als lebte er buchstäblich in seiner Familiengeschichte.
Auffallend war, wie gründlich sich alle Mitwirkenden auf die Teilnahme an meiner Studie vorbereitet hatten. Sie gaben mir vorab schon viele Informationen über sich, waren bei der Anreise behilflich, bewirteten mich und trugen dafür Sorge, dass alles gut klappte. Gewiss, die Motivation der Beteiligten war groß, schließlich hatten sie sich mit dem Wunsch bei mir gemeldet, über ihre Familiengeschichte zu erzählen. Sie waren einverstanden, in drei- bis vierstündigen Gesprächen – und oftmals auch noch danach im schriftlichen Austausch – sehr Persönliches und Verstörendes über ihre Eltern und Großeltern und vor allem über sich selbst preiszugeben, damit wir gemeinsam herausarbeiten könnten, welchen Einfluss ihre besondere Situation als Kinder von Vergewaltigungsopfern auf ihre Biografien hatte. Sie hatten selbst ein Interesse daran, durch das gebündelte Erzählen nach einem roten Faden in ihrem Leben zu suchen. Ihre Geschichten waren von viel Emotion begleitet. Bisweilen so sehr, dass es sinnvoll war, das Interview zu unterbrechen und einen Spaziergang einzulegen.
Anschließend erhielten die Befragten die Möglichkeit, das wörtliche Protokoll unseres Gesprächs zu lesen und zu überarbeiten. Durch diesen Prozess der Partizipation an der Forschung wurde sichergestellt, dass sie die »Redaktion« ihres Lebens in der Hand behielten. Dinge, die sie bislang niemandem oder höchstens einer Therapeutin oder ihrem Partner erzählt hatten, konnten in diesem offenen Verfahren bearbeitet werden, was fast immer dazu führte, dass nach dem Gespräch ein neues Erinnern einsetzte.
Doch abgesehen von pragmatischen Gründen waren das Entgegenkommen meiner Interviewpartner und ihre Hilfsbereitschaft für mich auch ein Zeichen dafür, dass aus den Kindern der Gewalt Erwachsene geworden sind, die gelernt haben, auf andere zu achten und für Harmonie zu sorgen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Sie waren meist bei der Geburt unerwünscht, sie mussten zeitlebens um die Zuneigung ihrer Mütter und um Akzeptanz kämpfen, sowohl in ihrer Familie als auch in der Gesellschaft, oder sie hatten gelernt, eine schwer gezeichnete Familienangehörige zu unterstützen. Fast alle, mit denen ich gesprochen habe, trugen noch im fortgeschrittenen Alter eine große Trauer in sich über die belastete Beziehung zu ihren Müttern. Auch deshalb war es für sie wichtig, die Erinnerungen, von denen sie mir berichteten, noch einmal bearbeiten zu können, ohne das Gefühl, es der Forscherin recht machen zu müssen.
Natürlich bleibt eine ungewollte Beeinflussung des Erzählten durch das Forschungsinteresse der Autorin grundsätzlich unvermeidbar.8 Ein besonders drastisches Beispiel, wie stark sich Erinnerungen im Laufe des Interviewprozesses verändern können, war die Geschichte von Eleonore S. Während des Gesprächs erzählte sie mir zunächst, die Suche nach ihrem Vater, einem französischen Soldaten, sei ins Leere gelaufen. Wochen später ließ sie mich jedoch wissen, ihr Vater sei vermutlich in Indochina gefallen. Solche Ungereimtheiten zeigen, wie unabgeschlossen das Thema für die Befragten ist, wie sehr im Fluss sich die Erinnerungen befinden. Da meine Interviews nicht allein dem Erheben von Fakten dienen sollten – was streng genommen auf der Grundlage autobiografischen Erinnerns methodisch auch nicht sinnvoll wäre –, sondern dazu beitragen sollten, subjektive Wahrnehmung zu rekonstruieren und Lebensgeschichten zu deuten, waren diese Verschiebungen der Erzählinhalte für mich besonders interessant.9
Bei der Auswahl der Fallbeispiele hält sich das Verhältnis der Kinder, die aus Vergewaltigungen entstanden, und der Kinder, die mit vergewaltigten Müttern aufgewachsen sind, jedoch selbst nicht in einem Gewaltakt durch einen Besatzungssoldaten gezeugt worden waren, die Waage. Es war für mich lehrreich zu erfahren, dass sich ihre Probleme in den Grundzügen ähnelten. Die Vergewaltiger gehörten der Sowjet-, der US- und der französischen Armee an. Bei zwei Interviews konnten Erfahrungen und Sichtweisen eines Enkelkindes miteinbezogen werden, wodurch zumindest ein kurzer Blick auf die momentan stark diskutierte transgenerationale Perspektive fällt.
Das Buch gliedert sich in die Schilderung fünf ausführlicher Lebensgeschichten und daran anschließende allgemeine Kapitel. Mein Ziel war es, dem Einzelfall genügend Raum zu geben, dann aber immer wieder den Fokus auf die allgemeine Situation zu richten, um Analyse und Einordnung zu ermöglichen. Denn viele der erschreckenden Details der Lebensgeschichten lassen sich nur vor dem allgemeinen Zeithintergrund verstehen. In die übergeordneten Kapitel flossen zahlreiche andere Quellen aus Archiven sowie aus eigener Erhebung, nicht zuletzt aus Dutzenden von Zuschriften und kürzeren Gesprächen mit Betroffenen, ein.
Eleonore S. – Ein »Franzosenkind« sucht die Liebe
Am 14. Januar 2004 setzt sich Eleonore S. an ihren Schreibtisch und beginnt, einen Brief an ihre Tochter Jacqueline zu schreiben. Obwohl es ein sonniger Tag ist, dringt kaum Licht durch die Fenster in dem mehrstöckigen Neubau am Rande eines Vororts von Karlsruhe. Sie schaltet den teuren Computer an, den sie nach dem Ausscheiden aus der Firma, in der sie als Fremdsprachensekretärin gearbeitet hatte, mitnehmen durfte und der ihr den Übergang in den Ruhestand erleichtern soll. Das Verhältnis zu ihrer Tochter ist nicht unbelastet, und nachdem Jacqueline nach Australien gezogen ist, droht der Kontakt abzureißen. Deshalb der Brief.
Freizeit, so beginnt Eleonore S. zu schreiben, sei für sie immer schon ein schwieriger Begriff gewesen, jetzt werde sie mit dem lang gehegten Wunsch ernst machen, ihr Leben zu rekapitulieren. Sie nennt das, was sie aufschreiben möchte, nicht Biografie oder Autobiografie, sie nennt es »Rückblick und Ausblick miteinander verknüpfen« – als klaffe da in ihrem Leben eine Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Die Vergangenheit, die sie in den Griff bekommen möchte, ist nicht die eigene, sondern die ihrer Mutter Monika. Es ist aber auch ihre eigene Geschichte und die ihrer Tochter Jacqueline. Um ihrer Tochter das zu verdeutlichen, muss Eleonore S. eine große zeitliche Distanz überwinden. Sie beschreibt, wie anders die Welt war, in die sie hineingeboren wurde:
»In dem kleinen Dorf in Deutschland, in dem sich zur Nachkriegszeit Hund und Hase Gute Nacht sagten, wüteten jene Nachkriegswirren, die die Menschen verunsicherten, wo die Wunden auf allen Seiten der betroffenen Länder noch weit auseinanderklafften, als Deutschland und Frankreich sich als bitterböse Feinde gegenüberstanden und keine Heilung in Sicht zu sein schien und Frauen, die sich mit dem Feind einließen, hüben und drüben aus der heimatlichen Gesellschaft nicht nur ausgeschlossen, sondern gesteinigt wurden bzw. den Kopf von ihren Landsleuten geschoren bekamen. Zu jener Zeit begegnete meine damals noch junge Mutter einem ebenfalls im Dorf stationierten jungen französischen Soldaten.«
An dieser Stelle wechselt sie abrupt zu ihrer eigenen Lebensperspektive: »Von Anbeginn wurde ich von einem Teil meiner Seele beraubt [sic], bevor ich überhaupt an das Licht dieser Welt trat.«
Als ich Eleonore S. für das Interview besuche, sind dreizehn Jahre vergangen, seit sie versucht hat, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Doch den Brief an ihre Tochter hat sie nie abgeschickt. Sie hat es letztlich nicht über sich gebracht, Jacqueline damit zu belasten. Dennoch ist das Verhältnis zu ihrer Tochter inzwischen besser, und auch sonst hat sich für sie einiges verändert. Die Pfälzerin ist in eine helle Wohnung umgezogen, hat sich in einem therapeutischen Akt einen Platz gesucht, der zu ihrem größten Bedürfnis im Leben passt, dem nach Harmonie und Liebe. Bunte Tüllvorhänge tauchen das Wohnzimmer in rosiges Licht, auf dem Sofa stapeln sich bonbonfarbene Kissen, darunter eines in Herzform. Jedes Stück in der Wohnung, vom Kerzenhalter bis zum Fußabstreifer, steht im Zeichen der Suche nach einem verlorenen Kindheitsglück.
Die Geschichte von Eleonore S. kommt nach und nach zu mir. Erst schickt sie mir die Schilderung für die Tochter, dann gibt sie mir ein ausführliches Interview, dann schreibt sie E-Mails, in denen sie neue Details, auch solche mit deutlichen Abweichungen zum bisher Erzählten, berichtet. Diese Veränderungen im Gedächtnis sind typisch. Erinnerungen sind keine in Bernstein erstarrten Insekten, vielmehr verändern sie mit jedem erneuten Aufrufen Form und Gehalt. Das ist Eleonore S. selbst wohl bewusst, als wir darüber sprechen. »Ja«, sagt sie, »Erinnerungen sind subjektiv, aber es gibt gewisse Dinge, die implantieren sich im Kopf.«
Szenen der Eroberung in der Pfalz
Geboren wurde Eleonore S. im Februar 1946, neun Monate nach dem Einmarsch der Franzosen, in einem kleinen Pfälzer Ort.10 Ihr Heimatdorf lag unweit einer Stadt, die schon nach dem Ersten Weltkrieg Garnisonsort der Franzosen gewesen war. Jetzt standen wieder französische Truppen im Land, und viele Deutsche fühlten sich schon deshalb an die Zeit der verhassten ersten Besatzung erinnert. Bereits damals war es zu sexuellen Übergriffen gekommen, die im Nachhinein als »schwarze Schmach« bezeichnet wurden. Denn vor allem die Begegnung mit schwarzen Kolonialsoldaten der französischen Armee hinterließ bei der deutschen Bevölkerung, die Menschen anderer Hautfarben damals eher nur vom Hörensagen kannte, tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis.
Die Vorstellung, dass Schwarze besonders triebhaft und undiszipliniert seien, hatte während der damaligen Besatzungszeit zu einem verzerrten Bild geführt, das jetzt im Jahr 1945 reaktiviert wurde. Wieder hieß es: »Die Franzosen kommen!« Und schlimmer noch: »Die schwarzen Franzosen holen sich unsere Frauen!« Die Deutschen konnten kaum unterscheiden zwischen den früheren Geschichten, den echten und falschen Erinnerungen, den düsteren Drohungen, die Reichspropagandaminister Goebbels ausgestoßen hatte für den Fall, dass Deutschland den Krieg verlöre, und den tatsächlichen Umständen, unter denen sich die Einnahme und Besetzung des Landes diesmal vollzogen.
Wie die Okkupation dieser Region durch die Besatzungsarmeen im Einzelfall erlebt wurde, führt uns ein Tagebuch aus der Zeit der Einnahme ganz konkret vor Augen. Die Verfasserin der Aufzeichnungen ist Liesel G., die als Ärztin in einem Krankenhaus in Germersheim arbeitete, als die wechselnden Siegertruppen einmarschierten. Ihre Schilderung wirft auch ein Licht auf die Umstände, unter denen Eleonore S. gezeugt wurde:11
»Anfang März 1945: Im Keller Schwerverbrecher und Todeskandidaten. Abgerissenes Bein eines Zivilisten, stirbt auf dem OP-Tisch, Granatsplitter, Bauchschuss, Hodenschuss, Hände zerfetzt und zerbrochen. Stirbt, wie er noch nicht fertig verbunden ist.
22. März: Grässliche Verwundungen und furchtbares Elend hab ich wieder gesehen … In der Nacht gehe ich nicht zu Bett. Ich spüre keine Müdigkeit.
23. März: Jagdbomberbeschuss permanent. Beim Mokka anschließend platzt eine Bombe in den Hof. … Viel Arbeit – viel Blut. Amputationen, Frakturen, Steckschüsse … Ich schlafe wie tot und höre keine Ari mehr schießen.
24. März: Die Amerikaner stehen am Bellheimer Wald. … Ich esse nichts den ganzen Tag – höchstens aus den Nahkampfpäckchen, die allenthalben verteilt werden, etwas Schokolade. … Meine Patienten sind rührend glücklich, dass ich immer in der Nähe bin.
18.40 Uhr Die Amerikaner sind da. ›Come along!‹, ›Go on‹, ›Follow me!‹, ›Hands up!‹.
25. März: Die Amerikaner sind sehr anständig. Ich dolmetsche. Ausgehverbot für 48 Stunden wegen Beschuss. …
29. März: Die Plünderei geht weiter. Soldaten und Zivilisten räumen gemeinsam leere Wohnungen und Gaststätten aus.
30. März Karfreitag: Mittags ziehen Franzosen ein. Auch in unser Kasino. Ich sitze gerade in unserm Refugium, als von draußen die Türen eingeschlagen werden, die abgeschlossen waren. Sie lassen mich in Frieden, aber ich ziehe natürlich aus in den Keller unter die Treppe in ein kleines Kabäuschen … In der Nacht versucht man zweimal einzubrechen bei Gitta und mir. Unser Herzklopfen ist nicht schlecht, aber die Tür hält gottlob. ›Merde!‹, sagt der draußen.
31. März Karsamstag: Schon am Morgen geht das Elend los: Es kommen Frauen und Mädchen – immer mehr, die von den Marokkanern vergewaltigt wurden, welche jetzt mit den Franzosen unser Städtchen besetzt haben. Furchtbares hat sich abgespielt und ist draußen noch im Gang. Die Frauen werden verfolgt in den Häusern, den Männern mit Erschießen gedroht. Berichte, wie sie aus dem Osten gegeben wurden. Viele suchen Schutz bei uns drüben im Krankenhaus. Der Pater und der Doktor versuchen, zu den Kommandanten durchzudringen. Umsonst. Der eine hält gerade Mittagsschlaf, der andere lacht und sagt: ›C’est la guerre!‹ Und – was man immer wieder hört: ›Eure SS hat es bei uns genauso gemacht!‹ Schließlich am Abend wird versprochen, Streifen auszuschicken. Die Marokkaner haben alle Wein- und Schnapsvorräte geplündert und sich sämtlich total besoffen. Daher hausen sie so. Mittags kommt Edith G. ganz aufgelöst. Mit Mühe konnte sie entrinnen. Ein französischer Offizier brachte sie zu uns. Sie bleibt nun da. Wir umarmen uns weinend. Das sind die ersten Tränen. Gitte und ich sind wieder umgezogen nach den Erfahrungen der letzten Nacht. Hinauf traut man sich gar nicht mehr, noch nicht einmal auf die Treppe.
1. April Ostersonntag: Ich schlief schlecht in der Nacht. Eine Wanze habe ich getötet. Nun ja – warum nicht auch noch Wanzen? Das menschliche Ungeziefer haust weiter. […] Auf dem Kirchplatz begegnet uns ein trauriger Zug: Frauen, Kinder und einige Männer aus der Siedlung, zerzaust, verdreckt, Stroh in den Haaren, Entsetzen in den Gesichtern, auf der Flucht vor den Schwarzen. Die ganze Nacht haben sie weitergetobt. Mütter mussten ihre Kinder verstecken, Mädchen sprangen aus dem Fenster etc. Das Krankenhaus ist voller Schutzsuchender. Gegen Mittag dringen die Schwarzen dort ein und hausen wild. Dr. K. geht zum Kommandanten und erhält eine Wache fürs Krankenhaus. Keilerei zwischen Franzosen und Marokkanern auf dem Vorplatz. 6 Mann Bewachung bleiben im Haus. Einige Übeltäter werden erschossen. Aber die Schandtaten gehen in kleinerem Maß weiter. Immer wieder heißt es: ›Die Deutschen haben es auch so gemacht. Die Marokkaner sind eben unsre SS.‹
2. April: Über uns ist ein französisches Feldlazarett eingezogen. Der Hof gleicht einem Heerlager. Französische Mädchen in Uniform, geschminkt, Zigarette im Mundwinkel, stehen herum, schenken unsern Kindern Puppen. Im Keller hausen jetzt 300 Leute, drüben im Krankenhaus 400. Kein Wasser, kein Licht, Clo-Verhältnisse schauderhaft – alles hat Durchfall. Auch ich habe ein Rührchen. Aber ich will nicht krank werden, schlucke Opium und Tanalbin, und es geht. […] Wir sind alle älter geworden in diesen Tagen. Von oben hört man den Lärm der Franzosen, Mädchenstimmen, Grammophonmusik – die Welt ist weit weg von mir. Alles, was Heimat heißt, ist weit – weit. In mir ist Totenstille. Ich habe keine Sehnsucht, kein Heimweh, keine Tränen – gar nichts. Ich will nur eins glühend und unbedingt – am Leben bleiben.
3. April: Viele Frauen erzählen nun schon von ihren Erlebnissen mit einer gewissen breiten Behaglichkeit und Anschaulichkeit. Allmählich verliert sich das Entsetzen. Einige Mädchen bandeln schon wieder mit den Franzosen an […].
16. April: Nach 19 h dürfen wir nicht mehr auf die Straße. Die gehört dann dem franz. Militär. Das ist ein Gejohle und eine Knallerei! Die Schwarzen singen ihre eintönigen Lieder. – Neben H. wurde ein Freudenhaus eingerichtet. Der Pater fragte mich, was das für Tabletten waren, die ich an die vergewaltigten Frauen und Mädchen ausgegeben habe. Elendron war es – gegen Tripper. Ich erkläre ihm das. Er will es kaum glauben und hatte gedacht, es seien Abtreibungsmittel gewesen. ›In diesem Fall wäre es nämlich ein moralisches Problem‹, sagt er. Ja, das wäre es, und das gibt es auch noch in den nächsten vier Wochen.
2. Mai: Obgleich das Ende vorauszusehen war und ich seit August 44 nicht daran gezweifelt habe, dass es so kommen müsse, greift mich alles jetzt unsäglich an.
16. Mai: Flirte mit den französischen Ärzten, darunter auch ein Jude. Ich finde es recht lustig, sich ein bisschen verehren zu lassen. Aber ich wünsche von ganzem Herzen, dass mich Walter bald holen möge.
21. Mai: Walter kehrt zurück.«12
Diese Quelle zeichnet in vielerlei Hinsicht ein plastisches Bild. Liesel G., die schreibende Ärztin, erlebte erst den Einmarsch der Amerikaner und dann die Übergabe an die Franzosen hautnah, denn Mediziner und medizinisches Personal sahen die Auswirkungen der letzten Kämpfe um ein Gebiet und der Gewaltakte nach dessen Einnahme meist als Erste. Neben diesen konkreten und, wie wir annehmen dürfen, realen Erfahrungen zeigt das Tagebuch aber auch, wie die meisten Deutschen damals fühlten, mit welchen starken Meinungen sie die Siegermächte erwarteten. Die Amerikaner waren für Liesel G. »große Kinder«, die Engländer ein »vornehmes Volk, aber zu konservativ«, die Franzosen bewunderte sie für ihre Kultur, über die Sowjets sagte sie nichts. Die Schwarzen waren für sie »Ungeziefer«. Sie teilte zudem eine damals durchaus typische Ignoranz für die eigenen Verbrechen der Deutschen. Von der Ermordung der Juden wollte sie nichts gewusst haben, nichts von Konzentrationslagern (sie habe nur von Dachau und Oranienburg gehört), nichts von den »Vorgängen dort«.13
Das Tagebuch zeigt, wie vorbelastet die Konfrontation der deutschen Zivilbevölkerung mit den Besatzungssoldaten war, die sich unter großen Verlusten auf deutsches Gebiet hatten vorkämpfen müssen und erfahren hatten, wozu die Deutschen fähig gewesen waren, auch wenn sie selbst vielleicht nicht dabei gewesen waren, als die Konzentrationslager befreit wurden. Diese Soldaten stießen nun auf Deutsche, die größtenteils gar nicht befreit werden wollten vom Nazi-Regime und jetzt, nachdem das »Tausendjährige Reich« untergegangen war, vorgaben, von nichts gewusst zu haben, und die aufgrund von nationalsozialistischer Indoktrination, rassistischen Vorurteilen und regionaler Vorgeschichte feste Vorstellungen von den neuen Herren im Land hatten – kurz, die den Alliierten kaum Anlass gaben anzunehmen, sie hätten es mit einem geknechteten oder gar reuigen Volk zu tun.
Aber auch auf die eigenen Landsleute hatte Liesel G. eine stark eingeschränkte Sicht, vor allem was Kontakte zwischen deutschen Frauen und Besatzungssoldaten betraf. Hier gab es für die Tagebuchschreiberin keine Grauzonen. Für die Ärztin waren nur zwei Formen von sexuellen Kontakten zwischen den einheimischen Frauen und den fremden Soldaten denkbar: die rohe Gewalt auf der einen Seite und das leichtfertige Techtelmechtel auf der anderen. Dazwischen gab es nichts. Heute wissen wir, wie verkürzt diese Sichtweise war.
Die eigene Entstehung liegt im Dunkeln
Eleonore S.’ Großmutter mütterlicherseits stammte aus Thüringen und hatte sieben Geschwister. Sie lernte einen Schneider kennen, der sie mit in die Pfalz nahm. »Nach ihren Erzählungen ist er nicht gerade zimperlich mit ihr umgegangen und hat sie wohl vor der Ehe zum Sex gezwungen. Sie wurde schwanger«, erinnert sich Eleonore S. Für ihren Mann trat die Großmutter auch zum Katholizismus über. In der neuen Heimat verdingte sie sich bei einem Bauern als Magd und pflegte noch zusätzlich einen älteren Herrn. Irgendwann begann ihr Mann ein Verhältnis und trennte sich, sie sah ihn zum letzten Mal im Oktober 1945.