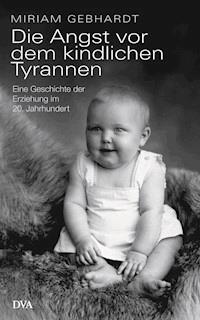10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Warum bist Du so?“ – eine Historikerin zeigt, warum wir in die Geschichte schauen müssen, um unsere Eltern und uns selbst besser zu verstehen
Wie wurden meine Eltern, wie sie sind? Und wie haben ihre Erfahrungen mein Leben geprägt? In diesem Buch zeigt die Historikerin Miriam Gebhardt, wie Nachkriegseltern und Babyboomer über die deutsche Geschichte miteinander verbunden sind, und untersucht das emotionale Erbe unserer Geschichte seit 1945. Zwar hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg viel geändert. Doch gerade bei den privaten Themen, bei den Vorstellungen von Ehe, Familie, Erziehung und Sexualität, von Geschlechterrollen, Arbeit und Schmerz finden sich auch überraschende Kontinuitäten. »Unsere Nachkriegseltern « basiert auf zahlreichen biografischen Zeugnissen und auf den generationellen Erfahrungen von Miriam Gebhardts eigener Familie. Sie erzählt deutsche Geschichte als Familiengeschichte, ergänzt um den ganz persönlichen Blick einer Babyboomerin auf ihre Nachkriegseltern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wie wurden meine Eltern, wie sie sind? Und wie haben ihre Erfahrungen mein Leben geprägt? Die Historikerin Miriam Gebhardt zeigt, wie Nachkriegseltern und Babyboomer über die deutsche Geschichte miteinander verbunden sind. In »Unsere Nachkriegseltern« geht es um das emotionale Erbe der deutschen Geschichte seit 1945. Viel hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg geändert. Doch gerade bei den privaten Themen, bei den Vorstellungen von Ehe, Familie, Erziehung und Sexualität, von Geschlechterrollen, Arbeit und Schmerz findet sich auch viel Kontinuität. Gebhardts neues Buch basiert auf zahlreichen biografischen Zeugnissen und auf den generationellen Erfahrungen ihrer eigenen Familie. Sie erzählt deutsche Geschichte als Familiengeschichte, ergänzt um den persönlichen Blick einer Babyboomerin auf ihre Nachkriegseltern.
Miriam Gebhardt ist Journalistin und Historikerin und lehrt als außerplanmäßige Professorin Geschichte an der Universität Konstanz. Neben ihrer journalistischen Arbeit, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und verschiedene Frauenzeitschriften, habilitierte sie sich mit einer Arbeit über die Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert, auf der »Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen« (2009) beruht. Sie ist Autorin zahlreicher weiterer Bücher, darunter »Rudolf Steiner. Ein moderner Prophet« (2011), »Die Weiße Rose« (2017) sowie zuletzt »Wir Kinder der Gewalt« (2019). Ihr Bestseller »Als die Soldaten kamen« (2015) über die Vergewaltigungen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland durch die Soldaten der Siegerarmeen wurde breit besprochen und in mehrere Sprachen übersetzt. Miriam Gebhardt lebt in Ebenhausen bei München.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Miriam Gebhardt
UnsereNachkriegseltern
Wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Coverabbildung: akg-images /ddrbildarchiv.de
Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-22697-8V001
www.dva.de
Inhalt
Einleitung
1. Die schwierige Suche nach einer Verankerung im Leben
2. Die Gefühle im Kühlschrank und der lange Weg bis zur Selbstfürsorge
3. Die Kinderfrage – ein über Generationen hinweg schwer befrachtetes Thema
4. Sex und Liebe zwischen bürgerlicher Pflichtübung und Freiheitsversprechen
5. Frauen im doppelten Einsatz als eine Hypothek der Nachkriegszeit
6. Soldat, Familienoberhaupt, Liebhaber: Wann ist ein Mann ein Mann?
7. Generationengeschichte zwischen Abwehr, Selbstfindung und Empathie
Schlussbemerkung
Anmerkungen
Quellen und Literaturhinweise
Einleitung
Mein Vater starb auf dem Weg zu einer Fahrradtour. Die Aussicht, gleich aufs Rad zu steigen und mit Freunden um den See zu fahren, hat ihn so kurz vor seinem Tod sicherlich noch einmal froh gestimmt. Ein Tag in der Natur, beim Wandern, Baden oder beim Boulespielen ist für ihn grundsätzlich ein guter Tag gewesen. Das Rad hatte er schon auf den Dachständer seines Autos gehoben, er wollte nur noch schnell einen Teller Suppe essen, da war es plötzlich vorbei. Mitten im »Aufbruch« – ein Wort, das er sehr schätzte – ereilte ihn der Tod. Er spürte ihn kommen, konnte noch den Notarzt anrufen, aber als der Rettungswagen da war, saß er bereits leblos in seinem Lesesessel. Herzstillstand. Es klingt hart, aber ich glaube, für meinen Vater war das ein guter Tod, ein Abgang zur rechten Zeit. Ein halbes Jahr später wäre er nämlich in ein Altersheim umgezogen und schon der Gedanke daran machte ihn mutlos, wie er mir bei unserem letzten Treffen gestanden hatte. Hinterbliebene trösten sich oft mit dem Gedanken, dass ihre Lieben »erlöst« würden, wenn sie sterben. Bei meinem Vater, glaube ich, stimmte das. Er wurde erlöst von der Aussicht auf ein Leben, das ganz bald begonnen hätte auszutröpfeln. Ein Ende aus einer Aktivität heraus, das passte zu seiner Vorstellung von einem gelungenen Leben viel besser.
Der erwartbare und dennoch so plötzliche Tod des Vaters nach einer schweren Krankheit, die er schon überstanden zu haben schien, löst einiges aus. Bei mir, die ich nun auch schon sechzig Jahre alt bin, weckte er das Bedürfnis, die Enden zu verbinden. Seither denke ich mehr über mein Leben und das meiner Eltern nach. Was habe ich von ihnen geerbt, und was unterscheidet uns? Ich rufe Erinnerungen an meine Kindheit auf und vergleiche sie mit meiner gegenwärtigen Wahrnehmung der alternden Eltern. Das Ergebnis ist durchaus paradox: Der beginnende Abschied bringt mich ihnen näher und zugleich trennt er mich von ihnen. Er überdeckt die Gegensätze zwischen uns, bringt mich dazu, sogar manche ihrer unangenehmen Wesenszüge an mir selbst wiederzuerkennen. Gleichzeitig sehe ich in meinen Eltern nicht mehr nur Individuen mit merkwürdigen oder nachahmenswerten Ansichten und Gewohnheiten, sondern auch die Vertreter ihrer Generation. Als Erben ihrer Eltern. Kurz gesagt: Ich fange an, sie zu historisieren. Ich stelle sie in ihre Zeit und muss erkennen: Sie sind nicht nur meine Eltern, sondern sie sind auch Nachkriegseltern, und das lässt mich selbst ein Stück weit aus der Zeit fallen.
Wie wir leben und wie wir sterben wollen, ist natürlich eine persönliche Frage. Ich zum Beispiel hätte nichts gegen ein langsames Hinausschleichen aus dieser Welt. Ich glaube allerdings, dass derartige individuelle Einstellungen immer einen kollektiven Anteil haben. Sie sind auch Ausdruck einer generationellen Mentalität. Diesen Lebenshunger, den mein Vater verspürte, empfinden viele in seiner Generation. Die Altersgruppe der zwischen 1930 und 1945 Geborenen war und ist auch noch mit weit über siebzig Jahren voller Energie. Manches Mal kommen sie mir sogar vitaler vor, als wir es sind – ihre Kinder. Zuletzt haben sie das während der Coronapandemie vorgeführt. Während wir, die Jüngeren, uns isolierten und auf vieles verzichteten, fuhren sie ohne zu zögern in ihr Ferienhaus nach Frankreich oder zum Wandern nach Österreich. Sie begannen miteinander online zu turnen und zoomten um die Wette, als seien sie die wahren »Digital Natives«. Hauptsache nichts verpassen.
Die Generation meiner Eltern wird auch als »Generation Kriegskind« bezeichnet. Das greift aber nur einen Teilaspekt ihres Lebens. Zwar stimmt es, dass sie ihre Kindheit und manchmal noch Teile der Jugend zwischen den Jahren 1939 und 1945 erlebt haben. Aber bewusst herangereift sind sie nach dem Krieg. Dadurch erklärt sich vieles, was ihnen in ihrem Leben so wichtig war und ist. Zum Beispiel ihre unerschütterliche Suche nach Erfüllung von Bedürfnissen. Sie haben viel konsumiert und tun es noch, obwohl die Schränke, Keller, Speicher und Garagen längst voll sind. Sie tauschen sich darüber aus, wo es Schnäppchen gibt, und dann scheuen sie keine weite Fahrt, um sich das Ersehnte zu kaufen. Das war und ist für sie ein Weg, sich für den Kriegs- und Nachkriegsmangel zu entschädigen. Bei meinem Vater waren es Gummistiefel. Er besorgte sich eigens einen Einkaufsschein für Gewerbetreibende, nur damit er Gummistiefel und andere eher hässliche Gegenstände günstig kaufen konnte, deren praktischer Nutzen sich dem Rest der Familie nicht immer so erschloss. Bei anderen waren es Plastiktüten. Die wurden über Jahre hinweg säuberlich gefaltet und in Schränken verwahrt, gleich neben den alten Geschenkschleifen, die sie ebenso wenig wegwarfen.
Dass sich unsere Nachkriegseltern gerne materiell abgesichert fühlen, ist verständlich. Aber es geht nicht nur darum, dass sie es immer gut geheizt und ihren Kühlschrank voll haben wollen. Dahinter steckt in meinen Augen vielmehr ein unstillbarer emotionaler Hunger. Kindheit im Krieg, vaterloses Aufwachsen, belastete Mütter, Entbehrungen im Hungerwinter 1946, autoritäre Lehrer, bescheidene Anfänge bei der Familiengründung, frühe Verantwortung für andere, das alles hat Spuren hinterlassen. Die Frauen brachten viele Opfer, sagen sie, für ihre Kinder und für ihre Männer. Welcher Babyboomer kennt sie nicht, diese traurige Geschichte vom Waschzuber im Keller, in dem sie damals unsere Stoffwindeln auskochen mussten, weil sie noch keine Waschmaschine hatten? Die Väter wiederum nutzen heute die Gelegenheit, wenn ein Enkelkind kommt, sich endlich eine Eisenbahn zu kaufen. Oder sie kramen ihr altes Schaukelpferd hervor, das aussieht, als hätte es schon im Ersten Weltkrieg mitgekämpft, und freuen sich selbst am allermeisten darüber. Es scheint fast, als dürften sie sich zum ersten Mal im Leben beim Spielen entspannen. Denn sie hatten genauso wie die Frauen eigentlich immer für andere sorgen müssen. Sie mussten vielleicht vor den Truppen der Sowjets fliehen und sich im Kindesalter schon um ihre Mütter kümmern. Mädchen und Jungen dieser Generation wurden zur angeblichen Erholung in Kinderheime gesteckt, in denen noch NaziPädagogen ihr Unwesen trieben, oder sie wurden wegen der Bombardierungen aufs Land geschickt und über viele Wochen von ihren Eltern getrennt. In jedem Fall mussten sie sich frühzeitig als selbstständig und autonom von familiären Beziehungen erweisen. Denn sie waren ja nicht nur »Kriegskinder«, sie waren auch die Kinder einer nationalsozialistischen Erziehungsideologie, die eine frühe Unabhängigkeit von sentimentalen Bindungen forderte.
So haben sie in jungen Jahren viel Stoff für Trauer und Angst angesammelt. Sie bekamen mit, dass ihre Väter doch keine strahlenden Helden waren, sondern geschlagene Krieger, oder schlimmer noch, Verbrecher mit Blut an den Händen. Von der schlechten Ernährungslage haben sie uns erzählt, auch von den Hamsterfahrten aufs Land und der verhärmten, aber auch tapferen Mutter. Aber kaum erzählt haben sie von ihrer harten Jugend und ihrem abrupten Erwachsenwerden. Von der abgebrochenen Schule, der Notwendigkeit, schnell Geld zu verdienen, von ihrem großen Drang, das Elternhaus und vielleicht sogar die Heimat hinter sich zu lassen. Von der Frustration über die Wiederaufrüstung Deutschlands. Auch das waren Aspekte ihres Lebens, die sie vergraben haben und die sich für ihre Nachkommen mehr erspüren als erfragen ließen.
Sehr viele ihrer Altersgruppe wurden mit Anfang zwanzig Vater oder Mutter – aus Kriegskindern wurden Nachkriegseltern. Es mit den eigenen Kindern anders zu machen, ihnen die Wärme zu vermitteln, die sie selbst vermisst hatten, hatten sie jedoch noch nicht gelernt. Das war eine Aufgabe, die sie sich vornehmen, aber selten genug auch lösen konnten. Mancher Mutter fiel Zärtlichkeit mit ihrem Kind zeitlebens schwer, mancher Vater sah das freiere Leben seines Sohnes mit gemischten Gefühlen. Denn den großen Wandel der Werte in Erziehung, Partnerschaft und Sexualität erlebten sie erst, als sie dafür eigentlich schon zu alt waren. Die Zeit der Emotionalisierung der Deutschen auf allen Ebenen seit den Siebzigerjahren erwischte sie sozusagen auf dem falschen Fuß. Einige versuchten noch von der einsetzenden Psychologisierung zu profitieren. Sie erkannten schockartig, welche Bedürfnisse ihnen zugestanden hätten, ließen sich mitunter scheiden, um in Sachen Liebe noch einmal ganz neu anzufangen, zeugten vielleicht sogar ein spätes Kind und versuchten sich in einer neuen Rolle als einfühlsame und großzügige Eltern. Aber die Versprechen des Lebensstilwandels erfüllten sich für sie meistens nicht mehr. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich täglich erneut auf die vergebliche Jagd nach kurzen Glücksmomenten zu machen, nicht zuletzt beim Konsum oder bei der Freizeitgestaltung.
Jetzt, da sie auf das Lebensende zugehen, verhalten sich die Nachkriegseltern entsprechend trotzig. Sie verteidigen ihre Freiheitserfahrungen zum Beispiel beim Autofahren. Wenn sie nicht mehr gut sehen können, testen sie eben den Stoßdämpfer anstatt ihrer Fahrtauglichkeit. Die Straßen im Speckmantel Münchens, wo ich wohne, sind voll von Autofahrern (meist sind es die Männer, die in dieser Altersgruppe am Lenker sitzen), die scheinbar ferngesteuert unterwegs sind. Ab und zu lese ich dann eine Notiz in der Zeitung, dass mal wieder ein Hochbetagter eine ganze Reihe parkender Autos seitlich mitgenommen hat und noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben musste. Gefährlich, aber auch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, wie wichtig die individuelle Mobilität für diese Generation war. Auch dass sie sich von ihrem körperlichen Verfall nicht beeindrucken lassen wollen, kann ich gut verstehen. Wenn die Hüfte knirscht, wird ein neues Gelenk eingesetzt und weiter Tennis gespielt. Fürs Altersheim ist es allemal zu früh, und sie werden sich auch bestimmt nicht als liebe Omi an den Kamin setzen. Da machen sie eher noch einmal eine Nilfahrt.
Wenn wir den historischen Kontext sehen, kommen uns diese Ansichten und Gewohnheiten weniger schräg vor. Aber wir können noch einen Schritt weitergehen und uns fragen, was davon uns selbst in den Knochen steckt. Wie viel vom Nachkrieg haben die Nachkriegseltern an uns weitergegeben? Wir Babyboomer wurden in die Welt gesetzt, als es vor allem im westlichen Teil Deutschlands wirtschaftlich steil bergauf ging. Wir waren die erste Generation, die nicht nur mit industriell gefertigter Babynahrung großgezogen werden konnte, sondern für die sich der Konsumkapitalismus für jedweden Anlass alters- und geschlechtergerechte Produkte einfallen ließ. So wurden wir Kinder der Nachkriegseltern selbst zu Symbolen für die Gesundung und das Wiedererstarken Deutschlands. Jedes Gramm Gewichtszunahme und jeder tolle Kinderwagen, der nach dem Vorbild der Automobilherstellung mit Zierleisten geschmückt war, symbolisierte auch den Sieg über die dunkle Vergangenheit der Deutschen in Krieg und Nationalsozialismus. Auf diese Weise folgten wir unbewusst dem Schatten der Biografien unserer Eltern. Wir waren der leibhaftige Beweis dafür, dass es der nächsten Generation viel besser ging als der vorherigen. Das hatte neben dem Wohlleben auch weitergehende positive Auswirkungen. Aktivität, Dynamik und Ehrgeiz gingen von der älteren Generation auf die jüngere über. Der Begriff »Work-Life-Balance« war noch nicht erfunden, als die Babyboomer in den Siebziger- und Achtzigerjahren in die Berufswelt eintraten. Wir arbeiteten viel, weil wir es so gelernt hatten. Wer rastet, der rostet. Aber diese Generationenerbschaft hatte auch eine Kehrseite: Eine gewisse Härte gegen sich selbst, resultierend aus der Erziehung, die bei vielen Babyboomern in ein Burn-out oder irgendwann in die Totalverweigerung mündete. Gepaart mit sozialer Ängstlichkeit und der Bereitschaft, sich in Hierarchien unterzuordnen.
Die Langzeitwirkung der Wiederaufbau-Mentalität nach dem Krieg ist nur ein Beispiel dafür, wie die Generation der Nachkriegseltern und die Generation der in den Fünfziger- und Sechzigerjahren geborenen Babyboomer über die deutsche Vergangenheit miteinander verbunden sind. Ich werde in diesem Buch deutsche Geschichte als Familiengeschichte erzählen. Es wird dabei vor allem um Gefühlserbschaften gehen. Um das Gefühl der Unbehaustheit in dieser Welt, das sich von der realen Erfahrung der Kriegskinder, weil sie zum Beispiel ausgebombt worden waren, zu einem allgemeinen Lebensgefühl bei den Babyboomern weiterentwickelt hat. Um das Gefühl der Ambivalenz in der Kinderfrage, die seit der aggressiven Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten eine historische Belastung in Deutschland darstellt. Die Nationalsozialisten hatten von jeder Frau verlangt, viele Kinder zu gebären, und zwar gesunde. Wer aus vermeintlich rassischen oder aus sozialen Gründen nicht zur Volksgemeinschaft gehörte oder wer kranke Kinder zur Welt brachte, musste hingegen um das Leben seines Nachwuchses fürchten. Das hat sich buchstäblich in die Körper der Menschen eingeschrieben. Es geht um das Gefühl der Rollendiffusion. Ist eine Frau noch eine Frau, wenn sie kein Kind bekommt? Oder verrät sie ihr Geschlecht, wenn sie viele Kinder bekommt? Das führt zum nächsten Problem, der Kontinuität bei der Kindererziehung. Die Babyboomer konnten den großen Erziehungsstilwandel seit den frühen Siebzigerjahren für ihren eigenen Umgang mit Kindern aufgreifen. Aber sie hörten dabei ständig eine innere Stimme, die sie ermahnte: Du verwöhnst dein Kind, du machst dein Einzelkind zu einem Egoisten, du musst es abhärten. Es waren die Stimmen ihrer Mütter, die angesichts ihrer Enkelkinder die eigenen Erziehungsansichten verteidigen mussten. Schließlich ging es dabei um einen ganz zentralen Anteil ihrer Identität.
Auch der Umgang mit Krankheit und Schmerz ist bei Babyboomern mit einer historischen Altlast behaftet. Gesundheit wird immer auch als ein moralisches Gut angesehen, und wer es sich mit Schmerzmitteln leicht macht, begibt sich womöglich bereits auf die schiefe Bahn. Weitere emotionale Erbschaften der Babyboomer, von denen ich berichten werde, betreffen die Geschlechterbeziehungen, die Haltung zu Liebe und die Sexualität. Babyboomer lehnten die Vorstellungen von den Geschlechterrollen ihrer Eltern meistens ab. Abschreckend waren für viele Töchter die Mütter, die sich nur über ihre Ehemänner definiert haben, und für manchen Sohn der Anspruch des Vaters, im Haus genauso bestimmen zu wollen wie im Betrieb. Doch was sollte an die Stelle der alten Ordnung treten? Wie autonom durfte eine Frau sein oder sollte sie nicht doch besser dem Mann beruflich die Vorfahrt überlassen?
Ein letztes Thema in diesem Buch wird der Umgang mit der Vergangenheit sein. Unabhängig davon, wo sie sich unterscheiden und wo sie sich ähneln, beide Generationen kommen von der deutschen Zeitgeschichte nicht los. Während die Nachkriegseltern, pauschal gesagt, den Blick zurück eher vermieden, weil sie sich nur allzu schnell am Abgrund des Nationalsozialismus wiedergefunden hätten, standen Babyboomer oft mit dem Rücken zur Zukunft und blickten starr in die schreckliche Geschichte zurück. Sie taten das schon aus Gründen der Selbstfürsorge, denn sie begriffen sich als »Kriegsenkel« und als Erben der Verantwortlichkeit für den Nationalsozialismus. Diese Rückwärtsgewandtheit der Babyboomer auf Ereignisse, die lange vor ihrer Geburt liegen, schlägt sich besonders seit der Jahrtausendwende in einer Flut von autobiografischen und autofiktionalen Veröffentlichungen nieder. Wenn den Babyboomern gelegentlich vorgehalten wurde, sie gehörten der Generation »Zaungast« an, weil sie zwischen den sogenannten Achtundsechzigern und den Computerkids nicht besonders wirksam werden konnten, dann ist das nur die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere ist, dass sie diejenigen sind, die sich als Erste wirklich mit der deutschen Zeitgeschichte auseinandergesetzt haben. Die Kinder der Täter, die zwischen 1940 und 1950 geborenen Achtundsechziger, waren dazu noch nicht in der Lage gewesen, weil sie ihren Eltern nicht zu nahe treten wollten. Sie führten in den späten Sechzigerjahren zwar Klage gegen die autoritären Väter und deren »Faschismus«. Doch gemeint waren nie die eigenen Väter, sondern stets die Vaterrepräsentanten in der Gesellschaft wie beispielsweise Professoren oder Richter. Das Neue an der Auseinandersetzung mit der Geschichte in der nächsten Generation ist, dass sie sich nicht in Anklage erschöpft. Wichtiger ist der Versuch des Verstehens. Die Babyboomer sind die Ersten, die sich nach der Klärung der historischen Schuld der Deutschen im Nationalsozialismus auch für die deutschen Opfer interessieren und, manchmal zum Missvergnügen der Achtundsechziger, auch Mitgefühl für ihre Vorfahren zeigen können.
In diesem Buch soll es um gegenseitiges Verständnis gehen. Das Verstehen generationeller Erfahrungen und die Frage, wie sie miteinander zusammenhängen, ist letztlich der einzige Weg, mir über mich selbst klar zu werden. Angesichts des bevorstehenden Abschieds von der letzten Generation, die noch den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt hat, frage ich nach den prägenden Erfahrungen, für die weder Nachkriegseltern noch Babyboomer etwas konnten. Ich fasse den Begriff »Generation« dabei alltagssprachlich in seiner weiten Bedeutung von Abstammungsgemeinschaft. Generation kommt vom Lateinischen generare (erzeugen). Ich definiere die Nachkriegseltern und die Babyboomer als Generationen, die den Krieg und die Nachkriegszeit beziehungsweise den Lebensstilwandel der Sechziger- und Siebzigerjahre teilen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich jeder, der zwischen 1930 und 1945 oder zwischen 1955 und 1970 geboren wurde, selbst zu den hier so genannten Nachkriegseltern oder Babyboomern zählen möchte. Die deutschen Babyboomer sind übrigens nicht mit den amerikanischen Babyboomern zu verwechseln, die schon ab Mitte der Vierzigerjahre bis Mitte der Sechzigerjahre geboren worden waren. Hierzulande setzte die Zeit des Geburtenanstiegs erst Mitte der Fünfzigerjahre ein und endete mit den Sechzigerjahren.
Meine Absicht ist es, die Perspektiven der Nachkriegseltern und der Babyboomer zu verknüpfen und beide Generationen miteinander ins Gespräch zu bringen. Methodisch gehe ich dabei von der Selbstsicht von Repräsentanten der jeweiligen Generationen aus. Um Fallbeispiele analysieren zu können, habe ich im Deutschen Tagebucharchiv (DTA) zahlreiche Selbstzeugnisse gesichtet und eine systematische Auswahl nach der größtmöglichen Differenz und Aussagekraft getroffen. Das heißt, die Fallbeispiele sind nicht im quantitativen Sinne repräsentativ. Für meine qualitative dichte Lektüre der Quellen stelle ich vielmehr Tagebücher und Autobiografien aus ganz unterschiedlichen Milieus einander gegenüber. Das reicht von der bürgerlichen Ehefrau mit sieben Kindern, die sich trotz aller moralischen Bedenken in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in einer Dreieckskonstellation wiederfindet, über den straffällig gewordenen Bauernsohn, der mit der traditionellen Sexualmoral auf dem Land nicht zurechtkommt und sie für seinen Zusammenstoß mit dem Strafrecht verantwortlich macht, bis hin zu der alleinerziehenden Mutter aus der DDR, die sich an den widersprüchlichen Rollenerwartungen der »guten« Mutter und der guten Werktätigen zerreibt. Auf Grundlage dieser vielfältigen Quellen kann ich natürlich keine soziologischen Generationenporträts schreiben. Davon gibt es auch genug. Die »beleidigte«, »verdammte«, »verratene«, »vergessene«, »unerhörte«, »geschlagene« Generation oder die Generation X, Y, Z – all das sind Zuschreibungen, die sich meist um ein entscheidendes soziologisches Kriterium ranken. Die Schlüsselbegriffe und Etiketten wechseln im Jahresrhythmus, bis den Wissenschaftlern und Publizistinnen womöglich eines Tages die passenden Attribute ausgehen. Mein Buch sucht erst gar nicht nach dem ultimativen Label. Es betrachtet vielmehr den Generationenbegriff als historische Schnittstelle der Weitergabe zwischen Alterskohorten. Der Unterschied ist, dass es mir um die Beziehungen zwischen Menschen geht, insbesondere die Beziehungen, die auf der Grundlage der Sozialisation einer historischen Gemeinschaft beruhen.
Die Chefredakteurin des evangelischen Magazins Chrismon, Ursula Ott, hat für den Verständigungsprozess, den auch ich anstrebe, eine schöne Überschrift gefunden. Ihr lesenswertes Buch über den Umzug ihrer Mutter in ein Altenheim heißt Das Haus meiner Eltern hat viele Räume. Vom Loslassen, Ausräumen und Bewahren. Bei ihr ist das ganz handfest gemeint: Welche Gegenstände aus dem Leben unserer Eltern sind es wert, aufgehoben zu werden, und wohin soll ich mit dem Rest? Mein Buch ist ein ähnlicher Versuch auf der Ebene der emotionalen Erbschaften. Es ist eine Form der Mediation. Im Mittelpunkt stehen die Themen des privaten Lebens, die von der generationellen Weitergabe am meisten beeinflusst wurden: die eigene Verortung in der Welt, der Umgang mit sich selbst, das Verhältnis zum anderen Geschlecht, zu den Kindern, die Sexualität, die Identitätssuche. Die objektivierbaren Quellen aus dem Archiv, die ich analysieren werde, möchte ich um meine eigene Perspektive ergänzen. Als Angehörige des Geburtsjahrgangs 1962 kann ich nicht so tun, als stünde ich außerhalb dessen, was ich untersuche. Im Gegenteil: Ich möchte die eigene Betroffenheit nutzen, um in einer Art Auto-Ethnografie das emotionale Erbe meiner Vorfahren zu objektivieren, damit ich mit meiner eigenen auch die Geschichte der anderen besser verstehe. Dabei ist mir klar, dass ich, wenn ich von meiner Familie erzähle, der Geschichte meiner Eltern meine eigene Sichtweise hinzufüge. Sie selbst werden auf ihre Geschichte und selbstverständlich auch auf meine ganz anders schauen. Aber vielleicht trägt das Buch auch in dieser persönlichen Hinsicht zur Verständigung bei.
1. Die schwierige Suche nach einer Verankerung im Leben
Am schnellsten war mein Schulfreund Martin. Er verließ mit siebzehn Jahren sein Zuhause in Hamburg und zog in eine Pension im Münchner Umland. Von seiner autonomen Warte im Dachzimmer aus führte er vor, dass es für ein recht gutes Abitur weder Familie noch geregelte Mahlzeiten brauchte. Meine Freundin Conny trat kurz darauf die Reise in umgekehrter Richtung an. Weil sie die Stiefvater-Halbschwester-Mutter-Familie am Münchner Stadtrand nicht mehr ertrug, packte sie ihre Sachen und legte ihr Abitur in Düsseldorf ab. Sie wohnte in einer Wohngemeinschaft, später bei einer Freundin im Einzimmerappartement, bevor sie als Au-pair-Mädchen ins Ausland verschwand. Ich war die Dritte im Bunde, verließ im Jahr 1980 an meinem achtzehnten Geburtstag mein Elternhaus, kroch erst in einer WG unter, dann in einer Gründerzeitvilla am Stadtrand, die von einem Dragoner mit Turban zimmerweise vermietet wurde. Nach dem Abitur, das ich mit minimaler Punktzahl bestand, wohnte ich einige Wochen ambulant in meinem Auto. Meine wichtigsten Papiere und Kleider bewahrte ich in einem weißen Koffer vom Flohmarkt auf, bis eines Tages das Auto aufgebrochen wurde und alles weg war.
Unsere frühe Nestflucht klingt heute sonderbar. Das Durchschnittsalter beim Auszug liegt inzwischen bei 23,7 Jahren, aber noch 30 Prozent der 25-Jährigen leben mit ihren Eltern unter einem Dach.1 Hohe Mieten und die Kälte der Welt mag viele junge Leute davon abhalten, vor dem Ende der Ausbildung das »Hotel Mama« zu verlassen. Die damalige Losgelöstheit liegt den meisten jungen Menschen aber ohnehin fern. Sie fühlen sich so wohl zu Hause, dass es Eltern geben soll, die eines Tages selbst ausziehen müssen, wenn sie sich etwas mehr Abstand zwischen sich und ihren erwachsenen Kindern wünschen.
Damals, in den frühen Achtzigerjahren, waren die Bedingungen, um sich auf eigene Füße zu stellen, übrigens auch schon nicht gut. Allein unsere schiere Anzahl stand uns bei der Wohnungs- und Jobsuche im Weg. In der siebten Klasse sortierte mein Lateinlehrer von 43 Mitschülern zwölf aus. Dass es ihm dabei nicht um Latein ging, verriet sein skeptisches Durchzählen in der ersten Stunde. Er kündigte an, dass er am Ende des Jahres »aussieben« müsse. An der Schulmauer prangten »No Future«-Graffitis. Überall standen Warnhinweise und Hindernisse. Vom Studium einer Geisteswissenschaft wurde abgeraten, Lehrer schien niemand mehr zu brauchen, der strenge Numerus clausus kanalisierte den Zugang zu attraktiven Studiengängen wie zum Beispiel Medizin. Ich dachte nach dem Schulabschluss nicht lange darüber nach, ob ich studieren wollte, sondern trat sechs Wochen später eine der raren Ausbildungsstellen als Journalistin an. Diese bestand freilich erst einmal aus einer neunmonatigen praktisch unbezahlten Hospitanz. Den Absprung an die Universität wagte ich erst nach sechs Jahren Berufstätigkeit. An den rosigen Aussichten kann es also nicht gelegen haben, dass wir Babyboomer frühzeitig flügge wurden.
Der Soziologe Heinz Bude, die Künstlerin Bettina Munk und die Schriftstellerin Karin Wieland, drei Babyboomer, haben sich damals dazu entschieden, erst einmal Häuser zu besetzen. Heute verklären sie diese Zeit als heroische Antwort auf die damalige Wohnungsnot, als Protest gegen ungenutzten Leerstand, und als Abkehr vom engen bürgerlichen Leben. Von sich selbst sichtlich beeindruckt, schildern sie in dem für mich als Roman getarnten autobiografischen Bericht Aufprall, wie sie vorsichtshalber ohne Wertgegenstände lebten, da jederzeit die Polizei anrücken und sie aus dem Haus werfen konnte. »Wir lebten aufregend experimentell, alle anderen erschienen uns langweilig konventionell. Unser Zusammenleben folgte bestimmten radikalen Prinzipien. Besitzansprüche waren unangebracht: Jemand kaufte ein und kochte, jemand anderes aß das Essen auf – zumeist ohne sich dafür zu bedanken. (…) Alles war für alle da. Alle Türen standen offen, keiner schloss sich ein. Wohnen war eine Herausforderung.«2
Die Hausbesetzerszene – die berühmteste gründete sich bereits 1971 im Kopenhagener Stadtteil Christiania – deckte damals vom heimwerkenden Idyll über den Familienersatz bis hin zum anarchischen »Häuserkampf« alle möglichen Bedürfnisse ab. Sie nur als politische Aktion zu sehen, ist ein wenig zu romantisch. Sie hatte etwas mit dem Gefühl der Unbehaustheit in der Babyboomergeneration zu tun. Damit meine ich den existenziellen Zustand, nirgendwo richtig dazuzugehören. Die hohe Mobilität und die Vorliebe für informelles Wohnen waren meines Erachtens nicht nur die Folge soziostruktureller Härten und politischer Aufmüpfigkeit, sondern auch die einer Mentalität. Der ungebundene Lebensstil war unsere Antwort auf die Situation und die Lebenshaltung unserer Eltern, der Kriegskinder, oder wie ich sie in diesem Buch nenne: unsere Nachkriegseltern.
In der DDR sah die Situation anders aus als in der BRD. Die Ausbildungsplatzgarantie und das an politisches Wohlverhalten geknüpfte Studium, an das sich zuverlässig eine feste Arbeitsstelle anschloss, begünstigten ohnehin das frühe Ausziehen von zu Hause. Die Studierenden wohnten meistens gemeinschaftlich in Wohnheimen, banden sich frühzeitig fest an Partner, heirateten und bekamen oft noch vor dem Ende des Studiums Kinder. Sie mussten in der Regel nicht nebenher arbeiten, da sie staatlich finanziert wurden. Insofern lassen sich die äußeren Umstände mit der BRD nicht vergleichen. Eine frühe Nestflucht war gesellschaftspolitisch eingeplant. Das Ergebnis war jedoch im Westen und im Osten das Gleiche: Babyboomer und ihre Nachkriegseltern trieb es oft schon früh auseinander.
Zur Rationalisierung dieses Verhaltens gab es auch eine Theorie, die man mit der antiautoritären Einstellung umschreiben könnte. Babyboomer begleitete bei ihrem Auszug von zu Hause die familienkritische Ideologie, die ihnen die Studentenrevolte der Achtundsechziger hinterlassen hatte. Sie war getragen von der Sehnsucht nach Befreiung von der patriarchalen Reproduktionsstruktur, die damals für die Gewaltgeschichte der Deutschen im 20. Jahrhundert verantwortlich gemacht wurde. Die Kernfamilie galt nicht mehr als Keimzelle des Staates, wie im 19. Jahrhundert, sondern als Keimzelle für den autoritären Menschen, der letztlich den Faschismus ermöglicht habe. Viele wollten mit der Wagenburgmentalität der Nachkriegsfamilie nichts mehr zu tun haben. Sie suchten deshalb nach alternativen Lebensformen zur isolierten Kleinfamilie mit ihren Schrankwänden, alten Erziehungsprinzipien und Geschlechterrollen, mit ihrer Apologie des Privatbesitzes und der Unterdrückung des Sexualtriebes.3 In Wohngemeinschaften und anderen informellen Wohnformen (ein Freund von mir wohnte das ganze Jahr über im Wohnwagen, auch als er beruflich schon einen Anzug trug) zelebrierten sie die Abschaffung der Trennung von öffentlichem und privatem Bereich, von Privatbesitz, einengender Monogamie, geschlechtsspezifischer Aufgabenteilung und der kindlichen Abhängigkeit von den Eltern.
»Man konnte sich hier – nicht ohne narzisstischen Überschuss – neu erschaffen und selbst verwirklichen«, meint der Historiker des linksalternativen Milieus, Sven Reichardt.4 Allzu theoriegesättigt darf man sich den Auszug der Babyboomer von zu Hause allerdings auch wieder nicht vorstellen. Die Zusammenhänge zwischen autoritärer Persönlichkeitsstruktur, bürgerlicher Kleinfamilie und Nationalsozialismus, den Sozialforscher der Frankfurter Schule konstatiert hatten, waren wohl den wenigsten bewusst. Die altlinken Sprüche waren eben Versatzstücke der Achtundsechziger-Revolte, die aufgegriffen wurden, weil sie zu den momentanen Bedürfnissen passten. Richtig daran geglaubt haben die Babyboomer nicht. Die Ironie ist, dass sich Reichardts These der linksalternativen Nestflucht sogar auf den Kopf stellen lässt. Babyboomer haben damals ihre Herkunftsfamilien verlassen, weil sie darin nicht genügend Wärme fanden.
Meine Eltern gehörten zur sogenannten »Psychoszene«. Mein Vater war Psychologe, meine Mutter auf dem Weg dahin; sie begann im Alter von 38 Jahren zum zweiten Mal zu studieren, diesmal Psychologie. Anlass war die Trennung von meinem Vater im Winter 1977/78. Er hatte eine Affäre mit einer jüngeren Psychologin begonnen, woraufhin sich meine Mutter alsbald ebenfalls mit einem jüngeren Psychologen zusammentat. Auf diese Weise entstand mein »vierblättriges Psychologenkleeblatt«, wie ich meine neue Elternkonstellation nannte – beide Paare gründeten sofort wieder neue Familien.
Diese gewiss nicht alltägliche Familienzusammensetzung mit vier »Psychologen-Eltern« symbolisiert für mich den Wertewandel der Siebzigerjahre. Meine Mutter zog in ein Reihenhaus in einem gehobenen Münchner Vorort und begann mit der gelegentlichen Unterstützung einer Haushaltshilfe und eines Kindermädchens ein neues Leben als späte Studentin, Hausfrau und Mutter. Sie nutzte diese zweite Chance dazu, vieles anders zu machen. Nur ein Beispiel: Während sie mich im Jahr 1962 noch unter Betäubung im Kreißsaal bekommen hatte, erblickte meine Schwester siebzehn Jahre später nach den Regeln der »sanften« Geburt das Licht der Welt.
Auch mein Vater ging die Familiengründung beim zweiten Mal ganz anders an. So durften sich seine jüngsten Kinder mit Filzstiften an den Wänden der Altbauwohnung verewigen. Später verwirklichte er seinen Traum und sanierte einen alten Bauernhof am See, wo seine zweite Frau Obst und Gemüse anbaute und eine öko-feministische Mehrfachexistenz als Therapeutin, selbst ernannte Hexe, Wanderapothekerin und Künstlerin führte.
Martin, Conny und ich wurden, so sehe ich das heute, auch deshalb so früh selbstständig. Unsere Eltern waren uns zu progressiv. In den Dreißigerjahren geboren, waren sie aus ihren vorgezeichneten Biografien ausgebrochen, natürlich ohne uns vorher gefragt zu haben. Sie hatten als unauffällige Nachkriegseltern begonnen und verspürten nach zehn oder fünfzehn Jahren Familienleben plötzlich andere Bedürfnisse. Sie bildeten sich emotional fort und stiegen sozial aus. Damit besetzten sie gewissermaßen den Raum, der eigentlich uns Halbwüchsigen gehört hätte. Wir, ihre Kinder, litten unter der Rollenkonfusion und dem Chaos, das die Siebzigerjahre in unserem Zuhause angerichtet hatten – und traten die Flucht nach vorne an.
Der Umbau der bürgerlichen Kleinfamilie, der schon Anfang des 20. Jahrhunderts in der marxistischen Theorie und in der Psychoanalyse begonnen und von den Achtundsechzigern fortgesetzt worden war, bildete dazu das Hintergrundrauschen.
Joachim Süss erkennt in der damaligen Zerbrechlichkeit der Familienbande ein tief liegendes Muster. Süss ist Theologe und zweiter Vorsitzender des Vereins »Kriegsenkel e. V.«, der sich seit 2010 mit den Kindern derjenigen Generation beschäftigt, die durch NS-Ideologie und Krieg in jungen Jahren geprägt worden war. Nach zahlreichen Gesprächen, Befragungen und Seminaren ist er zu der Auffassung gekommen, dass die zwischen 1960 und 1975 geborenen Babyboomer die Unbehaustheit ihrer Eltern übernommen und sich anverwandelt haben. Sie empfänden eine »existenzielle Heimatlosigkeit«. Ihr Leben habe sich gerade in den frühen Erwachsenenjahren wie ein »Schwanken auf instabilem Grund« angefühlt.
Die typische innere und äußere Verfassung der Jugendlichen Ende der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre schildert Süss so: »Die Herkunft, das Elternhaus, ist kein Ort zum Leben mehr und rückt allmählich in die Ferne. Der neue Ort, die Stadt, in der die eigene Ausbildung oder das Studium begonnen hat, erscheint vorläufig und vorübergehend. Heimat gibt es nicht mehr und noch nicht, ebenso ein Zuhause. Das Unterwegssein wird als einzig stabiles Daseinsmoment erlebt; der Zug oder der Bahnhof sind die Orte, an denen sich das Leben richtig anfühlt, weil sie den latenten Zwischenzustand und die Vorläufigkeit widerspiegeln, in denen man lebt. Sie machen die oszillierende Pendelexistenz des späteren Kriegsenkels aus, der zu diesem Zeitpunkt aber noch lange nicht weiß, dass er einer ist.«5
Mit diesen Zeilen ist alles über meine Zeit nach dem Auszug von zu Hause schon in der elften Klasse gesagt. Das Leben aus dem Koffer und dem Auto fühlte sich genau so für mich an. Im Elternhaus nicht mehr daheim, aber auch noch nirgendwo anders angekommen. Es gab aber noch viel drastischere Wege, sich aus den potemkinschen Elternhäusern zu lösen. Der damals für die Erwachsenen beunruhigendste waren Sekten und Drogen. Ab Mitte der Siebzigerjahre pilgerten Tausende ins indische Pune zum Ashram von Bhagwan und erschreckten die bürgerliche Öffentlichkeit in Deutschland mit ihren Geschichten von Erleuchtung und nackter Ekstase. Im Jahr 1977 erschien Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, eine Reportage über Christiane F., eine Teenagerin, die in die Berliner Drogen- und Prostitutionsszene geraten war. Dieser Bericht wurde 1981 als Spielfilm gezeigt und sollte vielen Jugendlichen und Eltern als warnendes Beispiel dienen, was passierte, wenn man es mit der Ablösung vom Elternhaus zu weit trieb.
Die elterliche Angst verstärkt die eigenen Ängste
Auch der Publizist und Trendforscher Matthias Horx, Jahrgang 1955, glaubte damals schon, die Babyboomer suchten in den kollektiven Wohnformen »all die Liebe und Aufmerksamkeit …, die man im Elternhaus entweder nicht richtig oder gar nicht bekam«. Das meinte er nicht sehr freundlich. Für ihn waren die WGs nichts anderes als »die Kuschelinstitute einer Softie-Generation, die immer gegen ihre Väter und Mütter gekämpft hat, aber ständig unbewusst auf der Suche nach den wahren Vätern, Müttern, Tanten und Onkel ist.«6 Bettina Alberti ist eine Babyboomerin, die dieser etwas boshaften Interpretation widerspricht. Für sie stellen sich ernsthaftere Zusammenhänge dar. Dass sich die Kinder der Nachkriegseltern von Haus aus trotz der schweren Teppichböden und Wohnzimmereinbauten, mit denen sie aufgewachsen waren, wenig zukunftsfroh fühlten, habe mit uneingestandenen Ängsten zu tun gehabt. Einerseits hatten diese ihre Ursache in der allgemeinen politischen Lage: Der Kalte Krieg und die atomare Hochrüstung versetzten die junge Generation, die den »heißen« Krieg nicht selbst erlebt hatte, in Endzeitstimmung.7 Man rechnete sich aus, wie weit entfernt die eigene Wohnung vom »Fulda Gap« lag. So wurde in den Siebzigerjahren das hessische Gebiet bezeichnet, in das die Truppen des Warschauer Paktes möglicherweise vorstoßen würden. Doch es gab viele Fulda Gaps. Vor den Toren meines beschaulichen Vororts am südöstlichen Münchner Stadtrand saßen die Waffenschmieden Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) und Siemens. Irgendwann würde da, damit musste ich rechnen, eine Bombe einschlagen. Das wäre das Ende der grünen Siedlung mit ihren Straßen, die Märchennamen trugen. Die 30 000 bis 40 000 Wohngemeinschaften in Westdeutschland im Jahr 1980 waren in dieser Situation wenigstens eine vorübergehende Zuflucht. Zwar ließ es sich dort nicht so komfortabel wohnen wie bei den Eltern, aber dafür konnte man sich intensiver über seine Ängste austauschen. Mit ihren Eltern konnten die Jungen damals darüber nicht sprechen. Denn sie waren der eigentliche Mittelpunkt ebenjener beklemmenden Gefühle.8
Auf der anderen Seite bedrohten die Babyboomer auch interne Ängste. Die Psychologin Alberti glaubt, das frühe Wegstreben von zu Hause habe mit der nicht stattgefundenen Aufarbeitung der Traumata in den Familien zu tun. Deshalb seien sie »Orte der Ungeborgenheit und des Unverständnisses« gewesen.9 Alberti zieht diese Einsicht aus ihrer therapeutischen Praxis. Dort habe sie beobachtet, dass sich Babyboomer als Kinder immer wenig beachtet und gehört gefühlt hätten. Denn ihre Eltern seien mit dem lebenslangen Verdrängen ihrer Kriegskindheit beschäftigt gewesen. Sie hätten sich frühzeitig in ihrem Leben eine Gefühlstaubheit zulegen müssen, die ihnen später auch den Kontakt zu den eigenen Kindern erschwert habe. So kam es, dass die Nachkriegseltern von ihrem Nachwuchs Bindung, Aufmerksamkeit und Liebe erwarteten, die sie selbst nicht geben konnten.10
Die im Krieg geborenen oder aufgewachsenen Alterskohorten drehten also die Rolle zwischen Eltern und Kind um. Sie »parentifizierten« ihre Kinder. Das heißt, sie machten sich zu den Kindern ihrer Kinder. »Die Kinder und Jugendlichen waren aufgefordert, die Seele ihrer Eltern zu erspüren, sie mussten dafür Antennen entwickeln und sich auf sie einstellen, um den seelischen Austausch, den sie selbst so dringend für ihre Bindungsaufnahme benötigten, aufrechtzuerhalten«, meint Alberti.11 Ohne dass es den Beteiligten selbst bewusst geworden wäre, bemutterten Kinder ihre Eltern, denn die strahlten eine unausgesprochene, aber manifeste Hilfsbedürftigkeit aus. Ein sehr plastisches Beispiel ist die Geschichte des Romanautors Frank Witzel. Der 1955 geborene Buchpreisträger hat in seinem autobiografischen Roman an vielen Stellen herausgearbeitet, wie sich diese Konstellation von Eltern-Kind-Beziehungen auf das Leben eines Babyboomers auswirkten. Noch mit Anfang sechzig, als er Inniger Schiffbruch schrieb, fühlte er sich, als habe das Leben für ihn als Kind von Nachkriegseltern immer noch nicht richtig angefangen. Als sei er übergangslos von einem »noch nicht« in ein »nicht mehr« gewechselt. Als Ursache hierfür sieht er seine Eltern, die als Kinder ihren Mittelpunkt verloren hätten, geografisch und emotional. Dadurch seien sie ihr Leben lang bedürftig geblieben. Sie hätten ein Leben zu führen versucht, in dem es endlich um sie selbst ging. Um ihr Wohlergehen sollte sich das Familienleben drehen, nicht um das ihrer Kinder. Er als Sohn habe vielmehr die Aufgabe bekommen, genau zu beobachten, was den Eltern fehlen könnte, und es ihnen dann möglichst zu geben. Er war zur Rolle des Zuschauers verdammt. Das Bühnenstück zu Hause hieß: Nachkriegseltern entdecken ihre Bedürfnisse, und ihre Kinder müssen es ausbaden.12
Solche Rollenumkehrungen blieben für alle Beteiligten unbewusst und ungewollt. Die psychologische Theorie sagt, dass solche Aufträge von Eltern an ihre Kinder ursprünglich einmal sinnvoll gewesen sein können, sich dann aber von den realen Ursachen entkoppelt haben und sinnfrei weiter kursieren. Ein Auftrag vieler Kriegsenkel kann zum Beispiel gewesen sein, sich möglichst früh sowohl materiell als auch emotional auf eigene Füße zu stellen.13 Damit übernahmen wir Babyboomer das Ideal der »Lebenstüchtigkeit« von unseren Eltern, die selbst noch in dem darwinistischen Klima Deutschlands aufgewachsen waren. Die Erziehungsideale der Dreißiger- und Vierzigerjahre, über die ich weiter unten noch ausführlich sprechen werde, forderten Autonomie, nicht zuletzt, damit die Erwachsenen die Hände frei hatten für die kriegswichtigen Aufgaben und später für den Wiederaufbau. Eltern und Kinder sollten nicht zu eng verbunden sein, damit sie die übergeordneten Ziele des NS-Staates nicht aus dem Auge verlören. Das wurde frühzeitig eingeübt. Die Generation der Nachkriegseltern wuchs mit von der »Hitlerjugend« organisierten Freizeiten, mit Kuraufenthalten und Landverschickungen auf. Sie erlernte zwangsläufig früh die Fähigkeit, sich zu trennen. Dieses Ideal trugen sie weiter bis in die Sechzigerjahre hinein. Unabhängigkeit war und blieb ein Ziel auch für die Vorbereitung der eigenen Kinder auf das Leben. Somit blieben die Babyboomer mit den Erziehungsidealen ihrer Eltern und Großeltern innerlich verbunden.
Das Ideal der inneren und äußeren Unabhängigkeit
Unabhängigkeit war auch in meinem Elternhaus ein Mantra. Mein Vater erzählte gerne, wie er und seine Geschwister alleine verreist seien mit nichts als einer Zitrone im Gepäck, die offenbar alle Hunger- und Durstgefühle stillen konnte. Auch meine Mutter blieb als Kind den Tag über allein in der Wohnung, weil ihre Mutter als Witwe arbeiten gehen musste und weil es abgesehen von der Kirche keine angemessenen Betreuungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten gab. Die Erfahrungen meiner Eltern haben sich meines Erachtens in meiner Kindheit ausgewirkt. Als ich sechzehn wurde, erklärte mich mein Vater für erwachsen und bot mir Geld an, falls ich von zu Hause ausziehen wollte. Er erinnerte mich immer wieder an seine eigene frühe Selbstständigkeit und schlussfolgerte, was ihm selbst nicht geschadet habe, könne auch für mich nur gut sein. Das Autonomieideal war typisch für seine Generation. Man musste es im Leben notfalls auch alleine schaffen können.
In der Alterskohorte der Babyboomer führte dieser generationelle Auftrag nicht selten dazu, dass sich Jugendliche so gründlich abnabelten, dass sie in finanzielle Notlagen oder sogar vorübergehende Obdachlosigkeit gerieten, weil sie glaubten, sich von den Eltern nicht mehr unterstützen lassen zu dürfen. Sonst wären sie ja nicht »lebenstüchtig«. Auch für mich war es eine Frage des Stolzes, mich irgendwie alleine durchzuschlagen, ohne Hilfe der Eltern. Die Kehrseite davon war die emotionale Überforderung, die manche meiner Altersgenossen in den Schoß von Sekten wie zum Beispiel der Bhagwan-Bewegung lockte.
Ursula Ott wollte sich als Jugendliche von einem ganz speziellen Verhältnis zur Welt abgrenzen. Die Eltern der Journalistin hatten ihr aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen von Heimatverlust und Zerstörungen im Bombenkrieg ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis vorgelebt. Sie hatten sich in ihrem Haus hinter hohen Thujenhecken, dicken Türen, Sicherheitsschlössern und Alarmanlagen regelrecht verbarrikadiert. Wenn das Bollwerk nicht halten sollte, gab es immer noch Taschenlampen, Messer und sogar Schusswaffen, mit denen sich die Familie in der beschaulichen Siedlung gegen Bedrohungen von außen hätte wehren können. Doch richtig sicher fühlten sich ihre Nachkriegseltern nie. Hinter dieser generalisierten Angst konnte die Geschichte einer Vertreibung, einer Ausbombardierung, einer Flucht oder Deportation stecken, oder auch nur die Gewissheit, dass einem das Eigene in einer grundsätzlich feindlichen und gefahrvollen Welt jederzeit abhandenkommen konnte.
Die Verlustangst versinnbildlichte ein für die Bundesrepublik der ersten Jahrzehnte typischer Einrichtungsstil, wie Ott ihn in ihrem Bericht Das Haus meiner Eltern hat viele Räume festgehalten hat. Die massiven Wohnzimmerschrankwände, die Musiktruhen, Polstergruppen, Zinnsammlungen, Vitrinen mit Bierkrügen und schweren Kristallgläsern, die sie beim Umzug ihrer Mutter ins Altenheim ausräumen musste, standen dafür, was nach dem Krieg alles wieder aufgebaut worden war. »Dafür hat dein Vater ein halbes Jahr gespart«, war so ein Satz, der ihr nun durch den Kopf ging, als sie sich schweren Herzens von dem angesammelten Trödel im Elternhaus zu trennen begann. Hinter jedem Objekt hatte der Wunsch gestanden, den Geschäftsfreunden, Nachbarn und Verwandten zu zeigen: »Seht her, wir haben es geschafft!«14 In ihrem Wohninventar steckte für die Nachkriegsgesellschaft nicht nur der Ausweis für Tüchtigkeit, sondern auch das »Wir sind wieder wer«.
Bei meiner Mitschülerin Andrea durfte das Wohnzimmer von uns Kindern nicht betreten werden, damit keine Fingerabdrücke auf den Möbeln und dem Nippes landeten. Bei anderen kam das siebzigteilige goldgeränderte Kaffeeservice nur zu besonderen Gelegenheiten auf den Tisch, Plastikhussen schützten die Sesselpolster, oder Väter kämpften aussichtslos gegen jeden Brösel im Auto. Alle diese in die Ewigkeit weisenden Merkwürdigkeiten, mit denen Babyboomer aufgewachsen sind, bildeten eine Kulisse familiärer Unverwüstlichkeit. Doch das Grundgefühl darunter blieb porös. Wer früh auszog, befürchtete, sonst für immer kleben zu bleiben. Entsprechende Beispiele gab es. So kennt mein Mitschüler Hubert bis heute – mit Ausnahme eines kurzen Abstechers zur Bundeswehr – nur ein Zuhause: nämlich sein eigenes Elternhaus. Er fand immer neue Gründe, warum das für alle Beteiligten so das Beste sei. Erst half es, Miete zu sparen, dann bot die zunehmende Hilfsbedürftigkeit der alternden Eltern einen legitimen Anlass, in ihrem Haus zu bleiben. Ob dahinter tiefere Gründe lagen, die mit der Geschichte seiner Eltern zu tun hatten? Darüber habe ich nie mit ihm gesprochen. Er war kein Einzelfall in meinem Bekanntenkreis. Wir nahmen das so hin und sprachen das Thema nicht an. Ich hatte immer die Ahnung, es könnte gefährlich werden, wenn ich seine lebenslange Nesthockerei hinterfragen würde. Die Psychologin Sandra Konrad glaubt, dass besonders in engen und geschlossenen Familiensystemen überproportional häufig der Wunsch formuliert wurde, »sich nicht zu entfernen und im Dienste der Familie zu leben«.15 Die Ursache dafür konnte in der Familiengeschichte verborgen liegen, die erst den Kriegskindern und dann den Kriegsenkeln zäh in den Kleidern hing.
Historische und biografische Brüche
Sich früh vom Hofe zu machen oder für immer bei den Eltern wohnen zu bleiben, diese Entscheidung fiel jedenfalls nicht aus einer materiellen Notlage heraus. Meine These ist, dass sich die reale und psychische Entwurzelung der Generation der Nachkriegseltern zu einem Gefühl der Unbehaustheit der Babyboomer ausgewachsen hat. Um das zu verstehen, möchte ich die Umstände schildern, unter denen viele im oder vor dem Krieg Geborene ihre Verortung im Leben verloren oder ihren Platz gar nicht erst gefunden hatten. Dass 1945 etwas Neues beginnen würde, war den meisten Menschen unter dem Eindruck des Zusammenbruchs ihrer alten Welt im »Dritten Reich« nicht klar gewesen. Eine »Stunde null« gab es nicht, das geflügelte Wort entstand erst aus der Rückschau. Die Zeitgenossen erlebten den Übergang vom NS-Regime zur Besatzungszeit mit gemischten Gefühlen – »von Fassungslosigkeit und Verbitterung über ›zerrissene Illusionen‹ bis hin zu Dankbarkeit über einen ›geschenkten neuen Anfang‹« reichte das Spektrum.16 Viele Menschen hatten Angst; Angst vor der Rache der von den Deutschen dezimierten und versklavten Völker im Osten, Angst vor den ehemaligen Zwangsarbeitern, und vor allem Angst vor den Juden, die den Holocaust überlebt hatten. Es gab den Verschwörungsmythos der »jüdischen Rache«, und es schien außerdem wahrscheinlich, dass die Sieger und Überlebenden stellvertretend für die Opfer Vergeltung üben würden.
Deutschland habe keine Zukunft mehr, sagten sich deshalb viele und begingen im Extremfall Selbstmord, nachdem ihnen nicht nur ihr »Führer«, sondern auch eine politische Vision und ein Lebensplan abhandengekommen waren, und weil sie Angst vor der Abrechnung hatten. Sie fühlten sich als »wahre« Opfer des Zweiten Weltkriegs und verdrehten damit die tatsächlichen Zusammenhänge. Beispielsweise schrieb der Schriftsteller und zweifache Weltkriegsveteran Ernst Jünger im März 1945 in sein Tagebuch: »Die Lage der Deutschen ist jetzt ganz so, wie die der Juden innerhalb Deutschlands war.«17
Auch wenn die Vergeltungsangst völlig übertrieben war, gab es Nachrichten und Schauermärchen, die sie nährten. Angebliche Banden aus ehemaligen KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern, aber auch die reale Bedrohung durch vergewaltigende Besatzungssoldaten hielten die Nachkriegsbevölkerung in Atem. Den Rotarmisten war der Ruf vorausgeeilt, dass sie sich an den Frauen der Wehrmachtssoldaten schadlos hielten. Zum Schrecken der Zivilbevölkerung traf dies aber auch auf britische, amerikanische und französische Soldaten zu. Nach meiner Hochrechnung, die ich in dem Buch Als die Soldaten kamen näher erläutere, fielen mindestens 860 000 Frauen in Deutschland zwischen 1945 und 1955 Vergewaltigungen durch Siegertruppen zum Opfer. Weder Polizei noch Gerichte konnten ihnen helfen. Die Verbrechen wurden, wenn überhaupt, nur vor den Militärgerichten der Alliierten verhandelt, meistens wurden sie jedoch gedeckt und vertuscht. Die Erkenntnis, jederzeit auf offener Straße oder in den eigenen vier Wänden von fremden Männern überfallen und gruppenweise vergewaltigt werden zu können, verunsicherte nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern die Bevölkerung kollektiv.18
Die Bedrohung durch sexualisierte Kriegsgewalt war nur ein Angstfaktor, aber ein lange verdrängter, der sich in vielen Familien festsetzte. Dass die deutsche Nachkriegsgesellschaft in solchen Fällen weder Empathie zeigte noch Hilfsangebote bereithielt, verschlimmerte die Lage noch. Die Deutschen hatten sich in der Zeit des Nationalsozialismus darin geübt, schmerzresistent und unsentimental zu erscheinen. Es gab nicht nur eine Kultur der Abhärtung, die es verbot, Gefühle wie Angst und Schmerz und Trauer zu zeigen. Die menschenverachtende nationalsozialistische Ideologie förderte auch, dass sich die Deutschen um das Schicksal ihrer verfolgten und gequälten Mitmenschen nicht kümmerten. Um beim Beispiel der Massenvergewaltigungen zu bleiben: Den betroffenen Frauen schlug Misstrauen entgegen und häufig der Vorwurf, sie hätten es selbst so gewollt. Sie galten als sittenlose »Amiliebchen« oder Ähnliches, die sich für ein Paar Seidenstrümpfe billig verkauft hätten. So lernten die Opfer der kriegsbedingten sexuellen Gewalt schnell, ihr Unglück zu verheimlichen und die Zähne zusammenzubeißen. Wenn die Übergriffe eine Infektion oder gar eine ungewollte Schwangerschaft zur Folge hatten, dann wurden die Frauen von ihren Familien versteckt oder in die Fremde geschickt. Kinder aus Vergewaltigungen wurden zur Verschleierung ihrer Herkunft bei anderen Leuten untergebracht und erfuhren oftmals nur durch Zufall und viele Jahre später von den Umständen ihrer Zeugung. Eine meiner Interviewpartnerinnen hatte beispielsweise zwei »Mütter« – ihre leibliche, die vergewaltigt worden war und die sie nur gelegentlich sah, und ihre Großmutter, die sie ebenfalls als »Mutter« ansprechen sollte. Im Schulalter wurde sie plötzlich aus ihren Lebenszusammenhängen gerissen und zur leiblichen Mutter geholt, die inzwischen geheiratet und noch ein Kind bekommen hatte. In dieser neuen Familie wurde das Kind jedoch nie angenommen und geliebt.
Ich habe von Babyboomern immer wieder gehört, dass sie noch in den Sechziger- und Siebzigerjahren in einem Klima der Angst vor sexualisierter männlicher Gewalt aufgewachsen seien. Die »männliche Bestie« konnte buchstäblich hinter jedem Busch lauern. Ich glaube, das lag daran, dass die Nachkriegseltern ihren Töchtern und Söhnen eine einseitige und oft verquere Vorstellung von der menschlichen »Natur« mitgegeben haben. Anna G. zum Beispiel, 1956 geboren, schreibt im Jahr 1983 in ihr Tagebuch, dass sie erst im Alter von 26 Jahren festgestellt habe, »dass Männer ja auch Menschen sind, mit denen ich reden kann, etwas unternehmen und zärtlich sein kann, ohne den erhobenen Zeigefinger meiner Mutter im Kopf, alle Männer sind schlecht und bösartig«.19 Und in meiner Familie schnitt meine Großmutter mütterlicherseits Zeitungsartikel aus, die von Vergewaltigungen junger Mädchen berichteten, und schickte sie mir. Das dadurch heraufbeschworene Bild, jederzeit in den Straßengraben gezerrt werden zu können, sollte mich auf den Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule und bei abendlichen Unternehmungen immer begleiten, so ihr Plan. Ihre Absicht, mich zu beschützen, war sicherlich gut gemeint, aber wie bei vielen meiner Altersgenossinnen entstand so auch bei mir ein falscher Eindruck von den von der Männerwelt ausgehenden Gefährdungen für junge Mädchen.