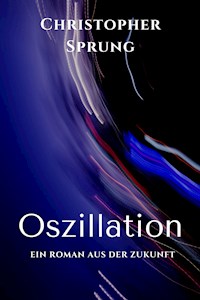3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Gleichnis auf moderne Zeiten, in der Kulisse eines Dorfes am Fuße des Blocksbergs, des Hochsitzes alter Rituale. Die Anklägerin: eine Haushälterin des Pfarrers, geheime Meisterin der Heilkunst und Spiritualität, die die Heuchler aufdeckt und ihre Anklage selbst vollstreckt. Der verhärmte, gebildete Dorfschrat mit seiner Ablehnung des Menschen, von ihr in die Geheimnisse des Tantra und der Liebe eingeführt. Der Pfarrer mit seiner Doppelmoral; der Bischof und dessen heimliche Liebe zu seinem Lakaien. Die dramatische Feuernacht auf dem Blocksberg, Männer in Masken, Rituale der Hexen. Die Anklage, die Vollstreckung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christopher Sprung
Die Anklägerin
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Anklägerin
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Impressum neobooks
Die Anklägerin
Christopher Sprung
Die Anklägerin
Novelle
Eins
Das Dorf schwingt zur Mondzeit unberührt im Tal, der Rauch zahlloser Kamine eine Andeutung verbotener Lust, von deren willenloser Hingabe manch eine Unschuldige, doch nicht Schuldlose, Witterung aufnimmt, um sie sich für immer einzuprägen. Johan Germel kehrt die Erinnerungen aus den Gassen, die Mägde schon längst ins Hintere geflüchtet. Er will nichts empfinden, ist traurig, wenn ihm die Leere aus den Hauswänden zuspringt. Die Gemäuer würden die Zimmerlügen aus dem Innern aufsaugen und zu ihm tragen, dem sei er gewiss, denkt er, seit geraumer Zeit, denn er kennt sie genau, die Türen und Fenster, und die Bewohner dahinter, dazwischen, darinnen, in ihrem Nirgendwo. Man habe ihn doch nie gefragt, würde er später sagen. Zwei Stunden jeden Abend, danach in den Dorfkrug.
Gar manches Mal setzt er sich spät noch auf die ersehnte Holzbank, dort unter dem Baum. Die gnädige Dorflinde, seine Zuflucht. Zu viel Wein aus alten Fässern, zu viele Gedanken. Seit Tagen ist er verärgert. Sie verschwindet nicht aus seinem Kopf, mehr noch, sie hat sich bei ihm festgebissen. Was er nicht will, was er ablehnt, bringt die Liebe am Ende doch nur Unbill. Er sah sie auf dem Markt, Esther, die Haushälterin im Pfarrhaus.
Im Dorfkrug hört man neuerdings weniger vom neuen Pfarrer als von ihr, die schon Waldheim diente, dem plötzlich verstorbenen Vorgänger im Amt. Gemunkel, Andeutungen, Vermutungen. Für Germel hat das Geschwätz keinen Wert, bestätigt es nur stets aufs Neue die menschliche Schwäche. Rücksichtslos, so Germel, streuen sie Gerüchte gegen die Ehre, verletzen den Ruf, wähnen sich selbst immun und ertrinken, würden sie das nächste Opfer.
»Niemals makellos, nie unsterblich«, sein Grübeln nimmt kein Ende. »Dem Menschen einzig gewiss sind der Schatten und der eigene Tod.« Kreisende Rückblicke, vor allem um die Umstände im Pfarrhaus. Er, Germel, meint nun, ein einzig Gutes sei doch geschehen, er habe jetzt, hier, auf der Bank, im späten Winter dem Frühling getrotzt und noch ein letztes Mal die Kälte eingeladen, sich in allen Gassen trotzig einzugraben. Es waren auch die Winkel und Züge seines eigenen Körpers, in die hinein die Kälte noch einmal drängt. Arg nutzlos all das Fressen und Saufen im Winter.
Wenn im wuchtigen Frost die technischen Gewerke erstarren, die menschliche Anmaßung über die Natur vorübergehend eingestellt, da fühlt Johan Germel sich mehr in Heimat als im Frühling oder Sommer, den Zeiten, die den Bedenkenlosen Tür und Tor für ihre frivolen Spielchen öffnen, in denen die Sonne triumphiert und Johan Germel gefriert. So aber ist es das Dörfchen selbst, das die Menschen einfrostet, kein Schutz vor der Last des Winters.
Johan Germel ist froh, es ist nicht der Pfarrer, sondern die Kälte, die die Begierden und Gelüste der Menschen um ihn herum zähmt. Denn die Natur sei ehrlich, der Pfarrer aber nur ein kläglicher Pharisäer und Tartüff, ein Speichellecker des im nahen Kloster residierenden Bischofs. Er, Germel, wäre vom Leben und den Menschen gänzlich enttäuscht, würde das Gesetz der heiligen Kirche aus Unterwürfigkeit zu diesem Heuchler eingehalten. Nein, im Winter erscheint in gewisser Weise die Erlösung, da es nicht der kriechende Frömmler, sondern die Natur ist, vor der die Menschen innehielten in ihrem Wahn. Er schließt das Fenster, wie immer, wenn schon der Gedanke an Menschen, jenes ätzende Menschengedenken, zu nahekommt. Er friert, wenn Lügen sich aufbauen, überall die Unaufrichtigkeiten, Ausflüchte und Irreführungen das Leben beherrschen, wie intensiv die Anmaßungen ihn treffen, wie schmerzhaft die Zumutungen seine Haut irritieren, sein Empfinden hemmen, seine Zuversicht lähmen.
Tiergedenken wäre angebracht. Doch Menschengedenken, das kommt ihm stets wie unnatürlich, ja widerwärtig vor, angesichts des Menschen und seiner Taten, seiner grundsätzlich eingefügten Fehlerhaftigkeit, der Kriege und Morde, des ständig lauernden Verrats. Er genießt es zu frösteln, und noch mehr, sodann sich zu schließen.
Im Wald findet er seinen eigenen Frieden. Im letzten, rasch verflossenen Oktober, dessen Gold zu schnell versiegte, befand sich Johan Germel auf einer jener Wanderungen, die er sich aufzubürden pflegte, wenn es halt Oktober wurde. Der September war ihm noch zu lüstern. Zu nah die Sommermonate, in denen Menschen aus der Stadt hier oben auf den eigentlich ihm gehörenden Wegen ihren ekelerregenden Dreckatem abgelassen hatten, der dann, so nahm er, Germel, es mit Gewissheit an, auf den Blättern und Zweigen, den Gräsern und Moosgeflechten wie Schwermetall niederkam und dort unablöslich anhaftete. Zu nah noch die Abende, an denen die Stadtmenschen vorgeblich die Kühle des Waldes suchten, in Wahrheit jedoch im Unterholz verschwanden, nur um mit ihnen oft unbekannten Dritten gegen den Bischof anzukopulieren. Das Moos gehörte doch Johan Germel.
Es war Montag. Er wanderte weder samstags noch am Sonntag. Obwohl es schon Oktober war, konnte man des Wochenends Andere nicht völlig ausschließen. »Oberflächliches Mentalgesindel«, wie er zu denken pflegte. Spaziergänger, Ausflügler, aus Sicht des Waldes schädliche Vergifter. Montage und Mittwoche im Oktober waren hervorragende Wandertage.
Der Planet, vor den Sekunden des Menschen, Germel sinniert unentwegt: seit Jahrmillionen ohne menschliche Stimmen und doch nicht still, seit Äonen nur mit Gestein, sodann nur mit Mikroben, zartem Farn, Jahrhunderte von Millionen Jahren, ohne Tiere, ohne Insekten, ohne Gewerke aus Stahl und Beton, ohne Lärm aus Maschinen, Schmutz aus den Abfällen seelenloser Rohre, die den Grund der Erdenfelse verdunkeln und die Höhen der Luft ersticken; der Planet, der gewiss vorübergehend, doch erst seit kurzem, den technischen Lärm und seelischen Widerstand des Menschen zu verkraften beginnen muss, kommt ihm so am nächsten.
Germel empfindet Mitleid mit den Wesen allüberall. Stellt sich vor, wie ein Berg, ein Tal, der Fluss dort unten, die Wälder sich anschauen, wenn nur er allein existierte, einziger Beobachter, Augenzeuge und Betrachter einer Welt ohne Menschen, die Menschheit noch nicht geformt.
Wäre es nicht eine ehrliche Welt, der Mensch nur eine Möglichkeit in ferner Zeit. Eine Welt ohne Zweifel und Gnade, ja auch ohne menschliche Ethik, doch mit Ästhetik. Er, Germel, meinte, diese Schönheit sei austariert, in einem Gleichgewicht, selbst voll Anmut.
»Wäre ich damals: wäre ich vielleicht verpflichtet, den ersten Menschen auszulöschen, mit dem Wissen von heute.« Germel will diesen Gedanken nicht. Sein Arm versagt in vorauseilend gnädiger Amnesie, will er doch nur die Blasphemie wegwischen. Doch dann erscheint es ihm nur folgerichtig, simpel, genial, das Beste für den Planeten.
»Ich könnte den ersten Menschen vertuschen. Ihm eine Maske aufsetzen.«
Hätte er damals, aus dem Keim des künftigen Menschen, dessen Niedertracht und Vernichtungswillen, die Zerstörung der Natur durch ihn, erkennen können? Johan Germel weiß, von der Antwort hängt das gesamte Lehrgebäude der allmächtigen katholischen Kirche ab, vielleicht auch gar die staatliche Ordnung. Ja, ich hätte den künftigen Menschen erkannt? Und was denn dann mit all den unendlichen Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden, Jahrmillionen vor dem Gottessohn, also ohne Gottessohn und sein Opfer? Wie ist das göttliche Schweigen in den Äonen vor dem Heiland zu werten, das doch schließlich auch ein Schweigen der Natur, weil ohne den Menschen, bedeutete? Was mit all den wunderschönen Tälern, Wäldern, Bergen, Meeren und Flüssen, den klaren Bächen, den herrlichen Tieren, den gefiederten Sauriern, den ersten Fischen? Ohne wissenden Beobachter – waren sie da überhaupt wunderschön, klar, herrlich, gefiedert, zuerst? Zuerst und später, Kategorien nur des zeitlichen Menschen. Johan Germel.
»Du dummer Kerl«, pflegt er dann zu denken. »Der Schöpfer braucht keinen Dritten, um die Schönheit seiner Schöpfung feststellen zu lassen. Die Zukunft der Welt wird auch ohne den Menschen sein.«
Und als er so denkt, hört er eine Stimme:
»Die Welt, in der hinein du dich verzweifelst, erwartet geradezu stündlich jene Stille zurück, die vor dem Menschen war.«
Und er weiß nicht, ob er trunken ist oder träumt.
Er, Germel, gerade in seiner Eigenschaft als Wächter hier im Dorf, sei, auch nach einem guten Trunk im Dorfkrug, zu solch strengen Überlegungen berechtigt, selbst wenn sie defätistisch seien. Nein, wenn er es aufs Ganze sehe, er sei geradezu berufen, das Absonderliche mitzudenken, um das Alte zu bewahren. Die Heutigen haben das alte Wissen verloren, so Germel, er nannte es süffisant die »gewollte Ignoranz«.
Von seiner Bank kann er zum Markplatz blicken, in Richtung des Dorfkrugs, entgegengesetzt zur Pfarrgasse hin, an deren Ende gelegen das Pfarrhaus, wo sich Kirche und Friedhof anschmiegen. Und zugleich seit ewigen Zeiten um die Gunst derer buhlen, um derer Bemächtigung sie erbaut, deren Gebete sie erheischen, auf deren Besorgnis sie setzen.
So, wie er es sich versuchte vorzustellen, von seiner Lindenbank aus zur Nachtzeit in ein schlafendes Menschendorf hineinblickend, war die Welt aber in Wahrheit in ihrer ganz überwiegenden bisherigen Zeit auch tatsächlich gewesen: ohne den Menschen. Mineralien, Steine, Pflanzen, Gewächse, Bakterien, Amöben, Insekten, Tiere zu Wasser, auf dem Land und in der Luft: sie waren in beinahe aller bisherigen Zeit des Erdenballs unter sich, ohne die lärmend giftige Menschheit.
Wenn er dann auf den Kirchturm schaut, das Pfarrhaus, an den Pfarrer und Bischof denkt, an ihre Predigten – so sehr er auch für die Einhaltung der Moral eintritt – ist es für ihn, Germel, dann doch recht unverständlich, wie solch intellektuell doch anscheinend begabte Persönlichkeiten sich offensichtlich niemals eine zwingende Frage stellten. Zu deren Antwort er selbst sich in Ansehung seiner niederen beruflichen Stellung nicht berufen fühlt. Nämlich, eine Frage dergestalt, die er, Germel, nur für sich zu stellen wagt. War dann in der vormenschlichen Zeit, die immerhin weit über 99 Prozent aller irdischen Entwicklung ausmacht, die Natur und alles in ihr, in all jenen vormenschlichen Äonen und Epochen, war sie dann kraft eigener Lehre der Kirche nicht ohne Gott, ohne den Heiland und damit auch ohne Sünde, und mit ihrem Fehlen ohne Vergebung, ohne Gnade? Schließlich, so jedenfalls Pfarrer, Bischof, Kardinäle und mit ihnen der ferne Papst, waren nur die erdgeschichtlich sehr späten Menschen mit einer das Heil erflehenden Seele ausgestattet. Wo katholische Seele fehlte, weil nur Pflanzen und Tiere aller Art den Erdball bevölkerten, gab es kein Ringen um Wahrheit, um Glauben, um den Heilsweg, und mangels Kreuzesopfer keine Vergebung.
»Vielleicht war Gott auf anderen Erdbällen beschäftigt«, Johan Germel liebt blasphemischen Sarkasmus. So muss es gewesen sein. All das Abschlachten, Fressen und Getötet werden in jenen Erdepochen ohne Menschen: offensichtlich ohne Gott. Zumindest ohne den Gott, den die Heutigen sich vorstellen.
In ihrer Einsamkeit waren sie auch unendlich ruhig. Nicht, dass sie ohne Töne lebten. Auch ohne Menschen, so stellte sich es Germel vor, gab es grollenden Donner, im tierischen Todeskampf krachende Knochen, Musik der Vögel, fletschende Zähne, zärtliche Anmut sich nähernder Paare, Glücksrufe satter Mägen und begatteter Damen.
Steine, Pflanzen und Tiere unter sich und damit unendlich ruhig. Doch nicht, dass sie ohne Töne lebten. Doch die Ruhe der Welt ohne ihn, ist für den Menschen nicht vorstellbar. Eine Ruhe, die in ihrer Tiefe und Dichte zu jedem Augenblick an den Urgrund mahnt, empfunden in der Neuzeit nur von jenen wenigen, die in dünnhäutigen Raumkapseln die Schwerkraft dieser Welt überwanden und, noch nah am Planeten, sich in der beißenden Stille des Weltalls aufhielten. Empfindbar höchstens noch für jene, die in den drei Minuten einer totalen Sonnenfinsternis hoch oben auf einem Plateau in höchster Öffnung all ihrer Sinne den Urgrund aufsaugen. Das wäre für den unruhigen Mensch, der in der heutigen Fremdheit lebt, zu viel.
Aus diesem Grunde schuf er sich den Lärm, die großen Gewerke, das Getöse künstlicher Maschinen, Antriebe, Einrichtungen und Bewegungsmittel, die nur einem einzigen unbewussten Zweck dienten: ihn in seiner Ungeduld zu stärken und vom Urgrund abzuhalten, ihm die Stille und das tiefglückselige Schweigen zu versagen.
Wie durfte er, der arme kleine Johan Germel, sich das dann vorstellen, ohne wegen Gotteslästerung angeklagt und eines nicht allzu fernen Tages auf einem irdischen oder höllischen Scheiterhaufen zu enden?
Die Wege des dem Dorf so nahen Waldes waren vollgesogen mit all diesen ketzerischen Gedanken. An jedem Blatt haftete der Zweifel des Grüblers. Würde je ein offener Geist hier entlanggehen, er würde unverzüglich innehalten, erschrocken, ja erschlagen von der Schärfe der Wahrheit, die hier lauerte. Stadtmenschen spönnen ein Geflecht aus Gerüchten und Verleumdungen über die verschlungenen Pfade, so dass es im Laufe der Zeit nur noch wenige waren, die selbst des sonnigen Tages sich hier über ihren Weg trauten.
Doch an jenem Montag im letzten Oktober, wie immer ist er schon früh um sechs aus dem Haus gegangen, trifft er – kaum war er die leichte Anhöhe aus dem östlichen Winkel des Dörfchens hinauf- und auf den sich hier schon tief und dunkel abzeichnenden Wald zugegangen – auf den Pfarrer, der, wie er so in seinem schwarzen Kleid aus dem Waldweg herauskam, ob dieser frühmorgendlichen Begegnung genauso überrascht und entgeistert schien wie Johan Germel selbst.
»Herr Pfarrer!« ruft Johan Germel aus, der Unterton eines Vorwurfs, weit mehr nur als eine vorsichtige Anfrage, schon behaftet mit Zweifel und Misstrauen, schwingt fast als Oberton. Kaum finden die Worte ihren Schallweg, will er sie zurückholen, zu spät, die Wellen keilen sich kurz vor dem Riff der Kutte zu kantigen Pfeilen, fliegen uneinholbar weiter auf ihr Ziel hin, ihre Spitzen durchbohren das hochheilige Amt, treffen das Herz des Gesetzes.
»Knie nieder, Germel!« Schon wähnt der Pfarrer sich in Siegeslaune, vorbei das winzig kurze Flackern seiner Gesichtes Röte, nur kurz aber umso deutlicher ist er ertappt, aus einem noch unbekannten Grunde.
So kam es, dass Johan Germel, noch frohgemut sich aufmachend zu seinem Montagweg, sich unerwartet wiederfindet, am Waldesrand vor dem Pfarrer kniet, in äußerster Unterwerfung um Vergebung bittet.
»Germel! Was tust Du hier in der Frühe? Wie wagst Du es, die geistlichen Übungen der heiligen Kirche zu stören?«
Schon ist Johan Germel besiegt, schon sein Muteshauch verflogen.
»Ich bitte um Vergebung, Hochwürden! Verzeiht mir noch ein einziges Mal! Wie dumm von mir, noch vor dem Morgengrauen aufzubrechen! Wie konnte ich es nur von mir wegwischen, dass die Geistlichkeit gelegentlich im Morgengebet sich in Gottes heilige Schöpfung begibt, um Ihn dort zu huldigen, wo Er, der Schöpfer, unmittelbar zu spüren ist! Vergibt mir dieses Mal!«
»Wie kannst Du es wagen, Elender! Es ist nicht an Dir, in Deinem Unwissen zu räsonieren, was die heilige Kirche unternimmt! Wenn ich Dich nicht kennen würde, könnte ich Dich der Blasphemie beschuldigen! Hast Du nicht eben behauptet, im Gotteshaus, in unserer Kirche, sei Gott nicht zu spüren, indem Du in vorgeblichem Scharfsinn die häretische These öffentlich verbreitest, Gott sei unmittelbar nur in der Natur zu spüren? Bleib knien, Verdammter, und gib Dich reumütig! Auf der Stelle fordere ich Dich auf, der Gotteslästerung abzuschwören und den Gehorsamseid erneut zu leisten, den ich Dir vor nicht allzu langer Zeit im Beichtstuhl abzuverlangen genötigt war! Und wage Dich noch ein einziges Mal, die Geistlichkeit der heiligen Kirche in ungebührender Weise überhaupt anzusprechen, geschweige denn, das ihr durch besonderen Akt und für alle verbindliche Lehramt anzuzweifeln!«
Der Pfarrer mustert ihn.
»Nicht auszudenken«, fährt er fort, »welch Skandal entstünde, würde unser Dorf besudelt durch ein kirchenrechtliches Verfahren, dessen Einleitung ich zwingendermaßen erwägen müsste, dessen Vortrag bei unserem Herrn Bischof alleine schon, nicht zu denken an das Urteil, Dir und Deiner Familie auf ewig Schmach und Schande bereitete!«
Johan Germel ist unfähig, zu denken und zu sprechen. Ein Naturereignis ist auf ihn eingebrochen.
Wollte er doch nur nichts weiter als seine Ruhe finden! Welches unvorhersehbare Schicksal stellte ihn an diesem frühen Morgen dem Pfarrer gegenüber, nur um die Einrichtung seines behaglichen Lebens ins Wanken zu bringen? Welcher Art ist das Schicksal, das ihn zu einer solch schwerwiegenden Anklage schiebt? Und vor allem: was ist es, dass der Pfarrer zu verbergen trachtet? Was treibt ihn um, zu dieser Morgenstunde, an diesem Ort?
Doch, Johan Germel weiß nur allzu gut, diesen Fragen darf er jetzt nicht nachgehen. Ein Schauspiel hat er darzubieten, muss den Pfarrer von seiner vollständigen Unterwerfung überzeugen. Keinen Verdacht sollte der Pfarrer hegen. Den Argwohn, er, Johan Germel, werde nun der Frage nachgehen, warum er, Johan Germel, misstrauisch wurde, als er den Pfarrer an Zeit und Ort so ungewöhnlich traf. Er, Johan Germel, würde das jetzt richten.