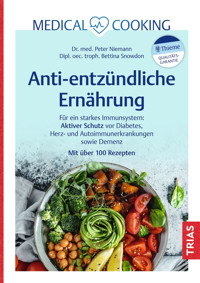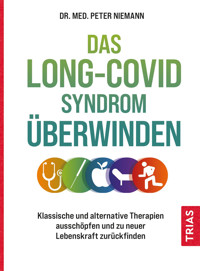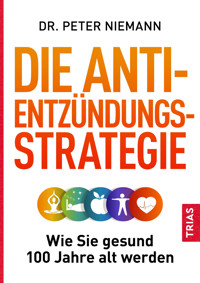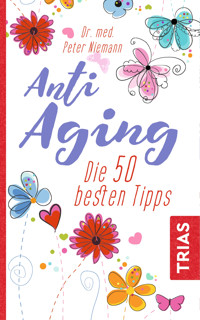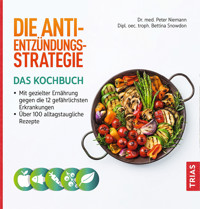
21,99 €
Mehr erfahren.
Antioxidativ – köstlich – und so gesund!
Für viele schwere Erkrankungen sind »stille Entzündungen« verantwortlich, die wie ein Schwelbrand ihre zerstörerische Kraft in unserem Körper entfalten. Die richtige Ernährung – vorbeugend wie therapeutisch – ist die wirksamste Maßnahme für ein langes, gesundes Leben. Der Arzt für Innere Medizin, Dr. Peter Niemann, zeigt, welche antioxidativen Lebensmittel und Ernährungsformen sich wissenschaftlich als besonders wirkungsvoll erwiesen haben.
Ein Kochbuch mit überraschenden Erkenntnissen:
• Gezielt gegen Erkrankungen: Entzündungen sind mitverantwortlich für Herz und Autoimmunerkrankungen, Rheuma und Arthrose, Diabetes und Lungenkrankheiten, vorzeitiges Altern, Demenz und Depressionen sowie andere Leiden.
• Die Anti-Entzündungs-Strategie: Lesen Sie hier, wie Sie gezielt dagegen vorgehen und welch erstaunliche Wirkungen die antioxidative Ernährung hat. Auch zur Prävention geeignet!
• Nahrung als Therapie: Viele gängige und heimische Beeren und Gemüsesorten, Gewürze, Kräuter, Öle, Nüsse und Fische entfalten starke entzündungshemmende Wirkungen. Diese und andere Entzündungslöscher hat die Ernährungswissenschaftlerin Bettina Snowdon in über 100 Rezepten köstlich verpackt.
Geben Sie stillen Entzündungen keine Chance!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Anti-Entzündungs-Strategie – Das Kochbuch
Mit gezielter Ernährung gegen die 12 gefährlichsten Erkrankungen Über 100 alltagstaugliche Rezepte
Dr. Peter Niemann, Bettina Snowdon
1. Auflage 2021
50 Abbildungen
Natürliche Entzündungshemmer: Essen Sie sich gesund!
Sind Sie unkonzentriert und unausgeglichen oder ständig müde und schlapp? Schlafen Sie schlecht? Sind Sie oft verstimmt oder fühlen Sie sich depressiv? Schmerzen Ihre Muskeln die ganze Zeit? Vielleicht leiden Sie auch an einer der klassischen Zivilisationskrankheiten? Dann geht es Ihnen wie Millionen anderer Menschen. Unzählige werden leider unnötig krank oder sterben sogar vorzeitig. Die Krankheiten sind vielfältig und oft kommt es auch zu einem vorzeitigen Altern oder zu Beschwerden, die man eigentlich gar nicht haben müsste.
Das meiste davon ließe sich in vielen Fällen verhindern. Doch leider bleibt dadurch ein enormes Gesundheitspotenzial ungenutzt, denn eine Ursache dafür bleibt bisher in der Öffentlichkeit undiskutiert: die »stille Entzündung«, manchmal auch unter dem englischen Begriff »silent inflammation« bekannt. Sie ist eine regelrechte Volkskrankheit, von der mehr als jeder Zweite betroffen ist und die tragischerweise wenig an der Wurzel gepackt wird.
Gut, dass Sie dieses Buch gekauft haben! Sie haben die Initiative ergriffen und halten ein wichtiges Puzzlestück für mehr Gesundheit und damit für ein längeres und glücklicheres Leben in Ihren Händen. Entzündungsprozesse, die in uns allen von Zeit zu Zeit ablaufen, werden in immer mehr Fällen chronisch und schaden uns dann. Die gute Nachricht: Stille Entzündungen können mit bestimmter Ernährung aktiv gebessert werden. Nur in seltenen Fällen braucht man dann die moderne Medizin und das dafür zur Verfügung stehende Hochleistungs-Gesundheitssystem. Das heißt: Sie können sich tatsächlich gesund essen!
In diesem Buch möchten wir Ihnen nicht nur die antientzündliche Ernährung mit leckeren Kochrezepten schmackhaft machen, sondern Ihnen auch Wege zeigen, wie Sie Ihr eigenes Wohlbefinden und Ihre Gesundheit verbessern können. Obwohl jeder Einzelne von uns ein wunderbares und einzigartiges Wesen ist, sind wir uns in vielen Dingen doch auch sehr ähnlich. Eines davon ist, dass Entzündung uns allen schadet.
Ein wichtiger Aspekt bei der Recherche für unser Buch war uns das fundierte wissenschaftliche Vorgehen, denn das fehlte uns zuweilen in anderen Ratgebern, Artikeln und Internetseiten zu diesem Thema. Dabei haben wir uns gefragt: Auf welcher Grundlage werden bestimmte Nahrungsmittel als sogenannte Superfoods angepriesen? Gibt es eine wissenschaftliche Basis für eine solche Empfehlung? In den allermeisten Fällen fanden wir sie viel zu dürftig. Deshalb haben wir dieses Buch nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelt, die wir Ihnen später vorstellen werden.
Die Kochrezepte basieren auf dieser Grundlage, denn die Auswahl der Zutaten richtet sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zudem war es uns wichtig, dass die Lebensmittel leicht erhältlich sind und Ihren Geldbeutel nicht zu sehr strapazieren. Außerdem sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Allerdings haben wir – mit Absicht – Fleischgerichte ausgeklammert und Milch sowie Milchprodukte weitestgehend außen vor gelassen. Doch keine Sorge, die Bandbreite der gesunden Lebensmittel ist dennoch riesig. Obwohl wir von jedem einzelnen Rezept überzeugt sind, sollten Sie diese Rezepte allem als Anregung und Vorschlag betrachten: Am Ende wissen Sie am besten, was Ihnen schmeckt und guttut.
Frohes Kochen, guten Appetit, eine gute Gesundheit und viel Spaß mit unserem Anti-Entzündungskochbuch!
Ihr Peter Niemann und Ihre Bettina Snowdon
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Natürliche Entzündungshemmer: Essen Sie sich gesund!
Wie uns stille Entzündungen krankmachen
Was ist eine Entzündung?
Die vier Phasen der Entzündung
Wie misst man Entzündungen?
Auf was wird getestet?
Die zwölf häufigsten Erkrankungen im Überblick
Vielfältige Beschwerdebilder
Diabetes mellitus
Autoimmunkrankheiten
Rheuma
Vorzeitiges Altern
Asthma und COPD
Herzinfarkt bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Depression
Krebs
Übergewicht und Fettleibigkeit
Allergien und Neurodermitis
Rücken- und Gelenkschmerzen
Altersbedingte Senilität und Demenz
Antioxidantien gegen Oxidantien
Was schadet dem Körper?
Schutz vor Oxidantien
Antioxidantien in Pflanzen
Wie misst man Antioxidantien?
Analysemethoden
Der Speiseplan gegen Entzündungen
Warum Bio-Lebensmittel wichtig sind
Das »dreckige Dutzend«
Die »sauberen 15«
Obst und Gemüse waschen
Fettsäuren
Fett ist nicht ungesund
Speiseöl
Nüsse, Fisch und etwas Alkohol
Gewürze, Honig, Kakao, Kaffee und Tee
Potenziell entzündungsfördernde Lebensmittel
Fleisch
Milch und Milchprodukte
Zucker
Eier
Besonders antientzündliche Lebensmittel
Rezepte
Start in den Tag
Suppen, Salate, Kleinigkeiten
Hauptgerichte
Süsses, Desserts, Gebäck
Service
Literatur
Sachverzeichnis
Impressum
Wie uns stille Entzündungen krankmachen
Die Entwicklung einer chronischen Entzündung ist kaum merkbar, doch ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden sind enorm. Zum Glück können Sie mit der richtigen Ernährung hier selbst gegensteuern.
Was ist eine Entzündung?
Eine Entzündung ist eine ganz normale, akute Reaktion des Körpers, um Wunden zu heilen oder Bakterien unschädlich zu machen. Die stillen Entzündungen sind aber chronisch und stellen durch ihre Dauer eine enorme Belastung für den Organismus dar.
Zunächst das Offensichtliche: Wir Menschen leben in einer uns feindlich gesinnten Welt. Unsere Umwelt hält zahlreiche Gefahren für uns bereit, denen wir uns aussetzen müssen, da wir ja nicht unter einer Glasglocke leben können und wollen.
In früheren Zeiten konnte jederzeit ein Tier auf uns zuspringen und uns für seine nächste Mahlzeit vorsehen. Auch Menschen griffen andere Menschen an, was bis heute anhält. Dazu kommt eine unsichtbare Armee von Bakterien und Viren, die um, auf und sogar in uns lebt und oftmals nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, um uns Schaden zuzufügen. Vergessen werden dürfen auch nicht die vielen Parasiten und Insekten und natürlich die sogenannten physikalischen Einflüsse: Kälte, die Frostschäden verursachen kann, Sonnenstrahlung und Hitze, die Verbrennungen bewirken können.
In unserer modernen Welt sind viele neue Gefahren hinzugekommen: beispielsweise Umweltverschmutzung, radioaktive Strahlung, Drogen, Übergewicht, diverse Chemikalien oder ungesunde Nahrungsmittel. Die Umwelt und unsere Nahrung sind also voller Gefahren. Gegen all diese Einflüsse müssen wir uns wehren und hierbei spielt Entzündung eine maßgebliche Rolle. Das Immunsystem, das eine Art Polizei in unserem Körper ist, koordiniert und leitet die Abwehr und damit auch diese Entzündungsprozesse.
Doch manchen Menschen ist nicht bewusst, dass man Entzündungsprozesse im Körper auch durch sogenannte stille Auslöser, die oft in der Nahrung vorkommen, verursachen kann. Das geschieht z. B., wenn zu viel Zucker, trans-Fette oder bestimmte Nahrungschemikalien aufgenommen werden und diese für den Körper schädlich sind. Wir entwickeln zwar keine klassischen Entzündungszeichen, haben aber trotzdem eine Entzündung in uns. Gerade unsere Ernährung spielt in der modernen Welt eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer chronischen Entzündung – dazu später mehr.
Die vier Phasen der Entzündung
Eine Entzündung läuft in vier Phasen ab und im Allgemeinen beginnt sie als Reaktion auf einen äußeren oder inneren schädlichen Reiz. Wer sich eine Schnittwunde zufügt, wird eine Entzündungsreaktion an der entsprechenden Hautstelle bekommen und die klassischen fünf Symptome im Laufe von wenigen Stunden entwickeln: Wärme, Hautrötung, Schwellung, Schmerz und Funktionseinschränkung.
Sobald eine weiße Blutzelle in unserem Körper auf diese Verletzung bzw. das uns schädigende Agens trifft (sei es ein Virus, ein Bakterium, eine Chemikalie oder anderes mehr), tastet sie es ab bzw. berührt es und erkennt sehr schnell anhand bestimmter Strukturmerkmale, dass es sich um eine Gefahr für den Körper handelt. Die weiße Zelle ruft nach Hilfe und beginnt mit der Abwehr.
Unser Körper besitzt Abermilliarden solcher weißen Blutzellen (bzw. Leukozyten, wie sie fachsprachlich genannt werden), weshalb sich eine anfänglich regionale Entzündungsreaktion auf den gesamten Körper ausdehnen kann. Das erklärt, warum eine ungesunde Ernährung nicht nur den Darm betrifft, sondern den gesamten Körper. So entsteht dann eine systemische und potenziell lang andauernde Entzündungsreaktion mit daraus resultierenden Schäden: Wir altern schneller, sind anfälliger für Krankheiten, fühlen uns unwohl oder sind einfach »irgendwie immer schlapp«.
Wenn die Beschwerden eher diffus oder kaum wahrnehmbar sind, spricht man von einer »stillen Entzündung«. Es handelt sich hierbei um eine Schädigung, die zwar langsam und auf niedrigem Niveau abläuft, aber doch auf Dauer großen Schaden anrichten kann. Der Begriff »stille Entzündung« ist deshalb kein besonders gelungener, da chronische Entzündung nicht still ist, sondern lediglich gering wahrnehmbare Beschwerden verursacht.
Doch um zu unserer weißen Blutzelle zurückzukehren: Sie löst Alarm aus. Das geschieht mittels von ihr produzierter Stoffe, der sogenannten Zytokine. Hierdurch werden andere Immunzellen aktiviert und eilen der Leukozyte zu Hilfe. Es werden weitere Zytokine freigesetzt und andere Gewebezellen in ihrer Funktion so verändert, dass sie den Kampf gegen diese Gefahr mit unterstützen. Das ist die erste Phase einer Entzündung.
So kommt es dann zur regelrechten Generalmobilmachung körperlicher (zweite Phase) einer Entzündungsreaktion. Hierbei soll die Gefahr bekämpft und neutralisiert werden, was aber nicht immer gelingt. In vielen Fällen weitet sich die Entzündung auf den gesamten Körper aus. Leider kommt es nicht nur zur Abwehr der gefährlichen Faktoren, sondern oft auch zur Schädigung körpereigenen Gewebes. Übrigens spürt man diese Phase der Entzündung oft in Form körperlicher Reaktionen wie Muskelschmerzen, Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Verstimmung und von vielem mehr.
Erst mit der Behebung der Ursache (dritte Phase) klingt eine Entzündung im Regelfall ab. Es folgt die Reparaturphase (vierte Phase), an deren Ende Wohlbefinden und körperliche Integrität des Körpers wiederhergestellt sind. Hierbei wird eine Vielzahl entzündungshemmender Zytokine, die man als »Friedens-« oder »Beruhigungssignale« betrachten kann, ausgeschüttet.
Doch wenn der die Entzündung auslösende Faktor nicht beseitigt wird, kann dieser Prozess sich über Wochen, Monate, Jahre und sogar das gesamte Leben lang hinziehen. Diese chronische Entzündung besteht auch dann, wenn man immer wieder entzündungsfördernden Faktoren ausgesetzt wird, wie das beispielsweise bei Umweltvergiftungen, aber gerade auch einer Fehlernährung der Fall ist. Dann kann es dazu kommen, dass wir uns wie in einer Dauerschleife schädigen und Opfer dieser stillen oder auch nicht stillen, sondern spürbaren Entzündung werden.
(Foto: Rogge und Jankovic, Köln)
Wie misst man Entzündungen?
Um Erkrankungen oder Unwohlsein gezielt anzugehen, können wir durch die Bestimmung von Blutwerten erfahren, ob und in welchem Maße Entzündungsprozesse in unserem Körper ablaufen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, dies genau aufzuzeigen. Viele davon werden nur im Rahmen von Forschungen oder, wie während der Corona-Pandemie, zur Feinjustierung der Therapie genutzt. Aber auch in den Arztpraxen werden einige eingesetzt und sind fast überall verfügbar. Wenn Sie es für sinnvoll erachten, können Sie eine Entzündung also bestimmen lassen.
Sie sollten die Vor- und Nachteile einer Entzündungsbestimmung aber im Vorfeld mit Ihrem Hausarzt erörtern, denn weder sind die Tests hundertprozentig genau, noch ist es immer sinnvoll, eine Entzündung messen zu lassen. Ein klärendes Gespräch ist hier angeraten. Doch als Grundlage einer Diskussion mit Ihrem Arzt und zum besseren Verständnis sollten Sie wissen, dass sich vor allem folgende vier Bluttests durchgesetzt haben. Sie sind sowohl kostengünstig als auch problemlos verfügbar, wobei sich in den letzten Jahren insbesondere das sogenannte C-reaktive Protein (CRP) als der am besten geeignete Test herauskristallisiert hat.
Auf was wird getestet?
Leukozyten Das Blut besteht aus einem flüssigen und einem zellulären Teil. Im Letzteren kommen viele weiße Blutkörperchen vor, die auch als Leukozyten bezeichnet werden. Es gibt diverse Untergruppen wie beispielsweise Monozyten, Lymphozyten, eosinophile, basophile oder neutrophile Leukozyten. Wichtig ist aber im Regelfall vor allem ihre Gesamtzahl, denn sie sind bei vielen Entzündungsreaktionen erhöht. Da dieser Wert aber auch bei anderen, nicht entzündlichen Krankheiten erhöht und bei einer nicht besonders ausgeprägten Entzündung auch auf normalem Niveau sein kann, ist die Aussagekraft dieses Blutwertes nur sehr begrenzt.
Fibrinogen Dieses vom Körper hergestellte Eiweiß spielt eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Es bildet, wenn es in Fibrin umgewandelt worden ist, mit anderen Fibrinmolekülen ein Gerinnsel, das ähnlich wie ein Pflaster bei einer blutenden Stelle zum Wundverschluss führt. Fibrinogen spielt bei Entzündungen deshalb eine wichtige Rolle, weil es verletztes Gewebe verschließen hilft, aber auch gefährliche Partikel, Viren und Bakterien in den gebildeten Gerinnseln wie in einer Falle fangen kann. Es ist bei Entzündungen oftmals erhöht. Der Test gilt aber auch nicht als optimal, weil Fibrinogen erhöht sein kann, wenn keine Entzündungen vorliegen, aber auch normal hoch sein kann trotz Anwesenheit von Entzündungsprozessen.
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) Die BSG ist eine Messmethode. Anders als bei den drei anderen hier vorgestellten Methoden wird kein Körperprotein oder eine Blutzelle bestimmt. Im Rahmen dieses Messverfahrens wird eine Blutprobe entnommen, das Blutröhrchen senkrecht aufgestellt und gemessen, um wie viele Millimeter die Zellbestandteile in einer Stunde absinken. Der ermittelte Wert kann eine Aussage über Entzündungsprozesse machen – je schneller die Blutbestandteile absinken, desto stärker ist die Entzündungsreaktion im Körper. Das Verfahren gilt zunehmend als veraltet, ungenau und wurde mittlerweile großteils durch die Bestimmung des CRP bzw. hs-CRP ersetzt.
C-reaktives Protein (CRP) CRP steigt im Regelfall innerhalb von 24 Stunden nach dem Beginn einer Entzündungsreaktion an. Dieses vor allem von der Leber produzierte Eiweiß hilft bei der Aktivierung des Immunsystems und der Neutralisierung eines die Entzündung auslösenden Stoffes. Erst wenn eine Entzündung abklingt, normalisiert sich das CRP, weshalb es bei vielen Menschen über Jahre hinweg erhöht sein kann, zumindest so lange, wie sich Entzündungsreaktionen abspielen. Ärzte bestimmen es sehr häufig, denn es hilft beispielsweise bei der Behandlung von Autoimmunkrankheiten und anderen chronischen Entzündungsreaktionen. Es kann mittels einer einfachen Blutentnahme in fast jedem Labor der Welt schnell und kostengünstig ermittelt werden. Langfristig erhöhte CRP-Werte bedeuten einen Anstieg des Krebs-, Herzinfarkt-, Schlaganfall- und allgemeinen Sterblichkeitsrisikos. Zunehmend wird statt des CRP das hs-CRP bestimmt (»hs-CRP« steht für »hochsensitives C-reaktives Protein). Es ist in seiner Aussagekraft noch genauer.
Die zwölf häufigsten Erkrankungen im Überblick
Eine stille Entzündung ist ein Syndrom und noch keine Erkrankung. Sie kann aber im weiteren Verlauf zu einer Krankheit führen. Erfahren sie jetzt, welche Auswirkungen eine Entzündung haben kann.
Leider ist es noch zu wenig bekannt, dass die meisten Krankheiten eng mit Entzündungsreaktionen verknüpft sind. Ging man früher davon aus, dass nur eine übersichtliche Zahl von Krankheiten Folge von Entzündungen sind, hat sich heute das Bild dramatisch gewandelt.
Vielfältige Beschwerdebilder
Herzinfarkte, Krebskrankheiten, Allergien, Autoimmunkrankheiten, aber auch Depression, Stoffwechselstörungen wie die Diabetes mellitus, viele Gelenkbeschwerden und selbst das vorzeitige Altern, all das hat mit Entzündungsreaktionen zu tun. Wer diese in seinem Körper also bekämpft, wird nicht nur gesünder, sondern auch länger und sogar glücklicher leben. Die zwölf häufigsten Krankheiten, die eng mit Entzündungsreaktionen verwoben sind, sollen hier vorgestellt werden.
Diabetes mellitus
Häufigkeit Mehr als 400 Millionen Menschen sind weltweit von Diabetes betroffen. Allein im deutschsprachigen Raum gibt es acht Millionen Diabetiker. Besonders tragisch ist, dass die Zahl jährlich zunimmt und immer häufiger gerade auch jüngere Erwachsene, Jugendliche und sogar Kinder betroffen sind. Diabetes mellitus ist eine wahre Volkskrankheit.
Was ist es? Es handelt sich hierbei um eine Stoffwechselstörung des Körpers, bei welcher der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht ist. Das kann aufgrund einer Autoimmunkrankheit eintreten, bei der bestimmte Zellen der Bauchspeicheldrüse angegriffen und zerstört werden, weshalb dann viel zu wenig oder gar kein Insulin mehr produziert wird. Hier spricht man vom Diabetes mellitus Typ 1. Am häufigsten kommt der Typ 2 vor, bei welchem zwar das Hormon Insulin hergestellt wird, es aber zu einer sogenannten Insulinresistenz kommt. Obwohl Insulin hergestellt wird, kann es nicht ausreichend wirken, was dann ebenfalls zu langfristig erhöhten Blutzuckerspiegeln führt. Man unterscheidet noch einen Diabetes mellitus Typ 3, der eine große und heterogene Gruppe darstellt, bei der es vielfältige genetische, hormonelle und anatomische Gründe für die Stoffwechselstörung gibt, und einen Typ 4, der schwangerschaftsbedingt auftritt.
Symptome Die Beschwerden sind vielfältig, aber gerade am Anfang merken viele nicht, dass sie unter Diabetes mellitus leiden. Im fortgeschrittenen Stadium haben Diabetiker oftmals großen Durst, verlieren Gewicht und haben starken und häufigen Harndrang. Weiterhin kann es zu neurologischen Beschwerden wie Kribbeln und Taubheitsgefühlen (vor allem in den Füßen) kommen wie auch verschwommenem oder eingeschränktem Sehen.
Diagnostik Die Diagnostik erfolgt am häufigsten über Bluttests. Hier hat sich neben dem Blutzuckerwert vor allem der HbA1c durchgesetzt, bei dem bestimmt wird, in welchem Maße ein bestimmtes Blutprotein (Hämoglobin) mit Zuckermolekülen besetzt ist – je höher der Wert, umso schwerer der Diabetes.
Langfristige Komplikationen Diese sind abhängig vom Typ des Diabetes mellitus. Beim Typ 1 kann es häufiger zur Ansammlung von bestimmten Säuren und einem sehr stark erhöhten Blutzucker kommen – man spricht von einer Ketoazidose –, was lebensgefährlich sein kann, wenn es nicht therapiert wird. Die anderen Typen, vor allem Diabetes mellitus Typ 2, führen über Jahre und Jahrzehnte zu chronischen Schäden im gesamten Körper. Vorzeitige Alterung, Sehstörungen bis hin zu Erblindung, Nierenstörungen mit der Notwendigkeit einer maschinellen Nierenwäsche mehrmals die Woche (Hämodialyse) können auftreten, genauso wie chronische Missempfindungen in den Beinen und Armen oder erhöhte Raten von Infektionen, Herzinfarkten, Schlaganfällen und sogar der vorzeitige Tod.
Rolle der Entzündung Es gibt eine enge Verzahnung zwischen Entzündungsprozessen und Diabetes. Wissenschaftler haben aufzeigen können, dass jene Menschen, bei denen erhöhte Entzündungswerte wie CRP oder Interleukin-6 gemessen wurden, viel wahrscheinlicher Diabetes entwickeln. Sie litten also unter einer stillen Entzündung und erkrankten bis zu dreimal häufiger an dieser Stoffwechselkrankheit. Umgekehrt lässt sich auch klar aufzeigen, dass eine Absenkung der Entzündungsreaktionen den Diabetes mellitus deutlich verbessert und z. B. weniger Medikamente und geringere Insulindosen benötigt werden. Es gibt sogar viele Berichte darüber, wie sich Erkrankte durch eine antientzündliche Lebensweise und vor allem Ernährung von ihrer Krankheit befreit haben. Sie haben sich, mit anderen Worten, gesund gegessen und selbst geheilt.
Antientzündliche Ernährung Diabetes mellitus, insbesondere der Typ 2, ist stark ernährungsabhängig. Wichtig ist eine moderate Zufuhr komplexer Kohlenhydrate (wie z. B. Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen), ein hoher Gehalt an Ballaststoffen, viel Gemüse und Obst sowie ausreichend Wasser, da Letzteres die Insulinresistenz etwas mildern kann. Als Diabetiker-Produkte ausgewiesene Lebensmittel sind häufig nicht nötig, in manchen Fällen können sie sogar kontraproduktiv sein. Wichtige antioxidative Lebensmittel sind hier Kurkuma ▶ [1], Zimt, Knoblauch ▶ [2], Kaffee (ungesüßt), grüner und schwarzer Tee (beide Sorten ungesüßt), Olivenöl, vielfältige Gemüse- und Obstsorten, bestimmte Fischarten wie Sardinen, Lachs, Hering oder Makrele ▶ [3].
Autoimmunkrankheiten
Häufigkeit Etwa ein Zehntel der deutschsprachigen Bevölkerung leidet unter einer Autoimmunerkrankung, was etwa zehn Millionen Betroffene bedeutet. Ihre Zahl nimmt jedes Jahr zu. Viele Mediziner vermuten, dass die Umwelt und gerade auch eine Fehlernährung eine wichtige Rolle bei der Entstehung spielen ▶ [4].
Was ist es? Es gibt mehr als 50 verschiedene Autoimmunkrankheiten, die unterschiedliche Organe und Teile des Körpers betreffen. Der Körper greift dabei einen Teil seiner selbst an, das Immunsystem ist dauerhaft aktiviert. So gibt es beispielsweise die Multiple Sklerose, eine Erkrankung des Nervensystems, bei der die Betroffenen im fortgeschrittenen Stadium nicht mehr laufen und sich selber versorgen können. Andere wiederum entwickeln Erkrankungen des Darmtrakts wie beispielsweise Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, bei welcher die Erkrankten wiederkehrende Bauchkrämpfe mit hohen Durchfallraten haben. Prinzipiell kann jedes Organ oder jede Körperstelle betroffen sein, wie beispielsweise die Haut bei der Schuppenflechte (Psoriasis), die Wirbelsäule beim Morbus Bechterew, die Schilddrüse bei der Hashimoto-Thyreoiditis oder der gesamte Körper wie beim Lupus erythematodes.
Symptome Diese hängen davon ab, welches Organ konkret betroffen ist. Trockene, schuppende und juckende Haut kann die Schuppenflechte ankündigen, während bei der Hashimoto-Thyreoiditis Müdigkeit, Gewichtszunahme und Haar- und Hautveränderungen im Vordergrund stehen. Im Regelfall verspüren die meisten eine allgemeine Schwäche, Abgeschlagenheit, Unwohlsein und ein leichtes Fiebergefühl – Zeichen einer systemischen Entzündung im Körper.
Diagnostik Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden komplexe Diagnoseschemata entwickelt. Eine Kombination aus bestimmten Symptomen und Blutwerten steht dabei im Vordergrund. Das CRP und die Erythrozytensedimentationsrate (ESR) werden regelmäßig bestimmt, wie auch krankheitsspezifische Antikörperwerte.
Langfristige Komplikationen Eine allgemeine Aussage ist nur schwer möglich angesichts der Vielzahl von Erkrankungen. Eine vorzeitige Alterung tritt ein, die Zahl der kardiovaskulären Krankheiten ist erhöht wie auch das allgemeine Krebsrisiko, aber auch die Neigung zu Depression und sogar die Selbstmordrate.
Rolle der Entzündung Bei allen Autoimmunkrankheiten spielen chronische Entzündungsreaktionen eine maßgebliche Rolle, denn der Körper greift einen Teil von sich selbst an. Das heißt, ein körpereigener Stoff wird vom Immunsystem fälschlicherweise als Gefahr angesehen. Dies aktiviert das Immunsystem, welches wiederum Entzündungsprozesse auf Hochtouren laufen lässt. Jegliche Maßnahme, die antientzündlich wirkt, bessert sowohl den Schweregrad als auch die Beschwerden. Deshalb werden in regelmäßigen Abständen Entzündungswerte wie das CRP gemessen wie auch entzündungshemmende Medikamente eingesetzt. Mit antioxidativen Maßnahmen und einer antientzündlichen Ernährung hat schon so mancher Betroffene seine Erkrankung deutlich gebessert oder gar ausgeheilt. Umgekehrt gilt auch: Wer stille Entzündungen in sich trägt, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Autoimmunkrankheit entwickeln.
Antientzündliche Ernährung Trotz der Breite der Erkrankungen scheint es übergreifende Ernährungsweisen zu geben, die helfen können. So lässt sich bei vielen Betroffenen im Darm ein Überwiegen »schlechter« gegenüber »guten« Bakterien nachweisen. Diese wiederum kurbeln die Herstellung hoher Mengen kurzkettiger Fettsäuren an, was wiederum die Entzündung im Körper anregt. Deshalb können fermentierte Produkte wie z. B. Joghurt, viele Käsesorten, Quark oder Sauerkraut helfen, den Anteil »guter« Bakterien zu erhöhen ▶ [5]. Bio-Produkte sind ebenfalls sehr wichtig, weil Pflanzenschutzmittel bzw. Pestizide oft hochtoxisch auf den Körper wirken und Autoimmunkrankheiten verschlimmern oder sogar verursachen können. Aber neben Gemüse und Obst im Allgemeinen sind Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind (wie verschiedene Nuss- und Fischarten), empfehlenswert, wie auch eine eher pflanzen- denn fleischbasierte Ernährung ▶ [6]. Einzelne zu empfehlende Lebensmittel sind Walnüsse, Mandeln, Lachs, Sardinen, Avocados, Leinsamen, Rosen- und Grünkohl.
Rheuma
Häufigkeit Etwa 1 % der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum ist vom Rheuma betroffen. Diese Krankheit befällt Frauen etwa drei Mal häufiger als Männer, was daran liegt, dass Frauen ein aktiveres Immunsystem haben. Da diese Krankheit häufig zwischen 35 und 45 Jahren auftritt, leben die Betroffenen oft viele Jahrzehnte mit ihr.
Was ist es? Rheumatoide Arthritis, wie diese Krankheit medizinisch genannt wird, ist eine der häufigsten Autoimmunkrankheiten und betrifft vor allem die Gelenke der Arme und Beine. Diese sind dann schmerzhaft und geschwollen, morgens oft sehr steif. Es kommt immer wieder zu Schüben, die mehrere Wochen dauern können und im Laufe der Jahre zunehmend zu Einschränkungen im Alltag führen.
Symptome Rheumakranke klagen verstärkt über steife, geschwollene und schmerzhafte Gelenke am Morgen. Am häufigsten sind die Finger- und Zehengelenke betroffen, hier vor allem die Fingergrund- und -mittelgelenke. Aber auch Handwurzelknochen, Knie-, Schulter-, Fuß- und Hüftgelenke sind oft befallen. Daneben kann es zu Atem-, Seh- oder Herz-Kreislauf-Beschwerden kommen.
Diagnostik Es besteht der dringende Verdacht auf diese Erkrankung, wenn mindestens drei von vier der folgenden Kriterien erfüllt sind: Erstens, die betroffenen Gelenke sind morgens länger als eine Stunde wie eingerostet, d. h. steif. Zweitens, der Nachweis eines Rheumafaktors (das ist ein Antikörper gegen einen anderen Antikörper) oder Antikörper gegen citrullinierte Proteine (ACPA) im Blut. Drittens, wenn zwei oder mehr Gelenke schmerzhaft und geschwollen sind, und viertens, wenn im Blut erhöhte Entzündungswerte nachweisbar sind wie das CRP oder die BSG.
Langfristige Komplikationen Im Laufe des Lebens kann es zu massiven Einschränkungen im Alltag kommen. Unter Kunsthistorikern ist beispielsweise der französische Maler und Impressionist Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) als Rheumakranker deshalb bekannt, weil seine Malerei immer schemenhafter wurde. Die letzten 20 Jahre seines Lebens konnte er die Pinsel nicht mehr richtig halten, band sie sich sogar oft an seine Unterarme, nur um noch malen zu können. Weiterhin kann es zum entzündungsbedingten Umbau des Lungengewebes hin zu vernarbten Lungen kommen mit entsprechender Sauerstofftherapie. Zusätzlich treten Herzinfarkte und Schlaganfälle mehr als doppelt so häufig auf, und manchen ereilt der plötzliche Herztod. Darüber hinaus kommt es in manchen Fällen zu Augenentzündungen mit Einschränkung der Sehkraft.
Rolle der Entzündung Wissenschaftler haben zwar eine genetische Komponente mit mittlerweile mehr als 100 beschriebenen Genen festmachen können, doch Entzündungsreaktionen spielen eindeutig die Hauptrolle. So wird das Bakterium Porphyromonas gingivalis bei vielen Rheumakranken kausal erwähnt, was deshalb von Bedeutung ist, weil es vor allem bei Menschen mit chronischer Entzündung des Zahnfleischs vorkommt. Aber auch andere Infektionen wie durch das Epstein-Barr-Virus, die Bakterien Escherichia coli oder Proteus mirabilis können eine Rheumaerkrankung auslösen ▶ [7]. Weiterhin verursachen und verschlimmern auch andere Faktoren das Rheuma, wenn sie eine Entzündungsreaktion im Körper auslösen, wie z. B. Rauchen, Übergewicht, Drogen und diverse Umweltverschmutzungen. Das erklärt, weshalb Makrophagen, T- und B-Zellen im Gelenkknorpel und -flüssigkeit bei Betroffenen in größeren Mengen nachgewiesen werden – sie sind Teil eines körperweiten Entzündungsprozesses. Weiterhin werden in den Gelenken diverse Zytokine wie Interferon-Alpha, Interleukin-6, Interleukin-18 oder Interleukin-23 freigesetzt. All das verschlimmert die Entzündungsreaktion und dadurch entstehen nicht nur Schäden am Gelenkknorpel und -knochen, sondern im gesamten Körper.
Antientzündliche Ernährung