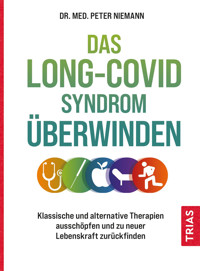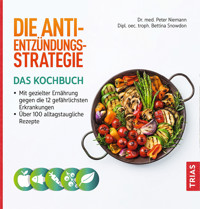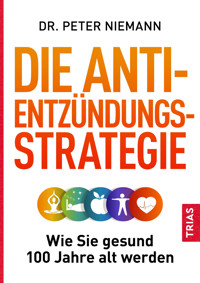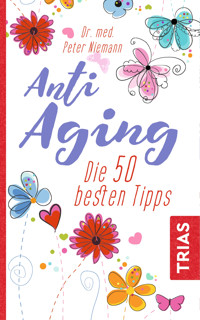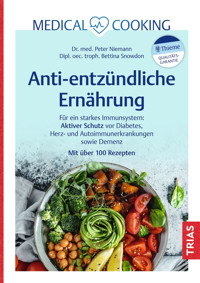
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TRIAS
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Medical Cooking
- Sprache: Deutsch
Gesunde Rezepte gegen die Entzündung
Für viele schwere Erkrankungen wie Herz- und Autoimmunerkrankungen, Rheuma und Arthrose, Diabetes und Lungenkrankheiten, Demenz und Depressionen, aber auch vorzeitiges Altern sind »stille Entzündungen« verantwortlich, die wie ein Schwelbrand ihre zerstörerische Kraft in unserem Körper entfalten. Die richtige Ernährung – vorbeugend wie therapeutisch – ist die wirksamste Maßnahme für ein gesundes, langes Leben. Der Arzt für Innere Medizin, Dr. Peter Niemann, und die Ernährungswissenschaftlerin Bettina Snowdon zeigen, welche antioxidativen Lebensmittel und Ernährungsformen sich wissenschaftlich als besonders wirkungsvoll erwiesen haben.
Beim täglichen Essen erstaunliche Heilwirkungen erzielen:
- Entzündungen stoppen: Die Anti-Entzündungs-Strategie zeigt Ihnen, wie Sie gezielt entgegenwirken und welche erstaunlichen Wirkungen die antioxidative Ernährung hat.
- Die Zutaten: Welche Lebensmittel löschen Entzündungen am besten? Was macht heimische Beeren und Gemüsesorten, Gewürze wie Kurkuma und Ingwer, Kräuter, Öle, Nüsse und Fisch so gesund? Mit viel praktischem Küchenwissen über Sorten, Lagerung und Verarbeitung.
- Die Rezepte: Wie köstlich gesundes Essen sein kann, zeigt der opulente Rezeptteil. Die Gerichte sind einfach und schnell zubereitet und absolut alltagstauglich – und die Zutaten sind überall erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anti-entzündliche Ernährung
Für ein starkes Immunsystem: Aktiver Schutz vor Diabetes, Herz- und Autoimmunerkrankungen sowie Demenz. Mit über 100 Rezepten
Dr. Peter Niemann, Dipl. oec. troph. Bettina Snowdon
1. Auflage 2024
42 Abbildungen
Liebe Leserin, lieber Leser,wenn es um die eigene Gesundheit geht, darf man nichts dem Zufall überlassen. »Für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben«: So lautet das Qualitätsversprechen der Marke Thieme. Ärztlich Tätige, Pflegekräfte, Physiotherapeuten oder Hebammen – sie alle verlassen sich darauf, dass sie von Thieme, dem führenden Anbieter von medizinischen Fachinformationen und Services, die entscheidenden Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bekommen. So können sie die Menschen, die sich ihnen anvertrauen, bestmöglich unterstützen. Auch Sie können sich auf die TRIAS Ratgeber mit dem Thieme Qualitätssiegel verlassen! Diese Informationsangebote helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es um Ihre Gesundheit geht, selbst daran mitzuwirken, gesund zu werden, sich gesund zu erhalten oder das Fortschreiten einer Erkrankung zu vermeiden. Mit einem TRIAS Titel aus dem Hause Thieme überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall!Ihr TRIAS Team
Essen Sie sich gesund!
Wir gratulieren zum Kauf dieses Buches! Sie haben die Initiative ergriffen und halten ein wichtiges Puzzlestück für mehr Gesundheit und damit für ein längeres und glücklicheres Leben in Händen. Denn Sie müssen wissen: Es gibt eine wirklich massive Pandemie um uns herum, die in fast allen von uns stattfindet – es handelt sich hierbei um die Pandemie der (stillen) Entzündung.
Entzündungsprozesse sind normalerweise natürliche Abwehr- und Reparaturmechanismen unseres Körpers, die in uns allen von Zeit zu Zeit ablaufen, wenn wir uns zum Beispiel verletzt haben oder krank sind. Aber in der heutigen Zeit laufen diese Prozesse bei vielen von uns dauerhaft ab und chronifizieren. Das hinterlässt dann Spuren sowohl an unserem Körper als auch der Psyche und schadet uns, wobei sich das bei jedem unterschiedlich manifestiert.
Sind Sie manchmal unkonzentriert oder fühlen sich unausgeglichen? Sind Sie ständig müde und schlapp? Schlafen Sie schlecht? Haben Sie Falten und graue Haare, weit mehr, als Sie eigentlich für Ihr Alter haben müssten? Sind Sie oft verstimmt oder fühlen Sie sich depressiv? Schmerzen Ihre Muskeln aus unerfindlichen Gründen? Oder leiden Sie, wie Millionen von Deutschen, Schweizern, Österreichern und anderen Europäern, an einer der klassischen Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, schlechten Fettwerten oder Diabetes? Wussten Sie, dass all die hier aufgezählten Beschwerden und Krankheiten mit Entzündungsprozessen zusammenhängen?
Die gute Nachricht: Diese Entzündungsprozesse können mit einer in diesem Buch im Detail vorgestellten Ernährungsweise aktiv gebessert und sogar vollständig aufgelöst werden. Man braucht dafür weder die moderne Medizin noch das vor allem auf Notfälle und akute Krankheiten ausgelegte Hochleistungs-Gesundheitssystem. Das heißt: Sie können sich tatsächlich gesund essen!
Auch viele der in diesem Buch vorgestellten Krankheiten ließen sich durch eine solche Anti-Entzündung-Ernährung entweder verhindern oder deutlich bessern. Doch leider bleibt bei den meisten von uns dieses enorme Gesundheitspotenzial ungenutzt, und die Öffentlichkeit spricht nicht über eines der größten Probleme der Gegenwart, eben jenes Zuviel an Entzündungsprozessen. Es handelt sich hierbei um eine regelrechte Volkskrankheit und mehr als jeder Zweite ist betroffen.
Mit diesem Buch möchten wir Ihnen helfen und Ihnen konkrete Ratschläge in Form von Rezepten an die Hand geben. Aber wir möchten Ihnen in diesem Buch nicht nur die antientzündliche Ernährung mit Rezepten für leckere Gerichte schmackhaft machen, sondern Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihr eigenes Wohlbefinden und Ihre Gesundheit verbessern können – dafür haben wir Wert auf einen größeren Ausflug in die Wissenschaft zum Thema Entzündung gelegt, ehe wir dann im zweiten Teil konkrete Rezepte präsentieren.
Wichtig bei der Recherche für unser Buch war uns ein fundiertes wissenschaftliches Vorgehen, denn das fehlte uns zuweilen in anderen Ratgebern, Artikeln und Internetseiten zu diesem Thema. Dabei haben wir uns gefragt: Auf welcher Grundlage werden bestimmte Nahrungsmittel als sogenannte Superfoods angepriesen? Gibt es eine wissenschaftliche Basis für eine solche Empfehlung? In den allermeisten Fällen fanden wir sie viel zu dürftig. Deshalb haben wir dieses Buch nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelt, die wir Ihnen später vorstellen werden.
All die hier vorgestellten Kochrezepte basieren darauf, denn die Zutaten sind nach vielfältigen wissenschaftlichen Erkenntnissen regelrecht gesundmachend durch ihre entzündungsabbauenden und -verhindernden Wirkweisen. Zudem war es uns wichtig, dass die Lebensmittel leicht erhältlich, also nicht allzu exotisch sind und Ihren Geldbeutel nicht zu sehr strapazieren. Außerdem sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, wobei wir mit Absicht Fleisch und viele Milchprodukte ausgeklammert haben. Wieso uns das notwendig erschien, schildern wir im Buch ausführlich. Sie werden merken, die Vielfalt der gesunden Lebensmittel ist sehr groß. Setzen Sie diese Rezepte für sich um und spüren Sie die positive Veränderung.
Wir wünschen wir Ihnen frohes Kochen, guten Appetit, eine gute Gesundheit und viel Spaß mit unserem Anti-Entzündungs-Kochbuch!
Ihr Dr. med. Peter Niemann und Ihre Bettina Snowdon
Hinweise zu den Rezepten
Damit Sie ohne großen Aufwand eine optimal antientzündliche Ernährunggenießen können, haben wir darauf geachtet, dass die Rezepte einfach umzusetzen sind, nicht viele unterschiedliche Zutaten enthalten und Sie diese in den meisten Supermärkten bekommen. Wenn Sie doch einmal Zutaten in den Rezepten entdecken, die nicht so leicht zu finden sind, dann deshalb, weil uns sehr daran gelegen ist, Ihnen eine möglichst große Vielfalt vorzustellen. Manche Zutaten sind in der unverarbeiteten Form zwar am gesündesten, aber weil sie ebenfalls kaum frisch zu bekommen sind (es sei denn, Sie sammeln sie selbst), haben wir in solchen Fällen verarbeitete und leicht erhältliche Varianten in den Rezepten verwendet.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Essen Sie sich gesund!
Wie uns stille Entzündungen krank machen
Entzündung: Was ist das?
Stille Entzündungen machen uns krank
Stille Faktoren
Die vier Phasen der Entzündung
Phase 1: Erkennen der Gefahr
Phase 2: Die Mobilmachung
Phasen 3 und 4: Abklingen der Entzündung und Heilung
Wie misst man Entzündungen?
Auf was wird getestet?
Die zwölf häufigsten Erkrankungen
Vielfältige Beschwerdebilder
Diabetes mellitus
Autoimmunkrankheiten
Rheuma
Vorzeitiges Altern
Asthma und COPD
Herzinfarkt bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Depression
Krebs
Übergewicht und Fettleibigkeit
Allergien und Neurodermitis
Rücken- und Gelenkschmerzen
Altersbedingte Senilität und Demenz
Antioxidantien gegen Oxidantien
Oxidantien und ihre Gegenspieler, die Antioxidantien
Schutz vor Oxidantien
Antioxidantien in Pflanzen
Antioxidantien bestimmen
Analysemethoden
Der Speiseplan gegen Entzündungen
Bio-Lebensmittel sind wichtig
Bio-Lebensmittel sind gut für die Umwelt
Bio-Lebensmittel fördern die Gesundheit
Unklare Langzeitfolgen
Bio lohnt sich
Das »Dreckige Dutzend«
Die »Sauberen 15«
Obst und Gemüse waschen
Fettsäuren
Fette sind nicht per se ungesund
Speiseöl
Nüsse, Fisch und etwas Alkohol
Gewürze, Honig, Kakao, Kaffee und Tee
Potenziell entzündungsfördernde Lebensmittel
Fleisch
Milch und Milchprodukte
Zucker
Eier
Besonders antientzündliche Lebensmittel
Rezepte
Start in den Tag
Kleinigkeiten, Suppen, Salate
Zwischendurch
Hauptgerichte
Süsses, Desserts, Gebäck
Sachverzeichnis
Impressum
© A. Rogge & J. Jankovic/Thieme |
Wie uns stille Entzündungen krank machen
Eine stille und dann meist chronische Entzündung entwickelt sich kaum merklich, doch die Auswirkungen auf die Gesundheit sind enorm. Steuern Sie mit der richtigen Ernährung gegen.
Entzündung: Was ist das?
Eine Entzündung ist normaler Mechanismus, um Wunden zu heilen oder eingedrungene Erreger unschädlich zu machen. Eine stille Entzündung ist aber ein chronischer Prozess, der den Körper schädigt.
Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, erkennt, wie gefährlich sie für unsere Gesundheit ist. Unsere Umwelt hält zahlreiche Gefahren für uns bereit, denen wir uns aussetzen müssen, da wir ja schließlich nicht unter einer Glasglocke leben können und wollen.
Stille Entzündungen machen uns krank
In früheren Zeiten konnte jederzeit ein Tier auf uns zu springen und uns für seine nächste Mahlzeit halten. Auch unter Menschen war (und ist) gegenseitige Gewaltanwendung ein übliches Mittel der Konfliktbewältigung. Dazu gesellen sich unzählige Bakterien und Viren, die um, auf und sogar in uns leben und oft nur auf den richtigen Zeitpunkt warten, um uns anzugreifen und uns Schaden zuzufügen. Natürlich gibt es auch noch viele Parasiten und Insekten sowie die sogenannten physikalischen Einflüsse: Kälte, die Frostschäden verursachen kann, Sonnenstrahlung und Hitze, die Verbrennungen bewirken können.
Als wäre all das nicht genug, hält unsere moderne Welt viele neue Gefahren für uns bereit wie zum Beispiel Umweltgifte und -verschmutzung, radioaktive Strahlung, eine Vielzahl von Drogen, Chemikalien, aber auch ungesunde Nahrungsbestandteile und selbst psychische Faktoren wie Stress, wobei später genauer darauf eingegangen wird, wie diese Faktoren uns krank machen. Die Umwelt, aber auch unsere Nahrung sind also voller Gefahren. Gegen all diese Einflüsse müssen wir uns wehren und hierbei spielen Entzündungen eine maßgebliche Rolle. Das Immunsystem, das eine Art Polizei in unserem Körper ist, koordiniert und leitet die Abwehr und damit auch diese Entzündungsprozesse. Auf eine sehr fein abgestimmte Art und Weise kann das Immunsystem auf all diese Faktoren reagieren und die Schäden nicht nur identifizieren, sondern auch wieder beheben.
Stille Faktoren
Doch wir müssen uns bewusst machen, dass es nicht nur die oben als klar schädlich erkennbare Faktoren sind, die Entzündungsprozesse im Körper auslösen können, sondern dass es auch sogenannte stille Faktoren gibt, die uns – oft zunächst unerkannt – schädigen. Viele dieser Faktoren sind in unserer Nahrung, wenn wir beispielsweise zu viel Zucker zu uns nehmen, Trans-Fette als Zutat beigemengt sind oder bestimmte Chemikalien in unserem Essen enthalten sind. Auch die Rückstände von Pestiziden auf unserem Obst und Gemüse, die von der Verpackung auf den Inhalt übertragenen Chemikalien oder selbst die in Käseprodukten zum Teil noch nachweisbaren Antibiotika und Wachstumshormone der Milchkühe können eine Rolle bei der Entstehung einer stillen Entzündung spielen. Diese ist deshalb besonders bedrohlich, weil wir in solchen Fällen keine klassischen Entzündungszeichen entwickeln, aber trotzdem eine Entzündung in uns tragen, die man wahlweise messen oder doch bei genauer Befragung feststellen kann.
Mithilfe einer entsprechenden Ernährung kann es gelingen, die Gefahren der Entstehung einer stillen Entzündung zu vermindern und gegen solche Entzündungsprozesse vorzugehen.
Die vier Phasen der Entzündung
Die Entzündung ist die Reaktion des Immunsystems auf schädliche Reize, die von innen oder von außen kommend auf den Körper einwirken. Beispiele sind Krankheitserreger, geschädigte Zellen, Giftstoffe sowie ultraviolette oder radioaktive Strahlung.
Entzündungsvorgänge haben die Funktion, diese schädlichen Reize zu identifizieren, sie zu beheben und somit den Heilungsprozess einzuleiten. Mit anderen Worten, Entzündungen sind ein wichtiger Abwehrmechanismus des Körpers.
Sicher haben Sie es auch schon an sich selbst beobachten können, wie eine Entzündungsreaktion abläuft. Wenn man sich beispielsweise verletzt, beginnt an der betroffenen Hautstelle schon innerhalb kürzester Zeit die Entzündungsreaktion. Man beobachtet im Regelfall die klassischen fünf Symptome einer Entzündung: Wärme, Hautrötung, Schwellung, Schmerz und Funktionseinschränkung, was im medizinischen Jargon mit den lateinischen Begriffen calor, rubor, tumor, dolor und functio laesa benannt wird.
Phase 1: Erkennen der Gefahr
Eine Vielzahl von Zellen, aber auch bestimmte Eiweiße (fachsprachlich Protein genannt), sind in der Lage, eine solche Verletzung, das Eindringen eines Krankheitserregers oder eines Giftstoffs festzustellen.
Leukozyten Am häufigsten sind weiße Blutzellen, fachsprachlich Leukozyten, an diesem Vorgang beteiligt. Wenn sie in unserem Körper auf eine Verletzung oder ein uns schädigendes Agens wie ein Virus, ein Bakterium, eine Chemikalie oder etwas anderes treffen, erkennen sie sehr schnell anhand bestimmter Strukturmerkmale, dass es sich um eine Gefahr für den Körper handelt. Die weiße Zelle »ruft« nach Hilfe und beginnt mit der Abwehr.
Unser Körper besitzt Abermilliarden solcher weißen Blutzellen, weshalb sich eine anfänglich regionale Entzündungsreaktion auf den gesamten Körper ausdehnen kann. Das erklärt, warum eine ungesunde Ernährung nicht nur örtlich den Darm betrifft, sondern meistens den gesamten Körper umfasst. So kann bei einer regionalen Schädigung eine systemische und potenziell lang andauernde Entzündungsreaktion mit daraus resultierenden Schäden entstehen.
Eiweiße Neben den Leukozyten spielen auch Zellen der Haut, der Gefäßwände, aber auch des Bindegewebes eine Rolle im Entzündungsprozess. Hier sind es vor allem auf den Zellen sitzende Eiweiße, sogenannte Mustererkennungsrezeptoren (pattern recognition receptors, PRRs), die bei der Identifizierung von Mikroorganismen und Stoffen, die von geschädigten Körperzellen freigesetzt werden, helfen.
Aus diesen Zellen ragen diese Mustererkennungsrezeptoren wie feine Härchen heraus. Wenn sie mit einem Stoff in Berührung kommen, der vom Körper als schädlich oder gefährlich wahrgenommen wird, lösen sie in der Zelle eine Kaskade von Reaktionen aus. Dadurch wird die Produktion von entzündungsfördernden Stoffen in Gang gesetzt. Diese Alarmphase kann man als erste Phase einer Entzündung betrachten. Am Ende dieser Phase kommt es zu einer Hochregulierung bestimmter Genabschnitte und damit zur vermehrten Herstellung von Zytokinen, also Botenstoffen, die einen starken – manchmal aktivierenden, manchmal beruhigenden – Einfluss auf das Immunsystem haben.
Bei diesen Zytokinen handelt es sich um relativ kleine Eiweiße, die von nahezu jeder Zelle produziert werden. Sie steuern die Immun- und damit Entzündungsreaktion, wobei entzündungsfördernde Zytokine als proinflammatorisch bezeichnet werden. Während der COVID-Pandemie ist manchmal von einem »Zytokinsturm« die Rede gewesen – es handelte sich hierbei um die plötzliche Freisetzung von sehr vielen Zytokinen, die eben die betreffende Person sehr krank machen konnte. Dies veranschaulicht, wie stark Entzündungsprozesse sein können.
Man unterscheidet eine ganze Reihe von Zytokinen wie unterschiedliche Interleukine, Chemokine oder Wachstumsfaktoren. Sie weisen jeweils ähnliche Strukturen, aber nicht immer die gleiche Funktion auf. Außerdem hängt ihre Wirkung von der Zielzelle ab, sie sind also pleiotrop, wie man das in der Medizin sagt. Durch relativ viele Moleküle der schwefelhaltigen Aminosäure Cystein innerhalb ihrer biochemischen Struktur entfalten sie im Regelfall eine starke Wirkung auf andere Zellen. Es gibt eine beinahe unübersichtliche Zahl von entzündungsfördernden Zytokinen, wobei zu den wichtigsten der Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), die Interleukine 1, 6 und 10 (IL-1, IL-6 und IL-10) sowie das Chemokin CXCL8 und Interferon-γ (IFN-γ) zählen.
Phase 2: Die Mobilmachung
Wenn diese von Körper- und Immunzellen hergestellten Eiweiße mit anderen Körperzellen in Berührung kommen, kommt die Entzündung so richtig in Gang. Denn eine der wichtigsten Aufgaben dieser Zytokine ist, das umliegende Gewebe über das Auftreten einer Gefahr wie einer Infektion, eines schädlichen Stoffes oder eine Verletzung zu informieren. Außerdem gelangen sie in den Blutkreislauf und aktivieren Immunzellen, können zu Fieber und allgemeinen Krankheitszeichen wie Müdigkeit, zu diffusen Schmerzen oder Abgeschlagenheit führen. So kommt es dann zur regelrechten Generalmobilmachung einer körperweiten Entzündungsreaktion. Die auftretenden Symptome lassen sich gut erklären.
Schwellung Unter den Zytokinen gibt es beispielsweise mehr als 50 verschiedene Chemokine, also Eiweiße, die die Bewegung von Immunzellen (aber auch von Nichtimmunzellen) steuern. Mit diesen Stoffen werden dann jene Zellen angelockt, die die schädlichen Stoffe neutralisieren und den Schaden reparieren. Diese Ansammlung von Zellen und von ihnen produzierten Stoffen kann man dann als Schwellung bei der Entzündungsreaktion beobachten.
Rötung und Erwärmung Andere Zytokine binden sich an die Zellen der Gefäßwände und sorgen für ihre Erweiterung. Dadurch kommt es zur vermehrten Durchblutung an der betroffenen Stelle, zum Teil entstehen sogar neue (kleine) Gefäße, es findet die sogenannte Angiogenese statt. All das geschieht, indem Bindegewebszellen (Fibroblasten) und Gefäßzellen (Endothelzellen) aktiviert werden und sich auf komplexe Art und Weise nicht nur miteinander verbinden, sondern teilen und zahlenmäßig zunehmen. Hierdurch entstehen die Wärme und Rötung einer Entzündungsstelle.
Verschlechterung des Allgemeinbefindens Bei einer Entzündung geht es stets um die Bekämpfung dessen, was vom Körper als Gefahr eingeschätzt wird. Dies soll aber nicht nur bekämpft, sondern neutralisiert werden. Das bedeutet, als je größer diese Gefahr angesehen wird, umso systemischer und stärker wird die Entzündungsreaktion.
Abläufe bei der stillen Entzündung
Doch wenn etwas wiederholt in den Körper eingebracht wird – beispielsweise mit der Nahrung aufgenommene Pestizidrückstände, ungesunde Nahrungsbestandteile wie Konservierungs- oder Verpackungsstoffe oder auch ungesunde Lebensmittel mit sehr hohem Zucker- oder Transfettanteil, um nur einige von vielen Faktoren zu nennen – dann verstetigt sich diese Entzündungsreaktion, sie chronifiziert. Außerdem weitet sie sich immer mehr auf den gesamten Körper aus, was dann nicht nur zur Abwehr der gefährlichen Faktoren führt, sondern auch zur Schädigung körpereigenen Gewebes. Diese systemischen Entzündungsreaktionen spürt man im Regelfall an Symptomen wie beispielsweise Muskel- und Gliederschmerzen, Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Verstimmung und vielem mehr.
Phasen 3 und 4: Abklingen der Entzündung und Heilung
Erst mit der Behebung der Ursache (dritte Phase) klingt eine Entzündung im Regelfall ab. Es folgt die Reparaturphase (vierte Phase), an deren Ende das Wohlbefinden und die körperliche Integrität des Körpers wiederhergestellt sind. Auch hier spielt eine bestimmte Art der Leukozyten eine Rolle. Außerdem kommt es nun zur Ausschüttung von entzündungshemmenden Zytokinen, die man als »Friedens-« oder »Beruhigungssignale« betrachten kann.
Leukozyten Auch das Herunterfahren einer Entzündungsreaktion läuft über zellulären Mechanismen ab. Hierbei spielen vor allem die sogenannten neutrophilen Leukozyten eine Rolle. Eine ihrer wichtigen Funktionen ist die Aufnahme schädlicher Stoffe wie Zellbestandteile, eingedrungener Keime oder sonstiger Giftstoffe. Sobald die Entzündungsursache abnimmt, entfernen sie sich oder gehen unter, sie »sterben« (Apoptose).
Eiweiße Außerdem vermitteln diese Leukozyten die Freisetzung der entzündungsabbauenden Zytokine, wozu Interleukin 4, 13 und 35 (IL-4, IL-13, IL-35) gehören sowie der Tumorwachstumsfaktor-β (TGF-β). Der Wirkmechanismus ähnelt dem der Anfangsphase der Entzündung, er verläuft aber in entgegengesetzter Richtung: Diese Zytokine unterdrücken die Herstellung entzündungshemmender Stoffe, fahren das Ablesen der Entzündungsgene zurück und reduzieren die am Entzündungsort vorkommenden Zellen und Stoffe, indem sie die Synthese und Freisetzung von Adhäsions- und Chemokinmolekülen unterdrücken.
Abläufe bei der stillen Entzündung
Wenn der die Entzündung auslösende Faktor nicht beseitigt bzw. immer wieder aufgenommen wird, dann kann sich dieser Prozess über Wochen, Monate, Jahre und sogar das gesamte Leben hinziehen. Wenn die Beschwerden eher diffus oder kaum wahrnehmbar sind, spricht man von einer »stillen Entzündung«. Es handelt sich hierbei um eine Schädigung, die zwar langsam und auf niedrigem Niveau abläuft, aber doch auf Dauer großen Schaden anrichten kann. Wobei der Begriff »stille Entzündung« nicht unbedingt korrekt ist, denn wenn man genau in sich hineinhört, kann man die Beschwerden wahrnehmen.
Wie misst man Entzündungen?
Man kann Entzündungsreaktionen heutzutage sehr genau und mittels einfacher Tests auf Marker im Blut bestimmen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese genau aufzuzeigen. Viele davon werden nur im Rahmen von Forschungen oder, wie während der Corona-Pandemie, zur Feinjustierung der Therapie genutzt. Einige der bestimmbaren Zytokine (wie beispielsweise viele der Interleukine) sind schon weiter oben genannt worden. Die Nachweise dieser Substanzen sind oft sehr teuer und haben nur eine geringe Aussagekraft. Dahingegen gibt es einige Blutwerte, die in den allermeisten Arztpraxen bestimmt werden können. Sie liefern bei der Diagnose und der Kontrolle der Therapie wertvolle Informationen.
Wenn Sie es für sinnvoll erachten, können Sie also den Grad der Entzündung in Ihrem Körper bestimmen lassen. Heute kann man solche Werte auch ohne Arztbesuch über Angebote im Internet bestimmen lassen. Sie sollten aber die Vor- und Nachteile einer Bestimmung der Entzündungswerte im Vorfeld mit Ihrem Hausarzt erörtern. Bedenken Sie, dass kein Test hundertprozentig genau ist, und es ist auch nicht immer sinnvoll, die Entzündungswerte messen zu lassen. Außerdem gibt es eine nicht unbeträchtliche Zahl von Betroffenen, bei denen die unten genannten Werte sehr niedrig oder sogar normal sind, die aber dennoch eine stille Entzündung aufweisen. Diese lässt sich dann möglicherweise durch eine Bestimmung der Zytokine nachweisen. Ein klärendes Gespräch ist hier angeraten.
Als Grundlage für ein Gespräch mit Ihrem Arzt und zum besseren Verständnis sollen folgende vier Blutwerte vorgestellt werden, die zum einen einfach zu bestimmen und kostengünstig sind, zum anderen auch von den allermeisten Ärzten in sehr kurzer Zeit interpretiert werden können. Von diesen vier Blutwerten hat sich in den letzten Jahren insbesondere das sogenannte C-reaktive Protein (CRP) als der am besten für Tests geeignete Blutwert herauskristallisiert.
Auf was wird getestet?
Leukozyten Das Blut besteht aus einem flüssigen und einem zellulären Teil. Im Letzteren kommen viele weiße Blutkörperchen vor, die auch als Leukozyten bezeichnet werden. Es gibt diverse Untergruppen, wie beispielsweise Monozyten, Lymphozyten, eosinophile, basophile oder neutrophile Leukozyten. Wichtig ist aber im Regelfall vor allem ihre Gesamtzahl, denn sie sind bei vielen Entzündungsreaktionen erhöht. Da dieser Wert aber auch bei anderen, nicht entzündlichen Krankheiten erhöht und bei einer nicht besonders ausgeprägten Entzündung auch auf normalem Niveau sein kann, ist die Aussagekraft dieses Blutwertes nur sehr begrenzt.
Fibrinogen Dieses vom Körper hergestellte Eiweiß spielt eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Es bildet, wenn es in Fibrin umgewandelt worden ist, mit anderen Fibrinmolekülen ein Gerinnsel, das ähnlich wie ein Pflaster bei einer blutenden Stelle zum Wundverschluss führt. Fibrinogen spielt bei Entzündungen deshalb eine wichtige Rolle, weil es verletztes Gewebe verschließen hilft, aber auch gefährliche Partikel, Viren und Bakterien in den gebildeten Gerinnseln wie in einer Falle fangen kann. Es ist bei Entzündungen oftmals erhöht. Der Test gilt aber auch nicht als optimal, weil Fibrinogen erhöht sein kann, wenn keine Entzündungen vorliegen, aber auch normal hoch sein kann trotz Anwesenheit von Entzündungsprozessen.
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) Die BSG ist eine mittlerweile etwas veraltete Messmethode. Anders als bei den drei anderen hier vorgestellten Methoden wird kein Körpereiweiß oder eine Blutzelle bestimmt. Vielmehr wird im Rahmen dieses Messverfahrens eine Blutprobe entnommen, das Blutröhrchen senkrecht aufgestellt und gemessen, um wie viele Millimeter die Zellbestandteile in einer Stunde absinken. Der ermittelte Wert kann eine Aussage über Entzündungsprozesse machen – je schneller die Blutbestandteile absinken, desto stärker ist die Entzündungsreaktion im Körper. Das Verfahren hat eine gute Vorhersagekraft hinsichtlich der Entzündungsprozesse im Körper, gilt aber deshalb zunehmend als veraltet, weil es etwas ungenau ist und mittlerweile durch die Bestimmung des CRP bzw. hs-CRP eine bessere Aussagekraft erreich wird.
C-reaktives Protein (CRP) Das CRP steigt im Regelfall innerhalb von 24 Stunden nach dem Beginn einer Entzündungsreaktion an. Dieses vor allem von der Leber produzierte Eiweiß hilft bei der Aktivierung des Immunsystems und der Neutralisierung eines die Entzündung auslösenden Stoffes. Erst wenn eine Entzündung abklingt, normalisiert sich das CRP, weshalb es bei vielen Menschen über Jahre hinweg erhöht sein kann, zumindest so lange, wie sich Entzündungsreaktionen abspielen. Ärzte bestimmen es sehr häufig, denn es hilft beispielsweise bei der Behandlung von Autoimmunkrankheiten und anderen chronischen Entzündungsreaktionen. Es kann mittels einer einfachen Blutentnahme in fast jedem Labor der Welt schnell und kostengünstig ermittelt werden und hat sich international als gängiger Laborwert durchgesetzt. Langfristig erhöhte CRP-Werte bedeuten einen Anstieg des Krebs-, Herzinfarkt-, Schlaganfall- und allgemeinen Sterblichkeitsrisikos. Zunehmend wird statt des CRP das hs-CRP bestimmt (»hs-CRP« steht für »hochsensitives C-reaktives Protein«). Das hs-CRP ist in seiner Aussagekraft noch genauer als das CRP.
Die zwölf häufigsten Erkrankungen
Entzündungsprozesse, vor allem langandauernde wie die stillen Entzündungen, schädigen uns. Wenn der Schaden groß genug geworden ist, kann eine Krankheit daraus erwachsen.
Wissenschaftler entdecken immer neue Wechselwirkungen zwischen Krankheiten und Entzündungsreaktionen. Während man früher davon ausging, dass nur einige Krankheiten eine Folge von Entzündungsprozessen sind, hat sich heute das Bild dramatisch gewandelt und man hat bei einer sehr großen Zahl von Erkrankungen, sogar vielen psychischen, eine solche Wechselwirkung aufzeigen können.
Vielfältige Beschwerdebilder
Herzinfarkte, Krebskrankheiten, Allergien, Autoimmunkrankheiten, aber auch Depression, Stoffwechselstörungen, wie der Diabetes mellitus, viele Gelenkbeschwerden und selbst das vorzeitige Altern, all das hat mit Entzündungsreaktionen zu tun. Wer diese in seinem Körper bekämpft, wird nicht nur gesünder, sondern lebt auch länger und sogar glücklicher. Zwölf sehr häufige Krankheiten, die eng mit Entzündungsreaktionen verwoben sind, sollen hier vorgestellt werden.
Diabetes mellitus
Häufigkeit Mittlerweile sind mehr als 500 Millionen Menschen weltweit von Diabetes mellitus betroffen. Allein im deutschsprachigen Raum gibt es wohl bis zu zehn Millionen Diabetiker. Besonders tragisch ist, dass die Zahl jährlich zunimmt und immer häufiger gerade auch jüngere Erwachsene, Jugendliche und sogar Kinder betroffen sind. Diabetes mellitus ist eine wahre Volkskrankheit.
Was ist es? Es handelt sich hierbei um eine Stoffwechselstörung des Körpers, bei welcher der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht ist. Das kann aufgrund einer Autoimmunkrankheit eintreten, bei der bestimmte Zellen der Bauchspeicheldrüse angegriffen und zerstört werden, weshalb dann viel zu wenig oder gar kein Insulin mehr produziert wird. Hier spricht man vom Diabetes mellitus Typ 1. Deutlich häufiger kommt der Typ 2 vor, bei welchem zwar das Hormon Insulin hergestellt wird, es aber zu einer sogenannten Insulinresistenz kommt: Obwohl Insulin hergestellt wird, kann es nicht ausreichend wirken, was dann ebenfalls zu langfristig erhöhten Blutzuckerspiegeln führt. Man unterscheidet noch einen Diabetes mellitus Typ 3, der eine große und heterogene Gruppe darstellt, bei der es vielfältige genetische, hormonelle und anatomische Gründe für die Stoffwechselstörung gibt, und einen Typ 4, der schwangerschaftsbedingt auftritt.
Symptome Die Beschwerden sind vielfältig, aber gerade am Anfang merken viele nicht, dass sie unter Diabetes mellitus leiden. Im fortgeschrittenen Stadium haben Diabetiker oftmals großen Durst, verlieren Gewicht und haben starken und häufigen Harndrang. Weiterhin kann es zu neurologischen Beschwerden wie Kribbeln und Taubheitsgefühlen (vor allem in den Füßen, später auch den Beinen und sogar Händen) kommen wie auch zu verschwommenem oder eingeschränktem Sehen.
Diagnostik Die Diagnostik erfolgt am häufigsten über Bluttests. Hier hat sich neben dem Blutzuckerwert vor allem der HbA1c durchgesetzt, bei dem bestimmt wird, in welchem Maße ein bestimmtes Blutprotein (Hämoglobin) mit Zuckermolekülen besetzt ist – je höher der Wert, umso schwerer der Diabetes.
Langfristige Komplikationen Diese sind abhängig vom Typ des Diabetes mellitus. Beim Typ 1 kann es häufiger zur Ansammlung von bestimmten Säuren und einem sehr stark erhöhten Blutzucker kommen – man spricht von einer Ketoazidose –, was lebensgefährlich sein kann, wenn es nicht therapiert wird. Die anderen Typen, vor allem Diabetes mellitus Typ 2, führen über Jahre und Jahrzehnte im gesamten Körper zu chronischen Schäden. Vorzeitige Alterung, Sehstörungen bis hin zu Erblindung, Nierenstörungen mit der Notwendigkeit einer maschinellen Nierenwäsche mehrmals die Woche (Hämodialyse) können auftreten, genauso wie chronische Missempfindungen in den Beinen und Armen oder erhöhte Raten von Infektionen, Herzinfarkten, Schlaganfällen und sogar der vorzeitige Tod.
Rolle der Entzündung