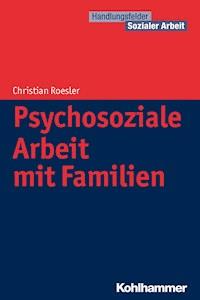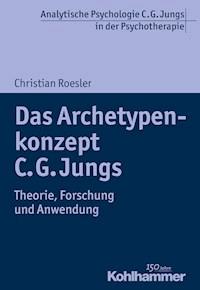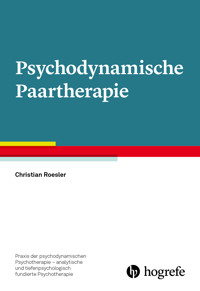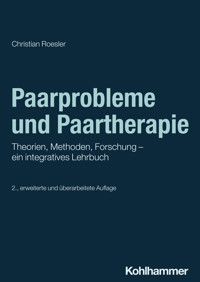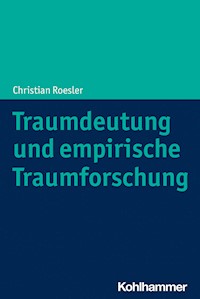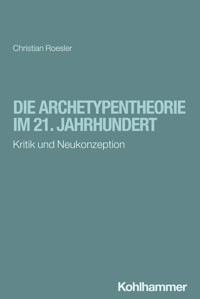
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Archetypentheorie stellt den Kern der Analytischen Psychologie von C.G. Jung dar. Anhand einer historischen und kritischen Analyse der Theorie, ihrer Bestandteile, historischen Vorläufer und Einflüsse werden ihre inneren Widersprüche und problematischen Konsequenzen aufgezeigt. Die zentralen Aussagen der Theorie werden mit Bezug auf den aktuellen Stand des Wissens in Ethnologie und Paläoanthropologie, Biologie und Genetik, Entwicklungspsychologie, Religionswissenschaft und vergleichender Mythenforschung überprüft und als in weiten Teilen unhaltbar erkannt. Als Kerntheorie der Analytischen Psychologie sind die Archetypen für diese jedoch unverzichtbar; es wird eine Neukonzeption vorgeschlagen, die eine tragfähige Grundlagentheorie für die analytische Psychologie im 21. Jahrhundert darstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1 Einleitung
2 Definitionen des »Archetyps«
3 Die Theorie der Archetypen in Jungs Werken
4 Probleme und Kritik
4.1 Struktur ohne Inhalt?
4.2 Das Verhältnis von Stabilität und Wandel in Archetypen
4.3 Das Kulturelle vs. das Biologische, das Persönliche vs. das Kollektive
4.4 Der »Das-ist-alles-dasselbe«-Fehler
4.5 Eine unbegrenzte Anzahl von Archetypen?
4.6 Unterschiedliche Komplexitätsstufen
4.7 Die Wirkung von Archetypen: Determinierung, (In-)Formierung, Strukturierung, Ordnung?
4.8 Der erkenntnistheoretische Status von Archetypen
4.9 Verdinglichung und Ontologisierung
4.10 Phänomenologie
4.10.1 Jungs Interpretationsmethode
4.11 Transzendentalismus
4.12 Fragwürdiges wissenschaftliches Arbeiten
4.13 Eine systemtheoretische Perspektive
4.14 Eine Geschichte der Kritik
4.15 Kritik von außerhalb der AP
4.15.1 Jung im Umgang mit Kritik
4.16 Ist die Archetypentheorie ein Glaubenssystem?
4.17 Schlussfolgerung: Nicht eine, sondern mehrere Theorien
4.17.1 Theorie 1: Eine Theorie biologisch präformierter (genetisch vererbter) mentaler Fähigkeiten
4.17.2 Theorie 2: Eine anthropologische Theorie menschlicher Universalien
4.17.3 Theorie 3: Eine Prozesstheorie der psychologischen Transformation (in der Psychotherapie)
4.17.4 Theorie 4: Eine transzendentale Theorie einer Einheitswirklichkeit
4.17.5 Fazit
5 Biologie, Genetik und Vererbung
5.1 Angeborenheit
5.2 Der Verlauf der Debatte in der AP
5.3 Das Primat der Bilder
5.4 Das Argument der Ähnlichkeit der Gehirnstruktur
5.5 Genetik
5.6 Epigenetik
5.7 Gen-Umwelt-Interaktion
5.8 Temperament
5.8.1 Der biologische Ansatz in der Psychologie und Psychiatrie und seine verheerenden Auswirkungen
5.9 Das Emergenzmodell von Archetypen
5.10 Kritik an der emergentistischen Position
5.11 Selbsterzeugtes Lernen
5.12 Kritik an Goodwyns Position
5.13 Jung, evolutionäres Denken und die darwinistische Theorie
5.14 Ein Überblick über die Erkenntnisse der zeitgenössischen Evolutionspsychologie
5.15 Angeborene mentale Fähigkeiten
5.16 Bindungstheorie und -forschung
5.17 Bindung und Evolution: Environment of evolutionary adaptedness (EEA)
5.18 Das soziale Gehirn: Kooperation und reziproker Altruismus
5.19 Transaktionale Kausalität: Wie Kultur die Evolution beeinflusst
5.20 Das Selbst ist beziehungsorientiert: Beziehung ist vorrangig, nicht das Individuum
5.21 Fazit
6 Anthropologie
6.1 Die Homologie von Phylogenese und Ontogenese
6.1.1 Giegerichs Kritik
6.2 Die Homologie-Hypothese in der Geschichte der Anthropologie
6.2.1 Rassismus bei Jung
6.3 Beweise, welche gegen die Homologie-Hypothese sprechen
6.4 Jung und die Großtheorien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
6.5 Zeitgenössische Kritik an der evolutionistischen Schule
6.6 Bachofens »Mutterrecht« und Jungs »Große Mutter«
6.7 Kultur vor Biologie
6.8 Zeitgenössische Ansätze in der Anthropologie zur Frage der interkulturellen Ähnlichkeiten
6.9 Menschliche Universalien: Isolationismus vs. Diffusionismus
6.10 Universalismus vs. Kulturrelativismus/Partikularismus
6.11 Die empirische Grundlage für menschliche Universalien
6.12 Fazit
7 Religion
7.1 Eliades monolithischer Ansatz und sein Erbe
7.2 Vergleichende Religionswissenschaft: Von den Großtheorien zu zeitgenössischen Ansätzen
7.3 Die Theorie der religiösen Evolution
7.4 Die Evolution der ersten Religionen
7.5 Schamanismus
7.6 Fazit
8 Frühgeschichte
8.1 Probleme in der Archäologie der Vorgeschichte
8.2 Out of Africa
8.3 Noch einmal: Isolationismus vs. Diffusionismus
8.4 Religion im Paläolithikum
8.5 Paläolithische Höhlenmalereien und Felskunst
8.6 Prähistorische Frauenfiguren und der Mythos der Großen Mutter
8.7 Neolithikum
8.8 Schlussfolgerungen
9 Mythologie
9.1 Dennoch: universelle Motive
9.2 Die Theorie des gemeinsamen Ursprungs
9.3 Laurasische oder nordische Mythologien
9.4 Südliche oder Gondwana-Mythologien
9.5 Pan-Gäische Mythen – die wirklich universellen Motive
9.6 Fazit
10 Schlussfolgerung: Die Kerntheorie – eine Theorie der psychologischen Transformation
10.1 Die Prozessidee
10.2 Verschiedene Prozessmodelle
10.3 Ist Jungs Modell des Individuationsprozesses universell?
10.4 Jungs Auffassung von Übertragung
10.5 Die Rolle der Archetypen in der entwicklungsorientierten Schule
10.6 Die Theorie der Archetypen als Hermeneutik
10.7 Was verbleibt von der Archetypentheorie?
10.8 Und das kollektive Unbewusste?
10.9 Ausblick: die Richtungen der künftigen Forschung
Literatur
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Prof. Dr. habil. Christian Roesler, Dipl.-Psych., Psychologischer Psychotherapeut, lehrt Klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg i. Br. sowie Analytische Psychologie an der Universität Basel. Er ist darüber hinaus Dozent an den C. G. Jung-Instituten Zürich und Stuttgart sowie Lehranalytiker am Aus- und Weiterbildungsinstitut für Psychoanalytische und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg (DGPT).
Christian Roesler
Die Archetypentheorie im 21. Jahrhundert
Kritik und Neukonzeption
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043603-9
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043604-6epub: ISBN 978-3-17-043605-3
DanksagungDas vorliegende Buch basiert auf einem Forschungsprojekt, das von der International Association for Analytical Psychology (IAAP) finanziert wurde. Die Studie wurde vom Autor am Institut für Angewandte Forschung der Katholischen Hochschule Freiburg durchgeführt. Mein Dank gilt den damit befassten Mitarbeitenden1 des Instituts sowie Stefanie Ehret für ihre Unterstützung bei der Übersetzung des ursprünglich englischen Forschungsberichts. Die Veröffentlichung wurde darüber hinaus großzügig von der Susan-Bach-Stiftung finanziell unterstützt.
Endnoten
1In diesem Buch wird wegen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet, das alle Geschlechter einschließt, ohne eine Bevorzugung vorzunehmen.
1 Einleitung
»The discomfort I am talking about can assume various forms: that of an uneasiness with some unsolved contradictions in AP itself; that of a refusal of the constant turning into ontology of the origin of the metaphorical language of AP; that of a refusal of the typical ahistorical suspension typical of AP that never established any fruitful exchange with those problems of the philosophical, anthropological, and methodological thought which during the same years had appeared and established themselves; that of the suspicion caused by the divorce that AP continuously maintains towards those empirical observations coming from other fields of psychological research, or that, on the contrary, of the repudiation of it's all too easy syncretistic way of uncritically accepting everything, thus destroying the essential character of AP; that of the doubt about the distance between its theoretical hypothesis and their practical applications; that of a diffidence about a field which has never consistently faced a radical, or even pitiless, rethinking of its foundations; that of a nausea for the careless, superficial and uncritical use of the comparative method in the de-metaphorization of the images of fantasy or of dreams without any care for historical or cultural differentiation: that of the suspicion for all too easy a recourse to the therapeutic practice, or to a recourse to experiences either purely emotional, or of a dangerously parapsychological nature and thus banally suggestive; the discomfort, finally, of a repugnancy for a linguistic and hence theoretical carelessness in most of the scientific production which goes under the name of AP.« (Trevi 1992, S. 356)
Auch wenn das Konzept des Archetyps als zentral für die Analytische Psychologie (AP) angesehen werden muss, gab es von Anfang an darum Kontroversen. Wenn wir zu Jungs ursprünglichen Formulierungen des Archetyps zurückgehen, finden wir keine einheitliche Definition. Heute müssen wir uns also zunächst die Frage stellen: Worauf bezieht sich der Begriff Archetyp?
Jung bemühte sich stets zu zeigen, dass seine Konzeptualisierung des Archetyps fest in der Biologie verankert war (z. B. Jung GW 18, 1228)2. Es gab viele Versuche, neue theoretische Grundlagen für die Argumentation universeller Archetypen zu formulieren, aber es gibt keine vollständig zufriedenstellende theoretische Konzeptualisierung. Folglich gibt es keinen Konsens darüber, wie Archetypen in der zeitgenössischen AP definiert werden. Ich stimme Mills zu, der sagt:
»Jung failed to make this clear. And Post-Jungian schools including contemporary Jungian movements have still not answered this most elemental question. As a result, there is no clarity or consensus among the profession. The term archetype is thrown about and employed, I suggest, without proper understanding or analysis of its essential features [...] to the degree that there is no unified consensus on what defines or constitutes an archetype. This opens up the field to criticism – to be labeled an esoteric scholarly specialty, insular self-interest group, Gnostic guild, even a mystic cult. Jungianism needs to rehabilitate its image, arguably to modernize its appeal to other academic and clinical disciplines.«(Mills 2018, S. 1)
Da das Konzept der Archetypen zusammen mit dem Konzept des kollektiven Unbewussten als Kernkonzept der AP bezeichnet werden kann, was es von anderen Schulen der Psychotherapie und Psychoanalyse unterscheidet, ist die Verwirrung über die Definition unerträglich. Die Archetypentheorie muss neu definiert und konzeptualisiert werden, damit die AP auf eine allgemein akzeptierte Theorie zurückgreifen kann, die mit zeitgenössischen Erkenntnissen in anderen Disziplinen, nämlich Biologie, Genetik, Psychologie, Anthropologie, Kulturwissenschaften und Neurowissenschaften, übereinstimmt.
Trotz dieser Widersprüchlichkeiten finden wir, beginnend mit Jung und fortgeführt in der gesamten Praxis der AP, eine typische Verwendung des Konzepts, die auf einem Verständnis von Archetypen als universellen Mustern basiert, die Bedeutung erzeugen und Entwicklung leiten. Dies ist die Grundlage für die Praxis der jungianischen Psychotherapie, die darauf setzt, dass sich durch eine besondere Beziehung, wie die analytische, Archetypen konstellieren und den Prozess der therapeutischen Entwicklung leiten, und dass diese Archetypen in jedem Menschen zu finden sind. Unter diesem Gesichtspunkt wird das definierende Element der Universalität zum zentralsten für den Archetypusbegriff und es wird klar, warum Jung enorme theoretische Anstrengungen unternahm, um dieses Element sicherzustellen und warum er sich dabei auf biologische Erklärungen stützte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird diese biologische Erklärung der Entstehung von Archetypen ernsthaft in Frage gestellt und Jungs Standpunkt des Präformationismus wurde widerlegt. Dies führt dazu, dass selbst neuere Ansätze die Universalität solch komplexer Archetypen nicht zufriedenstellend erklären können. Die Theorie und Praxis der AP basieren jedoch auf dem Glauben, dass die Gesamtheit der universellen Archetypen zumindest als Potenzial in jedem Menschen zu finden ist. Dies schafft eine ernste Situation, die theoretischen Grundlagen für die Praxis von AP sind zusammengebrochen. Damit nicht genug, es scheint, dass sich große Teile der Community gar nicht dafür interessieren oder nur ein begrenztes Bewusstsein dafür haben.
Meiner Meinung nach steht die AP derzeit vor dem Problem, auf einem Konzept zu basieren, dessen ursprüngliche Erklärungstheorie sich verflüchtigt hat. Die Frage, die es zu beantworten gilt, lautet: Wie entstehen diese Muster, die wir archetypisch nennen und auf die wir einen Großteil unserer Theorie sowie unserer klinischen Praxis stützen – und was sind sie eigentlich, wie lassen sie sich definieren, was enthalten sie, was sind ihre Wirkungen usw.?
Einige Schulen der jungianischen Therapie mögen sagen, dass das Konzept der Archetypen für die Praxis nicht so grundlegend ist und dass es viele Jungianer gibt, die es nicht einmal mehr verwenden. Das mag so sein, würde dann aber die Frage aufwerfen, was diese Praktiken von anderen Schulen der psychodynamischen Psychotherapie unterscheidet.
Einige Schulen, wie z. B. die archetypische Psychologie, sehen hier möglicherweise gar kein Problem. Interessanterweise würde ein Argument, das auf einer transzendentalen Definition von Archetypen basiert, eine kohärente Erklärung für die Existenz selbst sehr komplexer Archetypen liefern, wenn die Grundannahme akzeptiert wird, dass es mehr Faktoren gibt, die die Realität beeinflussen, als nur die kausalen Faktoren des deterministischen Wissenschaftsmodells. Es würde bedeuten, zu akzeptieren, dass die Archetypen, die den analytischen Prozess beeinflussen, aus einer transzendentalen Sphäre stammen und würde die jungianische Therapie in den Bereich der religiösen Praktiken einordnen, was aus meiner Sicht sehr viel Sinn ergibt (vgl. Roesler & Reefschläger 2022). Nichtsdestotrotz gibt es eine anhaltende Debatte unter Jungianern, das oben formulierte Problem auf eine Weise zu lösen, dass das Konzept der Archetypen bewahrt werden und gleichzeitig einen Platz im Bereich der normalen Wissenschaft behalten kann.
Für Jung war seine Theorie nicht nur Theorie, sondern ein starker Glaube, der auf seinem persönlichen inneren Erleben beruhte und nicht nur die individuelle psychische Entwicklung erklären konnte, sondern zu so etwas wie einer »Welterklärungstheorie« wurde: Sie enthält weitreichende Behauptungen zu Themen der Anthropologie, Urgeschichte/Paläoanthropologie, Religion, vergleichenden Mythologie usw., die, wie ich zeigen werde, auf hochproblematischen Theorien des 19. Jahrhunderts beruhen, die in die AP aufgenommen wurden und bis heute fortgeführt werden. Es scheint, als ob es in den Jahrzehnten seit Jung keine Aktualisierung dieser Ideen gegeben hat, die der Archetypentheorie inhärent sind, in Bezug auf die Entwicklung und den zeitgenössischen Stand von Disziplinen wie der (Paläo-)Anthropologie, Mythenforschung, Religionswissenschaft usw. Manchmal scheint es, als hätte die AP den Kontakt zu diesen Disziplinen, welche für die Ideen der Archetypentheorie so wichtig sind, völlig verloren. Diese Vernachlässigung führt zu einer weit verbreiteten Unkenntnis der Entwicklungen in den jeweiligen Disziplinen, was nicht zuletzt einer gewissen Arroganz gleichkommt, als hätten andere Wissenschaften nichts mit der AP zu tun oder könnten einfach ignoriert werden. Insofern liefert das oben von Trevi (1992) geäußerte Unbehagen, auch wenn es hart klingen mag, immer noch ein korrektes Bild der Situation der AP. Dadurch hat die AP den Kontakt zu den für ihre Themen relevanten Wissenschaften verloren und befindet sich in einem Zustand der Isolation. Interessant ist auch, dass dieser Sachverhalt bereits in den 1970er Jahren kritisiert wurde und viele der Punkte in diesem Buch seit Jahrzehnten vorgebracht werden, scheinbar ohne große Auswirkungen auf die größere Community. Es scheint mir, dass dies auf eine bestimmte Haltung zurückzuführen ist, die mit Jung begann, sich aber seitdem in der jungianischen Community fortgesetzt hat.
Für viele Entwickler wissenschaftlicher Theorien waren ihre Ideen natürlich von starken Überzeugungen gestützt, aber bei Jung ist dies ins Extrem gesteigert – insbesondere bei seiner Archetypentheorie konnte Jung keinen nüchternen Blick mehr einnehmen, der für sachliche Kritik offen gewesen wäre. Auch wenn er auf die Tatsache der »persönlichen Gleichung« hinweist, meine ich, dass er in seinem eigenen Fall nicht in der Lage war, dies zu berücksichtigen und sich zumindest von Zeit zu Zeit von seinen eigenen Ideen zu distanzieren, was als wissenschaftlicher Skeptizismus bezeichnet wird, und offen darüber zu diskutieren – im Sinne von Offenheit für Kritik und für Korrekturen. Es wurde zu einem Glaubensbekenntnis. Das hat damit zu tun, dass Jungs Konzepte so eng mit seinen eigenen Erfahrungen verknüpft waren. Für ihn war es eine Art Wahrheit, und so war er nicht daran interessiert, Beweise für seine Theorien zu finden oder Kritik anzunehmen.
Meine Hypothese ist, dass zu seiner Zeit und auch heute noch Anhänger von seinen Ideen angezogen werden, weil es ein gewisses Bedürfnis gibt, an ein solches »ganzheitliches« Glaubensbekenntnis zu glauben. Es besteht kein Zweifel, dass es eine große Anzahl von Veröffentlichungen zu diesen Problemen gegeben hat, insbesondere in jungianischen wissenschaftlichen Zeitschriften, und viele der Punkte, die ich hier anführe, bereits diskutiert wurden; z. B.:
»Jungian analysts cannot get around the ›Jung cult‹ argument started off by Richard Noll (1994) simply by attacking its author. [...] there is sometimes an excessive deference shown in Jungian groups to analysts in general, and to senior analysts in particular, a deference which it is quite often hard to justify in terms of the productivity and output of those individuals.« (Samuels 1998, S. 17)
Mein Eindruck (z. B. aus der Lehre an Ausbildungsinstituten) ist jedoch, dass es außerhalb der eher akademischen Kreise in der jungianischen Community, welche sich mit Wissenschaft und Forschung befassen, immer noch eine starke Tendenz gibt, Jung zu idealisieren und an sehr klassischen Positionen in der AP und an einer konservativen Lesart von Jungs Werken festzuhalten. Mir scheint, dass kritische Publikationen keine starke Reichweite in der jungianischen Community haben. Noch schlimmer: Es scheint eine Haltung der Überlegenheit zu geben, die sowohl bei Jung als auch bei vielen seiner Anhänger heute zu finden ist, dass ihr Modell, wie sich die Psyche entwickelt und wie Psychotherapie funktioniert, ultimativ ist, als ob sie im Besitz der Wahrheit über die Psyche seien. Dies hat zu einer Verdinglichung und Ontologisierung von Konzepten geführt, die ursprünglich nur eine persönliche Erfahrung von Jung waren. Diese Haltung der Überlegenheit hat auch zu einer Tendenz geführt, sich von Erkenntnissen aus anderen Disziplinen abzuschotten.3
Aus meiner Sicht befindet sich die AP als wissenschaftliche Theorie sowie die theoretische Kultur innerhalb der jungianischen Community in einem schlechten Zustand: Selbst nach mehr als 100 Jahren gibt es keinen Konsens über die Definition des Kernkonzepts, der Archetypen, und die Debatte bezieht sich häufig auf völlig veraltete Theorien und Konzepte aus der Psychologie und anderen Gebieten. Auch dies wird seit vielen Jahren hervorgehoben:
»We run the risk of working with increasingly outdated and inaccurate models of the human mind if we avoid subjecting them to the rigour of scientific scepticism, for fear that the numinous or spiritual will be destroyed by the scientific advances in understanding the way the mind actually works.« (Knox 2001, S. 616)
Es herrscht Einigkeit darüber, dass Jungs Werke voller Widersprüche sind, und darüber ist schon viel geschrieben worden:
»Jung repeatedly insisted that he did not have a theoretical system of his own. In so far, as he claimed that his ideas were not theoretical abstractions but founded on his own direct clinical experience, he did not feel compelled to present them as a neat system with their own logical coherence, which would enable his readers to access them easily. This close relationship between Jung's theory and practice could account for the fact that his writings are accepted as lucid and indeed inspirational by some and as incomprehensible by others.« (Papadopoulos 1992a, S. XIV)
Wie der Autor hervorhebt, stützte sich Jung bei der Formulierung seiner psychologischen Ideen und Konzepte einerseits stark auf sein eigenes inneres Erleben, andererseits versuchte er verzweifelt, nicht als Philosoph angesehen zu werden, da er als Wissenschaftler gelten wollte. Folglich werden viele seiner Ideen und Konzepte von ihm in der Art nomothetischer Aussagen präsentiert, als empirisch begründete Einsichten, wenn nicht sogar als Wahrheiten. Es besteht kein Zweifel, dass Jung innovativ war, als er die Introspektion in die psychologische Theoriebildung einführte, aber seine wiederholten Behauptungen, dass seine Ergebnisse als objektive empirische Fakten betrachtet werden sollten, führen häufig zu Aporien. Mein Eindruck ist, dass diese Tendenz, sich der inhärenten Widersprüche in der AP nicht bewusst zu sein, bis heute anhält. Viele jungianische Autoren argumentieren, wenn sie mit diesem Problem konfrontiert werden, dass dies eine absichtliche Strategie von Jung war und in der Tat genial, und dass seine paradoxen Aussagen als eine neue Form der Psychologie angesehen werden sollten. Aus meiner Sicht ist dies eine Glorifizierung von Jungs Unfähigkeit, grundlegende erkenntnistheoretische und wissenschaftliche Standpunkte zu klären. Was ich im Folgenden zu zeigen versuche, ist, dass es Verwirrung auf Jungs Seite gibt, dass es sich nicht um eine systematische Strategie in Jungs Schriften handelt, sondern um ein Versagen, die Grenzen seines eigenen Denkens zu erkennen, und dass die Verherrlichung Jungs, dass er absichtlich und genialisch paradox war, als eine Verteidigungsstrategie in der jungianischen Community betrachtet werden muss. Ich würde argumentieren, dass diese Haltung sowohl bei Jung als auch in der Community der Usprung der immer noch andauernden und schwerwiegenden theoretischen Probleme ist, die wir heute in der AP haben, wie das Fehlen einer konsensualen Definition von Archetypen, ein Widerstand gegen die Berücksichtigung theoretischer Entwicklungen und Erkenntnisse in relevanten Disziplinen und gegen eine Überprüfung der Theorie im Sinne von Forschung. Meine Hypothese ist, dass all dem eine bestimmte Haltung zugrunde liegt, die wiederum mit Jungs Persönlichkeit in Verbindung gebracht werden kann, die sich aber in den postjungianischen Entwicklungen bis in die Gegenwart fortsetzt. Dieser Stil, Wissenschaft zu betreiben, prägte bei Jung Haltungen und eine bestimmte Denkweise in der Community der Jungianer. Dies beinhaltet: a) den Glauben, dass in der Entwicklung der Person alles aus dem Individuum herauskommt, was b) zur Folge hat, dass es sowohl bei Jung als auch in der AP heute an einer kohärenten Theorie der zwischenmenschlichen Beziehungen und ihrer Auswirkung auf die Entwicklung mangelt und, vor allem, wie sich diese zur Archetypenlehre verhält, was Konsequenzen für die klinische Arbeit hat; zu dieser Haltung gehört c) die mangelnde Bereitschaft oder gar der Widerstand, die eigenen Theorien (weil sie als innere Wahrheit angesehen werden) durch die Konfrontation mit Erkenntnissen aus anderen Disziplinen zu überprüfen, was d) zur Folge hat, dass sowohl die Methode der Erkenntnisgewinnung als auch die daraus resultierenden Theorien unwissenschaftlich werden. Infolgedessen ist es, zumindest aus meiner Sicht, kein Wunder, dass die jungianische Psychologie von der akademischen Psychologie mehr oder weniger ignoriert wurde, was von Jungianern oft als böser Wille interpretiert wird.
Es geht mir hier nicht darum, Jung als Person in den Mittelpunkt zu stellen, denn wie jeder andere Mensch, war er inneren Widersprüchen, Konflikten, Ambivalenzen und blinden Flecken unterworfen. Diese Aspekte sind nur insofern relevant, als sie sich auf die Theoriebildung in der AP auswirken, mit Konsequenzen bis in die Gegenwart. Dies muss aufgrund der oben erwähnten Tendenzen, Jung als Person zu idealisieren, noch stärker thematisiert werden. Das zeigt sich z. B. daran, dass wir uns im Vergleich zur Freud'schen Psychoanalyse immer noch mehr mit der Person Jung beschäftigen als mit seiner Theorie. Es ist in jungianischen Kreisen eigentlich nicht üblich, von der jungianischen Psychologie als einer wissenschaftlichen Theorie zu sprechen. Es wäre jedoch wichtig, Jungs Werk als eine Zusammenstellung von wissenschaftlichen Konzepten und Ideen zu sehen, die im Allgemeinen kritisiert werden können. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen der Person und ihren vermuteten Intentionen auf der einen Seite und theoretischen Elementen, Schemata und Denkfiguren, die objektiv in Jungs Arbeiten zu finden sind. In der Tat hat es in den letzten Jahren eine ausführliche Diskussion über die Grundlagen von Jungs Denken und seinen Konzepten gegeben, aber es scheint mir, dass die Reichweite dieser Diskussionen in der internationalen jungianischen Community nicht überschätzt werden sollte. Zumindest für den deutschsprachigen Raum kann ich sagen, dass Veröffentlichungen zu jungianischen Konzepten die zeitgenössischen Erkenntnisse in den einschlägigen Disziplinen häufig nicht berücksichtigen und die Lehre an den Instituten sich oft auf sehr klassische Positionen ohne Bezug zu neueren Entwicklungen beschränkt; und aus meinen Erfahrungen mit der Lehre in anderen Ländern habe ich oft den Eindruck gewonnen, dass die Situation dort noch schlimmer ist.
Die problematische Situation in der AP gipfelt in der Archetypentheorie. Das vorliegende Buch basiert auf einer von der IAAP finanzierten Studie. In einem ersten Schritt wurde eine Umfrage unter Experten der Archetypentheorie durchgeführt, in der sie gebeten wurden, Antworten auf Fragen zur Definition des Begriffs, zu Erklärungstheorien darüber, wie Archetypen entstehen, ob sie als universell angesehen werden usw. zu geben. Die Ergebnisse bestätigen, dass eine konsensuale Definition fehlt; es wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen und Erklärungen von Archetypen vorgestellt, die größtenteils unvereinbar sind (Roesler 2022).4
Das Fehlen einer konsensualen Definition für den Begriff Archetyp stellt für die AP ein großes Problem dar. Ich werde an dieser Stelle nicht versuchen, diese Definition zu geben. In meinem Buch Das Archetypenkonzept C. G. Jungs (Roesler 2016) habe ich zusammengefasst, was man als klassische Position in der jungianischen Psychologie bezeichnen könnte. Obwohl ich in dieser früheren Veröffentlichung auf einige Widersprüche und Probleme in Jungs Arbeiten über den Archetyp hingewiesen habe, konzentriert sie sich auf die Entwicklung des Konzepts im Mainstream der jungianischen Psychologie sowie auf die Anwendungen. Im Folgenden werde ich mich auf dieses frühere Buch beziehen, wenn ich auf Definitionen, Konzepte und Beispiele aus der klassischen Sichtweise hinweise. Im Gegensatz zu dieser früheren Arbeit wurden in der vorliegenden Untersuchung Jungs Vorstellungen über den Archetyp im Sinne einer historisch-kritischen Analyse (in der Tradition von Michel Foucaults Diskursanalyse) in seinen Werken nachgegangen. Ziel ist es, die Denkfiguren zu rekonstruieren, die Jungs Theorien rund um den Begriff Archetyp inhärent sind. Diese Analyse stützt sich auf Jungs eigene Aussagen im Gesamtwerk sowie in anderen Publikationen (z. B. »Erinnerungen, Träume, Gedanken«). Ich werde zeigen, dass sich diese Denkfiguren im Mainstream von AP bis zum heutigen Tag fortsetzen. Im Anschluss an diese theoretische Rekonstruktion – die in gewissem Sinne auch eine Dekonstruktion ist – werden die Hintergründe anhand einflussreicher Theorien und Autoren veranschaulicht, die für die Entwicklung von Jungs Denken von Bedeutung waren.
In diesem Zusammenhang dürfte es interessant sein zu wissen, dass ein Forscherteam der Universität Wien seit 2012 eine historisch-kritische Sigmund-Freud-Edition erarbeitet, die bereits einige Erkenntnisse über die Entstehung zentraler Konzepte von Freuds Psychoanalyse hervorgebracht hat (Diercks & Skale 2021). Diese historisch-kritische Methode wurde erstmals auf die Werke Nietzsches angewandt (Colli/Montinari 1967 ff.), kürzlich auf die kritische Edition der Werke Heideggers. Ich denke, dass eine solche historisch-kritische Untersuchung der Werke von Jung, die auch einen kritischen Kommentar dazu enthält, wie die Texte entstanden sind, was die Einflüsse waren usw., dringend erforderlich ist (kurz vor Drucklegung wurde der Autor informiert, dass die Philemon Foundation unter der Leitung von Sonu Shamdasani eine Neuausgabe der Werke Jungs unter dem Titel Complete works of C. G. Jung plant, die zum einen zahlreiche bislang unveröffentlichte Texte von Jung enthalten wird und zum anderen eine ebensolche historisch-kritische Kommentierung). Die hier vorgestellte Untersuchung versucht, eine solche Analyse mit besonderem Augenmerk auf die Archetypenlehre zu liefern. Nachfolgend werden die Kritik an dieser Theorie und die dem Konzept innewohnenden Probleme zusammengefasst, sowohl von innerhalb als auch außerhalb der AP.
Als eine wichtige Schlussfolgerung aus dieser Analyse werde ich zeigen, dass Jungs Theorie der Archetypen eigentlich vier verschiedene Theorien innewohnen, die in Jungs Schriften miteinander verwechselt werden, und diese Verwirrung kann als Erklärung für viele der oben skizzierten Probleme dienen. Als Schritt zur Klärung des Konzepts empfehle ich daher, diese vier Theorien voneinander zu unterscheiden, da sie sich mit unterschiedlichen Wissensgebieten befassen. Jung hat zeitlebens versucht, diese vier Theorien zu einer kohärenten theoretischen Darstellung zusammenzufügen, was, wie ich noch zeigen werde, unmöglich und der Grund für den problematischen Zustand der Archetypenlehre ist, mit dem wir heute konfrontiert sind. Diese Theorien bei Jung machen Aussagen und Behauptungen, die sich auf die Bereiche Biologie, Anthropologie, Religionsgeschichte, Paläoanthropologie und vergleichende Mythologie beziehen. In den folgenden Kapiteln werde ich mich also ausführlich mit diesen Disziplinen befassen, versuchen, den Stand der Debatte in der jeweiligen Disziplin zusammenzufassen und den Aussagen und Behauptungen der Archetypenlehre gegenüberzustellen. Am Ende jedes Kapitels fasse ich die Schlussfolgerungen zusammen, die sich aus dieser Gegenüberstellung ergeben haben. Generell lässt sich feststellen, dass große Teile der klassischen Archetypenlehre als widerlegt angesehen werden müssen, da sie nicht mit den Erkenntnissen der jeweiligen Disziplinen übereinstimmen. Im abschließenden Kapitel werde ich aufzeigen, was von der Archetypentheorie bestehen bleiben wird, sowie Richtungen für zukünftige Forschungen in der AP.
Endnoten
2Jung wird in diesem Text unter Bezugnahme auf die Gesammelten Werke, Band und Paragraph zitiert, z. B. GW 7, 460.
3Bei Loomans (2020) wird diese Haltung der Überlegenheit, des Wahrheitsbesitzes, durch den Vergleich von Jungs Psychologie mit Karlfried Graf Dürckheims Initiatischer Therapie untersucht.
4Der vollständige Bericht enthält detaillierte Daten und Erkenntnisse sowie ergänzendes Material (zu finden unter: https://iaap.org/resources/research/).
2 Definitionen des »Archetyps«
In diesem Kapitel werde ich einen Überblick über die Definitionen des Begriffs Archetyp geben, wie sie in den letzten Jahrzehnten in der AP dargestellt wurden. Ziel ist es, zu zeigen, dass es keinen Konsens über die Definition dieses zentralsten Konzepts gibt, was sich auch in der erwähnten Umfrage (Roesler 2022) gezeigt hat.
Historisch gesehen gibt es in der AP eine starke Tradition, dass Autoren Jungs Argumentation folgen, indem sie Archetypen als in der Biologie verwurzelt betrachten, dass es sich um Instinkte oder Verhaltensmuster handelt – eine Sichtweise, die oft mit der Vorstellung verbunden ist, dass Archetypen genetisch übertragen werden. Ein herausragender Vertreter dieser Sichtweise ist sicherlich Anthony Stevens, der Jungs Theorien um den Archetyp mit seinem Konzept der evolutionären Psychiatrie verknüpfte (Stevens 1983, 2003). Gordon (1985) liefert eine umfassende Darstellung dieses Standpunkts, während er Jungs biologischen Standpunkt vollständig übernimmt, obwohl er auf die Verwirrung hinweist, die Jung durch seine beiläufige Verwendung von Begriffen geschaffen hat:
»There is frequently a confusion between the first three mental functions – archetype, image and symbol – and Jung himself has often been guilty of encouraging such confusion, at least as far as his casual use of these terms is concerned.« (S. 120)
Humbert (1988) skizziert die interessante Idee, dass Jung auf eine Idee hindeutete, die zu Jungs Zeit noch nicht verfügbar war; das Konzept der Information, während gleichzeitig Jungs Auffassung übernommen wird, dass Archetypen angeboren sind:
»[...] archetypes condition, orient, and support the formation of the individual psyche according to a plan that is inherent to them; [...] the archetypes are inscribed in the body in the same way that all organs of information are inscribed in living matter. This implies, among other things, that archetypes are genetically transmitted.« (S. 101)
Ich möchte auch eine Definition von Michael Fordham (1976) hinzufügen, die nicht wirklich von Jungs Vorstellungen abweicht, sondern das Konzept des Archetyps auf die Entwicklung des Kindes erweitert:
»[...] the archetypes are unconscious entities having two poles, the one expressing itself in instinctual impulses and drives, the other in spiritual forms. [...] Transferring this idea to childhood and starting from the spiritual components, the theory of archetypes means that a predisposition exists in the child to develop archaic ideas, feelings and fantasies without their being implanted in him or without his introjecting them.« (S. 5)
Daryl Sharp (1991) liefert in Jung Lexicon eine Definition, die sich eng an alle relevanten Ideen in Jungs Werken anlehnt. Nancy Kriegers (2019) Versuch, eine gewisse Ordnung zu schaffen, ist ein jüngeres Beispiel für eine Autorin, die sich eng an Jungs klassische Definitionen hält und Jungs unterschiedliche Argumentationen rund um den Begriff in zeitgenössischen Publikationen unkritisch übernimmt. Im Vergleich dazu ist die Definition von Patricia Berry (o. D.), die auf der Website der IAAP (https://iaap.org/archetype-2/) abrufbar ist, in den aufgestellten Behauptungen viel vorsichtiger.
Die genannten Definitionen versuchen, Jungs Aussagen und Standpunkte zu verteidigen. In meinem ersten Buch (Roesler 2016) habe ich versucht, einen umfassenden Überblick über diese klassische Position in der Archetypentheorie und ihre Entwicklungen in der Debatte innerhalb der AP zu geben. Im Gegensatz dazu eine postjungianische Definition von Andrew Samuels (1990):
»Archetypal theory has also been rethought. A radical change has taken place in what we require of an image before we call it archetypal. Archetypal images no longer have to be large, impressive, or decorous; what is archetype is to be found in the eye of the beholder and not in a particular image itself.« (S. 295, Hervorhebung C. Roesler)
Im Gegensatz dazu versuchte George Hogenson (2009), nicht zu weit von Jungs ursprünglichen Definitionen abzuweichen und eine gewisse Verbindung zur Biologie und den Verhaltenswissenschaften zu bewahren; er schlug daher vor, den Archetyp als »elementary action pattern« zu verstehen (S. 325). Hogenson spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der emergentistischen Position in der Archetypentheorie (ِ▸ Kap. 5). Pietikainen (1998) empfahl eine radikale Abkehr von der Diskussion über die Angeborenheit und schlug vor, dass Archetypen mit Hilfe von Cassirers Ansatz als »culturally determined functionary forms, organizing and structuring certain aspects of man's cultural activity« (S. 325) verstanden werden könnten. Van Meurs (1990) gibt einen Überblick über die Verwendung des Begriffs Archetyp in der Literaturkritik, betont allerdings, dass dieser hier ausschließlich als ein literarisches Konzept verstanden wird, welches z. B. verschiedene Gedichte miteinander verbindet. Eine Perspektive aus der Objektbeziehungstheorie versteht Archetypen als eine vorgeformte Fähigkeit in der Psyche, reale Objekte (hier: emotional bedeutsame Bezugspersonen) in Übereinstimmung mit bestimmten Formen und Mustern in der üblicherweise zu erwartenden Umwelt zu erkennen – sie dienen also zur Gestaltung von Objektbeziehungen (Papadopoulos 1992b, S. 197).
Um einen Überblick über die Definitionen zu erhalten, die derzeit in der AP zirkulieren, wurde im Rahmen des Forschungsprojekts eine systematische Befragung durchgeführt. In dieser Umfrage (Roesler 2022) wurden Experten der jungianischen Psychologie, die zur Archetypentheorie publiziert haben, gebeten, kurze Texte zur Definition des Begriffs Archetyp zur Verfügung zu stellen. Diese Definitionen sind um wiederkehrende Themen oder Konzepte der Archetypentheorie gruppiert (s. Forschungsbericht für ausführliche Informationen, Roesler 2021, 2016):
Archetypen seien sehr grundlegende, typische Muster, Veranlagungen und Fähigkeiten, die allen Menschen gemeinsam/universell sind; häufig wird auf kulturübergreifende Ähnlichkeiten in Kunst, Religion, Ritualen und sozialen Praktiken, die als »Beweis« dienen, oder auf das Konzept der anthropologischen Universalien verwiesen
Archetypen seien eng mit biologischen Argumentationen und/oder Ethologie/Verhaltensbiologie verknüpft sind, wobei die Definition von Archetypen als Instinkte/pattern of behavior, als angeboren, als genetisch vererbt usw. beibehalten wird
Archetypen sind inhaltslose Formen, die die menschliche Wahrnehmung zu bestimmten Bildern und Vorstellungen, aber auch zu Verhaltensmustern formen
Definitionen, die die letzte Konzeptualisierung einschließen, aber einen Blickwinkel der Systemtheorie hinzufügen, der den Aspekt der Selbstorganisation der Psyche sowie die Wechselwirkung von individuellen und Umweltfaktoren betont
Definitionen, die mit sehr formalen, z. B. mathematischen oder probabilistischen Merkmalen argumentieren; in einigen Fällen beziehen sie sich auf Ideen im Zusammenhang mit dem Pauli-Jung-Dialog
Philosophische Konzeptualisierungen: Archetypen sind formale Kategorien, die a priori gegeben sind und die Grundlage für die menschliche Wahrnehmung und das menschliche Handeln bilden; häufig nehmen diese Definitionen Bezug auf die aristotelische Metaphysik, auf kantische Kategorien oder platonische Ideen
Transzendentale Konzeptualisierungen im weitesten Sinne
Eine Kategorie von Argumentationen, die die Grenzen des Wissens über Archetypen stark betonen, die Qualität des Nichtwissens hervorheben usw.
Aus der Analyse der Beiträge der jungianischen Experten lässt sich eine allgemeine Schlussfolgerung ziehen: Es gibt definitiv keinen Konsens darüber, wie der Begriff des Archetyps zu definieren ist, sondern eine große Vielfalt von Standpunkten, die eine große Bandbreite unterschiedlicher und in gewisser Weise auch inkompatibler erkenntnistheoretischer Sichtweisen repräsentiert. Ein weiterer allgemeiner Befund ist, dass sie alle Denkansätze oder Argumentationsfiguren aufgreifen oder darauf verweisen, die bereits bei Jung zu finden sind. Daher wird sich die Analyse im nächsten Schritt den Originaltexten von Jung zuwenden und der Frage nachgehen, wie er den Begriff Archetyp definiert oder theoretisiert.
3 Die Theorie der Archetypen in Jungs Werken
1912 veröffentlichte Jung Wandlungen und Symbole der Libido (später revidiert als Symbole der Wandlung; GW 5), in der er die Phantasien einer jungen Frau untersucht und diese erstmals anhand von sogenannten archetypischen Mustern beschreibt. Dies war auch der Punkt, an dem er sich deutlich von Freuds Psychoanalyse entfernte und begann, seine eigene AP zu bilden. Hier zeigt sich, wie grundlegend der Begriff des Archetyps in der AP ist. In dieser Publikation untersucht Jung die Parallelen zwischen den Phantasiebildern einer jungen Frau und mythologischen Themen, z. B. dem Heldenmythos. Seine erste Verwendung des Begriffs Archetypus kann auf 1919 datiert werden:
»Auf dieser tiefen Ebene finden wir die a priori, angeborenen Formen der Intuition, nämlich die Archetypen der Wahrnehmung und Erkenntnis, die die notwendigen a priori Determinanten aller mentalen Prozesse sind« (Jung 1919, GW 9/I).5
Davor und synonym dazu verwendet Jung in seinen Werken auch den Begriff Bild, Urbild oder primordiales Bild; andere von Jung verwendete Begriffe sind: »symbolische Formen« (Jung 1921/1971, 625); »strukturelle Dominanten« (Jung 1942/1948, 222).
In den Definitionen von 1921 bezieht sich Jung unter der Überschrift Bild (GW 6, 759 – 773) auf den Begriff Archetypus, was ein Phantasiebild bedeutet, das Produkt unbewusster Phantasietätigkeit. Diese Phantasiebilder haben einen archaischen Charakter. Dieses Bild ist ein konzentrierter Ausdruck der gesamten psychischen Situation, nicht nur der unbewussten Inhalte, sondern auch derjenigen, die gerade konstelliert sind. Die Konstellation kommt durch die Aktivität des Unbewussten selbst zustande, die durch die aktuelle Bewusstseinssituation angeregt wird. Archaische Bilder haben eine auffällige Ähnlichkeit zu mythologischen Motiven, welche daher als kollektives Unbewusstes bezeichnet werden.
»Das urtümliche Bewußtsein, das ich auch als ›Archetypus‹ bezeichnet habe, ist immer kollektiv, d. h. es ist mindestens ganzen Völkern oder Zeiten gemeinsam. Wahrscheinlich sind die hauptsächlichsten mythologischen Motive allen Rassen und Zeiten gemeinsam; so konnte ich eine Reihe von Motiven der griechischen Mythologie in den Träumen und Phantasien von geisteskranken reinrassigen Negern nachweisen. Von einem naturwissenschaftlich-kausalen Gesichtspunkt aus kann man das urtümliche Bild als einen mnemischen Niederschlag, ein Engramm (SEMON) auffassen, das durch Verdichtung unzähliger, einander ähnlicher Vorgänge entstanden ist. In dieser Sicht ist es ein Niederschlag und damit eine typische Grundform eines gewissen, immer wiederkehrenden seelischen Erlebens. [...] Unter diesem Gesichtspunkt ist es ein psychischer Ausdruck einer physiologisch-anatomisch bestimmten Anlage.« (GW 6, 764 – 765)
Jung führt aus, dass die Form dieser psychologischen Bilder nicht einfach das Ergebnis der Beobachtung von Naturvorgängen sein kann, z. B. des Auf- und Untergangs von Sonne und Mond. Dies könne nicht die allegorisch-symbolische Verwendung dieser Bilder erklären. Andererseits macht er, wie im obigen Zitat, deutlich, dass er die Archetypen als durch immer wiederkehrende Erfahrungen der frühen Menschen, durch typische Erfahrungen der Menschheit, geformt sieht. Allerdings handelt es sich nach Jung nicht um Erfahrungen in der Außenwelt, sondern vielmehr in der Innenwelt der Psyche, die nur durch äußere Ereignisse aktiviert werden kann. Die Archetypen geben also ein Bild der inneren Welt des Menschen und nicht seiner Umwelt. Darüber hinaus plädiert Jung für eine biologische und erbliche Grundlage der Archetypen. Wir werden sehen, dass es bei Jung unterschiedliche Argumentationslinien zu dieser biologischen Grundlage gibt. Eine davon ist die Vorstellung, dass die interindividuelle und interkulturelle Ähnlichkeit archetypischer Muster durch die allen Menschen gemeinsame, ähnliche Gehirnstruktur zustande kommt (GW 6, 765). Das Urbild ist also die Voraussetzung dafür, dass Beobachtungen in der Natur und ihre Wahrnehmung ihre Ordnung erhalten. Das Urbild ist auch die Voraussetzung für Ideen, es übernimmt in seiner Erscheinung als Symbol die Aufgabe, undifferenzierte Wahrnehmungen und psychische Zustände mit Emotionen zu verbinden, ist also ein Vermittler.
»Das urtümliche Bild [...] ist ein eigener lebender Organismus, ›mit Zeugungskraft begabt‹, denn das urtümliche Bild ist eine vererbte Organisation der psychischen Energie, ein festes System welches nicht nur Ausdruck, sondern auch Möglichkeit des Ablaufes des energetischen Prozessess ist. Es charakterisiert einerseits die Art, wie der energetische Prozeß seit Urzeit immer wieder in derselben Weise abgelaufen ist, und ermöglicht zugleich auch immer wieder den gesetzesmäßigen Ablauf, indem es eine Apprehension oder psychische Erfassung von Situationen in solcher Art ermöglicht [...]. Diese Apprehension der gegebenen Situation wird durch das a priori vorhandene Bild gewährleistet.« (GW 6, 773)
Was sich bereits aus diesem frühen Text deutlich ableiten lässt, sind die Umrisse des Begriffs und die zentralen Elemente von Jungs Theorien rund um den Begriff der Archetypen. Ich würde sogar behaupten, dass die Hauptelemente des Konzepts schon lange vorher in Jungs Denken vorhanden waren. Sie finden sich in Symbole der Wandlung und wurden dann durch seine eigenen Erfahrungen während seiner Krise nach dem Bruch mit Freud bestätigt. Diese Elemente sind:
die apriorische Natur von Archetypen, was bedeutet, dass sie dem menschlichen Verstand gegeben werden, bevor es irgendwelche Erfahrungen gibt
sie sind völlig unbewusst und waren nie bewusst, waren also nie ein Element des bewussten Erlebens (in starkem Gegensatz zu Freuds Vorstellung, der davon ausging, dass unbewusstes Material hauptsächlich aus ehemals bewussten Erfahrungen besteht, die dann verdrängt wurden, mit Ausnahme der sogenannten Urphantasien)
sie sind Organisatoren der Wahrnehmung und verantwortlich für die Bildung von Ideen und psychischen Bildern (GW 8, 403)
sie erscheinen zuerst und vor allem als Bilder
sie sind kollektiv, also über alle Zeiten, Epochen und Völker hinweg ähnlich
sie verbinden den modernen Menschen mit archaischen Menschen in der Vorgeschichte und mit der Naturgeschichte im Allgemeinen
sie kanalisieren Emotionen und psychische Energie
sie haben eine biologische Grundlage und sind in gewisser Weise mit den Instinkten von Tieren vergleichbar
»Der Archetypus ist reine, unverfälschte Natur, und es ist die Natur, die den Menschen veranlaßt, Worte zu sprechen und Handlungen auszuführen, deren Sinn ihm unbewußt ist, und zwar so unbewußt, daß er nicht einmal darüber denkt. [...] Angesichts der Ergebnisse der modernen Psychologie kann kein Zweifel mehr darüber walten, daß es vorbewußte Archetypen gibt, die nie bewußt waren und indirekt nur durch ihre Wirkungen auf die Bewußtseinsinhalte festgestellt werden können. Es besteht meines Erachtens kein haltbarer Grund gegen die Annahme, daß alle psychischen Funktionen, die uns heute als bewußt erscheinen, einmal unbewußt waren und doch annähernd so wirkten, wie wenn sie bewußt gewesen wären. Man könnte auch sagen, daß alles, was der Mensch an psychischen Phänomenen hervorbringt, schon vorher in naturhafter Unbewußtheit vorhanden war.« (GW 8, 412)
Dieses Zitat fügt den Grundzügen von Jungs Archetyp-Konzept zwei weitere Elemente hinzu: Jung geht davon aus, dass der Primärzustand der Psyche unbewusst ist, was bedeutet, dass sich im Laufe der Entwicklung das Bewusstsein aus einem allgemeinen Primärzustand des Unbewussten entwickelt. Andererseits gibt es die Vorstellung, dass dieses kollektive Unbewusste, das die Archetypen enthält, eine bestimmte Richtung, ein Ziel oder sogar eine Absicht hat (s. u.).
Das vielleicht wichtigste Merkmal von Jungs Konzept der Archetypen ist ihre Universalität, was bedeutet, dass sie von allen Menschen geteilt werden, unabhängig von Zeit und Ort (GW 9/I, 273). Dieser Gedanke ist für Jungs Argumentation insofern von großer Bedeutung, als sie bei jedem Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt spontan wieder auftauchen können, nämlich im Falle der Psychopathologie. Daran anknüpfend ist es für sein Konzept des psychotherapeutischen Prozesses von großer Bedeutung, weil es von der Annahme ausgeht, dass der Prozess von Archetypen geleitet wird. Jung setzt auf die Existenz und Verfügbarkeit aller Archetypen in jedem Menschen. Der Aspekt der Universalität ist auch für Jungs Erklärung von Ähnlichkeiten in kulturellen Gewohnheiten, Mythologien und religiösen Vorstellungen von Bedeutung.
»Das kollektive Unbewußte entwickelt sich nicht individuell, sondern wird ererbt. Es besteht aus präexistenten Formen, Archetypen, die erst sekundär bewußtwerden können und den Inhalten des Bewußtseins festumrissene Form verleihen.« (GW 9/I, 90)
Grundlegend für Jungs Konzept ist die Vorstellung, dass sich Archetypen in der Vorgeschichte des Menschen entwickelt haben, daher ihr archaischer Charakter (Arche-Typ). Sie sind ein Erbe, das aus früheren Zeiten auf uns moderne Menschen übergegangen ist (GW 7, 104): »die unveränderliche Struktur einer psychischen Welt« (GW 9/I, 451). In gewisser Weise sind sie unsere archaische Natur und verbinden uns mit unseren Vorfahren in der Vorgeschichte (GW 16, 254). Hier argumentiert Jung auch evolutionstheoretisch, so wie der Körper habe sich auch die Psyche über Jahrmillionen entwickelt und trägt deshalb immer noch archaische Spuren (GW 9/I, 348). Diese archaischen Muster werden von Jung als näher an der Natur betrachtet. Das Vorhandensein von Archetypen, dem kollektiven Unbewussten, zu dem wir alle Zugang haben, ermöglicht es dem modernen Menschen, ein ganzheitliches Leben zu führen.
»Er schlägt eine Brücke zwischen dem von Entwurzelung bedrohten Gegenwartbewußtsein und der naturhaften, unbewußt-instinktiven Ganzheit der Vorzeit«. (GW 9/I, 293; s. a. den Begriff Archaismus in GW 6, 754)
Es gibt bei Jung die Vorstellung, dass sich die Archetypen über Jahrtausende in der Vorgeschichte als Niederschlag von Erfahrungen des frühen Menschen gebildet haben, sie sind »Residuen oder [...] Engramme« (GW 7, 158) – daher: Arche-Typus (GW 18, 80).
»[...] man annimmt, sie seien Niederschläge stets sich wiederholender Erfahrungen der Menschheit. [...] Der Archetypus ist eine Art Bereitschaft, immer wieder dieselben oder ähnliche mythische Vorstellungen zu reproduzieren« (GW 7, 109; s. a. Zitat oben S. 12, GW 6, 760; Jung & Meyer-Grass 2008, S. 162)
»Es gibt so viele Archetypen, als es typische Situationen im Leben gibt. Endlose Wiederholung hat diese Erfahrungen in die psychische Konstitution eingeprägt [...]« (GW 9/I, 99)
Es ist bereits deutlich geworden, dass die Angeborenheitsidee von Archetypen für Jung zentral ist. In der ersten Publikation, in der er den Begriff »Archetypus« verwendete (Jung 1919), spricht Jung explizit von Archetypen als »den a priori angeborenen Formen der Intuition«. Fast in allen Fällen, in denen Jung den Begriff Archetyp definiert oder beschreibt, verweist er auf seine Überzeugung, dass sie angeboren sind. Jung geht davon aus, dass Archetypen den Instinkten ähnlich sind, sie bilden unsere instinktive Natur. Jung setzt seine Archetypen mit dem Begriff pattern of behavior aus der Ethologie gleich, den er auch synonym mit dem Begriff Instinkt verwendet. Bei Jung ist der Archetyp ein angeborenes Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster, das die menschliche Wahrnehmung und Handlung beeinflusst und in ähnliche Formen bringt. Jung (1919, GW 8) detailliert in seinem Text Instinkt und Unbewusstes den Zusammenhang zwischen den Begriffen Archetyp und Instinkt: Er argumentiert, dass Instinkte typische Verhaltensformen sind. Überall dort, wo es ähnlich wiederholte Reaktionsformen gibt, kann dies als Instinkt bezeichnet werden (273). Während die Instinkte des Menschen ihn zu bestimmten menschlichen Verhaltensweisen motivieren, zwingen die Archetypen die Wahrnehmung der Außenwelt in spezifische menschliche Bilder und Konzepte. In diesem Sinne sind die Archetypen Determinanten der menschlichen Wahrnehmung (177). Es ist anzumerken, dass es einen Unterschied zwischen Jungs Theorien des Instinkts und des Archetyps gibt, auch wenn eine enge Korrelation besteht. Wie wir später sehen werden, verwendet Jung die Begriffe Instinkt/pattern of behavior und Archetyp synonym. In seinem Aufsatz von 1919 fasst Jung zusammen, dass jeder Mensch, ebenso wie er Instinkte hat, auch Urbilder/Archetypen hat. Das kollektive Unbewusste ist die Summe all ihrer Instinkte und deren Korrelate, der Archetypen (281).
»Es handelt sich bei diesem Begriff, wie bekannt, nicht um eine ›vererbte Vorstellung‹, sondern um einen vererbten Modus der psychischen Funktion, also jene angeborene Art und Weise, nach der das Hühnchen aus dem Ei kommt, die Vögel ihre Nester bauen, [...] also um ein ›pattern of behaviour‹. Dieser Aspekt des Archetypus ist der biologische« (GW 18, 1228; s. a. GW 8, 404; GW5, 158; GW 9/I, 136).
Eine wichtige Implikation dieser Perspektive ist die Sichtweise, dass der Mensch nicht als Tabula rasa/unbeschriebenes Blatt geboren wird, eine Annahme, die zu Jungs Zeit während des neu aufkommenden Behaviorismus sehr dominant war. Als Konsequenz aus diesem Glauben gibt es die wichtige Idee Jungs von einer Präformation der Psyche:
»Der Mensch ist nämlich ›im Besitze‹ vieler Dinge, die er sich nie erworben, sondern die er von seinen Ahnen ererbt hat. Er wird ja nicht als tabula rasa, sondern bloß als unbewußt geboren. Er bringt aber spezifisch menschlich organisierte, funktionsbereite Systeme mit, welche er den Millionen Jahren menschlicher Entwicklung verdankt. [...] so bringt auch der Mensch bei seiner Geburt die Grundzeichnung seines Wesens und zwar nicht nur seiner individuellen, sondern auch seiner kollektiven Natur mit. Die ererbten Systeme entsprechen den seit der Urzeit prävalierenden menschlichen Situationen.« (GW 4, 728; s. a. GW 8, 435; GW 5, 224)
In Bezug auf die Bedeutung des Archetyps verwendet Jung etwas rätselhafte Beschreibungen über die Beziehungen zwischen Instinkt und Archetyp und wie sie sich in der Psyche manifestieren, z. B. dass das Bild die Bedeutung des Instinkts darstellt und der Archetyp die Selbstdarstellung der Instinkte in der Psyche ist (GW 8, 277).
»Trieb und archaischer Modus koinzidieren im biologischen Begriff des pattern of behaviour. Es gibt nämlich keinen amorphen Trieb, indem jeder Trieb die Gestalt seiner Situation hat. Er erfüllt stets ein Bild, das feststehende Eigenschaften besitzt. [...] Ein solches Bild ist ein Typus apriorischer Natur. Er ist [...] eingeboren vor aller Betätigung, denn letztere kann überhaupt nur stattfinden, wenn ein entsprechend gestalteter Trieb Anlaß und Möglichkeit dazu gibt. Dieses Schema gilt für alle Triebe und ist in identischer Form in allen Individuen derselben Gattung vorhanden. Das gleiche gilt für den Menschen: er hat a priori Instinkttypen in sich, welche Anlaß und Vorlage seiner Tätigkeiten bilden, insofern er überhaupt instinktiv funktioniert. Als biologisches Wesen kann er überhaupt nicht anders als sich spezifisch menschlich verhalten und sein pattern of behaviour erfüllen. Damit sind den Möglichkeiten seiner Willkür enge Grenzen gesetzt, um so enger, je primitiver er ist und je mehr sein Bewußtsein von der Instinktsphäre abhängt. [...] Sie sind nämlich nicht nur Relikte oder noch vorhandene Reste früherer Funktionsweisen, sondern immer vorhandene, biologisch unerläßliche Regulatoren der Triebsphäre, deren Wirksamkeit sich durch den ganzen Bereich der Psyche erstreckt und erst dort ihre Unbedingtheit einbüßt, wo sie von der relativen Freiheit des Willens beschränkt wird. Das Bild stellt den Sinn des Triebes dar.« (GW 8, 398)
»[...] daß die Archetypen die unbewußten Abbilder der Instinkte selbst sind; [...] sie stellen das Grundmuster instinkthaften Verhaltens dar.« (GW 9/I, 91)
So wie ich Jung hier verstehe, versucht er folgende Idee vorzubringen: Die Instinkte bei Tieren werden durch typische Signale oder Situationen aktiviert (Angeborener Auslösemechanismus/AAM in der Ethologie) und können als angemessene Reaktion auf diese Situation, als Anpassung an die Anforderungen der Umwelt angesehen werden – was eine sehr darwinistische Argumentationsform ist. Parallel zu diesen Instinkten bei Tieren sieht er die Archetypen beim Menschen als ein System, das den Menschen auf eine angemessene Reaktion auf eine bestimmte Situation in seiner Umwelt vorbereitet. Es handelt sich gewissermaßen um eine adaptive, ganzheitliche Form des Verhaltens im Einklang mit der Natur – wobei unter Natur sowohl die Anforderungen der Umwelt als auch die Anforderungen der eigenen Psyche verstanden werden können. Und anstelle des angeborenen Auslösemechanismus der Ethologie ging Jung davon aus, dass die Parallele im Archetypus ein Bild ist (GW 4, 728).6
Daher sind und erscheinen Archetypen in erster Linie als Bilder (GW 8, 440), Jung verwendete ursprünglich sogar den Begriff Bild anstelle von Archetyp (z. B. Definitionen, GW 6). Der oben skizzierte Gedanke, dass der Archetyp als Anpassung an bestimmte typische Situationen (mit denen der Mensch seit der Urgeschichte immer wieder konfrontiert wird) ein präformiertes Verhaltensmuster aktiviert, steht im Zusammenhang mit der Idee eines Auslösemechanismus, mit dem Jung wiederum eine Parallele zwischen dem Archetyp und dem Begriff des pattern of behavior herzustellen versucht:
»Bei jedem Vorliegen einer Paniksituation – äußerer oder innerer Art – greifen die Archetypen ein und verhelfen dem Menschen dazu, in instinktiv angepaßter Weise zu reagieren, so wie wenn er die Situation schon immer gekannt hätte: er reagiert so, wie die Menschheit schon immer reagiert hat.« (GW 18, 368)
»›Bild‹ drückt nicht nur die Form der auszuübenden Tätigkeit, sondern auch zugleich die typische Situation aus, in welcher die Tätigkeit ausgelöst wird.« (GW 9/I, 152; s. a. GW 10, 547)
Bei der Frage, wie die biologische Basis dieser archetypischen Muster spezifiziert werden kann, argumentiert Jung oft mit der identischen Gehirnstruktur, die allen Menschen gemeinsam ist: »Sie vererben sich mit der Hirnstruktur, ja, sie sind deren psychischer Aspekt.« (GW 10, 53; s. a. GW 6, 748; GW 7, 109)
Jung beschreibt »das kollektive Unbewusste« als psychische Inhalte, die »nie im Bewusstsein [gewesen sind] und [...] somit nie individuell erworben [wurden], sondern [...] ihr Dasein ausschließlich der Vererbung [verdanken]« (GW 9/I, 88, Hervorhebung C. Roesler). Dies beschreibt die Bedeutung des Begriffs a priori, den Jung immer wieder verwendet, um die Archetypen zu charakterisieren. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass Archetypen vorhanden sind, bevor es eine persönliche Erfahrung gibt, die den Geist prägen könnte. In diesem Sinne sind Archetypen von Erfahrungen unberührt, sie verändern sich nicht durch Erfahrungen und, was am bedeutsamsten ist, sie sind in erster Linie unbewusst und waren noch nie bewusst (GW 9/I, 265): »[...] daß er seine Existenz nicht persönlicher Erfahrung verdankt und daher keine persönliche Erwerbung ist.« (GW 9/I, 88, auch 451; GW 8, 311)
»[...] wurden typische Mythologeme gerade bei Individuen beobachtet, wo dergleichen Kenntnisse ausgeschlossen waren. Solche Ergebnisse nötigten zur Annahme, daß es sich um ›autochthone‹ Wiederentstehungen jenseits aller Tradition handeln müsse, mithin um das Vorhandensein von ›mythenbildenden‹ Strukturelementen der unbewußten Psyche.« (GW 9/I, 259, auch 262)
Die Idee der autochthonen Wiederentstehung archetypischer Elemente ist für Jungs Psychologie absolut entscheidend: »[...] sie können spontan, zu jeder Zeit, an jedem Ort und ohne äußeren Einfluss wieder auftauchen.« (GW 9/I, 153), »welche durch keine Übermittlung von außen beinflußt ist« (GW 9/I, 153), da seine psychotherapeutische Methode auf der Überzeugung beruht, dass diese Elemente im Laufe des psychotherapeutischen Prozesses in Form von Bildern im Klienten reaktiviert werden.
»[...] daß es sich bei dieser Methode um die spontane [...] Manifestation eines an sich unbewußten Prozesses handelte, dem ich später den Namen ›Individuationsprozeß‹ gab.« (GW 8, 400)
Auf der anderen Seite findet Jung Belege für das Wirken – die autochthone Wiederbelebung – archetypischer Muster in den kreativen Produktionen seiner Patienten:
»Das anfänglich chaotische Vielerlei der Bilder verdichtete sich im Laufe der Arbeit zu gewissen Motiven und Formelementen, welche sich in identischer oder analoger Gestalt bei den verschiedensten Individuen wiederholten [...]. Die Zentrierung bildet den in meiner Erfahrung nie überschrittenen Höhepunkt der Entwicklung, welcher sich als solcher dadurch charakterisiert, daß er mit dem praktisch größtmöglichen therapeutischen Effekt zusammenfällt. [...] Ich kann davon nur soviel sagen, daß es wohl kein Motiv irgendwelcher Mythologie gibt, das nicht gelegentlich in diesen Produkten auftaucht. Wenn überhaupt nennenswerte Kenntnisse mythologischer Motive bei meinen Patienten vorhanden waren, so wurden sie von den Einfällen der gestaltenden Phantasie bei weitem überboten. In der Regel waren die mythologischen Kenntnisse meiner Patienten minim.« (GW 8, 401)
Das Konzept der Archetypen entwickelte sich aus Jungs psychiatrischen Erfahrungen mit psychotischen Patienten und deren Phantasien in der Klinik Burghölzli. Er erlebte Fälle, in denen psychotische Patienten Phantasien entwickelten, die Parallelen zu Motiven aus der antiken Mythologie aufwiesen. Der wichtigste Fall in dieser Hinsicht ist der sogenannte »Sonnenphallus-Mann«, ein Patient im Burghölzli, der Jung von einem Phallus erzählte, der aus der Sonne kommt und den Wind erzeugt. Jung war darüber sehr erstaunt, da er gerade einen altägyptischen Text übersetzt hatte, der das gleiche Bild enthielt (GW 5, 158) – insofern gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Archetypen und Psychopathologie.
»Der Archetypus geht nicht etwa aus physischen Tatsachen hervor, sondern er schildert vielmehr, wie die Seele die physische Tatsache erlebt, wobei sie (die Seele) des öfteren dermaßen selbstherrlich verfährt, daß sie die tastbare Wirklichkeit leugnet und Behauptungen aufstellt, die der Wirklichkeit ins Gesicht schlagen.« (GW 9/I, 260)
Jung vermutete, dass hinter Psychose und Schizophrenie ein Durchbruch des kollektiven Unbewussten steckte, das als »archaische[...] Triebe, vergesellschaftet mit unverkennbar mythologischen Bildern« in Erscheinung tritt (GW 8, 281). Ein wichtiger Gedanke ist also, dass Archetypen die Phantasien und sogar die Symptome bei psychopathologischen Störungen, insbesondere bei Psychosen und allen Formen der Paranoia, prägen. Die Archetypentheorie war ursprünglich ein Versuch, die Bilderwelt der Psychose zu erklären, basierend auf Jungs und Bleulers innovativem Ansatz zur Behandlung der Schizophrenie, nämlich der Annahme, dass hinter diesen Phantasien ein Sinn steht und es für therapeutische Zwecke wichtig ist, Zugang zu einem Verständnis dieser Ideen und Bilder zu bekommen. Aber nicht nur in der Psychose dienen die Archetypen als Erklärungsmodell. Jung geht auch davon aus, dass Archetypen persönlichen Komplexen zugrunde liegen und diese begründen. Generell basiert Jungs Erklärungstheorie der Psychopathologie unter Verwendung des Archetypenkonzepts auf der Idee, dass die psychischen Störungen, insbesondere die psychotischen Störungen, mit einer mangelnden Abgrenzung des Bewusstseins vom kollektiven Unbewussten bzw. von archetypischen Kräften zu tun haben. Wenn das Bewusstsein nicht in der Lage ist, sich von den archetypischen Kräften abzugrenzen, wird es davon ergriffen, und die Phantasieproduktion wird von archetypischen Mustern beherrscht. Die Notwendigkeit, sich von den Archetypen abzugrenzen, ist nicht nur ein Thema in der Psychopathologie, sondern gilt für die gesamte menschliche Entwicklung. Die individuelle Entwicklung ist nach Jung mit der Vorstellung verknüpft, dass das Problem der Abgrenzung des Bewusstseins vom kollektiven Unbewussten auch auf der Ebene der Entwicklung der Menschheit aus prähistorischer Zeit zu finden ist – ein Konzept, das als Homologie von Phylogenese und Ontogenese bezeichnet wird (▸ Kap. 6). Konkret geht es um die Vorstellung eines entwicklungsgeschichtlich frühen Geisteszustandes (»Primitivismus«/Archaismus), in dem das Bewusstsein nicht zwischen den Produktionen der eigenen Innenwelt und den Erfahrungen in der äußeren, physischen Welt unterscheiden kann. Jung nennt dies Identität, ein Begriff, der von dem heutigen psychologischen Begriff Identität im Sinne eines Selbstkonzepts zu unterscheiden ist. Für Jung ist die Bedeutung mehr oder weniger gleichbedeutend mit Verschmelzung im Sinne einer Abwesenheit von Differenzierung. In diesem Geisteszustand kann die Person nicht über ihre innere Welt reflektieren; es gibt keine Beobachterposition in Bezug auf die innere Welt. Jung geht so weit zu behaupten, dass dieser »primitive« Gemütszustand im Allgemeinen bei, wie er es nennt, »primitiven Völkern« zu finden ist sowie bei bestimmten psychopathologischen Gemütszuständen des modernen Menschen, nämlich dann, wenn Projektionen von unbewussten Inhalten auftreten. Diese beiden werden in Jungs Theorie gleichgesetzt. Für diese Zustände bedient er sich des Begriffs Participation mystique von Lévy-Bruhl (1912), den er in seinen Werken 60-mal zitiert (z. B. GW 9/I, 226).
»Unsere Mentalität ist noch so primitiv, daß sie erst in gewissen Funktionen und Gebieten sich aus der primären mystischen Identität mit dem Objekt befreit hat. Der Primitive hat, bei einem Minimum von Selbstbesinnung, ein Maximum von Bezogenheit aufs Objekt, das sogar einen direkt magischen Zwang auf ihn ausüben kann. Die ganze primitive Magie und Religion beruht auf diesen magischen Objektbeziehungen, welche in nichts anderem bestehen als in Projektionen unbewußter Inhalte ins Objekt. Aus diesem anfänglichen Identitätszustand hat sich allmählich die Selbstbesinnung entwickelt.« (GW 8, 516)
»Die Bestimmtheit und Gerichtetheit der Bewußtseinsinhalte ist eine in der Stammesgeschichte erst sehr spät erworbene Eigenschaft, die z. B. beim heutigen Primitiven in höherem Maße fehlt. Ebenso ist sie vielfach durchbrochen beim Neurotischen, der sich dadurch vom Normalen insofern unterscheidet, als bei ihm die Bewußtseinsschwelle verschiebbarer oder, mit anderen Worten, die Scheidewand zwischen Bewußtsein und Unbewußtem durchlässiger ist. Der Psychotische vollends steht ganz unter dem direkten Einfluß des Unbewußten.« (GW 8, 134)
Obwohl Jung betont, dass er die Archetypen in der Biologie des Menschen verwurzelt sieht, was bedeutet, dass das menschliche Verhalten stark von instinktiven Mustern oder Energien gesteuert wird, ist das zentrale Thema seiner Psychologie die Frage, wie sich der Mensch aus diesen Beschränkungen heraus entwickeln und frei werden kann, um freie Entscheidungen zu treffen und ein bewusstes Leben zu führen. Dies ist, wie Jung es sieht, das Hauptziel des Individuationsprozesses sowie der Psychotherapie/Analyse: sich des Unbewussten und der archetypischen Faktoren, die die Persönlichkeit beeinflussen, bewusst zu werden und so den Geist davon zu befreien, nur etwas Natürliches zu sein. Deshalb nennt Jung Analyse und Individuation ein »opus contra naturam«. In diesem Sinne stimmt Jung Freud zu, dass wo Unbewusstes war, Bewusstsein sein soll.