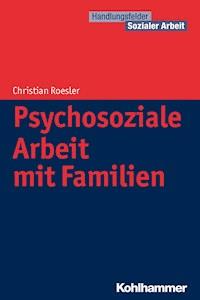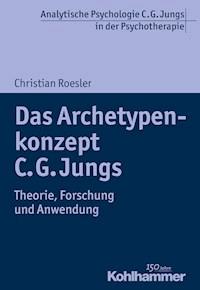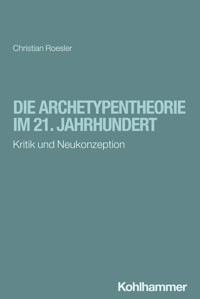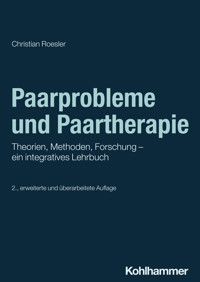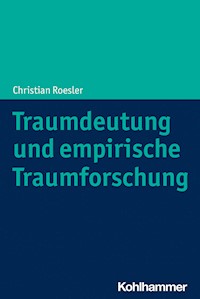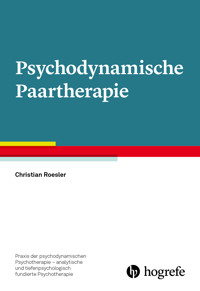
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Paartherapie stellt in der psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung eine wichtige Größe dar, denn schwerwiegende chronische Paarkonflikte tragen erheblich zur Entwicklung und Aufrechterhaltung psychischer wie auch körperlicher Erkrankungen bei. Dieser Band stellt eine forschungsbasierte und integrative Form der psychodynamischen Behandlung von Paarproblemen bzw. Störungen in Paarbeziehungen vor. Einleitend wird eine allgemeine Definition von Paarproblemen sowie ein Überblick über deren Verbreitung gegeben. Weitere Kapitel stellen Forschungsergebnisse und Theorien zu Paarbeziehungen und Paardynamik vor, erörtern psychodynamische Konzepte für die Paartherapie und informieren über die Wirksamkeitsforschung in diesem Bereich. Basierend auf diesen Ausführungen wird ein theoretisches Erklärungsmodell für die Entstehung von Paarproblemen aus psychodynamischer Sicht vorgestellt, um darauf abgestimmte Interventionen zu begründen. Der Fokus liegt dabei auf den Emotionen, Bedürfnissen und Beziehungsmustern. Ziel der Interventionen ist es u.a., problematische Interaktionsmuster zu identifizieren und aus der Entwicklungsgeschichte heraus zu verstehen sowie korrigierende emotionale Beziehungserfahrungen herbeizuführen. In einem abschließenden Kapitel wird auf Möglichkeiten der Diagnostik eingegangen. Die praxisnahen Ausführungen mit Beispielen bieten hilfreiche Anregungen, um Paare bei der Bewältigung ihrer Konflikte zu unterstützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christian Roesler
Psychodynamische Paartherapie
Praxis der psychodynamischen Psychotherapie – analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Band 16
Psychodynamische Paartherapie
Prof. Dr. Christian Roesler
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Manfred E. Beutel, Prof. Dr. Stephan Doering, Prof. Dr. Falk Leichsenring, Prof. Dr. Günter Reich, Prof. Dr. Simone Salzer
Die Reihe wurde begründet von:
Prof. Dr. Manfred E. Beutel, Prof. Dr. Stephan Doering, Prof. Dr. Falk Leichsenring, Prof. Dr. Günter Reich
Prof. Dr. phil. Christian Roesler, geb. 1967. 1988 – 1995 Studium der Psychologie in Freiburg. 1999 Approbation zum Psychologischen Psychotherapeuten, Fachkundenachweis für Analytische Psychotherapie. 2022 Habilitation. 2000 – 2008 Leitung der Ev. Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen in Lörrach. Seit 2000 private psychotherapeutische Praxis für Analytische Psychotherapie und Paartherapie in Freiburg. Seit 2008 Professur für Klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg. Seit 2008 Dozentur für Analytische Psychologie an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel. Seit 2022 Privatdozent für Psychotherapiewissenschaft an der Sigmund Freud Universität Linz. Forschungsschwerpunkte: Analytische Psychologie, Paartherapie / -beratung, Familienkonflikte und -mediation, Narrative Identität und Biografieforschung, Medienpsychologie.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Matthias Lenke, Weimar
Format: EPUB
1. Auflage 2024
© 2024 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3129-1; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3129-2)
ISBN 978-3-8017-3129-8
https://doi.org/10.1026/03129-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1 Grundlagen der Paarbeziehung: Paarbeziehung in der Spätmoderne
2 Grundlagen: Paarprobleme und Beziehungsstörungen
2.1 Diagnostische Definition
2.2 Paarbeziehung aus sozialwissenschaftlicher Sicht
2.3 Trennung und Scheidung und ihre Auswirkungen
2.4 Paarbeziehung und Gesundheit
2.5 Paartherapie bei psychischen und körperlichen Erkrankungen
3 Paartherapie im deutschen Versorgungssystem
4 Ein forschungsbasiertes Modell von Paarbeziehung und Paardynamik
4.1 Gottmans Forschung zur Paarinteraktion
4.2 Neuroaffektive Theorie
4.3 Mentalisierung und affektive Erregung
4.4 Paarbeziehungen als Bindungsbeziehungen – der Beitrag der Bindungstheorie
4.5 Exkurs: Zum Verhältnis von Bindung und Sexualität – getrennte Systeme oder Interdependenz?
4.6 Konsequenzen für die Praxis der Paartherapie
5 Was ist psychodynamische Paartherapie?
6 Störungsmodelle und -theorien: Psychodynamische Konzepte von Paardynamik und Paartherapie
6.1 Geschichtliche Entwicklung der Behandlung von Paarproblemen
6.2 Reinszenierung verinnerlichter Beziehungserfahrungen
6.3 Beziehungsanalyse nach Bauriedl
6.4 Das Kollusionskonzept
6.5 Ko-Evolution und die Arbeit mit Vorwürfen
6.6 Komplementarität, Polarisierung und das Entwicklungspotenzial von Paarbeziehungen
6.7 Modelle der Paartherapie des Tavistock Relationships Institute
6.8 Object Relations Couple Therapy
6.9 Ein integratives Modell tiefenpsychologischer Paarberatung am Evangelischen Zentralinstitut für Familienberatung Berlin (EZI)
6.10 Symbolisierende Arbeitsformen in der Paartherapie
6.11 Mentalisierungsbasierte Paartherapie
6.12 Exkurs: Ist die Emotionsfokussierte Paartherapie psychodynamisch?
7 Wirkungsforschung zur Paartherapie mit Fokus auf psychodynamischen Ansätzen
8 Ein psychodynamisch-integratives Modell von Paartherapie
8.1 Theoretisches Modell
8.2 Therapeutische Grundhaltung
8.3 Starke Strukturierung des therapeutischen Gesprächs
8.4 Fokus auf Emotionen und Interaktionsmuster
8.5 Interaktionsmuster identifizieren und aus der Entwicklungsgeschichte heraus verstehen
8.6 Korrigierende emotionale Beziehungserfahrungen herbeiführen
8.7 Mentalisierungsfähigkeit verbessern
8.8 Symbolisierungsmöglichkeiten für Unsagbares anbieten
9 Diagnostik: Einschätzung der Klienten und der Beziehung
Weiterführende Literatur
Literatur
Anhang
Anhang 1: Formen und Motive der Partnerwahl (nach Peseschkian, 2004)
Anhang 2: Phasenmodell des am Lebenszyklus orientierten Verlaufs von Paarbeziehungen
Anhang 3: Die GARF-Skala: Einführung und Hinweise zur Anwendung
|1|Einführung
Im vorliegenden Band wird die psychodynamische Behandlung von Paarproblemen bzw. Störungen in Paarbeziehungen dargestellt. Der Band wird somit insofern von dem üblichen Konzept dieser Reihe abweichen, als Paarprobleme nicht als psychische Störungen bzw. gesundheitliche Probleme von Krankheitswert in den gängigen Klassifikationssystemen kodiert und auch nicht im Gesundheitssystem als solche betrachtet werden. Trotzdem stellt Paartherapie innerhalb der psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung eine wichtige Größe dar. Denn schwerwiegende chronische Paarkonflikte tragen erheblich zur Entwicklung und Aufrechterhaltung psychischer wie körperlicher (!) Erkrankungen bei und sind für die Prognose beider ein wesentlicher Faktor, was leider oft übersehen wird (vgl. Dietzen et al., 2019; Frisch et al., 2017; Reich & von Boetticher, 2020).
Darüber hinaus kann die Psychoanalyse auf eine lange Tradition von paartherapeutischen Ansätzen zurückschauen. In jüngerer Zeit liegen sogar manualisierte Ansätze vor. Entsprechend dem Konzept der Reihe werden die Modelle der Paardynamik, der Entstehung von Störungen in Paarbeziehungen und darauf aufbauend deren therapeutische Bearbeitung im Überblick beschrieben. Zunächst werden zeitgemäße forschungsbasierte Modelle und Konzepte von Paarbeziehung und Paardynamik beschrieben (Kapitel 4). Diese umfassen Forschungen zur Paarinteraktion, zum Verlauf von Paarbeziehungen, neurowissenschaftliche Konzepte zur dyadischen Emotionsregulation (affektive Neurowissenschaft), den Mentalisierungsansatz sowie die Bindungstheorie (Konzeptualisierung erwachsener Paarbeziehungen als Bindungsbeziehungen). Diese Konzepte wiederum lassen sich gut mit zeitgenössischen psychodynamischen Modellen, die in Kapitel 6 ausführlich beschrieben werden, zu einem kohärenten Konzept für die Beschreibung von Paarbeziehungen, der Entstehung von Problemen in Paarbeziehungen und deren Behandlung integrieren (Kapitel 8).
Ein Überblick über die Forschung zur Wirksamkeit psychodynamischer Paartherapie gibt Hinweise darauf, welche Vorgehensweisen sich als besonders wirkungsvoll erwiesen haben. Darauf aufbauend werden, auch |2|unter Rückgriff auf schon vorliegende manualisierte Paartherapiemodelle, die grundlegenden Elemente einer modernen psychodynamischen Paartherapie im Sinne eines Prozessmanuals beschrieben und an Beispielen erläutert. Hierbei werden die klassischen psychodynamischen Behandlungsdimensionen wie Übertragung – Gegenübertragung, therapeutische Beziehung, Abwehrmechanismen, insbesondere die interpersonelle Abwehr, integriert.
|3|1 Grundlagen der Paarbeziehung: Paarbeziehung in der Spätmoderne
Es gibt wenige Grundmuster menschlichen Verhaltens, die derart über alle Kulturen und Epochen verbreitet sind wie die Institutionalisierung von Paarbeziehungen. Nicht nur findet man in praktisch allen Kulturen zu allen Zeiten, von einfachsten Jäger-Sammler-Gruppen bis hin zu hochkomplexen Gesellschaften, ein Zusammenleben von Mann und Frau in einer zumeist lebenslang dauernden Verbindung, sondern auch die ritualisierten Formen der Zusammenführung der beiden Partner1 in Form der Heirat sowie die darum herum gruppierten Regeln gleichen sich über viele Kulturen hinweg in hohem Maße (Levi-Strauss, 1976). Im Ethnografischen Atlas des Kulturanthropologen Murdock (1967), einer Untersuchung von 849 menschlichen Gesellschaften und ihren Eheformen, fand sich, dass weit über 90 % der untersuchten Ethnien eine lebenslange monogame Form des Zusammenlebens von Mann und Frau praktizierten. Insofern kann man die heterosexuelle Paarbeziehung durchaus als eine anthropologische Grundkonstante bezeichnen (siehe dazu ausführlich Roesler, 2024). Vor diesem Hintergrund lässt sich Paarbeziehung folgendermaßen definieren: „Eine Paarbeziehung ist eine enge, persönliche und intime, auf Dauer angelegte, exklusive Beziehung zwischen erwachsenen Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts. Typischerweise zeichnet sich eine Paarbeziehung durch Liebe, persönliches Vertrauen und sexuelle Interaktion aus“. Ebenso stellt das Auftreten von Konflikten und Leid in Paarbeziehungen eine Grundkonstante menschlichen Zusammenlebens dar, eines der zentralen Themen der menschlichen Geistesgeschichte von den frühesten Mythen bis hin zur modernen Filmindustrie.
Dabei sind in spätmodernen Gesellschaften sowohl die Ansprüche an als auch die Herausforderungen für Paarbeziehungen deutlich gewachsen, was sich in einer weiten Verbreitung von Paarproblemen niederschlägt. |4|Allein schon die hohe Scheidungsrate macht deutlich, dass die Belastung von Paarbeziehungen mit Beziehungsproblemen erheblich ist und ein hoher Bedarf an Paartherapie besteht. Mittlerweile ist auch wissenschaftlich gut abgesichert, dass die Folgen von Trennung/Scheidung nicht nur für die davon betroffenen Kinder, sondern auch für die beteiligten Partner, selbst für diejenigen, die die Trennung initiieren, mit erheblichen Schäden verbunden sind. Ähnliches gilt auch für anhaltende ungelöste Paarkonflikte, die nicht zur Trennung der Partner führen. Demgegenüber zeigen aktuelle Studien, dass bei jungen Menschen eine verbindliche langdauernde Paarbeziehung für die allermeisten nach wie vor zu den wichtigsten Werten im Leben zählt. Die Sehnsucht nach stabilen und erfüllenden Paarbeziehungen ist auch heute noch ungemindert – die Rhetorik von der „Versingelung“ der Gesellschaft oder dem Zerfall tragfähiger Bindungen ist durch die Datenlage nicht gestützt. Allerdings haben offenbar zunehmend mehr Menschen Schwierigkeiten damit, die in Paarbeziehungen auftretenden Konflikte zu bewältigen oder schrecken gar grundsätzlich vor intimen Beziehungen zurück (Roesler & Bröning, 2024).
Versorgungsstrukturen mit Paartherapie haben sich im Beratungsbereich etabliert, im deutschen Gesundheitswesen aber – etwas zugespitzt formuliert – existiert die Paarbeziehung bislang praktisch kaum, auch präventive Angebote sind keineswegs flächendeckend vorhanden. Wie auch in der Einzelpsychotherapie hat sich die Psychoanalyse als erste therapeutische Schule mit der Entwicklung von Konzepten für die Paartherapie beschäftigt und in dieser Geschichte ihre Paartherapiemodelle immer wieder aktualisiert; dabei sind auch in jüngster Zeit ganz neue therapeutische Ansätze entstanden, z. B. die Mentalisierungsbasierte Paartherapie (vgl. Kap. 6.11). In der internationalen Debatte wird schon länger über common factors in verschiedenen paartherapeutischen Ansätzen diskutiert und die Entwicklung entsprechender integrativer Verfahren gefordert. Aktuelle Versuche, integrative Modelle oder Konzepte der Paartherapie vorzulegen, finden aber häufig nur in additiver Form statt, wie z. B. in der Verhaltenstherapie oder dem systemischen Ansatz. Damit ist gemeint, dass Methoden und Interventionskonzepte aus unterschiedlichen Ansätzen aneinandergefügt werden, ohne ein verbindendes theoretisches Modell im Hintergrund zu formulieren, das eine Logik der Veränderungsprozesse in Paarbeziehungen berücksichtigen würde. Hier wird häufig eine Metaphorik von Reparatur und Werkzeugen („Tools“) für die Paartherapie verwendet, die ich für unangebracht und letztlich irreführend halte. Aus dieser Sichtweise folgt dann, dass man die Werkzeuge („Tools“) je nach Bedarf oder persönlicher Präferenz aus den unterschiedlichen therapeutischen Schulen miteinander kombinieren kann. Oft fehlt ein kohärentes und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauendes Modell davon, was eine |5|Paarbeziehung zwischen zwei Menschen überhaupt ist, was ihre Bedingungen und die darin entstehenden Probleme sein können sowie was es tatsächlich braucht, um hier therapeutische Veränderung herbeizuführen. Die angesprochene Sichtweise würde einen mechanistischen Blick auf menschliche Beziehungen einnehmen und meiner Ansicht nach deren Komplexität verfehlen. Auch wird dabei übersehen, dass solche additiven Modelle die Gefahr bergen, dass inkonsistente oder gar widersprüchliche Ansätze kombiniert werden, wobei manche Autoren betonen, dass hierdurch nicht nur nicht geholfen, sondern auch Schaden angerichtet werden kann (Snyder et al., 2012). Ich habe in meinem Buch Paarprobleme und Paartherapie (Roesler, 2024) versucht, diese in vielen Ansätzen vorfindbare mangelhafte wissenschaftliche Fundierung zu liefern und zu einem kohärenten Modell davon, was Paarbeziehungen sind, welche Bedingungen sie haben, wie es hier zu Störungen kommen kann, und wie dies therapeutisch sinnvoll veränderbar ist, zu integrieren, und verweise für eine ausführlichere Diskussion darauf. Es lässt sich mit guten Gründen argumentieren, dass Menschen zu langdauernden monogamen Paarbeziehungen angelegt sind, nicht nur um bei dem Heranwachsen der Nachkommen zu kooperieren, sondern weil beim Menschen die Emotionsregulation grundsätzlich dyadisch angelegt ist und daher alle Menschen lebenslang auf die Verfügbarkeit emotionaler Sicherheit in nahen zwischenmenschlichen Beziehungen angewiesen sind. Dies lässt sich mit anthropologischen und biologischen Erkenntnissen (z. B. zur Rolle des Hormons Oxytocin in Paarbeziehungen und bei der Sexualität) ebenso schlüssig erklären wie mit neueren Erkenntnissen aus der affektiven Neurowissenschaft, der Forschung zu Paarinteraktion und der Bindungsforschung.
Die psychoanalytischen Ansätze haben schon sehr früh in ihren Modellen diese wissenschaftlichen Grundlagen berücksichtigt und integriert und damit die psychoanalytische Paartherapie weiterentwickelt. Im vorliegenden Band sollen diese Grundlagen, insbesondere die affektive Neurowissenschaft, die Bindungstheorie, die Paarinteraktionsforschung sowie der Mentalisierungsansatz, zunächst vorgestellt werden, um dann die wichtigsten psychoanalytischen Paartherapieansätze und ihre historische Entwicklung sowie ihre Kernelemente zusammenzufassen. Die Wirksamkeitsforschung zur Paartherapie im Allgemeinen sowie zur psychodynamischen Paartherapie wird im Überblick dargestellt. Auf dieser Grundlage wird ein aktuelles, integratives, wissenschaftlich fundiertes Modell psychodynamischer Paartherapie (vgl. Kap. 8) im Sinne eines praxisorientierten Handbuches, um nicht zu sagen Manuals, vorgestellt.
Zu den Begriffen Paarberatung und Paartherapie. Im Folgenden wird mit dem Begriff „Paartherapie“ immer auch der Bereich der Paarberatung eingeschlossen, da die hier behandelten Problematiken sowie die eingesetzten |6|Interventionsformen sich nicht grundsätzlich unterscheiden, es unterscheiden sich höchstens die institutionellen Kontexte (Beratungsstellen bzw. Gesundheitswesen). Wenn im Paarsetting in der Richtlinienpsychotherapie gearbeitet wird, hat dies den Anspruch, in den gängigen Klassifikationssystemen (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen [DSM]; American Psychiatric Association [APA], 2022; Internationale Klassifikation der Krankheiten [ICD]; World Health Organization, 2019) erfasste psychische Störungen zu behandeln, zu bessern oder zumindest deren Besserung zu unterstützen. Dies gilt z. B. für Depressionen, Angststörungen, Borderline-Störungen oder Essstörungen. Insofern handelt es sich nicht um Paartherapie im eigentlichen Sinne, wie sie in diesem Band dargestellt wird, da diese auf die Verbesserung der Beziehungsqualität und -stabilität abzielt, also eine genuine Paarperspektive im Blick hat. In der Paartherapie in diesem Sinne ist der Klient die Beziehung, und nicht zwei Einzelpersonen.
Darüber hinaus möchte ich an dieser Stelle kurz die Verwendung des Begriffs „Patient vs. Klient“ diskutieren. Im Gesundheitswesen ist der Begriff „Patient“ üblich, was impliziert, dass eine krankheitswertige Störung bei der Person identifizierbar ist. Im Beratungsbereich dagegen wird von „Klienten“ gesprochen, weil diese im Sinne des Kundenbegriffs sich eigenständig Hilfe für ihre Probleme holen. Mir persönlich ist der Klientenbegriff sympathischer, zumal, da es schwierig ist, bei Paarproblemen grundsätzlich von einer krankheitswertigen Störung zu sprechen. Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch bei Paaren aus Expertensicht durchaus schwere Pathologien identifiziert werden können, die die Betroffenen selbst möglicherweise gar nicht als Problem sehen. Von daher ist auch für den Bereich der Paartherapie der Klientenbegriff allein nicht durchgängig sinnvoll, zumal aus einer psychoanalytischen Perspektive, welche unbewusste Motivationen und Konflikte annimmt. Diese Komplexität sollte also im Folgenden bei der synonymen Verwendung der Begriffe mitgedacht werden.
Vergleichbarkeit von hetero- und homosexuellen Paarbeziehungen. Bislang gibt es zu dieser Frage nicht sehr viel Forschung, allerdings nimmt die Publikationstätigkeit zu diesem Feld in den letzten Jahren deutlich zu. Verstreute Hinweise in der Literatur, die auch meiner eigenen Erfahrung in der Praxis der Paartherapie entsprechen, weisen darauf hin, dass grundsätzlich Beziehungsdynamiken in Paarbeziehungen eher allgemeinmenschliche Qualitäten haben und daher keine elementaren Unterschiede zwischen gleich- und gegengeschlechtlichen Beziehungen bestehen. Darauf weisen ebenfalls die Erkenntnisse aus der Bindungsforschung zu erwachsenen Paarbeziehungen hin: „Auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist Bindungsunsicherheit beim Befragten und/oder Partner assoziiert mit |7|weniger positiven Angaben zu Beziehungsqualität (Zufriedenheit, Commitment, Vertrauen, Kommunikation, Problembelastung)“ (von Sydow, 2017, S. 89).
In der Psychoanalyse, die sich ja historisch um das Kernthema Sexualität herum konstituiert hat, hat sich die Diskussion zum Thema sexueller Diversität in den letzten Jahren enorm intensiviert (Moeslein-Teising et al., 2020). Hier wird betont, dass Geschlechtsidentitäten in einem komplexen Zusammenwirken von körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren zustande kommen und man heute eher von einem Kontinuum an differenzierten Weiblichkeiten und Männlichkeiten ausgehen müsse, um den Anfragen der Klienten in der Therapie sinnvoll begegnen zu können. Für den vorliegenden Band wird davon ausgegangen, dass die Dynamiken in Paarbeziehungen, weil allgemein menschlicher Natur, sich auch unabhängig von der jeweiligen Geschlechterkombination nicht fundamental voneinander unterscheiden – was nicht heißt, dass man für bestimmte Gruppen von Klienten bzw. Patienten, z. B. solche, die polyamore Beziehungen leben, nicht auch über entsprechende Spezialkenntnisse verfügen muss.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird überwiegend das generische Maskulinum benutzt. Es sind jedoch immer alle Geschlechter mitgemeint.
|8|2 Grundlagen: Paarprobleme und Beziehungsstörungen
2.1 Diagnostische Definition
Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass es für allgemeine Beziehungsprobleme in Paarbeziehungen in den standardisierten Diagnostikschemata wie z. B. DSM oder ICD keine eigenen Kategorien gibt, mit der Ausnahme sexueller Funktionsstörungen, für die es schon seit Langem definierte Kategorien gibt (z. B. sexuelles Desinteresse und Lustlosigkeit). Tatsächlich gibt es in der wissenschaftlichen Literatur kaum Konsens darüber, welche Arten von Paarproblemen man tatsächlich konzeptuell voneinander differenzieren kann, was Oberflächenphänomene und was tiefer liegende Ursachen sind, und ob eine solche Unterscheidung überhaupt Relevanz für das paartherapeutische Vorgehen hat. Unter den in der Praxis vorkommenden Konstellationen, die auch in der Literatur immer wieder thematisiert werden, finden sich so unterschiedliche Dimensionen wie Kommunikationsprobleme („Frauen reden, Männer schweigen“), Streit in unterschiedlichen Ausprägungen (Dauerstreit, eskalierende Auseinandersetzungen), Entscheidungsprobleme (z. B. Familienplanung), Vereinbarkeit von Anforderungen (Familie, Beruf, Paarleben, eigene Interessen), Geschichte von Verletzungen, Differenzen über Kindererziehung, sexuelle Probleme, Außenbeziehungen, Trennungswünsche, Konstellationen von Zweitehen und Patchworkfamilien, bis hin zu manifesten Störungen wie Sucht oder häuslicher Gewalt. Verschiedene Paartherapiemodelle thematisieren auch Veränderungen von Beziehungsmustern im Lebensverlauf, z. B. an kritischen Übergängen (Geburt des ersten Kindes, „Empty Nest“, Übergang in den Ruhestand; vgl. Kreische, 1994).
Nach längeren, vor allem US-amerikanischen Diskussionen wurde die Diagnose der Hypersexualität nicht als Störung in die Diagnosesysteme aufgenommen. Allerdings existiert in der ICD-11 noch eine Kategorie „zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung“ (6C72; vgl. Bründl & Fuss, 2021). In den Medien wird das Phänomen der „Sexsucht“ gerne diskutiert. Aus |9|wissenschaftlicher Perspektive fehlen hierzu klare Definitionen sowie belastbare Daten. Jenseits der standardisierten Diagnosesysteme werden darüber hinausgehende Probleme mit der Sexualität beschrieben, insbesondere Differenzen im sexuellen Interesse in Partnerschaften. Entsprechende Konflikte sind in Partnerschaften weit verbreitet (von Sydow & Seiferth, 2015) und stehen häufig im Zusammenhang mit allgemeinen partnerschaftlichen Problemen und Unzufriedenheit. Es ist dabei keineswegs so, dass immer nur die Männer ein höheres Interesse an Sexualität hätten als die Frauen, in Statistiken zeigen sich beide Geschlechter gleich häufig interessierter als die Partnerin oder der Partner. Diskrepanzen im sexuellen Interesse sind so häufig, dass man sie wahrscheinlich eher als den Normalfall in länger dauernden Partnerschaften bezeichnen muss.
Zur Häufigkeit von Außenbeziehungen liegen ebenfalls belastbare Erkenntnisse vor:
In Deutschland geben 15 bis 26 % der Frauen und 17 bis 32 % der Männer im Alter von 16 bis 45 Jahren sexuelle Außenkontakte während der aktuellen Beziehung an – jemals passiert ist das 40 % der Befragten (Kröger, 2010; Plack, Kröger, Allen, Baucom & Hahlweg, 2010). … Frauen neigen eher dazu, emotional intensive Außenbeziehungen einzugehen (mit oder ohne sexuellen Kontakt), während Männer häufiger emotional unverbindliche sexuelle Abenteuer suchen (Banfield & McCabe, 2001). (von Sydow & Seiferth, 2015, S. 61).
Hinzu kommen seit einigen Jahren auch Außenbeziehungen über Medien: Zahlreiche Onlinedating-Plattformen bieten hier Möglichkeiten auch für unverbindliche Kontakte bis hin zu virtuellem Sex. In zahlreichen Untersuchungen sind Risikofaktoren für Untreue bestimmt worden (von Sydow & Seiferth, 2015). Diese scheinen aber eher unspezifisch zu sein und entstammen zum großen Teil angelsächsischen Studien, die nur bedingt auf die deutschsprachigen Länder anwendbar sind (für eine ausführliche Darstellung der Risikofaktoren für Beziehungsqualität und -stabilität siehe Roesler, 2024). Außenbeziehungen werden in 70 % der Fälle mit Eheproblemen begründet, doch sie kommen auch in von beiden Seiten als glücklich bezeichneten Ehen vor; hier berichten 16 % der Frauen und 20 % der Männer von Affären. Andersherum führt die Aufdeckung einer Außenbeziehung in einer länger dauernden Partnerschaft so gut wie immer zu einer ernsthaften Krise. Da also aus Sicht klinischer Klassifikation wenig Erkenntnisse über die Bestimmung von Paarproblemen zu gewinnen sind, soll im Folgenden eine sozialwissenschaftliche Perspektive eingenommen werden.
|10|2.2 Paarbeziehung aus sozialwissenschaftlicher Sicht
Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive könnte man die Paarbeziehung als die kleinste soziale Gruppe bezeichnen, und sie ist als solche von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung und den Erhalt des Gemeinwesens. Die Paarbeziehung stellt in diesem Sinne einen „Beziehungsraum“ dar, in dem wichtige Aufgaben sowohl für die einzelnen Gesellschaftsmitglieder als auch für die Gesellschaft als Ganzes erbracht werden, z. B. Befriedigung emotionaler Bedürfnisse, die gesellschaftliche Reproduktions- und Sozialisationsfunktion, sowie einen Erholungsraum als Ausgleich für berufliche und andere gesellschaftliche Aufgaben bereitzustellen. Paare sind die Architekten der Familie, wie schon die Familientherapeutin Virginia Satir (Kröger et al., 2008) zu Recht betont hat. Eine hohe Qualität in der elterlichen Paarbeziehung sorgt nicht nur für eine förderliche Entwicklungsumwelt für die Kinder, sondern stellt auch ein hilfreiches Modell für das Gelingen von Paarbeziehungen im späteren Leben der Kinder dar.
In zahlreichen Umfragen zur Lebenszufriedenheit stellen sich Liebe, Partnerschaft und Familie immer wieder als zentrale Faktoren für das Wohlbefinden und Lebensglück dar (für eine ausführliche Darstellung siehe Roesler, 2024). Eine intime Zweierbeziehung ist eine der wichtigsten Quellen für Lebensfreude und psychische Stabilität. Die meisten Menschen wünschen sich auch heute noch eine lebenslange glückliche Partnerschaft: 90 % geben an, dass eine Partnerschaft für sie das Wichtigste im Leben sei, um glücklich sein zu können. Nach wie vor heiraten über 85 % der Menschen im Verlauf des Lebens und rund 75 % der Geschiedenen heiraten erneut – teilweise mehrfach. Der Wunsch nach Geborgenheit und Erfüllung in einer intimen Zweierbeziehung besteht weiterhin. Familiensoziologische Studien zeigen dabei sehr klar (Matthiesen, 2007; Kalmbach et al., 2016; vgl. auch Reich, 2019), dass zwar die Wertschätzung von jungen Menschen für die Dauerhaftigkeit von Paarbeziehungen und Familie nach wie vor enorm hoch ist, zugleich aber die gelebten Beziehungsformen vielfältiger und unübersichtlicher geworden sind und vielen Menschen heute Orientierung darüber fehlt, welche Kompetenzen in einer Paarbeziehung zu deren Erhalt förderlich sind.
Schon früh im 20. Jahrhundert haben Soziologen wie Talcott Parsons festgestellt, dass die Modernisierung der Gesellschaft mit zunehmender Mobilität und Individualisierung mit einer Deinstitutionalisierung der Ehe einhergeht, diese destabilisiert und somit dauerhafte Paarbeziehungen mit hohen Anforderungen verbunden sind (Wagner, 2019). Diese Trends, die |11|zu einer weiteren Relativierung und damit Destabilisierung dauerhafter monogamer Bindungen führen, setzen sich auch weiter fort (Roesler & Bröning, 2024). In der amerikanischen Literatur spricht man mittlerweile von der Verschiebung vom Tod zur Scheidung als dem primären Grund für das Ende einer Ehe (Gurman, 2008). Eine einmal eingegangene Paarbeziehung ist heute nichts fest Gefügtes mehr, von dem man ausgehen kann, dass sie bis ans Ende des Lebens besteht, sondern sie stellt in spätmodernen Multioptionsgesellschaften eine Option unter vielen anderen dar, die auch wieder um anderer Möglichkeiten willen aufgegeben werden kann. Dabei zeigt sich, dass junge Menschen heute keineswegs eine Geringschätzung von lebenslanger Partnerschaft und Treue haben, sondern im Gegenteil diese sehr hoch bewerten, und man die hohe Scheidungsrate z. T. damit erklären kann, dass höhere Ansprüche an Partnerschaft als in früheren Zeiten gestellt werden, sodass, wenn eine Partnerschaft nicht genügt, nach gelingenderen Alternativen gesucht wird. In einer familiensoziologischen Untersuchung zu heutigen Beziehungsbiografien haben Schmidt et al. (2006) folgende zentrale Aussagen getroffen:
neben der Ehe haben sich verschiedene eheähnliche Lebensformen etabliert, z. B. Getrennt-Zusammensein („living apart together“) und unverheiratet Zusammenleben;
Sexualität und Ehe sind voneinander entkoppelt, das Gleiche gilt für Elternschaft;
gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen haben sich etabliert und nehmen weiter zu, bis hin zur gemeinsamen Erziehung von Kindern;
Scheidungen nehmen weiter zu, auch bei den über 60-Jährigen, was aber nicht, wie oben ausgeführt, als Geringschätzung verbindlicher Beziehung betrachtet werden muss, sondern vielmehr sind die Ansprüche an Beziehungen gewachsen;
eine Abfolge von Paarbeziehungen im Verlaufe des Lebens wird immer häufiger, schon 30-Jährige haben in der Regel mehrere Beziehungen und Trennungen hinter sich;
Singles nehmen daher zu, wobei die wenigsten davon auf diese Rolle festgelegt sind, die meisten sind sog. Durchgangssingles.
Seit Anfang der 1990er Jahre erfolgte ein Wertewandel, den man schlagwortartig mit Rückzug ins Private und Aufwertung von Familie, Intimität und emotionaler Nähe umschreiben kann, im Grunde eine Re-Romantisierung und Re-Idealisierung von Liebesglück. Dies geht einher mit einer hochgradigen Psychologisierung von Paarbeziehungen. Die zentrale Herausforderung in diesen Beziehungen ist, eine Balance zwischen Autonomie und Intimität herzustellen. Die Erwartungen an die Beziehung und damit an die Liebespartner sind stark gewachsen – was auch ein Grund für das häufige Scheitern von Beziehungen sein kann. Da Erwachsene ihre |12|Modelle für Paarbeziehung hauptsächlich aus ihren Erfahrungen mit der Paarbeziehung der Eltern in der Ursprungsfamilie beziehen, bei einer Scheidungsrate von fast 40 % diese Generationen allerdings in dieser Hinsicht häufig wenig Vorbildcharakter haben, kann ein hoher Bedarf an entsprechender Kompetenzförderung festgestellt werden. Darauf verweist auch die empirische Erkenntnis, dass die soziale Vererbung des Scheidungsrisikos einer der am besten untersuchten sozialpsychologischen Tatbestände ist: Wenn eine Person im Kindes- oder Jugendalter die Trennung/Scheidung der eigenen Eltern erlebt hat, so steigt das Risiko für diese Person deutlich, in der eigenen späteren Paarbeziehung ebenfalls wieder Trennung/Scheidung zu erleben (Roesler, 2024). Dies bestätigt schon lange bestehende psychoanalytische Annahmen: Man kann davon ausgehen, dass Kinder aus der Beobachtung der Paarbeziehung ihrer Eltern eine unbewusste Repräsentation von Paarbeziehung verinnerlichen, die im späteren Leben als implizites Modell oder Szenario für die eigenen gelebten Paarbeziehungen fungiert; scheitert die elterliche Paarbeziehung, wird dies ebenfalls verinnerlicht, die unbewusste Repräsentation von Paarbeziehung beinhaltet dann die Sichtweise: Das kann nicht gelingen. Die betroffenen Scheidungskinder wählen dann unterschiedliche Strategien, wie die psychodynamische Scheidungsforscherin Judith Wallerstein (vgl. Kap. 2.3) gezeigt hat: Manche heiraten forciert, sozusagen um die verinnerlichte Erfahrung zu widerlegen; manche trauen sich eine dauerhafte Paarbeziehung gar nicht zu; entscheiden sie sich doch für eine Heirat, wiederholen sie das Scheitern der elterlichen Paarbeziehung.
In einer aktuellen Übersichtsarbeit stellen Bradbury und Bodenmann (2020) fest: 40 % aller Ehen scheitern, in äußerlich intakten Ehen berichten 30 % der Partner von anhaltenden Belastungen. Für nicht verheiratete Paare sind diese Zahlen deutlich höher; nur ca. ein Drittel der belasteten Paare nimmt professionelle Hilfe in Anspruch, sodass Paarprobleme der häufigste Grund für die Inanspruchnahme von Beratung sind. Psychotherapiepatienten weisen ebenfalls häufig chronisch belastete Paarbeziehungen auf. Selbst in zunächst zufriedenen Paarbeziehungen sinkt oftmals die Beziehungsqualität besonders in den ersten Jahren nach der Heirat signifikant, sodass nach 15 Jahren für ca. die Hälfte dieser Paare eine Situation erreicht ist, die dem Beziehungsstress von Paaren gleicht, die sich in Paartherapie befinden (Balfour et al., 2012).
Eine deutschsprachige Studie zum Zusammenhang zwischen Bindungstyp, Paarbeziehungsmustern und langjährigem Verlauf (Berkic, 2006) untersuchte Paare in ländlichen Regionen von Bayern, die durchschnittlich bereits 28 Jahre miteinander verheiratet waren. Die Verteilung der Bindungsmuster sah folgendermaßen aus: Zwei Drittel der Frauen hatten eine sichere Bindungsrepräsentation, während die Hälfte der Männer unsicher-|13|vermeidend gebunden war. Von Letzteren waren 21 % unsicher-verstrickt, und 37 % der Männer wurden sogar dem ungelöst-traumatisierten Bindungstyp zugeordnet. Insgesamt bestand mehr als die Hälfte der untersuchten Paare aus der Verbindung zwischen einem sicheren und einem unsicher gebundenen Partner. Dies ergab bei einem Großteil der untersuchten Paare auch ein entsprechend hohes Konfliktniveau bzw. eine hohe Unzufriedenheit mit der Paarbeziehung: Es fand sich eine weite Verbreitung eines Musters von Zerrüttung, wechselseitigem Anschweigen oder sogar Verachtung. Trotzdem hatten sich auch diese belasteten Paare nicht getrennt, sondern vielmehr in einem Muster aus Konfliktvermeidung und gegenseitiger Abweisung eingerichtet. Dies bestätigt die Erkenntnis, dass belastete Partnerschaften langfristig stabil sein können, selbst wenn das Leiden bei beiden Partnern hoch ist. Job et al. (2014, S.12) bestätigen: „Alarmierend sind jedoch nicht nur die hohen Trennungs- und Scheidungsraten, darüber hinaus leben zahlreiche Paare, um die 10 bis 25 % (für Deutschland: 1.6 bis 4 Millionen), in stabilen jedoch unzufriedenen Partnerschaften.“
Die Wohlfahrtsorganisation Relate hat für die Situation in Großbritannien aus Daten einer nationalen Umfrage ermittelt, dass dort 18 % der Bevölkerung in stark belasteten Beziehungen leben (Balfour et al., 2019). Nur wenige belastete Paare suchen überhaupt therapeutische Hilfe. Selbst von den Paaren, die sich schließlich scheiden lassen, haben weniger als ein Viertel jemals professionelle Hilfe in Anspruch genommen (Doss et al., 2003; dies gilt für die USA, wo die Inanspruchnahme derartiger Leistungen deutlich höher ist als im deutschsprachigen Raum), und wenn sie es tun, dann zu spät, nämlich im Mittel sechs Jahre, nachdem die Belastung der Paarbeziehung überhandgenommen hat.