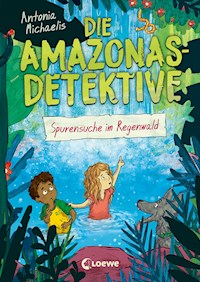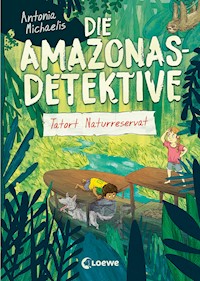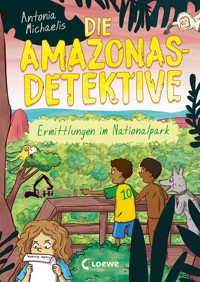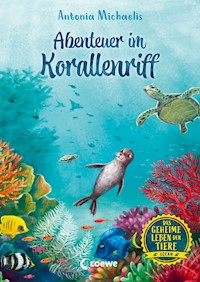9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Obwohl sie aus grundverschiedenen Verhältnissen stammen, sind Cliff und Alain fasziniert voneinander. Zwischen ihnen steht Margarete, die beide von klein auf kennen. Dann konvertiert Cliff zum Islam und verschwindet. Als er zurückkehrt, wird klar: Er soll für den IS einen "Tag des Blutes" planen. Alain will seinen Freund retten – doch wie lange kann er noch zu ihm halten? Mit "Die Attentäter" liefert Antonia Michaelis einen beklemmenden Blick in die Abgründe des Terrorismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Schon jetzt die ersten Seiten vorab lesen!
Am 22.08.2016 ist es endlich soweit: Dann erscheint »Die Attentäter« in voller Länge.
In Gedanken an die Einsamkeit zwischen den Glaswänden im obersten Stock der Lettischen Nationalbibliothek,
die Einsamkeit eines Hotels mit einem großen Weihnachtsbaum,
die Einsamkeit in einem Flugzeug
und alles, was danach geschah.
1
Ich hätte ihn beinahe nicht erkannt.
Er stand an einen Baum gelehnt und rauchte, sehr konzentriert, als müsste er all seine Aufmerksamkeit der Zigarette in seinen Fingern schenken, als wäre dies wichtig. Der Himmel war hellblau und fadenscheinig an diesem Tag wie etwas, das wir so lange benutzt hatten, bis es beinahe zerriss. Der Rauch der Zigarette zog in dieses Blau hinauf, durch den kalten Sonnenschein, und der Wind griff ins gelbe Herbstlaub der Parkbäume.
Leute führten Hunde spazieren, spielten mit Kindern, lachten, warfen auf einer Wiese einen Ball hin und her. Saßen auf Bänken. Und an diesem Baum stand Cliff und rauchte und betrachtete das alles wie etwas ihm Fremdes, etwas, womit er sich erst wieder arrangieren musste.
Cliff war schmal geworden.
Der Wind fuhr durch sein braunes Haar, doch es war nicht mehr braun, es sah staubig aus. Grau. Natürlich lag das am Licht. Das Licht malte auch Schatten unter seine Wangenknochen, unter seine Augen, tiefe Schatten, in denen etwas Unbekanntes wohnte.
Er hatte immer im Schatten gelebt. Im Dunkel. Und das Dunkel hatte geglüht, hatte eine eigene Anziehungskraft ausgeübt, wie ein schwarzes Feuer. Er hatte im Schatten gelebt, doch jetzt lebten die Schatten in ihm. Er schien nicht mehr Herr über sie zu sein.
Ich stand ganz still, halb hinter einem anderen Baum, er sah mich nicht. Einen Moment lang betrachtete ich meine eigenen Hände, die ich an die Rinde des Stammes gelegt hatte: schlanke Hände mit Farbresten unter den Nägeln, Hände, die ein wenig zu zerbrechlich wirkten. Ich war immer der Schmalere von uns beiden gewesen, der, den der Wind wegwehen konnte. Cliff war stets der Stärkere gewesen, stark genug, um den Wind aufzuhalten. Jetzt sah ich seine Schulterblätter, die sich unter dem T-Shirt abzeichneten. Er war immer noch kräftig, ich sah auch die Muskeln unter dem T-Shirt, aber er mochte gerade noch die Hälfte seines damaligen Gewichts auf die Waage bringen.
Und er wirkte nicht, als hielte er sich an der Zigarette fest, um nicht mit dem Herbstlaub davonzutreiben.
Ich schluckte.
Ich hatte gedacht, es wäre vorbei. Ich hatte gedacht, ich würde ihn nie wiedersehen, hatte mir gesagt, das Dunkle wäre mit ihm aus meinem, aus unserem Leben verschwunden. Aber natürlich hatte ich gewusst, dass es nicht so war. Dass er wiederkommen würde.
Ich hatte auf ihn gewartet.
Als er schließlich die Zigarette austrat und den Weg entlangging, an den Kindern und Ballspielern vorbei, folgte ich ihm. Er ging langsam, blieb immer wieder stehen, wie jemand, der aus einem langen Schlaf erwacht. Er drehte sich nicht um, aber sicher würde er sich umdrehen. Gleich. Mein Herz schlug rascher, und ich legte mir die Worte zurecht, die ich sagen würde, wenn er mich sah. Ich wünschte mir, dass er mich sah. Ich hatte mir immer gewünscht, dass er mich sah, schon mit vier Jahren.
Obgleich mir die Vernunft sagte, dass es besser wäre, herauszufinden, wohin er ging, ohne von ihm gesehen zu werden. Herauszufinden, warum er nach Berlin zurückgekommen war.
Der Park, durch den wir gingen, zu zweit und doch allein, war der Mauerpark.
Rechts erhob sich der Hügel, auf dessen Spitze die Reste der Mauer saßen, Betonblöcke wie große Tiere, die alles beobachteten, was in der Stadt geschah: alles Licht und allen Schatten. Sie wechselten ihre Farbe fast täglich, wurden von den Graffitisprayern in andere Blau-, Grün-, Gelb-, Bunttöne gekleidet: wie Frauen, die sich ständig umzogen und von jedem gesehen werden wollten, wie wechselndes Wetter auf Stein.
Die Oktoberluft schmeckte schon nach der kommenden Kälte, und entlang des breiten, geraden Weges wuchsen kleine, alte Gasöfen, über denen Leute Würstchen brieten oder Glühwein warm machten: sonntägliche Mauerpark-Feierstimmung. Das in mir, das nicht vernünftig war, sehnte sich danach, Cliff mit ein paar langen Schritten einzuholen, seine Schulter zu berühren, zu sagen:
»Hey! Wäre Glühwein eine gute Idee? Komm.«
Und wir würden den Hügel hinaufgehen mit unseren Styroporbechern und uns oben auf eine der riesigen Schaukeln vor der Mauer setzen und in den Himmel schwingen: Weißt du noch, wie damals.
Aber vermutlich hatte er es vergessen, vermutlich verwahrte nur ich all diese kleinen Erinnerungsfetzen in mir wie Juwelen. Schwarze Juwelen, die ein gefährliches Funkeln an sich hatten, da war ein ganzer Berg von ihnen, durch den ich mit den Händen fuhr, wenn ich alleine war. Jeder der Erinnerungsjuwelen trug das Gesicht des Menschen, dem ich folgte. Und ich schnitt mich an ihnen, wenn ich sie durch meine Finger gleiten ließ, bis das Blut über meine Finger lief.
Aber das war nur eine verrückte Idee, man hat wohl solche Bilder im Kopf, wenn man zwanzig Stunden am Tag vor einer Leinwand steht und Acrylfarbe darauf verteilt.
Was hatte Cliff das letzte Jahr über getan, während ich Acrylfarbe auf Leinwand verteilt hatte? Letzten Herbst, nachdem er verschwunden war, hatte ich ihn gemalt.
Immer wieder. Acryl, Aquarell, Kohle, Dreck auf Papier, Teer, Vulkankleber, Kreide.
Am Ende hatte ich alle Bilder in einen Karton gepackt, um sie wegzuwerfen, aber Margarete hatte gesagt: Tu das nicht. Und sie in den Keller gebracht. Tu das nicht, als würde ich Cliff damit töten. Auch Margarete hatte nie aufgehört, an ihn zu denken.
Er war stehen geblieben, am Rande der Menge, die sich um das Amphitheater gebildet hatte, in dem die Technik der Karaokeleute aufgebaut war wie jedes Wochenende. Die steinernen Ränge des Runds waren voll, die Menschen saßen in Mänteln und Daunenjacken dort, Glühweinbecher in den Händen, hundert oder zweihundert Menschen, und ihre Gesichter waren rot vor Kälte und Aufregung, auf ihnen glühte die Möglichkeit, der Nächste zu sein, der dort unten ins Mikro singen würde. Es war ein guter Platz, um Menschen zu beobachten, wenn man sie malen wollte.
Cliff stand da und tippte mit dem Fuß den Rhythmus von Zombie. Gott, war das Lied lange her. Es gehörte in die Zeit meiner Eltern. Cliff sah nicht die Frau an, die sang, eine rothaarige, nicht ganz schlanke Schottin mit einem glücklichen, breiten Lächeln auf dem Gesicht und einer Stimme, die immer um einen Halbton neben der Melodie blieb. Nein, Cliff sah nicht die Schottin an, sein Blick wanderte über die Ränge. Ich fragte mich, ob er jemanden suchte.
In der Menge stand ein Typ in einem alten Parka mit Kurt Cobains Konterfei auf dem Rücken, ein Typ, dessen Schultern etwas zu schmal waren für seine Größe, ein Typ, der sein hellblondes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengenommen hatte, ein Typ mit zu hellen, zu blauen Augen. Wie der Himmel über einem Haufen schwarzer Diamanten. Cliff sah ihn nicht.
Der Typ strich sich eine helle Haarsträhne aus dem Gesicht und steckte die Hände in die Taschen der Jacke: Alain Dubois, neunzehn Jahre und elf Monate alt. Sohn eines französischen Musikers und einer deutschen Galeristin. Unsichtbar, vielleicht, in einer Berliner Menschenmenge, nur einer von vielen, ein Mensch voller dummer Träume, mit Farbe unter den Fingernägeln und an den Jeans. Ein Mensch, der in diesem Moment gleichzeitig Angst hatte und glücklich war.
Ich.
Damals, als wir uns zum allerersten Mal gesehen hatten, war es genauso gewesen. Ich sah es noch vor mir, sah mich von außen, mich, das Kind.
Da war eine Menge von Menschen, obgleich natürlich eine kleinere, eine Menge von Menschen, die Möbel durch ein dunkles Berliner Treppenhaus trug und Topfpflanzen in den Armen hielt.
Dazwischen, im schwärzesten Schatten, in einer Ecke auf dem ersten Treppenabsatz, stand ein kleiner Junge. Etwa so alt wie Alain. Kräftig für sein Alter, muskulös, in einem schäbigen, zu großen T-Shirt und Jeans. Sehr kurz geschnittenes braunes Haar. Eine Zahnlücke vorne rechts.
Er sah den Menschen zu, die die Möbel hinauftrugen, er hatte sich in die Ecke gedrängt.
Dann drehte er den Kopf und sah nach unten. Dorthin, wo ein anderer kleiner Junge stand, ein kleiner Junge mit blondem Haar wie ein Heiligenschein, ein kleiner Junge mit einem schmalen, feinen Gesicht, der die Hände in den Taschen verbarg.
Als der dunkelhaarige Junge ihn ansah, von seinem Treppenabsatz aus, durch die Menge an Menschen und Möbeln hindurch, bekam der blonde Junge gleichzeitig Angst und fühlte sich seltsam erhoben. Als ströme eine unerklärliche Energie durch seinen Körper.
Die Augen des Jungen auf dem Treppenabsatz waren dunkelblau, beinahe schwarz, eine Farbe, von der der andere Junge bisher nicht gewusst hatte, dass Augen sie haben können. Sie funkelten. Wie Diamanten. Von diesem Moment an war nichts mehr so, wie es vorher gewesen war.
Das war der Beginn.
Angst und Glück und ein dunkles, staubiges Treppenhaus in Berlin.
Der Beginn.
Man hat mit vier oder fünf Jahren keine Zahnlücken. Die Milchzähne fallen erst später aus.
Alain Dubois, ebenfalls vierjährig, wusste das nicht.
Er stand an jenem ersten Tag in Berlin lange auf seinem Bett, am Fenster des Zimmers, das aufregend nach altem Haus und neuen Möbeln und nicht nach zu Hause roch, er wippte auf der Matratze auf und ab und sah in den Hof hinunter: sah die beiden großen Bäume an, die Büsche, die Fahrräder, die Mülltonnen, an denen bunte Aufkleber in verschiedenen Stadien der Auflösung klebten.
Er dachte an den kleinen Ort an der französischen Küste, der jetzt sehr weit weg war, und an alles, was dort geblieben war, seine Freunde, seine Großeltern, sein Meer. Und er dachte, dass er wahrscheinlich nicht gut gekaut hatte beim Mittagessen, auf der Reise, weil etwas in seinem Magen lag, schwer wie ein Stein. Schließlich kroch er unter die Bettdecke, denn das Bett hatte seine Mutter schon bezogen, und er lag eine Weile in der Dunkelheit und atmete nur. Ein und aus.
Er war in einer Eisbärhöhle, aber niemand wusste das. Nicht einmal die Eisbären, die draußen lauerten. Wenn er herauskam und sie ihn bemerkten, würden sie ihn zerfetzen, das war klar. Er hätte es seinen Eltern erklärt, aber seine Eltern hatten mit der Wohnung zu tun.
Alain schloss die Augen, und da sah er die Augen des anderen Jungen wieder vor sich. Dieses Dunkelblau. Es hatte nach ihm gegriffen. Wie eine Hand. Und plötzlich wurde ihm warm. Eine Weile spürte er die Wärme einfach in sich, ließ sie durch seinen Körper rinnen und lächelte. Dann schlief er ein.
Die Eisbären kamen nicht, um ihn zu zerfetzen. Das war erstaunlich.
Drei Tage später stand er im Hof und sah die Blumen dort an.
Da war ein Beet von violetten Blumen auf langen, dünnen Stängeln, mit grünen Fusselblättchen wie Petersilie. Sie sahen aus wie Margeriten, aber sie hatten weniger Blütenblätter. Er stand ganz still da und versuchte, die Blütenblätter zu zählen, während in seiner Hand ein Stück Schokolade schmolz. Die Sonne schien, es war Sommer. Aus dem zweiten Stock hörte Alain die Klänge eines Saxofons. Er war ganz allein im Hinterhof, völlig auf sich gestellt. Seine Mutter war irgendwo, was häufiger vorkommt bei Müttern, und sein Vater hatte nicht mal gemerkt, dass er alleine hinunter in den Hof gegangen war, sein Vater spielte Saxofon.
Er fühlte sich erwachsen.
Er pflückte eine Blüte ab und begann, die Blütenblätter zu zählen.
Ein, zwei, drei …
Ein Stein unterbrach ihn. Er landete mit einem winzigen Klicken vor seinen Füßen, und Alain fuhr herum. Hinter den Blumen, auf einer Treppe, die zum Hinterhaus führte, saß der Junge mit den dunkelblauen Augen und sah ihn an. Alain bückte sich ganz langsam und hob den Stein auf. Er war so groß wie eine ziemlich große Murmel und hatte eine scharfe Kante.
Der Stein, dachte Alain, hätte ihn treffen können. Und das hätte ziemlich wehgetan.
Er sah in die dunklen, fast schwarzen Augen des Jungen, und ihm wurde wieder warm. Aber die Wärme war wie ein Feuer, sie hatte etwas Zerstörerisches.
Der Junge stand jetzt auf und kam herüber, ging um zwei kaputte Fahrräder herum und blieb auf der anderen Seite des Blumenbeets stehen. Sie sahen sich zwischen den grünen Stielen mit dem Petersilienkraut weiter an.
»Der ist scharf«, sagte Alain und steckte den Stein in die Tasche, langsam, als wäre es ein geheimes Ritual.
»Kann schon sein«, sagte der andere und spuckte aus. Mitten hinein zwischen die Blumen. Alain wusste nicht, was es zu bedeuten hatte, aber er spuckte auch aus.
»Okay«, sagte der andere.
»Okay«, sagte Alain.
»Die haben gesagt, du kannst gar nicht Deutsch«, sagte der andere.
»Ich heiße Alain«, sagte Alain.
»Meine Mutter kann einen Zaubertrick mit einer weißen Taube«, sagte der andere. »Aber sie ist jetzt nicht hier. Sie ist weg.«
Und Alain fragte sich, ob er die Taube meinte oder die Mutter.
Eine Weile standen sie wieder schweigend da, zwischen sich die Blumen, deren hauchdünne violette Blütenblätter ihre Gesichter zu beiden Seiten des Beets berührten.
Dann trat jemand Großes hinter den anderen Jungen, legte eine Hand auf seine Schulter und zog ihn ein Stück zurück.
»Nicht in die Beete, wie oft denn noch!«, knurrte er. Er trug eine schwarze Lederhose und einen Bart, einen Pferdeschwanz und ein ziemlich graues T-Shirt. An seinem Hals war ein Bild von einer Schlange oder einem Drachen oder einem Krokodil, das sich bewegte, wenn seine Halsmuskeln unter der Haut spielten. Alain dachte Pirat.
»Wir waren gar nicht im Beet«, sagte er, und der Pirat sah ihn an. Er trug zwei Ringe an der Hand, die auf der Schulter des Jungen lag. Aus echtem Gold. Oder aus gefälschtem.
»Hm«, sagte er und nickte. »Du bist vielleicht ein anständiger Junge, aber John-Clifford hier muss ich alles viermal sagen.«
»Cliff«, sagte der andere leise.
»Cliff«, wiederholte Alain, ebenso leise. Und er dachte bei Cliff an die Felsen an der französischen Küste, wo das weiß schäumende Meer gegen den Stein schlug und die Möwen schrien. Er stellte sich vor, wie er zusammen mit Cliff dort stand. Sie könnten Steine hinunterwerfen. Murmelgroße, scharfkantige Steine.
»Was ist mit dem Zahn?«, fragte er, weil ihm das plötzlich einfiel. »Kriegst du da schon einen neuen?«
»Er ist die Treppe runtergefallen«, antwortete Cliffs Vater, obwohl Alain Cliff gefragt hatte. »Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann, die Treppe runterzufallen und sich dabei einen Zahn auszuschlagen.«
»Wann kommt deine Mutter wieder?«, fragte Alain. »Wegen dem Zaubertrick mit der Taube.«
»Taube?«, fragte Cliffs Vater, und dann sagte er plötzlich, sie müssten jetzt reingehen, obwohl die Sonne schien und es Nachmittag war. Aber vielleicht mussten sie etwas Wichtiges tun.
John-Clifford Bergmann und Ricki Bergmann lebten schon ihr ganzes Leben lang im Erdgeschoss des Hauses in der Schivelbeiner Straße, Ricki natürlich länger, er war bereits da gewesen, bevor Prenzlauer Berg schick geworden war, wie er sagte, schon damals, als der Umstandsmodeladen nebenan noch eine Kneipe gewesen war. Mit »schick« meinte Ricki nicht unbedingt »besser«. Alain erfuhr das nach und nach, setzte sich sein Bild aus den Scherben zusammen, die von den Gesprächen seiner Eltern blieben, wenn sie vom Abendbrottisch aufstanden. Sie vergaßen meistens, die Scherben ihrer Gespräche rechtzeitig wegzufegen, sie waren Künstler, keine allzu ordentlichen Menschen. Wenn Alain eine Scherbe länger betrachtete und Fragen stellte, versuchten sie zu antworten.
»Wann kommt Cliffs Mutter und zeigt mir den Zaubertrick?«, fragte Alain.
Seine Mutter, Coco, legte ihre Stirn in Falten, was sie noch hübscher machte, als sie ohnehin war, und sagte: »Ich glaube, sie kommt vielleicht gar nicht zurück.« Sie saß mit Alain zusammen auf dem Fußboden, im Schneidersitz, zwischen den bunten Kissen, die im Wohnzimmer verstreut lagen, und zupfte Johannisbeeren in eine große Schale. »Wir pflanzen im Hinterhof Johannisbeeren, ja?«, sagte sie, und Alain sagte: »Aber auch Bananen«, und Coco lachte und meinte, sie würden es versuchen.
»Warum kommt die Mutter von Cliff nicht wieder?«, fragte Alain. »Weil er die Treppe runtergefallen ist?«
»Das würde mich ja mal interessieren, wie er diese Treppe runtergefallen ist«, murmelte Alains Vater, Henri, der dabei war, die Fenster zu putzen. Er sagte, er putzte gerne Fenster, weil man sah, was man getan hatte. Sogar von außen. »Wenn ich mir diesen Ricki Bergmann so ansehe …«, sagte Henri und rieb das Fenster mit einem Knäuel Zeitung ab.
»Der Vater ist doch nicht die Treppe runtergefallen«, sagte Alain.
»Henri, das ist eine Unterstellung«, sagte Coco. »Du kennst die Leute gar nicht. Wir haben eine Menge Zeit, um sie kennenzulernen. Wir bleiben ja jetzt.«
Coco hatte früher in Berlin gelebt, aber an einer anderen Stelle, so viel hatte Alain verstanden, und dann war sie nach Frankreich gegangen, um Henri kennenzulernen, was sehr gut geklappt hatte, nur irgendwann hatte sie Heimweh nach Berlin bekommen. Oder Berlin hatte Heimweh nach ihr bekommen, denn es hatte ihr eine Arbeitsstelle in einer Galerie angeboten, wo Leute seltsame Bilder aufhängten, meistens falsch herum. Alain war erst vier, doch er wusste, wie herum die Bilder hätten hängen müssen.
Coco steckte ihm eine Johannisbeere in den Mund und drückte ihn einen Moment an sich. Sie roch gut, und er vergrub die Finger in ihrem weichen kurzen Haar. »Willst du immer noch zurück?«, fragte sie leise. »Nach Frankreich? Bananen im Hinterhof, das ist doch was.«
»Ja, aber die Treppen sind hier so gefährlich«, sagte Alain ernst.
Draußen im Hof – Alain sah es durchs geputzte Fenster – stand Clifford Bergmann mit seinem fehlenden Zahn und warf Steine auf ein Fahrrad, bis irgendwo ein Fenster geöffnet wurde und jemand, dem das Fahrrad gehörte, ihn anschrie.
Da zuckte er die Schultern und verzog sich.
Als Alain ein paar Tage später mit Coco vom Einkaufen kam, war eine große Aufregung im Haus ausgebrochen wie ein Feuer; mindestens hundert Leute schrien sich im Flur unten an.
Coco versuchte, möglichst schnell an den hundert Leuten im Flur vorbeizukommen, und irgendwie schaffte sie es, aber Alain blieb auf der Treppe stehen, eine braune Papiertüte mit Baguettes im Arm.
Einer der hundert Leute war Ricki Bergmann. Der Pirat. Er stand in der offenen Wohnungstür, eine Hand in den Rahmen gestützt, und das Krokodil oder der Drache auf seinem Hals wand sich und fauchte. Ricki Bergmann trug nur ein Unterhemd und eine Jeans, die vorne offen war. Seine Haare sahen feucht aus, und Alain dachte, dass er vielleicht gerade durch einen Sturm gesegelt war, das war ja bei Piraten möglich. Es konnte natürlich auch sein, dass er seine Haare lange nicht gewaschen hatte und sie ein bisschen fettig waren, Coco sagte, das würden Haare.
Im Flur stand eine junge Frau mit pechschwarzem Haar und pechschwarzen Augen und einer pechschwarzen Stimme, sie war wunderschön und trug einen eng anliegenden grünen Samtmantel und zwei große Taschen, aus denen Dinge ragten. Eines war eine kleine Topfpalme. Alain sah die Worte zwischen diesen beiden eine Weile hin- und herfliegen, sie waren kleine, bissige Tiere, die sich im Flug zusammen- und auseinanderrollten, die Stacheln hatten und winzige Klauen.
Der Letzte der hundert Leute, die einander anschrien, befand sich in der Wohnung, und Alain wusste, dass es Cliff war, obwohl er ihn nicht sah. Er hörte Dinge umfallen, krachen und klappern, Töpfe oder Geschirr. Dann rannte Cliff in den Flur und stürzte sich auf die junge Frau mit dem engen grünen Mantel wie ein Tier, und um ihn war etwas wie ein Schatten, ein dunkles Ding, das ihn umgab. Später würde Alain das Wort »Verzweiflung« denken, aber nicht mit vier Jahren.
Cliff schlang seine Arme um die junge Frau, ganz fest. Sie hob die Hände, hilflos, ließ die Taschen fallen, auch die mit der Topfpalme, welche umkippte. Dann kniete sie sich hin und drückte Cliff an sich, und Alain sah, dass sie weinte. Er sah auch, dass Cliff weinte. Seine Tränen wurden zu harten schwarzen Splittern, als sie auf dem altmodisch gefliesten Boden des Flurs aufkamen.
»Ich hole dich nächste Woche«, sagte sie. »Dienstag. Dann habe ich den ganzen Tag Zeit.«
Am Ende küsste sie Cliff auf die Stirn, und das war wohl ein Zaubertrick wie der mit der weißen Taube. Denn nach dem Kuss konnte sie Cliffs Arme von sich lösen, und sie stand auf, nahm die Taschen und war plötzlich weg. Noch ein Zaubertrick.
Alain blinzelte. Nein, sie war gar nicht plötzlich weg, sie war nur durch die Haustür gegangen, die Haustür klappte noch hin und her, und Cliff stürzte hinaus, der Frau nach. Alain folgte ihm, und er roch auf dem Weg durch den Flur etwas aus Richtung des Piraten, das er Jahre später als Bier identifizieren würde.
Draußen stieg Cliffs Mutter in ein Auto, das auf sie gewartet hatte. Er sah sie ihren grünen Mantel zusammenraffen, sah sie etwas zu dem Mann am Steuer sagen, der den Motor startete.
Cliff warf einen Stein. Einen großen Stein. Alain war relativ sicher, dass die Heckscheibe des Autos splitterte. Dann steckte er die Hände in die Taschen und ging langsam zurück ins Haus. Der Pirat löste sich aus dem Türrahmen und kniete sich hin und umarmte Cliff, so wie vorher seine Mutter, aber auch wieder ganz anders, und Cliff legte den Kopf an seine Schulter. Eine Weile streichelte der Pirat sein Haar, und schließlich gingen beide nach drinnen.
Alain stand noch immer reglos mit der Baguettetüte auf dem Bürgersteig.
Und dann merkte er, dass dort noch jemand stand, neben der offenen Haustür. Ein Mädchen in einer Ringelstrumpfhose und einem kurzen lila Kleid. Sie hatte die ganze Sache auch beobachtet, und jetzt schüttelte sie den Kopf, sodass ihr braunes Haar um sie herumflog, und sagte: »Auweia. Das mit dem Auto gibt Ärger.«
»Hallo«, sagte Alain. Seine Stimme war komisch, als hätte der Stein die Stimme getroffen, nicht die Heckscheibe.
»Er kriegt immer Ärger«, sagte das Mädchen. Sie pustete ihr Haar aus dem Gesicht, das ein bisschen gewellt war und glänzte, es sah aus wie Holz, das jemand gerade mit einem Tuch poliert hat.
»Ich wohn da oben«, sagte sie. »Erster Stock. Wir waren wegverreist. Für die Ferien. Du wohnst jetzt im zweiten, oder?«
Alain nickte. Das Mädchen war wunderschön, und sie war so vollkommen normal, sie hatte nichts Dunkles an sich und nichts Unerklärliches. Die Ringel an ihren Beinen waren rot und braun und violett wie ihr Kleid, und in ihrem Haar trug sie ein schmales Band im gleichen Farbton, mit einer rosa Stoffblume seitlich.
»Ich heiße Alain«, sagte Alain und streckte seine Hand aus, weil er erwachsen und höflich sein wollte, aber dabei fiel die Baguettetüte auf die Erde.
Das Mädchen nahm seine Hand und hielt sie einen Moment fest. Er spürte ihre feinen, kühlen Finger in seinen und fragte sich, wie es wäre, Cliffs Hand zu fühlen. Cliffs Hand, dachte er, wäre rau und verschwitzt und vermutlich dreckig.
»Ich heiße Margarete«, sagte das Mädchen, und dann bückte es sich und hob die Tüte für Alain auf. »Ich bin schon fünf. Seit nicht so lange.«
»Ich werde auch fünf, wenn Herbst ist«, sagte Alain.
Sie gingen zusammen die Treppe hinauf zum ersten Stock, wo Margaretes Mutter wartete, eine freundliche, pummelige kleine Frau in einem Kleid von der Farbe einer Sahnetorte mit Karamell; sie fuhr Alain durchs Haar und sagte, es wäre schön, dass er jetzt im Haus wohnen würde, und sie hätte eben seine Eltern getroffen, und dann könnten sie ja zusammen im Hof spielen, und sicher ginge er auch bald in die Kita, in die Margarete ging.
Oben, im zweiten Stock, wartete Coco. Sie wartete auf ähnliche Weise wie Margaretes Mutter, in der Tür, und Alain dachte, dass keine von diesen Müttern ein Pirat war und keine beim In-der-Tür-Warten nach dem Komischen roch, das er später als Bier identifizieren würde.
Coco nahm ihn in die Arme, und er umarmte sie zurück.
Sie würde seine Arme nie von sich lösen, dachte er, um irgendwohin zu fahren. Und er würde nie einen Stein auf ein Auto schmeißen.
Bestimmt war das Auto kaputt. Bestimmt wurde das teuer. Eigentlich geschah es dem Auto aber recht, weil es Cliffs Mutter weggebracht hatte, es hatte sie einfach aufgefressen und war mit ihr davongelaufen.
Alain sah Cliff ab und zu, doch er spielte wirklich mehr mit Margarete in jenem Sommer. Sie bauten zusammen Häuser für Zwerge zwischen den Blumen im Hinterhof, und sie pflanzten mit Coco und mit Margaretes Mutter Johannisbeeren und Bananen. Die Bananen wurden natürlich nichts.
Mit Margarete war alles einfach und schön, und wenn ihre blassen, kühlen Hände seine berührten, fühlte er sich sicher.
Cliff war ab und zu bei seiner Mutter und für eine Weile verschwunden. Wenn er wieder auftauchte, wurde es in der Wohnung im Erdgeschoss lauter, weil der Pirat und er sich manchmal anschrien.
Cliff zeigte Alain, wie man Steine warf. Wie man aufs Dach des Schuppens im Hof kletterte. Und dass man Regenwürmer durchschneiden konnte. Aber Alain wollte keine Regenwürmer durchschneiden. Er sammelte die Regenwürmer ein und evakuierte sie unter einen Rhododendron, obwohl er natürlich auch Worte wie »evakuieren« und »Rhododendron« erst später lernte. Cliff brachte ihm Worte bei, die die Erwachsenen nicht gerne hörten. Doch manchmal stand er mit Alain bei den Blumen, und sie sprachen nur über die Blütenblätter. In diesen Momenten war Alain glücklich; weder Weihnachten noch Geburtstage, die sicher alle schön waren, erreichten je den Rang der Momente, in denen er mit Cliff Blütenblätter zählte.
Und Weihnachten bekam in diesem Winter ohnehin einen seltsamen Beigeschmack.
Es schneite.
Doch, ja, Weihnachten 2000 schneite es, schon seit Anfang November, und Berlin verschwand unter einer dünnen, jedoch kalten Decke. Alain war im November endlich fünf geworden.
Er hatte Coco geholfen, in der Galerie mit den falsch herum aufgehängten Bildern Weihnachtsschmuck aufzuhängen – richtig herum –, und Henri spielte auf Weihnachtsveranstaltungen in Hotels oder Restaurants oder Firmen Saxofon. Er war jetzt in einer Band, und einmal zogen er und die Jungs, wie er sie nannte, rote Nikolausmützen an und spielten im Mauerpark, und Alain und Margarete hopsten durch die Schneeflocken und tanzten zu der Musik, während ihre Mütter Glühwein tranken.
Die Wohnung im zweiten Stock roch nach Tannenzweigen. Margaretes Mutter, die eine kleine Boutique für Einrichtungsgegenstände besaß, schenkte Coco einen Türkranz mit silbernen und weißen Kugeln und Schleifen und lauter totem Holz, von dem Coco und Henri fanden, er wäre hässlich und deshalb höchstwahrscheinlich Kunst, aber Alain sollte das Margaretes Mutter nicht sagen.
Und dann war Weihnachten, und es schneite weiter, und Henri und Coco kämpften mit dem Tannenbaum und drehten die Musik laut und tanzten durchs Wohnzimmer. Henri war nicht sehr schlank und nicht sehr groß, eher eine gemütliche, meistens entspannte Kugel. Wenn er tanzte, sah das lustig aus, und genau das fand er selber auch. Coco hatte ein knappes schwarzes Kleid an und war schön, und in ihrem kurzen Haar hatte sich Lametta verfangen. Alain sah ihnen zu und fühlte, dass er sie liebte.
Irgendwann ging er hinunter, um eine Kiste mit vergessenem Schmuck aus dem Keller zu holen, er hatte das allein tun wollen, um groß zu sein. Als er im Erdgeschoss vorbeikam, schrien sie sich hinter der Tür wieder an. Dass gerade Weihnachten einer dieser Tage sein musste, tat weh.
Er hob die Hand, um an die Tür zu klopfen. Doch er traute sich nicht. Drinnen brüllte Ricki Bergmann. Als Alain mit der Kiste voller Schmuck wieder aus dem Keller kam, brüllte drinnen Cliff. »Ich geh wohl zu ihr!«, brüllte er, ganz nahe bei der Tür. Alain blieb stehen und lauschte. »Ich will Weihnachten bei ihr sein, mir egal, was du sagst! Mir egal!« Und dann splitterte irgendwas.
Alain lief die Treppe hinauf.
Er sagte nichts zu Coco und Henri über das Gebrülle unten, aber das war auch nicht nötig, sie hörten es selbst ganz gut. Nach einer Weile knallten Türen, und dann wurde es unten still. Alain war auf dem Klo, das ein Fenster zur Straße hatte, und als er hinaussah, lief unten Ricki Bergmann über die Straße und verschwand im Kiosk auf der anderen Seite.
Sie haben sich wieder vertragen, dachte Alain, und jetzt geht er Zigaretten kaufen und für Cliff Schokolade. Das wäre es gewesen, was Henri getan hätte, obwohl er sich nie so mit Alain gestritten hatte.
Draußen war es beinahe dunkel, irgendwann war es ganz dunkel, und sie wanderten durch den verschneiten Nachmittag zur Gethsemanekirche, die eine Viertelstunde entfernt lag. Alain hatte die dicke Daunenjacke an und die neuen Stiefel, in denen man lief wie auf Wolken, weil sie so gut gefüttert waren wie ein ganzer Zoo zur Fütterungszeit, wie Henri sagte. Coco hielt Alains eine Hand und Henri seine andere, und ab und zu ließen sie ihn in die Luft fliegen.
Hinter ihnen ging Margarete mit ihren Eltern, und sie sangen leise »Stille Nacht«, während sie so dahinmarschierten. In der Kirche war es kalt und langweilig und schön, genau wie es sein musste, und auf dem Rückweg fingen Margarete und Alain die Schneeflocken mit der Zunge auf.
Aber die ganze Zeit über, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, drehte Alain sich alle paar Meter um und suchte unter den Kirchgängern Cliff und seinen Vater.
Gingen sie nicht zur Kirche? Alains Eltern waren nicht besonders christlich, aber Weihnachten ging man eben. Alain hatte ein Weihnachtsgeschenk für Cliff, ein kleines rotes Auto, das er hinter dem Schrank gefunden und in ein altes Stück Geschenkpapier eingewickelt hatte. Es steckte in seiner Jackentasche.
Aber sie trafen Cliff und Ricki Bergmann nicht.
In der Erdgeschosswohnung lief das Radio. Als Alain klingelte, kam keiner an die Tür. Er steckte das kleine rote Auto in den Briefkasten.
Irgendwo schrie und klagte eine Katze, und Henri sagte, die wollte wohl irgendwo durch ein Fenster herein, um einen Weihnachtsbraten zu essen.
Die Bescherung war wunderbar. Der Baum mit den brennenden Kerzen war wunderbar. Das Weihnachtsessen war wunderbar; riesige rote Teller mit hübschen kleinen Pasteten standen auf dem langen glatten Holztisch, und Henri und Coco tranken Wein aus bauchigen Gläsern und lachten.
Sie telefonierten mit allen Großeltern, und irgendwann lag Alain erschöpft im Bett, in einem neuen Schlafanzug mit Pinguinen, im Arm einen gelben Kran, den man echt benutzen konnte. Als er einschlief, fielen draußen noch immer weiße, leichte Flocken. Die Katze hatte aufgehört zu miauen.
Er fragte sich, wie sie im Erdgeschoss Weihnachten gefeiert hatten.
Als er die Augen schloss, sah er Cliffs Gesicht vor sich. Das Dunkelblau in seinem Blick, dieses Beinahe-Schwarz, das so glühte. Und er fragte sich, ob Cliff wirklich zu seiner Mutter gegangen war und ob er ihn dann die ganze Zeit bis Neujahr nicht sehen würde.
Am nächsten Morgen wachte Alain als Erster auf.
Der Hinterhof war völlig unter dem Schnee verschwunden. Es glitzerte und funkelte in den Ästen der beiden großen Bäume im Hof, die Sonne war gerade erst aufgegangen und der Hof in ein rosa-orangefarbenes Licht getaucht. Alain zog sich leise an, lief die Treppe hinunter und dann in den Hof, um Spuren im Neuschnee zu machen.
Er führte seine Spur einmal um die Fahrräder herum, an den Johannisbeersträuchern und der eingegangenen Bananenstaude entlang, zum Schuppen, auf dessen Dach ebenfalls eine weiße Schneedecke lag. Darin lagerten Luftmatratzen vom Sommer, mehr Fahrräder, die Kohlen, mit denen sie im Erdgeschoss heizten, und Holz für den kleinen, nachträglich eingebauten Kaminofen in der Wohnung der Dubois. Alain fragte sich, ob irgendwo im Schuppen auch sein Schlitten war. Bisher war nie genug Schnee gewesen, und er hatte ihn seit dem Umzug nicht gesehen. Er kletterte auf den Hackblock, der unter dem Schuppenfenster stand und auf dem Henri ihr Holz hackte, weil ihn das entspannte, wie er sagte.
Vom Hackblock aus wischte Alain das kleine Schuppenfenster sauber und sah hinein. Das Licht des langsam erwachenden Morgens fiel durch das andere Fenster gegenüber, rosa und orange, tastete sich drinnen über Fahrradschläuche, Kartons, einen schimmeligen alten Teppich … Aber etwas war seltsam im Schuppen. Der alte Teppich und die Plastiktüten lagen alle in einer Ecke, zusammen mit den unaufgeblasenen Luftmatratzen und einem Haufen anderer Dinge wie löchrigen Picknickdecken. Jemand hatte sie in dieser Ecke aufgehäuft. Vorher waren sie auf dem großen, langen Regal und in Schachteln und Kisten verteilt gewesen.
Und dann sah Alain, dass in der Ecke, unter den angehäuften Dingen, noch etwas lag. Oder eigentlich jemand. Da war ein Kopf. Ein Gesicht. Alain fuhr zurück, schwer atmend. Es war unheimlich. Die Neugierde siegte, er sah noch einmal hin, und diesmal erkannte er das Gesicht. Es gehörte Cliff. Er hatte sein Gesicht hier in den Schuppen gelegt und die Augen fest geschlossen.
Als Alain zum dritten Mal durchs Fenster sah, begriff er, dass da nicht nur Cliffs Gesicht war. Natürlich, der Rest von Cliffs Körper war auch da, verborgen unter den Decken und dem Teppich. Alain kletterte vom Hackblock und ging zur Schuppentür. Wollte sie öffnen. Doch die Schuppentür klemmte. Vielleicht war sie festgefroren.
Er sah Cliffs Augen vor sich, dieses Glühen, und ihm wurde heiß und kalt, und er riss an der Tür, wie er nie zuvor an irgendetwas gerissen hatte. Da gab sie nach. Alain fiel rückwärts in den Schnee.
Er rappelte sich hoch und trat ins Dämmerlicht des Schuppens.
Jemand hatte hier gewütet. Eines der kleineren, schmalen Regale war umgeworfen worden. Das Fenster, durch das er nicht gesehen hatte, war gesplittert. In der Mitte war ein Loch, als hätte jemand seine Faust ins Glas gerammt. Aber das Fenster war zu klein, um durchzuklettern. Alain spürte die Angst in sich, die wie eine Flut in seinen Hals hinaufstieg. Seine Beine trugen ihn bis zu der Ecke, in der Cliff unter all den Dingen lag.
Er erinnerte sich plötzlich an die Klagelaute der Katze.
Vielleicht war die Katze auch in einem Schuppen eingesperrt gewesen.
Vielleicht war es keine Katze gewesen.
Alain stand jetzt ganz nahe bei dem Haufen an Dingen, und er beugte sich über Cliff. Er spürte, dass er zitterte vor Kälte, trotz seiner Daunenjacke und den Stiefeln. Cliff trug nur einen Pullover. Er hatte die Kapuze des Pullovers über sein braunes Haar gezogen.
Alain streckte die Hand aus, um ihn zu berühren. Er ist tot, dachte er. Er war die ganze Nacht hier, aus irgendeinem Grund, und er ist tot. Er hatte noch nie einen toten Menschen gesehen.
Er legte die Hand auf Cliffs Hals.
Die Haut war eiskalt.
Und dann lief ein Ruck durch den Körper. Auf einmal krallte sich eine Hand um Alains Unterarm. Er schrie. Cliff schlug die Augen auf und sah ihn an, und dann begann er, Alain zu sich hinabzuziehen. Alain spürte wieder das Schwarze, das Dunkle, das möglicherweise Verzweiflung war, aber auch noch etwas anderes.
Die Angst in ihm stieg weiter und schwappte aus seinen Augen.
Er wollte sich losreißen und weglaufen, und gleichzeitig wollte er helfen, doch er wusste nicht, wie. Es war, wie wenn man ein angefahrenes Tier auf der Straße findet, das vielleicht fast tot ist. Einmal hatten sie so ein Tier gesehen, einen Fuchs, der nur noch zuckte. »Nicht hingucken«, hatte Henri gesagt, »er stirbt sowieso.« Alain hatte sich im Auto übergeben.
Sein Gesicht war jetzt ganz nahe an Cliffs Gesicht, und die dunkelblauen Augen fixierten ihn.
»Hilf mir«, flüsterte Cliff, kaum hörbar. »Alain.«
Alain nickte und schluckte. Er konnte sich nicht aus Cliffs Griff befreien, nur Cliffs Mutter hätte das gekonnt, mit einem Kuss, er erinnerte sich. So versuchte er mit der anderen Hand, die Dinge beiseitezuräumen, unter denen Cliff lag, er grub ihn aus wie einen Igel; er würde ihn aus dem Schuppen ziehen müssen, irgendwie, er konnte ihn bestimmt nicht tragen.
Er spürte die Tränen auf seinen Wangen als glühend heiße Spuren in der Kälte.
»Alain?«
Alain fuhr herum, und da stand Margarete in der Schuppentür. Sie trug einen dicken roten Wintermantel mit Kapuze und Kunstpelzkragen und strahlte. Aber dann begriff sie, dass etwas nicht stimmte, und war mit ein paar Schritten bei Alain.
Sie sah Cliff an, sah seine Hand an, die sich um Alain gekrallt hatte, und riss die grauen Augen weit auf.
»Er … ich glaube, er hat hier übernachtet«, sagte Alain.
Margarete nickte nur, machte auf dem Absatz kehrt und rannte, und Alain gab auf und ließ sich neben Cliff in den Haufen aus Dingen fallen. Wenn selbst Margarete wegrannte, konnte niemand ihm helfen. Er lag so, dass seine Wange Cliffs Wange berührte, und er spürte, wie seine Tränen Cliffs Gesicht nass machten. Sie waren sich noch nie so nahe gewesen.
»Alain«, flüsterte Cliff wieder, und Alain sagte: »Cliff«, und »tut mir leid«. Merkwürdigerweise sagte er eines nicht, er sagte nicht: »Lass mich los.«
Dann waren da auf einmal Stimmen von Erwachsenen und auch die von Margarete, die Schuppentür flog auf, und Coco und Henri und Margaretes Eltern stürzten herein, notdürftig angezogen, und Henri löste Cliffs Klammergriff und hob ihn auf seine Arme, und Coco zog Alain in ihre Arme. Sie roch nach Zimt und Parfüm und nach Sex, was Alain erst später begriff, noch später als »Bier«.
»Mein Gott«, sagte Margaretes Mutter immer wieder, »mein Gott, mein Gott« und »die ganze Nacht« und »niemand zu Hause« und noch ein paar Dinge. Die Worte der Erwachsenen waberten irgendwo über Alains Kopf, und er merkte, wie Margarete ihre Hand in seine schob, eine ganz und gar andere Hand als die klammernde Hand, die Alain eben noch so gnadenlos festgehalten hatte.
»Wieso war er im Schuppen?«, flüsterte sie, als sie nebeneinander, nach den Erwachsenen, die Treppe hinaufstiegen.
»Ich weiß nicht«, flüsterte Alain. »Die hatten Streit, oder. Vielleicht deswegen.«
Henri trug Cliff in die Wohnung im zweiten Stock, und Coco ließ warmes Wasser in die Badewanne und pellte ihm die Sachen vom Leib, die Jeans und den übrigens ziemlich ungewaschenen schwarzen Kapuzenpulli, und steckte ihn ins Wasser. Henri telefonierte, er hatte die Nummer von Ricki Bergmann, aber Ricki Bergmann ging nicht ans Telefon. Unten war niemand in der Wohnung. Cliff lag mit geschlossenen Augen im warmen Wasser; Alain und Margarete und Coco saßen im Badezimmer auf dem Fußboden und sahen ihn alle an, und Alain war sich nicht ganz sicher, aber möglicherweise weinte seine Mutter.
Henri schimpfte im Wohnzimmer und kochte Tee, und alle machten einen furchtbaren Wirbel. Schließlich ging Coco für einen Moment aus dem Bad, wahrscheinlich weil sie sah, dass Cliff ziemlich normal atmete, sie schloss die Tür, und da wurde es endlich, endlich still.
Und Cliff schlug die Augen auf.
Er setzte sich in der Badewanne hin und schlang die Arme um die Knie, er hatte ziemlich viele blaue Flecken überall, auch an den Knien. Im Sommer hatte Alain auch immer blaue Flecken vom Draußenspielen. Im Winter nicht.
Cliff sah Alain und Margarete an, und Alain begriff, dass er so dasaß, mit den Armen um die Knie, weil er nicht wollte, dass sie ihn nackt sahen.
»Hallo«, sagte Margarete. »Ich glaub, du bist jetzt wärmer.«
Cliff nickte.
»Warum warst du da drin? Im Schuppen?«, fragte Alain.
»Die Tür ging nicht auf«, sagte Cliff.
»Aber warum bist du da rein?«
Cliff zuckte die Schultern. »Nur so. Ich wollte nicht zu Hause sein.«
»Hat dein Vater dich in den Schuppen gebracht?«, fragte Margarete.
»Nee«, sagte Cliff. »Warum?«
»Nur so«, sagte Margarete. Und dann schwiegen sie, sie saßen einfach da und schwiegen, und es war, als gehörten sie alle drei auf eine komische Weise zusammen. Alain fühlte sich wieder glücklich und hatte gleichzeitig Angst. Das schwarze Funkeln in Cliffs Blick fraß sich in sein Innerstes, wie ein Schatz aus einem Märchen, der überall, wo er einmal liegt, verbrannte Erde hinterlässt.
Coco zwang Cliff, Tee zu trinken und Butterbrote zu essen, steckte ihn ins Bett und deckte ihn sehr gut zu. Alain hatte ihm den neuen, warmen Schlafanzug mit den Pinguinen geliehen.
Ricki Bergmann rief eine Stunde später zurück. Alains Vater, der nie schrie, schrie ihn am Telefon an.
Alain und Coco saßen still daneben. Er hatte das Telefon auf laut gestellt, und sie hörten, wie Ricki Bergmann sagte, er würde Cliff seit einer ganzen Weile suchen. Cliff müsste aus der Wohnung gerannt sein, als er kurz weg war, um Zigaretten zu holen. Er hätte wohl zu seiner Mutter gewollt, oder jedenfalls hätte er, Ricki, das gedacht, und als er dann gemerkt hätte, also, durch einen Anruf gemerkt, dass er nicht bei ihr war, hätte er angefangen, sich Sorgen zu machen, und wäre los, die Straßen absuchen, und dann hätte er die U-Bahn genommen, doch noch zu Cliffs Mutter, aber da hätte er ihn auch nicht gefunden.
Es klang alles sehr kompliziert.
Coco schüttelte den Kopf, und Henri sagte bemüht ruhig, Ricki Bergmann solle sofort nach Hause kommen. Als spräche er mit einem Hund.
Und als Ricki Bergmann eine Dreiviertelstunde später ihre Wohnung betrat, sah er auch aus wie ein Hund, ein geschlagener Hund, er ließ den Kopf hängen und wirkte nicht mehr wie ein Pirat. Er stand an dem Gästebett, in dem sein Sohn jetzt schlief, und wischte sich über die Augen und erklärte ungefähr eine Million Mal, es täte ihm leid.
Aber Coco und Henri flüsterten in der Küche, und Coco sagte, er hätte Cliff vergessen und sich die Nacht mit irgendwelchen Kumpels um die Ohren geschlagen und wahrscheinlich gesoffen. Und Henri sagte, er würde sich ernsthaft fragen, ob er Cliff in den Schuppen gesperrt hatte, aber Coco sagte, da wäre kein Schloss gewesen, nur die Tür hätte geklemmt. Und Henri sagte, das könnte man auch einsperren nennen und dass er eigentlich gerne die Polizei rufen würde. Coco beschwichtigte ihn, weil es für Familien immer das Schlimmste sei, sie auseinanderzureißen. Und was dann noch alles gesagt wurde, daran erinnerte sich Alain später nicht mehr. Es war zu schwierig und hatte mit Ämtern zu tun und Telefonaten.
Er erinnerte sich nur daran, wie Ricki irgendwann ging und er in das Zimmer schlich, in dem Cliff schlief. Er öffnete die Augen, sobald sich die Tür hinter seinem Vater schloss.
Und er sagte: »Der hat geheult, ja?«
»Ja, und wie«, sagte Alain. Er sah, dass Cliffs Augen auch komisch waren.
»Heulst du auch?«, fragte er.
Aber Cliff nieste nur, und dann hustete er. Und danach war er eine Woche lang ziemlich krank. Er blieb in der Wohnung im zweiten Stock. Er warf keine Steine, weil es in der Wohnung keine gab. Er redete nur das Nötigste. Manchmal saß Alain wieder an seinem Bett, und sie redeten einfach nicht, und das war schön und eigenartig. Cliff schien dann nach innen zu sehen und zu träumen.
Sein Gesicht sah manchmal wieder nach Steineschmeißen aus. Als wären seine Tagträume nicht unbedingt gut. Da war noch immer diese Energie in ihm, die Alain schon beim allerersten Mal gespürt hatte, ein dunkles Pulsieren in der Luft, und es schien Cliff selbst am meisten Schmerz zuzufügen.
Es war das seltsamste Weihnachten, das Alain je erlebt hatte. Sie versuchten, normale Dinge zu tun, sie aßen zusammen Kekse, und der Kinderarzt kam vorbei und verschrieb Cliff irgendwelche Medizin, und Cliffs Vater kam und saß an Cliffs Bett und sah aus, als wäre ihm alles furchtbar peinlich. An dem Tag, an dem er zurück nach unten zog, stand Cliff mit Alain am Fenster und sagte etwas Merkwürdiges.
Er sagte: »Wenn ich groß bin, sperr ich die ganze Welt in einen Schuppen. Und denn wart mal, bis es richtig kalt ist.«
Alain!
Ich stehe auf der Brücke beim Mauerpark, unter der die Birken an den Gleisen wild wachsen wie Wünsche, und ich sehe in die Ferne, in der die Züge verschwinden und all diese Wünsche in Erfüllung gehen können. Es ist kalt, aber das ist gut so.
Januar 2016, der kälteste Monat in meinem Leben.
Alain,
als ich dich zum ersten Mal sah, auf der Straße, mit dieser Bäckereitüte im Arm, wusste ich nichts.
Du warst einfach ein kleiner Junge, und ich war ein kleines Mädchen. Und der Stein, den Cliff auf das Auto warf, war nur ein Stein. Für mich waren die Dinge immer nur das, was sie waren. Wenn ich deine Bilder betrachte, ist das bei dir anders, du hast immer mehr in den Dingen gesehen, vielleicht schon mit vier Jahren.
Ich kannte ihn länger als du, aber nicht lange, vielleicht ein halbes Jahr, da waren wir in das Haus eingezogen. Und jetzt ist es für mich so, als hätte ich euch zusammen kennengelernt. Ihr wart eine Einheit, nie zu trennen. Und niemals zueinander zu bringen.
Ich sehe dich noch vor mir: diesen schmächtigen Jungen mit dem blonden Haar und dem aufmerksamen, ernsten, schmalen Gesicht. Und dann er, so ganz anders. Ein Kontrapol.
Ich habe euch heimlich beobachtet, vom Fenster aus, wie ihr manchmal im Garten bei den Blumen standet, die meine Mutter gepflanzt hatte. Und ich dachte, alles könnte gut werden.
Als du ihn damals im Schuppen gefunden hast und ich dich gefunden habe, dachte ich, er stirbt. Nie bin ich so schnell die Treppen hinaufgerannt, nie habe ich so laut an eine Tür gehämmert.
Jetzt frage ich mich, wie alles gewesen wäre, wenn wir ihn nicht gefunden hätten. Wenn er tatsächlich erfroren wäre, mit fünf Jahren, in einem Schuppen im Hinterhof.
Es bricht mir das Herz, das zu denken. Es bricht mir generell das Herz, über ihn nachzudenken.
Und über dich, natürlich.
Alain, weißt du noch, wie oft wir zusammen hier auf der Brücke standen? Es war ein guter Ort zum Träumen. Vor allem später, als Cliff verschwunden war. Als wir hier standen und uns in seine Ferne träumten, von der wir nie genau wussten, wo sie wirklich lag.
Als er wieder aufgetaucht ist, Alain, was hast du gedacht? Im ersten Moment? Hast du geahnt, warum er nach Berlin zurückgekommen war? Die Wahrheit? Hast du sie in seinen Augen gesehen?
Erzähl mir nichts. Natürlich hast du sie geahnt. Du warst immer der Mensch, der ihm am nächsten stand.
2
Ich erkannte ihn sofort.
Er saß auf einer Bank vor einem wackeligen Tisch, in der stillen Straße, in der das Eisenbahncafé liegt, und zeichnete. Die Sonne spielte in seinem hellen Haar, er hatte sich tief über das Blatt gebeugt, und von Zeit zu Zeit pustete er sich das Haar aus der Stirn. Es reichte noch immer bis zu den Schultern. Ich sah seine Hände an, die den Bleistift hielten, er hatte schöne Hände, immer gehabt: unwirklich lange, geschmeidige Finger und schmale Gelenke.
Damals war ich seit drei Wochen wieder in Berlin. Ich hatte nicht geplant, ihn zu treffen. Weniger als das. Ich war mir sicher gewesen, ich würde ihn nie wiedersehen.
Aber da saß er und zeichnete mit einem weichen Bleistift Linien aufs Papier, konzentriert, und ich stand auf der anderen Straßenseite und starrte ihn an. Der Himmel war grau und voller Wolken an diesem Tag, der Wind war kalt und schmeckte nach Herbst. Alain trug himmelgraue Handschuhe mit abgeschnittenen Fingerkuppen.
Die anderen Tische waren leer, nur ganz außen saß ein Penner in einer schmuddeligen Trainingsjacke, seine Sammlung an Tüten und Taschen neben sich.
Ich sah Alain wieder an. Etwas wie ein Leuchten ging von ihm aus. Der Wind fuhr durch sein blondes Haar, das Blau seiner Augen war so durchscheinend wie Buntglasfenster. Er hatte immer im Licht gelebt.
Ich merkte, dass ich zitterte.
Etwas in mir sehnte sich danach, hinüberzugehen und ihn anzusprechen. Doch stattdessen ging ich einen Schritt rückwärts. Das Licht. Es war mir immer unheimlich gewesen. Natürlich sah man es nicht, nicht wirklich. Aber es war da. Die ganze Zeit über. Es war in mein Leben eingedrungen wie ein unbesiegbarer Feind. »Alain«, wisperte ich. »Alain.«
Er sah nicht auf, er zeichnete weiter. Er zeichnete den Penner, für ihn war der Penner schön.
Ich schloss ebenfalls die Augen.
Und ich sah das Blut. Eine Pfütze, zu meinen Füßen, die auf der Erde stehen blieb, weil die Erde zu trocken war, zu rissig, um irgendetwas in sich aufzunehmen. Ich sah das Blut, und ich roch es, und ich öffnete die Augen wieder. Da hatte Alain den Kopf gehoben und blickte mich an, seine durchscheinend blauen Augen fanden meine. Etwas wie ein Lächeln huschte über sein Gesicht.
Und meine Beine trugen mich über die stille Straße, zwischen den Reihen parkender Autos hindurch. Es waren vielleicht zehn Meter. Es waren zehntausend Kilometer.
Ich sah die Reklametafeln am Eisenbahncafé, während ich ging. Ich sah die Kolonnen von buntem Metallschrott auf der Straße. Ich sah eine junge Frau mit einem Kinderwagen und zwei schweren Einkaufstaschen, prallvoll mit frischem Gemüse und steril verpackten Fertignahrungsmitteln. Ich sah die Sneakers der jungen Frau, die engen Jeans, das genauso enge Oberteil, das Kinderwagenverdeck aus silbergrauem Stoff. Sie trug eine amerikanische Flagge hinten auf ihrer Jacke. Ich sah einen Mann im Jackett, der aus einem Auto ausstieg, ein teures Jackett, ein teures Auto.
Ich sah, was ich sehen musste, um zu funktionieren, und mir war kalt, und die Stadt war fremd und groß und ein Feind, aber sie war auch das Wasser, in dem ich schwamm, der einzige Ort auf der Welt, an dem ich hundertprozentig funktionieren konnte.
Und dann stand ich an Alains Tisch. Er sah zu mir auf und blinzelte, auf die Art, auf die er es immer tat, als blicke er in eine noch größere Helligkeit.
»Cliff«, sagte er. Mehr nicht. Nur meinen Namen. Einen Namen, den ich lange nicht mehr gehört hatte.
Ich hätte niemals über diese Straße gehen dürfen.
Warum bin ich nicht weggegangen? Ohne mich umzudrehen? Ich wusste, dass das Licht gefährlich sein würde. Ich wusste es.
»Hey«, sagte Alain. »Du bist also wieder hier?«
»Und du?«
»Ich war nie weg. Nicht für länger. Ich war hier und habe gemalt. Und rumgehangen. Sozialkram gemacht. Sollte ein FSJ werden, aber dann war ich nicht organisiert genug und hab irgendwie so in ein paar Projekten gearbeitet. Obdachlose und Suppe und Flüchtlinge und so.«
Ich weiß nicht, ob er wollte, dass ich reagierte. Ich reagierte nicht.
»Ich habe dir Mails geschrieben«, sagte er.
Ich zuckte die Schultern. »Ich hab die alte Mailadresse nicht mehr.«
»Das dachte ich mir«, sagte Alain, auf eine Art gleichgültig, die unecht klang. Und dann grinste er plötzlich. »Ich … um ganz ehrlich zu sein, ich habe dich vor einer Woche schon gesehen. Ich wollte dir nach. Mit dir reden. Im Mauerpark. Aber dann bist du abgehauen, hinter dem Park. Du bist in ein Auto gestiegen und warst weg.«
Ich sah, dass er wissen wollte, wer in dem Auto gesessen hatte. Ich sagte nichts.
Er zuckte die Schultern. Schließlich brach das Lächeln wieder durch. »Kaffee?«
»Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich keine Zeit. Ich muss gehen.«
»Wohin denn?«, fragte er.
»Du siehst genauso aus wie damals«, sagte ich. »Okay, einen Tee.«
Ich holte den Tee, zwei Becher voll, drinnen, zwischen merkwürdigen Eisenbahnrelikten und merkwürdigeren Menschen. Das Eisenbahncafé war immer schon eine Anlaufstelle für merkwürdige Menschen gewesen. Womöglich, dachte ich, fühlten sich die merkwürdigen Menschen zwischen Schienen und alten Lampen wohl, weil sie genauso auf dem Abstellgeleis lebten, nicht mehr gebraucht wurden, einstaubten wie der ganze Schrott hier. Ich schenkte der Frau an der Theke ein Lächeln, als ich zahlte. Sie lächelte zurück. Nicht so wie Alain. Normal. Unwissend.
Und ich dachte, dass ich es also noch konnte. Frauen zum Lächeln bringen.
Gut.
Draußen stellte ich die Tassen ab und setzte mich auf einen wackeligen Klappstuhl an Alains Tisch.
Er sah mich in meinen Taschen suchen und schob mir ganz selbstverständlich den Aschenbecher hin. Doch es war das Handy, das ich gesucht hatte, keine Kippen.
»Ich rauch nicht mehr«, sagte ich und checkte die Zeit und die letzten Anrufe. Gut. Fünf Minuten.
»Kein Alkohol, keine Zigaretten. Ende.«
Und ich dachte, dass ich doch geraucht hatte, im Mauerpark. Hatte Alain es gesehen?
»Wo warst du?«, fragte er.
»Ist das Paket angekommen?«
»Es war für deine Mutter«, sagte Alain. »Nicht für uns.«
»Habt ihr es ihr gegeben?«
Alain nickte. »Wir … haben es aufgemacht, wir waren zu schnell, wir dachten, es ginge an uns. Was du hineingelegt hattest … Margarete hat sich übergeben, aber sie denkt, ich weiß es nicht. Es war eine Botschaft, aber was sollte es heißen?«
Ich sah weg, blies in meine Teetasse. Botschaften kann man nicht erklären, sie müssen sich selbst erklären. Und auf einmal beugte Alain sich über den Tisch und legte eine Hand auf meine, seine Hand war warm und lebendig. »Hast du schon mit Margarete geredet?«
»Nein.«
»Ruf sie an«, sagte er. »Sie hat dieselbe Nummer wie damals. Sie wartet. Sie hat das ganze Jahr über gewartet, auch wenn sie es niemals zugeben würde.«
Ich nickte langsam. Margarete. Ich sah sie noch vor mir, wie sie in der Tür des alten Hauses stand, unten, in der Tür voller Graffiti, vor dem dunklen Hausflur. Wie sie sich das Haar aus der Stirn strich und ihren Schal enger zog, einen weichen, anschmiegsamen Seidenschal, in den ich so gerne mein Gesicht gepresst hätte. Sie hatte nicht gewinkt, mir nur nachgesehen. Und ich war gegangen, ohne mich umzudrehen.
Ich hatte gedacht, es wäre ein Abschied für immer.
Alain beugte sich über das Blatt Papier auf dem Tisch und zeichnete weiter, und ich sah ihm zu.
Der Penner auf dem Papier war ein anderer als der in der Realität. Dreckiger, abgerissener, selbst seine Konturen waren zerrissen. Aber er hatte Flügel. Große, zerbrechliche, zarte Schmetterlingsflügel. Ein Windstoß, und auch sie würden zerreißen.
»Du bist noch besser geworden«, sagte ich.
Alain zuckte die Schultern. »Ich mache eine Mappe. Für die Kunsthochschule. Ich habe zu lange rumgehangen.«
Ich beobachtete seine Finger, die den Bleistift übers Papier führten, den Flügeln Schatten verliehen. Sie waren nicht schön, sie waren beunruhigend, und die Figur des Penners verkrümmt, verzerrt, wie eine Gestalt von einem anderen Planeten. Ein wenig wie die Gestalten von Giger; Giger hatte uns immer beide fasziniert. Maschinenkörper.
»Was ist mit dir?«, fragte Alain. »Hast du gezeichnet? Im letzten Jahr?«
Ich nickte.
»Was?«
Wie sollte ich Alain das sagen? Ich merkte, dass ich schwitzte. Und dass meine Hand auf seiner lag, ihn vom Weiterzeichnen abhielt. Ich hatte die Hand nicht dort hinlegen wollen, ich wusste nicht, wie es geschehen war.
»Du weißt nicht, wo ich war«, sagte ich ganz leise.
»Nicht genau.« Er schien zu schlucken. »Aber egal, wo«, flüsterte er dann. »Jetzt bist du wieder hier. Jetzt ist es vorbei, oder?«
Er sah von dem Bild auf, sah mich an, und ich spürte, wie seine hellen Augen die Wahrheit suchten.
»Ist es vorbei, Cliff?«
»Ich bin von dort wiedergekommen«, sagte ich. »Oder?« Und sah auf mein Handy, nach der Uhrzeit. »Ich muss. Ich treffe mich mit jemandem.« Ich bemerkte Alains Misstrauen und lächelte. »Normale soziale Kontakte.«
Er nickte. »Integration, Arbeitsmarkt, der ganze Scheiß? Was wirst du machen?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Mich beim Jobcenter melden, denke ich. Irgendwas finden.«
»Du solltest wieder zeichnen«, sagte Alain.
Ich stand auf. »Ja. Vielleicht.«
Der Penner erhob sich schwankend und schlurfte mit seinen Tüten die Straße entlang, doch ich sah beinahe die Flügel, er war ein Engel, ein falscher Engel, Alain hatte ihn dazu gemacht.
Und ich ging einen Schritt rückwärts, von Alain weg. Da saß er und lächelte, in all dem Licht, und er war mir unheimlich. Auch er war ein Engel, immer gewesen, ein Engel von Giger.
Irgendwo knallte etwas, und ich muss zusammengezuckt sein, mehr, als normale Menschen zusammenzucken, denn Alain sah mich seltsam an.
»Fehlstart«, sagte er. »Ein Motorrad. Sonst nichts.«
Ich nickte. Ging noch einen Schritt rückwärts.
»Cliff?«, sagte Alain. »Komm vorbei, wann immer du willst. Wir wohnen noch in der alten Wohnung, ich … na ja.« Er lachte. »Ich bin bisher immer nur fast ausgezogen. Ich glaube, meine Eltern würden mich gerne langsam rausschmeißen. Aber … wenn du irgendetwas brauchst, komm vorbei, ja?«
»Mal sehen«, sagte ich.
Und dann ging ich, rasch, an den Schlangen aus geparktem Blech vorbei, fort von dem Licht, das in meinem Rücken brannte. Zwei Straßen weiter gab es eine Kneipe, die schon offen hatte, irgend so ein abgewracktes Ding, an das ich mich erinnerte, kalte, dunkle Räume, schon nachmittags voller Zigarettenqualm. Ich hatte nicht vor zu bleiben.
Ich schaffte es gerade noch bis zur Toilette, dann hing ich über der Schüssel und übergab mich, spuckte alles aus, was ich gar nicht in mir hatte, spuckte, bis ich nur noch Galle hochwürgte, bittere Galle und ätzende Säure. Und etwas in mir wollte heulen, doch das war unmöglich. Die ganze Kneipe war voller Blut, es stand bis zur Decke, rot und dickflüssig, und das Licht, Alain in seinem Licht, trieb reglos darin, das blonde Haar ausgebreitet wie Seetang.
Komm vorbei.
»Du weißt nichts«, flüsterte ich in den Wasserspiegel der Kloschüssel. »Wenn du wüsstest, warum ich hier bin, Alain. Dann würdest du anders reden.«
Als ich in der U-Bahn saß, sah ich in der Scheibe die Spiegelung eines Gartens voller kleiner leuchtender Ballons aus Papier. Sie waren nicht da, natürlich, sie waren nur in meiner Vorstellung vorhanden. Die Lampion-Ballons hingen in den knorrigen alten Obstbäumen, als wären sie eine andere Art von Äpfeln: blassblau, violett, grün, gelb. Die letzten echten Äpfel des vergangenen Jahres hingen dazwischen wie Papierkugeln.
Ich sah aufs Display des Handys, schrieb eine SMS, dass ich später kommen würde. Und sah wieder in die Scheibe.
Unter den Zweigen saßen zwei kleine Jungen auf einer Holzwippe, zwei Jungen in dicken Winterjacken und mit glänzenden Augen. Unter der Wollmütze des einen lugten hellblonde Haarsträhnen hervor. Die beiden wippten auf und ab, auf und ab, und von irgendwoher kam Musik. Ein Tango. Erwachsene standen und saßen herum und tranken Punsch, eine Menge anderer Kinder rannte unter den Bäumen herum, und über einem Feuer weiter hinten im Garten brieten sie Würstchen an Stöcken.
Es war Februar, und dies war ein Fest der Kita, in die Alain und Margarete gingen. Cliff war immer in eine andere Kita gegangen, eine weniger private und weniger teure.
Margarete saß auf dem Schoß ihres Vaters und sah den beiden Jungen beim Wippen zu.
Es war eine schöne Szene, eine Szene wie für einen Film.
Irgendwann kletterte Alain von der Wippe, und Margarete in ihrem roten Mantel lief über das kalte, nasse Gras und setzte sich aufs Ende des Brettes, und Cliff stieß sich ab und ließ die Wippe auf und ab schwingen, und er sah Margaretes Lachen vor den Lampions und den Äpfeln und fühlte, dass er glücklich war.
Aber es war immer eine zweischneidige Sache, glücklich zu sein. Wenn man es am meisten war, kam irgendetwas und zerstörte das Ganze.
Bei Margaretes und Alains Eltern saß seine Mutter an einem der wackeligen Klapptische. Cliff hob die Hand und winkte ihr. Sie winkte zurück. Lächelte. Und er verließ Margarete und die Wippe und lief hinüber, um sie zu umarmen, denn auf einmal hatte er Angst, dass sie plötzlich fort sein könnte.
Sie streichelte sein Haar, und ihre Hand war sanft und freundlich, aber sehr leicht. Wie ein Schmetterling, der sich nur kurz setzt, um weiterzufliegen.
»Kannst du nicht immer dableiben?«, fragte Cliff. »Kann ich nicht bei dir wohnen?«
»Ich wünschte, das ginge«, flüsterte seine Mutter und schlang ihre Arme um ihn. Sie duftete nach Parfüm und nach Punsch und nach frischer Luft. »Ich wünschte, es ginge einmal gut. Wenn ich zu Ende studiert habe, habe ich vielleicht mehr Nerven.«
Er wusste, was sie meinte. Es ging nie gut, wenn er bei ihr war, irgendwann bekam er immer einen dieser Anfälle; dann zerschlug er etwas, tat jemandem weh, und sie sagte, sie könne nicht damit umgehen, und am nächsten Tag war er wieder bei seinem Vater, mitsamt Koffer und Autokindersitz.
Er wusste nicht, warum er diese Anfälle bekam. Oder vielleicht doch.
Es passierte, wenn sie ihn alleine ließ oder ihm nicht zuhören konnte, weil sie so viele andere Dinge tun musste. Sie lernte immerzu. Sie wollte etwas Gutes werden, sie wollte viel Geld verdienen. Cliff wusste nicht, wofür. Für wen. Vielleicht würde sie sich ein anderes Kind kaufen, wenn sie genug Geld verdient hatte.
Er hasste Geld. Es machte so viel kaputt, man hätte es nie erfinden sollen.
Er hatte sie schon ein paarmal gehauen, mit den Fäusten, oder getreten oder gebissen. Es gab diese Momente, in denen er ihr wehtun wollte. Einfach damit sie kapierte, dass er da war. Wenn er sah, was er getan hatte, erschrak er vor sich selbst.
Er war sehr stark für fünf Jahre.
Er liebte sie.
So sehr, dass es gefährlich war, denn Liebe ist immer gefährlich, je größer, desto gefährlicher, wie Feuer. Diesmal, dachte er, dort unter den Lampions, diesmal würde er bei ihr bleiben. Nicht wütend werden wegen irgendetwas. Niemanden verletzen. Er konnte es.
Zwei Tage später war er wieder bei seinem Vater.