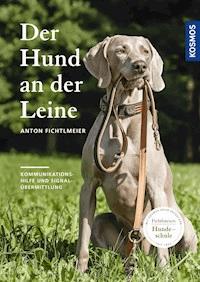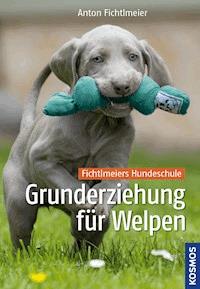28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Jagen ohne Hund ist Schund", besagt ein altes Jägersprichwort. Unter heutigen Anforderungen waid- und tierschutzgerechten Jagens ist es gültiger denn je. Zwei Experten stehen mit ihren Namen für erfolgreiche und zeitgemäße Jagdhundausbildung. Leicht nachvollziehbar informieren sie über den Weg des Jagdhundes von der Früherziehung des Welpen und Junghundes bis zum vielseitig einsetzbaren Jagdhelfer, auf den bei Prüfungen und in der Praxis Verlass ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
GELEITWORT ZUR ERSTAUSGABE
Vor einigen Jahren habe ich Anton Fichtlmeier kennen und vor allem schätzen gelernt. Mir fiel sofort sein Umgang mit Hunden auf – seine engagierte Art, mit ihnen zu arbeiten, dabei neue, moderne Wege zu gehen und alte Zöpfe abzuschneiden, das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue.
Ja, ich staunte und erfreute mich an seiner Liebe zum Tier. Ich sagte zu meiner Frau, die einige Bayerische-Gebirgsschweißhund-Würfe aufgezogen hat und mich ihre Liebe zu den Hunden immer spüren ließ: „Wenn ich noch mal auf die Welt kommen sollte, dann möchte ich Jagdhund bei dem Fichtlmeier oder Esterl sein.“
In unzähligen Gesprächen offenbarte Anton mir seine Visionen, in denen ich mich als Mensch, der die Natur und jede Kreatur darin mit Wertschätzung wahrnimmt, wiederfand. Ich habe miterlebt, wie sich einige Prinzipienreiter gegen ihn wandten, weil er die herkömmliche Ausbildung des Jagdhundes an der vorübergehend flugunfähig gemachten Ente zu Prüfungszwecken unnötig nannte. Ich habe mitbekommen, welchen Gegenwind er zu spüren bekam, weil er sich gegen das Kupieren von Hunderuten stellte oder weil er einen Weg zum freudigen Apport und damit zu echter Bringtreue des Hundes aufzeigte, der ohne „Zwang“ auskommt.
Beim „Altmeister“ Anton Fichtlmeier konnte ich beobachten, wie sein Spitzenhund, der Weimaraner Franz Josef, regelrecht lächelnd nach „Gefunden“ im Anschluss an eine Freiverlorensuche zu ihm zurückeilte und ihn freudig zum Stück führte. So etwas geht nur, wenn zwischen Hundeführer und Hund die Chemie stimmt.
© Gila Fichtlmeier
Ich habe viele Spitzenleistungen von Hunden erlebt, habe selbst geführt und auch gerichtet. Anton Fichtlmeier bietet praktikable und in höchstem Maße tierschutzkonforme Wege zur Ausbildung von Jagdhunden an, die in vielerlei Hinsicht von der „herkömmlichen Lehre“ abweichen, aber überaus erfolgreich sind. Und er bleibt seinen Idealen – auch bei Gegenwind – treu. Dass sein Weg ein richtiger ist, bestätigen all die unzähligen Jagdhundeführer, die Antons spannenden und einfühlsamen Weg der Ausbildung eines zuverlässigen Jagdhelfers erleben und genießen durften.
Anton Fichtlmeier zeigt in diesem Werk auf, wie artgerecht und erfolgreich mit dem Geschöpf Hund umgegangen wird. Er versteht es bestens, die hohe Intelligenz unserer Jagdhunde zu fördern und zu Spitzenleistungen zu bringen. Die „Koralle“ und anderweitige Repressalien gegen den Hund brauchen Sie nicht.
Anton arbeitet nach der Methode „In der Ruhe liegt die Kraft“. Ihm für dieses Buch ein recht herzliches „Ho-Rüd-Ho“ und Waidmannsdank!
Schliersee im Hahnenmond
Konrad Esterl
ZU DIESEM BUCH
In unserem KOSMOS-Buch „Die Prägung des Jagdhundwelpen“ haben wir aufgezeigt, wie Züchter und Hundebesitzer bereits in den ersten 20 Lebenswochen ihre Welpen aktiv auf die Familie und die Jagd vorbereiten können. An diese Vorprägung knüpft das hier vorliegende Buch nahtlos an.
THEMENBLÖCKE JAGDPRAXIS UND AUSBILDUNGSBAUSTEINE
Anders als „Die Prägung des Jagdhundwelpen“ ist dieses Buch aber nicht nach verschiedenen Lebensphasen des Hundes aufgebaut, sondern in zwei Themenblöcke gegliedert: Der erste Teil bis zum Ende des Kapitels „Die Arbeit auf der Wundfährte“ beschäftigt sich mit der Jagdpraxis und dem Einsatz des Hundes im Jagdbetrieb. Der zweite Teil widmet sich der Ausbildung des Hundes und zeigt die jeweiligen Schritte auf, die ihn für die gemeinsame Jagd im Revier fit machen.
© Gila Fichtlmeier
ANFORDERUNGSPROFILE SCHAFFEN KLARHEIT
Im Praxisteil habe ich die in Deutschland meistverbreiteten Jagdarten aufgeschlüsselt und für jede ein Anforderungsprofil angelegt. Dieses Profil macht klar, was Sie und Ihr Hund für die jeweilige Jagdart „draufhaben“ sollten. Außerdem zeige ich auf, welche Schwächen sich während der Jagd einschleichen können und wie man gegensteuert, damit sie nicht zur unerwünschten Tugend werden.
PRAXIS UND AUSBILDUNG GREIFEN INEINANDER
Und damit sind wir auch schon beim zweiten großen Themenblock meines Buches, dem Ausbildungsteil. Je nachdem, auf welchem Gebiet Sie Ihren Hund einsetzen wollen, schlagen Sie einfach bei dem entsprechenden „Fach“, dem jeweiligen Baustein, nach.
Ein Beispiel: Sie wollen, dass Ihr Hund Ihnen freudig Beute bringt und überlässt, weil Sie ihn mit auf die Fasanenjagd nehmen möchten. In den Abschnitten „In Besitz bringen“ und „Das Apportieren“ im Kapitel „Die Einarbeitung – Fichtlmeiers Weg“ finden Sie die entsprechenden Anleitungen. Egal, ob es sich bei Ihrem Hund um einen Einsteiger handelt oder er bereits zu den Fortgeschrittenen zählt – Sie können sofort mit ihm das Training beginnen.
GEMEINSAM JAGEN
Die Wege, die ich Ihnen dabei aufzeige, sind tierschutzgerecht und modern, und sie wurden bereits von vielen Hundeführern wie Ausbildern übernommen – Apportiertisch, „Koralle“ und andere Druckmittel werden Sie in diesem Buch vergeblich suchen. Vor allem den sogenannten „Zwangs“-Apport und die heiß diskutierte „Arbeit hinter der lebenden Ente“ lehne ich seit vielen Jahren ab. Mein Trainingskonzept bietet dazu eine bewährte Alternative. Im Bereich Nach-suchen auf Schalenwild lasse ich Sie an meinen Erkenntnissen teilhaben, die ich im Rahmen meiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit bezüglich der Nasenleistung von Hunden, der Verteilung von Geruchspartikeln sowie deren Beeinflussung durch Windverhältnisse (siehe hier) gewonnen habe. Hier beschreibe ich mein Trainingskonzept, das gestattet, den Hund ähnlich einem Messgerät einzusetzen (siehe hier).
Ich appelliere seit jeher an die Intelligenz des Hundes und stelle das Jagen im Team in den Mittelpunkt. Meiner Erfahrung nach ist das Zusammenspiel innerhalb des Gespanns ausschlaggebend für den gemeinsamen Erfolg.
ERFOLG IST PLANBAR
Apropos Erfolg: Er kommt nicht von ungefähr und ist planbar, denn wie so oft ist das eigene Engagement der sprichwörtliche Schlüssel zum Erfolg.
Beim gemeinsamen Herantasten und Üben mit dem Hund werden Sie innerhalb des Ausbildungsgeschehens und in der Praxis mit den Stärken und Schwächen Ihres Hundes konfrontiert. Anhand dieses Buches lernen Sie, ihn zu lesen, und Sie entwickeln mit der Zeit ein Gefühl dafür, was er sicher und zuverlässig leisten und auf welchem Gebiet er noch gefördert werden kann.
© Anton Fichtlmeier
JAGDARTEN IN WALD UND FELD
© Gila Fichtlmeier
DER ANSITZ
In Deutschland gehören der Morgen- und Abendansitz auf Schalen- und/oder Raubwild zu den meistverbreiteten Bejagungsstrategien. Der überwiegende Teil des Wildes wird seit jeher bei dieser Jagdart erlegt.
MERKMALE UND ABLAUF
Der Jäger passt das Wild in ausreichender Deckung bei gutem Wind ab, beispielsweise an einem Bodensitz, auf einer Leiter, einem Hochsitz oder einer Kanzel. Bevorzugte Ansitzplätze sind Hauptwechsel, Einstandsgebiete, Äsungsplätze (Wildacker und Kirrungen), Suhlen, Salzlecken, Luderplätze etc.
So mancher Hundeführer hat beim Ansitz seinen Hund gern an seiner Seite, schließlich zeigt der frühzeitig an, wenn Wild anwechselt – er wittert es schon auf weite Entfernung, er hört geringste Geräusche und nimmt kleinste Bewegungen auch in der Dämmerung wahr.
© Gila Fichtlmeier
Über den Baustein Bleib hat Weimaraner Franzl gelernt, ruhig und entspannt zu warten, bis Anton ihn wieder abholt.
Vorbereitende Bausteine
Bleib
Schussfestigkeit (Dummy Launcher)
Reizangel (Standruhe)
Apport
Geruchspartikel und Windkunde
Spurarbeit – Schleppe
Nachsuche – Einarbeitung
DAS PRAXISREIFE TEAM
DER HUNDEFÜHRER
Der Hundeführer kennt sein Revier und weiß, an welche Ansitzplätze beziehungsweise zu welchen Reviereinrichtungen er seinen Hund bei welchem Wind mitnehmen kann. Außerdem weiß er, wie dort das Wild zieht. Den Gefährten an einem Hauptwechsel abzulegen, verbietet sich von selbst. Der Hundeführer wird seinen Hund stattdessen so platzieren, dass anwechselndes Wild keinen Wind vom Jagdhelfer bekommt. Zudem muss der Hundeführer die Wetterlage gut einschätzen können; für den Hund sind Kälte, Hitze oder schwüle Abendstunden mit Mückenscharen, die ihn „auffressen“ wollen, unangenehm und nur schlecht auszuhalten.
Vor dem Ansitz gibt der Hundeführer seinem Hund genügend Auslauf und Gelegenheit, sich zu lösen. Für das Abliegen am Stand versorgt er ihn mit einer wärmenden Unterlage, die die vom Boden aufsteigende Feuchtigkeit und Kälte abhält.
DER HUND
Ähnlich wie bei der Pirsch läuft der Hund ruhig und leise bei Fuß neben dem Hundeführer zum Ansitz. Dort liegt er bombenfest im Bleib, unabhängig davon, wie lang sich der Ansitz hinzieht. Er verharrt, wenn er Wittrung von Wild bekommt oder es sieht. Der Hund beherrscht die Standruhe sogar dann, wenn Fuchs, Hase, Reh etc. in unmittelbarer Nähe auf ihn zupassen oder an ihm vorbeiziehen. Das Bleib funktioniert selbstverständlich auch neben dem erlegten Stück. Der Jagdgefährte darf nicht schussempfindlich, schussscheu oder gar schusshitzig sein.
© Anton Fichtlmeier
Hoch konzentriert, aber ruhig wartet Terrie beim Erdansitz auf anwechselndes Wild. Ein standruhiger Vierbeiner ist ein perfektes „Frühwarnsystem“: Er zeigt heranziehendes Wild frühzeitig an.
Hat der Hundeführer während des Ansitzes geschossen, liegt der Hund so lange ruhig im Bleib auf seiner ihm zugewiesenen Position, bis er dort abgeholt wird. Neben gutem Gehorsam am Wild muss der Hund sich – auch aus Entfernung – per Pfiff oder Handzeichen dirigieren lassen. Sollte eine Nachsuche notwendig werden, wird er eingesetzt.
In folgenden Fällen ist die Standruhe bei der Ansitzjagd unbedingt erforderlich:
Es kommt kein Wild in Anblick.
Wild wechselt an und bleibt unbeschossen.
Wild wechselt an, wird beschossen und liegt im Feuer: Der Hund wird nicht gebraucht.
Wild wechselt an, wird beschossen und liegt nach einer Todesflucht: Der Hund kommt zum Einsatz, weil das Stück nachgesucht werden muss.
Mögliches Fehlverhalten
Schusshitzigkeit
mangelnde Standruhe
nicht gefestigtes Abliegen
Anhetzen
SCHRITT FÜR SCHRITT IN DIE PRAXIS
Ruhiges und entspanntes Abliegen über einen Zeitraum von mindestens 30 bis 40 Minuten wurde vor dem ersten Ansitz bereits im Alltag, bei Apportier- oder Reizangelübungen, in Hundegruppen oder am Hundetreffpunkt unter möglichst vielen Ablenkungssituationen geübt und gefestigt. Wenn das gut funktioniert, nimmt der Hundeführer seinen Hund zum Ansitz mit.
Als erster Ansitzplatz empfiehlt sich ein Erd- beziehungsweise Bodensitz oder ein Schirm. Dort wird der junge Hund zu den Füßen des Hundeführers oder in unmittelbarer Nähe ins Bleib (siehe hier) auf seine Decke gebracht – das gibt dem Hund Sicherheit. Die ersten Male wird er über eine lange Leine abgesichert, die beispielsweise an einem Baum befestigt ist.
Die ersten Ansitzübungen absolviert das Gespann zu Zeiten, in denen nicht mit Wild zu rechnen ist, oder in Revierecken, die „wildarm“ sind. Die Dauer des Ablegens beträgt anfangs die bisher geübte Zeitspanne von circa 30 bis 40 Minuten, die man langsam von Mal zu Mal verlängert. Auch die Entfernung der Abliegeposition des Hundes zur Jagdeinrichtung wird kontinuierlich gesteigert.
Kommt der abgelegte Hund am Erdsitz augenblicklich zur Ruhe, kann jetzt bereits auf höhere Jagdeinrichtungen generalisiert werden. Es ist allerdings immer weiter darauf zu achten, dass Hundeführer und Hund sich gut sehen können.
© Anton Fichtlmeier
Was beim Ansitz funktioniert, kann später bei einer Gesellschaftsjagd zur Anwendung kommen.
KLEINE HUNDE MIT NACH OBEN
Mancher Hundeführer nimmt seinen kleinen Hund, wie beispielsweise Teckel oder Terrier, gern mit auf Kanzel oder Leiter. Aber Achtung: Der Hund bekommt den Schussknall mit all seinen Nebenwirkungen direkt zu spüren. Viele Hundeführer schützen deshalb inzwischen die Ohren des Hundes mit einem speziellen Gehörschutz.
Zeigen sich beim Hund Anzeichen von Unruhe, sei es, weil seine Nase Wittrung von Wild bekommt oder weil ihn die Gesamtsituation noch in Spannung versetzt, muss sofort wieder über die Basiserziehung an der Standruhe (siehe hier) gearbeitet werden.
© Gila Fichtlmeier
Nicht vergessen: Kommt der Hund mit auf die Kanzel, ist er dem Schussknall unmittelbar ausgesetzt.
Ab dem Zeitpunkt, an dem der Hund auch unangeleint sichere Standruhe zeigt, werden vom Hundeführer diverse Reizlagen eingebaut. Es können zum Beispiel Schüsse aus einer Signalwaffe abgegeben werden – ohne dass danach irgendeine Aktion folgt, das heißt: Der Hundeführer bleibt sitzen. Oder man wartet nach der Schussabgabe kurze Zeit, baumt ab und untersucht in aller Ruhe einen imaginären Anschusspunkt, um dann wieder aufzubaumen. Der Hund bleibt währenddessen abgelegt.
Verhält der Hund sich ruhig und souverän, imitiert der Hundeführer bei der nächsten Ansitzübung eine Nachsuche. Nach der Schussabgabe geht das Gespann zum Ansatzpunkt einer zuvor mit Schalen oder Schwarte gezogenen Schleppe – diese arbeitet der Hund jetzt in aller Ruhe am Schweißriemen aus.
Schließlich ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man gemeinsam in „wildreiche Ecken“ des Reviers zum Ansitz geht. Sicherheitshalber beginnt man aber auch hier wieder am Erdsitz, damit der Hund notfalls sofort korrigiert werden kann.
© Gila Fichtlmeier
Franzl bekommt einen Knochen zum Kauen. Damit wird aus dem Ansitz eher ein „Picknick“ und sein jagdlicher Erregungszustand gemindert.
DAS ERSTE STÜCK
Der Hund ist nun so gut vorbereitet, dass der Hundeführer bei sich bietender Gelegenheit das erste Stück schießt. Liegt es im Feuer, wartet er eine Weile, holt dann den Hund ab, leint diesen an und nähert sich gemeinsam mit ihm der Beute. Der Hund darf diese kurz bewinden und erhält dann seinen vollen Futternapf, bevor er in circa zwei Metern Abstand zum Stück wieder ins Bleib abgelegt wird.
Jetzt nutzt der Hundeführer diese Situation sofort für eine Anschneidkontrollübung. Er entfernt sich aus dem Sichtfeld des Hundes, aber so, dass er den jungen Hund gut beobachten kann. Geht der Hund tatsächlich an das Stück, greift der Hundeführer entsprechend reglementierend ein. Schließlich wird das Stück geborgen – dazu holt er entweder das Auto oder er zieht die Beute dorthin.
Ist das Stück hingegen in einer vom Hundeführer beobachteten Todesflucht in der Fluchtfährte verendet, wird dieses jetzt für eine kurze Nachsuche genutzt, allerdings erst nach einer mindestens 20-minütigen Pause. Der Hundeführer geht mit dem Hund zum Anschuss, beobachtet, wie er diesen anzeigt und annimmt, und lässt ihn die Nachsuche arbeiten.
© Gila Fichtlmeier
Den Kontakt zu Anton zu halten, ist für Franzl wichtiger als das Reh, das zur Anschneidkontrollübung neben ihm liegt.
Circa 20 Meter vor dem Stück bleibt der Hundeführer stehen, lässt den Riemen fallen und beobachtet, wie sich sein Gefährte nun am Stück verhält. Bewindet er es, wartet der Hundeführer, bis der Hund Kontakt zu ihm aufnimmt, und ruft ihn dann zu sich heran. Jetzt schickt er ihn mit einem „Zeig – zum Stück!“ wieder zum Stück und folgt ihm. Dort angekommen, liebelt er den Hund ab, gibt ihm Futter und es folgt die Anschneidkontrollübung (siehe hier). Fasst der Hund am Stück jedoch hinein, kommt sofort ein mahnendes „Nein, schone!“ und er wird abgerufen. Jetzt nimmt man den Riemen auf und ermuntert den Hund, noch einmal zum Stück zu suchen. Dort erhält er augenblicklich eine volle Futterschüssel und zum Abschluss folgt noch einmal die Anschneidkontrollübung.
TIPP
Auf dem Ansitz sollten immer ein verschließbares Gefäß für Schweiß und eine Tüte für Schalen griffbereit im Rucksack dabeisein. Beides braucht man für die Nachsuchenausbildung des Hundes. Und nach dem Schuss lautet die Devise: immer erst eine Weile „absitzen“ und Ruhe einkehren lassen. Wer nämlich sofort mit dem Hund in Richtung Wild geht, fördert unter Umständen Schusshitzigkeit, weil der Jagdhelfer verknüpft: Schuss – hinrennen – Beute in Besitz nehmen.
AM STÜCK ABLEGEN ODER MITNEHMEN
Nach der Erstversorgung muss der Hundeführer entscheiden, ob er den Vierbeiner, auch wenn dieser sicher abliegt und nicht anschneidet, in der Nähe des Stücks zur „Bewachung“ zurücklässt, während er sein Auto zum Abtransport holt, oder ob er ihn mitnimmt. Lässt er den Hund zurück und hat dieser die entsprechende Veranlagung zur Verteidigung von Ressourcen, wird er das Stück vielleicht tatsächlich bewachen und dann auch vor zufällig vorbeikommenden Pilzsuchern oder Spaziergängern nicht haltmachen!
Wenn der Hundeführer sich nicht hundertprozentig sicher ist, was der Hund während seiner Abwesenheit „anstellt“, einen Inbesitznahme-Bruch auf das Wild legen und den Hund lieber mit zum Auto nehmen. Beim Wiedereintreffen nutzt man gleich die Gelegenheit, den Hund verweisen zu lassen. Man fährt bis maximal 20 Meter an das Stück heran und lässt den Gefährten jetzt auf der eigenen zuvor verursachten Menschen- und Hundespur am Riemen zum Stück zurücksuchen. Ist er am Stück angekommen und sucht Blickkontakt zum Hundeführer, wird dies gleich belohnt. Alternativ kann er auch auf der Spur geschnallt werden und mit einem „Zeig das Stück!“ geschickt werden. So festigt sich neben dem Zurücksuchen zum Stück beim Hund das Zurücklaufen auf seiner eigenen Spur.
© Gila Fichtlmeier
Als das Reh in Sichtweite ist, lässt Anton den Riemen fallen und gibt Franzl die Chance zum Verweisen.
© Gila Fichtlmeier
Ist die Strecke zum Auto weit und das Bleib noch nicht gefestigt, lässt man den Hund nicht am Stück zurück, sondern nimmt ihn mit.
DIE PIRSCH
Bei der Pirsch versuchen Jägerin oder Jäger, unter Beachtung der Wildverhältnisse geräuschlos auf Schussentfernung an Wild heranzukommen. Diese Jagdart wird im Frühjahr, Sommer oder Herbst meist tagsüber oder kurz vor der Abenddämmerung ausgeübt.
MERKMALE UND ABLAUF
Im Winter pirscht der Jäger mitunter auch in der Dämmerung oder während der Nacht, wenn das Mondlicht ausreicht oder eine geschlossene Schneedecke für gute Lichtverhältnisse sorgt.
Während des Pirschens wechselt man das Tempo. Mal geht man schneller und mal langsamer, auch mal übertrieben schleichend, bleibt ab und zu stehen und setzt dann seinen Weg fort. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Revierecken ohne Ansitzeinrichtungen (Schalenwild) oder Feldgehölzen, Gewässern etc. (Raubwild, Enten usw.)
© Gila Fichtlmeier
Gemeinsames Anpirschen wie bereits über die Reizangel einstudiert.
Vorbereitende Bausteine
Bleib
Leine sowie Stop and Go mit und ohne Leine
Geruchspartikel und Windkunde
Spurarbeit – Schleppe
Schussfestigkeit (Dummy Launcher)
Apport (Verharren und Anzeigen)
Reizangel (Standruhe und Verhaltenskoppelung)
DAS PRAXISREIFE TEAM
DER HUNDEFÜHRER
Der Hundeführer kennt sein Revier und hat sich vorab eine Strategie zurechtgelegt. Er weiß, welche Ecken er bei welchem Wind ansteuern kann und hat Pirschwege angelegt, um so wenig wie möglich zu stören. Er beherrscht die treffsichere Schussabgabe mittels Pirschstock auf Schalenwild. Außerdem kann er das Anzeigeverhalten seines Hundes richtig lesen und deuten und hat ihn für den Pirschgang optimal vorbereitet.
DER HUND
Die wichtigste Voraussetzung ist ein ausgezeichneter Gehorsam des Hundes am Wild, sowohl an Schalen- als auch an Nieder- beziehungsweise Raubwild. Wird direkt vor dem Gespann Wild hoch, bleibt der Hund ruhig und prellt nicht vor. Er jault oder winselt auch nicht vor Aufregung. Außerdem erträgt er den eventuellen Schuss ohne Schusshitzigkeit.
DEN HUND LESEN
Ein Hundeführer, der seinen Hund zu „lesen“ gelernt hat, erkennt oft schon an dessen Verhalten, welche Wildart der Hund während des Pirschens wahrgenommen hat und anzeigt. Die Pirsch ist die Königsdisziplin des Zusammenspiels zwischen Mensch und Hund. Sie erfordert sowohl beim Hundeführer als auch beim Hund eine Konzentration aller Sinne.
Der Hund läuft entweder auf gleicher Höhe oder in kurzem Abstand vor dem Hundeführer, damit dieser das Anzeigeverhalten des Hundes bemerken und darauf entsprechend reagieren kann. Der Hund wiederum hält fortwährend Kontakt, dreht sich nach seinem Hundeführer um und koppelt sich an ihn: Wenn der Hundeführer stoppt, bleibt der Hund ebenfalls stehen. Die Pirsch ist nur dann erfolgreich, wenn sie möglichst geräuscharm abläuft – umso wichtiger ist es, dass der Hund absolut verlässlich auf die Sichtzeichen für Platz, langsames Nachziehen oder Stehenbleiben reagiert. Das setzt voraus, dass er permanent schaut, was sein Hundeführer macht. Wenn möglich, sollte der Hund selbstständig verharren, wenn er Wild bemerkt.
Mögliches Fehlverhalten
Zu wenig Gehorsam, der Hund wird bei Anblick von Wild unruhig, prellt zu weit vor.
Der Hund muss fortwährend zum Kontakthalten ermahnt werden.
Fehlendes Zusammenspiel, da der Hund nicht auf die Körpersignale des Hundeführers reagiert (Stopp, Halt, Ablegen, Bleib, Sitz etc.).
Der Hund hebt das Bleib auf.
Der Hund prellt nach dem Schuss vor.
SCHRITT FÜR SCHRITT IN DIE PRAXIS
Anhaltendes Zusammenspiel mit dem Hundeführer – Stoppen, Abliegen, Warten, Nachziehen des Hundes im Wechsel – sowie Standruhe und Schussfestigkeit wurden anhand der Basisübungen aufgebaut. Das wird jetzt beim Üben im Revier systematisch und konsequent gefestigt.
Man beginnt mit dem Training in „wildarmen“ Revierteilen, in denen man also wahrscheinlich kein Wild verpirschen kann. Das Gespann pirscht sich zum Beispiel an einen Schirm oder einen Siloballen heran, der als gute Deckung dient. Ebenso vorsichtig und ruhig kann man sich einem Gewässer nähern, um dann im Schilf Deckung zu nehmen.
© Gila Fichtlmeier
Diese Geste genügt, damit Franzl verharrt.
Die ersten Male führt der Hundeführer den angeleinten Hund noch über die Kombination von Leinen- und Körpersignalen (siehe hier) und geht dann, Schritt für Schritt, auf eine ausschließliche Führung über Körpersignale über. Auch hier läuft der Hund zuerst noch an der Leine, die jetzt aber stets locker bleibt. Sobald das funktioniert, wird auf die Leine verzichtet.
Wichtig ist, dass der junge Hund sich stets an den Hundeführer koppelt. Und umgekehrt: Bleibt der Hund beispielsweise stehen, weil er Wittrung von Wild bekommt, stoppt auch der Hundeführer. Dieses Wechselspiel macht die gemeinsame Pirsch mit dem Hund aus.
Um die Pirsch spannend zu gestalten, versteckt der Hundeführer zuvor kaltes Wild – dem Hund wird dann durch gemeinsames Anschleichen der Apport oder das Anzeigen beziehungsweise Verweisen ermöglicht. Die Pirsch beschert ihm also Erfolg. Beim Anpirschen bereits gesichteten Wilds nimmt man den Hund die ersten Male vorsichtshalber an die Leine, und dann gilt es, gemeinsam so nahe wie möglich ans Wild heranzukommen.
Selbstverständlich gibt es auch bei der Pirsch viele Mischformen. Sie lässt sich beispielsweise hervorragend mit dem „normalen“ Weg zur Ansitzeinrichtung kombinieren, den der Hundeführer entsprechend mit Tempowechsel, Verstecken von kaltem Wild etc. „bereichert“.
TIPP
Nach jeder Pirsch und jedem Ansitz, aber auch nach der Arbeit im Feld muss der Hund zu Hause in Ruhe und bei gutem Licht nach Zecken und Hirschläusen, nach Kletten und Dornen etc. abgesucht werden! Prüfen Sie auch, ob er irgendwelche Kratzer oder Blessuren hat.
© Gila Fichtlmeier
Insbesondere das Anpirschen an ein Gewässer erfordert Disziplin und Zusammenspiel.
DIE SUCHE IM FELD ALS EINZELJAGD
Bei der Suche handelt es sich um ein planmäßiges Ablaufen eines bestimmten Geländes mit dem Vorstehhund. Bevorzugt wird dabei auf die „klassischen“ Niederwildarten wie Rebhühner, Fasane und Hasen gejagt. Diese Jagdart lässt sich auch allein mit dem entsprechend vorbereiteten Hund durchführen.
MERKMALE UND ABLAUF
Der Vorstehhund arbeitet bei der Suche gegen den Wind und unter der Flinte, das heißt, er soll sich nicht weiter als maximal 50 Meter von seinem Hundeführer entfernen. Der Hund orientiert sich immer wieder an seinem Hundeführer. Der wiederum gibt per Pfiff, Rufen oder Handzeichen seinem Hund Hilfestellung, in welche Richtung er arbeiten soll.
Der Hund sucht das Gelände bogenrein ab (siehe hier). Sobald er Wildwittrung in die Nase bekommt, steht er vor und zieht gegebenenfalls auf der Spur oder dem Geläuf nach. Der Hundeführer nähert sich ruhig und bedächtig, bereit zum Schuss. Dabei muss der Hund weiterhin durchstehen, darf also keinesfalls einspringen. Je nachdem, wie fest das Wild liegt beziehungsweise sich drückt, wird es schließlich durch den herankommenden Hundeführer „nervös“, steht auf beziehungsweise streicht ab.
© Gila Fichtlmeier
So ist’s richtig: Der Hund achtet auf seinen Hundeführer und nicht auf Artgenossen.
Der Hund verharrt weiterhin und der Hundeführer schießt, sofern er in guter Position ist. Auch während oder nach der Schussabgabe prellt der Hund nicht vor.
Trifft der Hundeführer, kann er entweder die Beute selbst holen oder seinen Gefährten zum Apport schicken. Verfehlt der Hundeführer das Wild, wird die Suche fortgesetzt.
Vorbereitende Bausteine
Gehorsam und Triller
Bei Fuß
Geruchspartikel und Windkunde
Spurarbeit – Schleppe
Führigkeit
Zusammenspiel mit Hundeführer (richtungweisende Gesten)
Steadiness
Schussfestigkeit
Marking
Apportier- und Finderwille
Wild anzeigen durch Vorstehen
DAS PRAXISREIFE TEAM
DER HUNDEFÜHRER
Der Hundeführer weiß, wie er den Hund schicken muss, damit dieser Wind von sich drückendem Wild in die Nase bekommt. Er achtet außerdem auf das Rückkoppeln des Hundes und gibt ihm eindeutige, richtungweisende Handzeichen. Sobald der Hund vorsteht, tritt der Hundeführer ruhig heran.
Er besitzt ausgezeichnete Schießfertigkeiten und achtet vor und während der Schussabgabe darauf, das Umfeld und den Hund nicht zu gefährden.
DER HUND
Der Hund steht ausgezeichnet im Gehorsam und lässt sich jederzeit von Schalen-, Nieder- oder Raubwild abrufen oder trillern. Er geht tadellos bei Fuß, ob mit oder ohne Leine. Der Hund versteht und befolgt Pfeif-, Ruf- oder Handzeichen, hält stets Kontakt zum Hundeführer und ist außerdem bogenrein.
Der Hund sucht ruhig, ausdauernd und systematisch jede Ecke des Bogens ab und zeigt Wild zuverlässig durch Vorstehen an. Er steht auch dann durch, wenn sich der Hundeführer nähert. Wird direkt vor dem Gespann Wild hoch, bleibt der Hund ruhig, jault oder winselt nicht, erträgt den eventuellen Schuss und prellt nicht vor. Er ist ein zuverlässiger Apporteur, der zudem Wildschärfe mitbringt.
© Gila Fichtlmeier
Junge Hunde bleiben angeleint. So können sie das Treiben ringsumher kontrolliert kennenlernen.
© Gila Fichtlmeier
Abstreichendes Wild wird nicht verfolgt.
Mögliches Fehlverhalten
Vorprellen
Schussscheue/Schusshitzigkeit
Blender/Blinker
selbstbelohnendes Hetzen (Hasen)
Überjagen
SCHRITT FÜR SCHRITT IN DIE PRAXIS
ÜBEREINKÜNFTE PRÜFEN
Der Hundeführer konzentriert sich primär auf das Einhalten der bestehenden Übereinkünfte, die er in der bisherigen Ausbildung mit dem Hund getroffen hat. Er prüft, ob diese auch beim Jagen ihre Gültigkeit haben. In keinem Fall darf sich der Hund verselbstständigen. Funktionieren die Übereinkünfte nicht, muss sofort nachgearbeitet und über die entsprechenden Bausteine korrigiert werden. In der Anfangsphase ist daher bei der Suche immer ein zweiter, firmer Hund als „Reservist“ dabei, der beispielsweise einen krankgeschossenen Fasan oder Hasen nachsucht, wenn der Lehrling wider Erwarten nicht findet und bringt.
ERSTES VORSTEHEN
Der junge Hund wird im Revier gegen den Wind an Fasane oder Rebhühner gebracht, der Hundeführer hat ihn dabei unmittelbar an seiner Seite und im direkten Einflussbereich. Wenn der Hund Wittrung aufnimmt und nicht sogleich vorsteht, lässt er sich normalerweise mit leisen Ermahnungen zügeln und korrigieren. Dann wird das Wild herausgetreten, geschossen und anschließend der Hund zum Apport des sichtig verendeten Federwildes geschickt.
Zeigt der Hund keine Tendenz zum Vorstehen, sondern neigt stattdessen zum Einspringen, sichert der Hundeführer ihn zuerst über die Feldleine ab. Erneut bringt man den Hund an Wildwittrung. Weil in dem Fall Flinte und Feldleine zeitgleich beherrscht werden müssen, bietet es sich an, einen Helfer mitzunehmen, der sich um das flüchtige Wild „kümmert“.
Der Hund muss verknüpfen, dass sein Vorstehen den Schuss und damit das Beutemachen überhaupt erst ermöglicht. Sobald er nicht mehr einspringt, lässt man ihn ohne Absicherung suchen.
© Gila Fichtlmeier
So soll es sein: Bei der Schussabgabe bleibt der Hund ruhig und springt nicht in die Leine.
© Gila Fichtlmeier
Während ein anderer Hund apportiert, wartet dieses Gespann auf die Fortsetzung der Jagd.
DEN HUND IMMER IM BLICK
Der Hundeführer wählt tunlichst eine Revierecke aus, die übersichtlich hinsichtlich des Bewuchses ist, dann fällt es leichter, den jungen Hund im Blick zu behalten. Während der Suche bestätigt oder korrigiert der Hundeführer den Hund, je nachdem, wie und wo er sucht. Das sichtige Verfolgen eines gesunden Hasen muss unbedingt vermieden werden, weil darunter das Vorstehen leiden kann. Deshalb wird der hetzende Hund konsequent abgetrillert und/oder abgerufen!
Drückt sich jedoch zum Beispiel ein Fasan, gibt man dem Hund Gelegenheit, Wittrung aufzunehmen, nachzuziehen und vorzustehen. Idealerweise wird der Fasan von dem Hundeführer herausgetreten und erlegt (Schonzeiten beachten!) – dem jungen Hund wird also erneut vor Augen geführt, dass sein Vorstehen zum Jagderfolg führt.
Streicht der Fasan geflügelt in die nächstgelegene Deckung ab, schickt man den „Reservisten“ zur Nachsuche. Hat der Lehrling jedoch bereits zuvor ohne Scheu und Zögern einen frisch erlegten Fasan gepackt, sollte er die Nachsuche meistern können und der „Alte“ darf pausieren.
Je öfter der Junghund durch sein Vorstehen für Waidmannsheil gesorgt hat, umso besser.
© Gila Fichtlmeier
Der Hund steht vor. Jetzt ist Beutemachen angesagt.
HASENHETZE
Der Junghund wird im ersten Jahr konsequent nur an rollierenden, zur Strecke gekommenen Hasen geschnallt – das gemeinsame Beutemachen und der Apport stehen also ganz klar im Vordergrund.
Erst im zweiten Jahr, wenn der Vorstehhund noch führiger ist und noch besser im Gehorsam steht, dazu jagderfahrener und reifer geworden ist, darf er die Spur eines krankgeschossenen Hasen arbeiten. An jedem gesunden Hasen wird er jedoch nach wie vor getrillert und/oder abgerufen – und das zeit seines Lebens!
© Gila Fichtlmeier
Die ewige Versuchung: der aufstehende Mümmelmann. Hasenhetze verdirbt das Vorstehen, die Standruhe, Gehorsam am Wild und die Nachsuchenarbeit.
GESUNDSPUR NEIN – KRANKSPUR JA
Darf der Vorstehhund nicht auf einen gesunden Hasen jagen, kommt er erst gar nicht in die Versuchung, einem solchen zu folgen! Die Spur eines kranken Hasen hingegen darf er arbeiten. Dem Hund wird so nach und nach bewusst, dass Wundwittrung spannend ist, weil er Beute machen kann, wenn er die Spur hält.
Von solchen Erfahrungen profitiert man später vor allem während der Nachsuchenarbeit auf Schalenwild. Stößt der Hund dann auf gesundes Wild, zeigt er sich unbeeindruckt und folgt stattdessen der Krankwittrung mit tiefer Nase.
VORSICHT – PRÜFUNG!
Bei vielen Junghundeprüfungen wird das Verhalten des Hundes auf der gesunden Hasenspur geprüft. Dabei werden unter anderem Spursicherheit, Spurwille sowie der Spur- und/oder Sichtlaut bewertet. Viele Hundeführer lassen aus diesem Grund ihre Hunde wiederholt gesunde Hasen hetzen, um bei der Prüfung entsprechend viele Punkte einzufahren. Je versessener und ausdauernder der Hund Mümmelmann folgt, umso besser ist es, so die einhellige Meinung. Wird ein derart „vorbelasteter“ Hund dann aber irgendwann auf der Spur eines krankgeschossenen Hasen geschnallt und stößt er bei deren Ausarbeitung zufällig auf einen gesunden Hasen, schaltet er schnell von Spurarbeit auf Sichthetze um. Wird der gesunde, flüchtige Hase anschließend auch noch vor dem Hund geschossen, ist der Grundstein für den „passionierten Hasenhetzer“ gelegt.
PROBLEME AUS DER PRAXIS
ÜBERSCHIESSEN DES BOGENS
Sehr temperamentvolle Hunde suchen oft nicht bogenrein und unter der Flinte, sondern überschießen bei der Quersuche das abzusuchende Feld weiträumig.
Lösungsansatz Die bogenreine Suche wird wieder über kleinere Bögen in circa 60 bis 80 Meter breiten Feld- oder Grasstreifen mit etwas höherem Bewuchs aufgebaut. Dort legt man, für den Hund nicht sichtig, an den Rändern mehrere Dummys aus. Dann schickt man den Hund mit richtungweisenden Gesten abwechselnd nach rechts und links (siehe hier). Verlässt er den Bogen, wird er jedes Mal getrillert und/oder abgerufen.
Nach einigen „Fehltritten“ über den Bogenrand und dem sofortigen Reglementieren setzt beim Hund eine leichte Hemmung ein, sobald er sich dem Rand nähert. Die Folge: Er lässt sich jetzt besser kontrollieren und kann nun über richtungweisende Gesten zu einem versteckten Dummy geleitet werden. Der Hund verknüpft recht schnell, dass nur innerhalb des Bogens Beute gemacht wird. Das Verlassen des Bogens hingegen bedeutet Abbruch und keine Beute.
DER HUND STEHT NICHT VOR
Der Hund steht das Wild nicht vor, sondern prellt immer wieder vor und hetzt an.
Lösungsansatz Der Hund wird über eine zwei bis drei Meter lange Leine abgesichert und an einer wildverdächtigen Hecke an Wittrung gebracht. Eine Hecke ist deshalb ideal, weil man den Hund kurz führen kann. Jedes noch so geringe Anzeigeverhalten des Hundes wird mit einem ruhigen „Hüüüt!“ oder „Steeeh!“ (siehe hier) bestätigt. Dann trägt man den Hund ab.
© Gila Fichtlmeier
Mit „Hüüüt“ oder „Steeeh“ bestätigt man das Anzeigeverhalten.
© Gila Fichtlmeier
Der Hund wird nicht über die Leine weggezogen, sondern abgetragen …
© Gila Fichtlmeier
… ins Platz gelegt und nach einer kurzen Pause erneut an Wittrung gebracht.
Es wird weitergepirscht und der Hund dabei erneut an Wittrung gebracht. Sein Einspringen wird durch die gespannte Leine verhindert und mit einem Triller belegt. Nach einer oder zwei Wiederholungen hat der Hund normalerweise verknüpft, dass Wittrung gleichbedeutend mit dem Ertönen des Trillers ist.
Sofern keine Schonzeit ist, heißt es jetzt: Beute machen! Sobald der Hund wieder Wittrung in die Nase bekommt, wird er verharren oder zögern. Diesen Moment belegt man wieder mit leisem „Hüüüt“ oder „Steeeh“. Dann wird das Wild herausgetreten, wenn möglich beschossen und natürlich getroffen!
DIE JAGDARTEN AUF NIEDERWILD
Es gibt viele unterschiedliche Jagdarten, die, jede für sich, verschiedene Anforderungen an das Gespann stellen.
Buschierjagd Diese Jagdart verläuft nach dem gleichen Muster wie die Suche. Allerdings „klappert“ man hier keine gut zu überblickenden Flächen wie Felder oder Wiesen ab, sondern konzentriert sich eher auf kleinere Revierecken wie Knicks, Feldgehölze, Forstkulturen, verkrautete Streifen etc. Das Gelände ist enger gefasst, dafür aber von der Vegetation her unübersichtlicher. Daraus ergibt sich sofort ein wesentlicher Nachteil für den Hundeführer: Er hat den Hund nicht so gut im Blick wie beispielsweise bei der Suche im Feld. Das Risiko, die Kontrolle über ihn zu verlieren und die Verselbstständigung des Hundes unwissentlich zu fördern, ist daher recht groß.Auf der Buschierjagd kommen inzwischen nicht nur Vorsteh-, sondern auch verstärkt Stöberhunde zum Einsatz. Doch auch hier gilt: Nicht die Anzahl der Hunde ist entscheidend, sondern deren Qualität – ein einzelner, gut eingearbeiteter Hund, ist für die Buschierjagd in den kleineren Revierecken völlig ausreichend.
Vorstehtreiben auf Hasen im Wald oder Feld Die Schützen umstellen das abzutreibende Wald- oder Feldstück komplett oder nur teilweise. Die Treiberwehr versucht, so viel Druck aufzubauen, dass das Wild seine Deckung verlässt und die außenstehenden Schützen anläuft. Beim Vorstehtreiben ist der Hund an der Leine zu führen. Er wird nur auf sichtig krankes Wild geschnallt.
Vorstehtreiben auf Fasane Dieses Flugwild bevorzugt meist dichte Deckung wie zum Beispiel Schilfpartien oder Brombeerhecken. Deshalb kommen hier nur Hunde zum Einsatz, die langsam und gründlich das unwegsame Gelände absuchen. Falls ein Stück Rehwild hoch wird, muss sich der Hund jederzeit abrufen beziehungsweise trillern lassen.
Kesseltreiben auf Hasen Das Kesseltreiben war vor allem früher gebräuchlich auf Hasen im offenen Feld. Der Durchmesser eines Kessels sollte dabei mindestens 600 Meter messen. Bei dieser Jagdart sind doppelt so viele Treiber wie Schützen im Einsatz, Hundeführer haben ihren Hund an der Leine zu führen. Der Hund wird nur dann geschnallt, wenn krankes Wild sichtig flüchtet. Der Hund ist ein sicherer Apporteur und darf weder schusshitzig noch schussscheu sein. Er muss spurtreu arbeiten und darüber hinaus Wildschärfe mitbringen. In jüngerer Vergangenheit haben mit den sinkenden Hasenzahlen Kesseltreiben an Bedeutung verloren, weil das Abschöpfen der Hasenbesätze bei dieser Jagdart recht hoch ist.
Böhmische Streifen auf Hasen Die „Streife im XXL-Format“ wird in heutiger Zeit nur noch auf großen Schlägen durchgeführt. Sie wird in Form eines rechtwinkeligen „U“ durchgeführt. Die Seiten beziehungsweise Flügel sind mit Treibern besetzt, die ein seitliches Ausbrechen der Hasen verhindern. Auf Vorstehschützen oder Treiber in Laufrichtung wird verzichtet.
SUCHE ODER STREIFE MIT MEHREREN GESPANNEN
Die Herbstjagd auf Niederwild wird gern als sogenannte Streife mit mehreren Gespannen durchgeführt. Das Gelände ist oft unübersichtlich und von Feldstreifen, Feldgehölzen oder Hecken durchzogen. Ihr Hund muss auch auf das Arbeiten anderer in Gesellschaft vorbereitet werden.
MERKMALE UND ABLAUF
Bei reinen Waldjagden sind Streifen eher selten und werden wegen der besseren Übersicht nur auf großen Kulturflächen oder im lichten Altholz durchgeführt. Hier sind die Übergänge zur Buschier-, Stöber- oder Vorstehjagd fließend, je nachdem, wie die Schützen abgestellt sind.
Bei der Streife sind die Hundeführer gleichmäßig über die Treiber- und Schützenkette verteilt, und zwar so, dass sich die „Arbeitsbereiche“ der Hunde möglichst nicht überschneiden. Der Jagdleiter entscheidet, wann die Hunde zur Suche geschnallt werden sollen und wann sie wieder zurückgenommen oder angeleint werden müssen.
Auch wenn die Abstände innerhalb der Schützen-, Treiber- und Hundeführerkette eingehalten werden, ist noch lange nicht gewährleistet, dass jeder Hundeführer mit seinem Hund in seinem Bereich bleibt und nicht bei dem anderen Gespann „wildert“. Der Hund muss deshalb zu seinem Hundeführer sehr engen Kontakt halten – und umgekehrt. Er darf sich keinesfalls durch andere Hunde beeindrucken lassen oder ihnen gar nacheilen. Flüchtige Hasen, aufstiebende Hühner und/oder Schüsse in seiner Nähe beziehungsweise Nachbarschaft dürfen ihn nicht ablenken.
© Gila Fichtlmeier
Bei der Suche oder Streife hat es diszipliniert zuzugehen – das gilt auch für die mitgeführten Hunde.
Sobald Wild hochgemacht und beschossen wird, so die eiserne Regel, bleibt die gesamte Jagdgesellschaft stehen. Erst wenn das erlegte Wild entweder durch Schützen oder Treiber aufgenommen oder von einem Hund apportiert wurde, rückt die Jagdgesellschaft weiter vor. Sofern Wild krankgeschossen wird, verharrt die Korona so lange, bis der zur Verlorensuche geschnallte Hund es findet.
Findet er nicht, ist es durchaus möglich, dass die Jagd für längere Zeit unterbrochen wird. Einzelnen Hundeführern ist es dann nach Absprache mit dem Jagdleiter erlaubt, sich besser in Position zu bringen, damit die Hunde die Wittrung von Spur oder Geläuf besser aufnehmen können.
Vorbereitende Bausteine
Gehorsam und Triller
Bei Fuß– Führigkeit
Zusammenspiel mit Hundeführer (richtungweisende Gesten)
Geruchspartikel und Windkunde
Spurarbeit – Schleppe
Steadiness
Schussfestigkeit
Marking
Apportier- und Finderwille
Wild anzeigen durch Vorstehen
Reizangel
DAS PRAXISREIFE TEAM
DER HUNDEFÜHRER
Der Hundeführer ist ein treffsicherer Flintenschütze und achtet beim Schuss darauf, das Umfeld und die Hunde nicht zu gefährden. Außerdem gibt er seinem Hund eindeutige Pfeif-, Ruf- oder Handzeichen und weist ihn bei Bedarf mit Übersicht ein. Er lässt sich durch die anderen Hundeführer, Hunde und Schützen nicht aus der Ruhe bringen und hält sich an das, was der Jagdleiter sagt.
Darf der Hund geschnallt werden und steht er schließlich vor, nähert sich der Hundeführer umsichtig oder fordert den eventuell besser positionierten Nachbarschützen auf, in Richtung Hund zu gehen.
Der Hundeführer kann seinen Hund sehr gut lesen und steuert sofort gegen, wenn der Hund Ansätze zeigt, sich zu verselbstständigen oder sich mit anderen Hunden zu koppeln oder gar, um Beute zu konkurrieren.
DER HUND
Der Hund zeigt Schussfestigkeit, Standruhe, Gehorsam, Apportier- und Finderwille und Wildschärfe. Er sucht immer wieder den Blickkontakt zum Hundeführer und jagt kurz.
Die andere vierläufige Konkurrenz beeindruckt ihn nicht, er lässt sich nicht ablenken, sondern sucht ruhig und gleichmäßig das Gelände ab, orientiert sich an den Pfeif-, Ruf- oder Handsignalen seines Hundeführers, ist leinenführig und gehorcht auf den Triller. Schüsse bringen ihn nicht aus der Ruhe.
Er zeigt Wild an und steht durch, selbst wenn Konkurrenz auf vier Pfoten oder ein anderer Schütze im Anmarsch sind. Der Hund ist bogenrein, nicht neidisch auf Beute (Beißerei) und zeigt keine Tendenzen zum Anschneider oder Totengräber.
© Gila Fichtlmeier
Die Beute gehört dem, der sie trägt.
© Gila Fichtlmeier
Auch an der Strecke darf es nicht zu Beuteneid kommen.
Mögliches Fehlverhalten
Vorprellen
Schusshitzigkeit bzw. -scheue
Blender bzw. Blinker
Totengräber
Beißer
Gehorsamsmangel
VERLORENSUCHE – VORAUSSETZUNGEN
Der junge Hund wird nur dann zur Verlorensuche geschickt, wenn er Wildschärfe besitzt und bereits zuverlässigen Apport verendeten Wildes gezeigt hat. Wichtig ist, dass er die ersten Male allein zur Verlorensuche starten darf, denn sobald er den geflügelten Fasan findet und ein älterer Hund ihm die Beute anschließend einfach abjagt, verknüpft er das unter Umständen negativ. Deshalb muss zuerst Rücksprache mit den anderen Hundeführern gehalten werden. Erst wenn klar ist, dass kein anderer Hund im „Rennen“ ist, schickt man ihn.
SCHRITT FÜR SCHRITT IN DIE PRAXIS
Soll der junge Hund bei einer gemeinschaftlichen Streife mitjagen, ist dies nur dann sinnvoll, wenn der Hundeführer die Möglichkeit hat, sich stärker auf den Hund als aufs Beutemachen zu konzentrieren. Haben der Jagdleiter und die teilnehmenden Jäger oder Hundeführer dafür kein Verständnis, ist es besser, den Hund am Riemen zu führen oder zu Hause zu lassen.
© Gila Fichtlmeier
Trotz Schussabgabe wartet die Hündin, bis sie abgeben und erneut apportieren darf.
PROBLEME AUS DER PRAXIS
DER HUND PRELLT AUF SCHÜSSE SOFORT LOS
Ein Hundeführer gestattet seinem Vorstehhund, jeden von ihm getroffenen Fasan sofort nach der Schussabgabe ohne ausdrückliches Kommando zu verfolgen, nachzusuchen und zu apportieren. Schnell generalisiert der Hund sämtliche Schüsse als Startzeichen zur Verlorensuche.
Zufällig stößt er kurz nach dem Loshetzen auf gesundes Wild, das er Laut gebend und selbstbelohnend verfolgt. Bricht irgendwo ein weiterer Schuss, hetzt er sofort in diese Richtung. Dieses verselbstständigte Verhalten muss sofort korrigiert werden, da sich sonst extreme Schusshitzigkeit verfestigt, unter dem auch das Vorstehverhalten leidet. Bei dem Hund hat sich die Erwartungshaltung durchgesetzt, dass das Anschlagen der Flinte gleichzusetzen ist mit Schuss und Aktion.
Lösungsansatz Zur Korrektur muss man Schusssituationen über mehrere Wochen lang „provozieren“.
Der Hundeführer geht dafür mit dem Hund beispielsweise an ein Gewässer. Hier gibt er mehrere Schüsse ab – der Hund bleibt neben ihm im Sitz, der Hundeführer fordert den Blickkontakt des Hundes ein und/oder bietet ihm Futter aus der Hand an. Ein anderes Mal lässt der Hundeführer ihn abliegen und entfernt sich außer Sicht. Er gibt wieder ein oder zwei Schüsse ab, kommt zurück und bringt dem Hund seinen vollen Futternapf mit.
Weitere Möglichkeit Mit dem hungrigen Hund und einem zweiten Vierbeiner geht man aufs Feld und legt beide ab. Dann entfernt man sich etwas, schießt in die Luft, kommt wieder zu den Hunden zurück und reicht ihnen Futter. Während sie fressen, gibt man noch einmal ein oder zwei Schüsse ab. Der Hunger und auch der Futterneid lassen die Hunde dabei das Jagen für kurze Zeit vergessen.
© Anton Fichtlmeier
Disziplin bei allem – ein Muss bei Gesellschaftsjagden
Solche und ähnliche Situationen wiederholt man stetig, wechselt dabei aber die Örtlichkeiten, um das Verhalten des Hundes zu generalisieren. Bereits nach kurzer Zeit stellen sich wieder Schuss- und Standruhe ein. Dann erst ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dem Hund nach der Schussabgabe das Apportieren zu gestatten.
Dritte Möglichkeit Der Hundeführer verschießt aus seiner Flinte per Einstecklauf mehrere Dummys in Folge. Hierbei fordert er vom Azubi ein ruhiges Sitz und seinen Blickkontakt ein, bevor er losgeschickt wird und jedes Dummy als Belohnung apportieren darf. Bleibt der Junghund nicht ruhig, heißt es für ihn erneut Sitz und der Hundeführer holt die Dummys selbst. Sieht der Hund dabei gelassen zu, bekommt er als Belohnung Futter. Diese Übung wird so lange wiederholt, bis der Hund in Ruhe auf die Aufforderung zum Apport wartet.
Anschließend bringt man ihn an Hecken und Feldrändern zum Vorstehen. Wenn möglich macht man auch hier mit der Flinte Beute – Teamarbeit bringt den Erfolg und nicht tumbes Loshetzen. Auf künftigen Streifen ist der Hund an der Leine und wird nur für den Apport auf sichtig verendetes Wild geschnallt.
© Anton Fichtlmeier
Ausklang mit Tradition
DIE BEIZJAGD – EIN INTERVIEW
DIE BEIZJAGD
— ein Interview
Wolfgang Schreyer war 15 Jahre lang Vorsitzender des Deutschen Falkenordens – Landesverband Bayern. Anton Fichtlmeier hat ihm einige Fragen zur Beizjagd gestellt.
Fichtlmeier: Seit wann gibt es eigentlich die Beizjagd?
Wolfgang Schreyer (Vorsitzender des Deutschen Falkenordens – Landesverband Bayern 1998 bis 2013): Die Jagd mit den Greifen ist eine sehr urtümliche Jagd, die mehrere Tausend Jahre alt ist. Reitervölker in den Steppen erkannten, dass Greifvögel in der Lage sind, schnell fliehendes Wild zu schlagen, an das sie nicht näher genug herankamen, um es mit Pfeil und Bogen oder dem Speer zu erlegen.
© Gila Fichtlmeier
Wolfgang Schreyer mit Hund und Beizvogel
Fichtlmeier: Wozu werden heute noch Greife eingesetzt?
Schreyer: Damit man auch an den Orten jagen kann, an denen es wegen der Gefährdung des Umfeldes einfach nicht möglich ist, mit Flinte oder Büchse zu waidwerken – zum Beispiel in Hallen, in denen Tauben umherschwirren und Futtermittel oder Industrieteile verkoten. Wir sind auch häufig in befriedeten Bezirken unterwegs. Auch in alten Kirchen oder auf Flughäfen empfiehlt sich die Beizjagd.
© Gila Fichtlmeier
Der Hund muss hundertprozentigen Gehorsam zeigen – sonst ist ihm der am Boden schlagende Greif wehrlos ausgeliefert.
Fichtlmeier: Wie und wann werden Hunde bei der Beizjagd eingesetzt?
Schreyer: Zum Beispiel bei der Jagd mit dem Anwarterfalken. Der Hund steht vor, und der Greif, der auf den Hund eingespielt sein muss, wird ausgelassen. Der Greif beginnt nach geraumer Zeit über dem Hund zu kreisen, der Hund zieht kontinuierlich nach und steht wieder vor. Sobald das sich drückende Wild vor ihm hoch oder durch den Hundeführer herausgetreten wird, stoppt er augenblicklich. Jetzt ist der Falke an der Reihe. Bei dieser Jagd ist bester Gehorsam des Hundes Grundvoraussetzung. Er muss manchmal so lange verharren, teilweise mehrere Minuten, bis der Greif wieder bei seinem Falkner steht. Prellt der Hund jedoch nach, lenkt das den Greif nur unnötig von der Beute ab und die Jagd endet alles andere als erfolgreich.