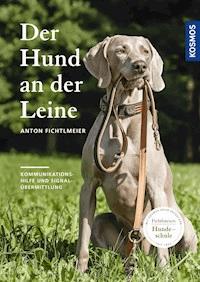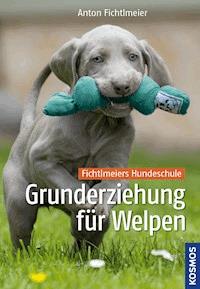14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Für Anton Fichtlmeier ist "Suchen und Apportieren" der Schlüssel für eine ausgeglichene stabile Mensch-Hund-Beziehung. Es ist eine Form der Beschäftigung, die viele Möglichkeiten bietet, die Freizeit und den Tagesablauf variabler und spannender zu gestalten. Alle Hundehalter finden hier wertvolle Anregungen, wie sie ihren Hund auf diese Art sinnvoll auslasten können: von Spiel und Spaß bis hin zu professioneller Sucharbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Zu diesem Buch
Liebe Hundefreundin, lieber Hundefreund
Ich möchte mit Ihnen auf einer freundschaftlichen Ebene über Hunde ins Gespräch kommen und Ihnen meine Ideen zum „Suchen und Apportieren“ näherbringen.
Suchen und Apportieren sind Beschäftigungsformen, die es uns ermöglichen, Spiel und Spaß mit unseren Vierbeinern zu haben und dabei ihre Ausgeglichenheit und Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Sie helfen uns, den Hund in allen Bereichen des Zusammenlebens kontrollierbarer zu machen, ihn sinnvoll (hundegerecht) auszulasten und im Bereich seiner Talente zufriedenzustellen. Im Rahmen von Gruppenübungen kann man konkurrierendes Verhalten unter Hunden mindern. Durch spezielle Aufgabenstellungen können Hunde lernen, sich selbst zu zügeln und Reize, die ihre Instinkte ansprechen, gezielt zu ignorieren. Dies eröffnet Hunden die Möglichkeit für Ersatzhandlungen, bei denen der Mensch in den Fokus rückt.
Bei diesem Buch geht es mir auch darum, dass wir – Familienmitglieder oder gleichgesinnte Hundefreunde – etwas miteinander machen. Lassen Sie uns an einem Strang ziehen. Wir stellen den Hund in den Mittelpunkt und entwickeln gemeinsam Ideen für ihn. Dadurch werden wir anders an ihn herangehen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und reichlich spannende und erkenntnisreiche Momente mit Ihrem Vierbeiner.
Anton Fichtlmeier
© Gila Fichtlmeier
© Gila Fichtlmeier
Plädoyer für ein Umdenken in der Hundeerziehung
„Nicht werfen, zerren oder quietschen“ lautete die Überschrift eines Artikels, den ich in den 90iger Jahren schrieb, um Hundehalter vor dem naiven Gebrauch von Spielzeug zu warnen, denn dieser kann ganz schnell zu negativer Veränderung der Kommunikationsfähigkeit von Hunden führen. Ich prägte die Begriffe „Balljunkie“ oder wie wir in Bayern sagen „Steckerldepp“. Damals bezeichneten Vertreter diverser Hundeverbände meine Ansichten als dubios und weit hergeholt, heute sind diese Erkenntnisse in aller Munde. Vielerorts tönt es auch heute noch: „Ohne Zwangsapport geht es nicht.“ Wo wird hier das Tierschutzgesetz umgesetzt? Ich verspreche Ihnen: „Es geht doch!“ Zu meiner Freude findet auch die von mir kreierte Methode des Tauschens immer mehr Akzeptanz.
In der Rettungshundearbeit entwickelte ich das kommunikative Anzeigen von Suchpersonen. Dabei wird dem Hund nicht vorgegeben, auf welche Weise er anzuzeigen hat. Anstatt ihm ein stereotypes und hysterisches, minutenlanges Lautgeben anzutrainieren, was genau genommen völlig sinnfrei ist, da der Hundeführer ja im klassischen Übungsaufbau bereits neben dem Hund steht, fördern wir beim Hund ein seinem Naturell entsprechendes Anzeigeverhalten, mit dem er situationsgerecht auf die Person verweist. Man gesteht ihm zu, sein kommunikatives Repertoire variabel auszuschöpfen.
Erst kommunizieren dann konditionieren
Aus meiner Sicht sollte im Umgang mit dem Hund immer der kommunikative Aspekt im Vordergrund stehen, so auch im Bereich von Suchen und Apportieren. Es gilt: Kommunizieren kommt vor dem Konditionieren. Damit Sie mein Empfinden für die Seele der Hunde nachvollziehen können, möchte ich Ihnen im ersten Kapitel die mir wichtigsten Gedanken über das Wesen des Hundes näher bringen.
Grundlagen zum Suchen und Apportieren
WAS SIE ÜBER HUNDE WISSEN SOLLTEN
Über Hunde
Die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten eines Hundes ergeben sich aus der Notwendigkeit, in einer von Menschen geschaffenen Umgebung zu überleben.
In Abstimmung mit seiner Umwelt versucht jeder Vierbeiner, diesen Anforderungen immer bestmöglich gerecht zu werden. Das bedeutet insbesondere auch, dass er grundsätzlich bereit ist, mit Menschen in Kontakt zu treten – zu kommunizieren. Erkennt man also den Hund tatsächlich als einen sozialen Partner an, so wird man andere Ansprüche an sich und die Qualität seiner Beziehung zu diesem Wesen stellen.
RASSETYPISCHE AUSPRÄGUNGEN
Ein umfassendes Verständnis für Hunde kann sich nur ergeben, wenn man deren rassetypisches genetisches Potenzial erfasst. Dabei stellt sich die zentrale Frage: Welche Kriterien waren bei der Hundezucht ursprünglich ausschlaggebend?
Die erste durch den Menschen bewusst gesteuerte Verpaarung von Hunden fand sicher unter dem Gesichtspunkt der Brauchbarkeit statt. Dabei dürften damals nicht das Aussehen allein, sondern vielmehr das Wesen des Hundes und die sich daraus ergebenden Nutzungsmöglichkeiten den Ausschlag gegeben haben. Der Mensch brauchte Hunde für das Bewachen des Gehöfts, zum Hüten und Treiben der Herden und für die Jagd. Hatte ein Bauer einen guten Wachhund, der sich völlig loyal gegenüber der eigenen Familie verhielt und das Territorium nicht verließ, wurde dieser mit einem Hund mit den gleichen Eigenschaften verpaart. Bei Hunden, die zum Hüten eingesetzt wurden, war es wichtig, dass sie auf keinen Fall die Herde verließen, nicht zum Reißen der Tiere neigten und sich gut steuern ließen. Bei den jagdlich genutzten Hunden legte man Wert auf deren jagdliche Veranlagung. Jagdhunde mussten nicht Haus und Hof verteidigen, sondern Wild aufspüren, anhaltend hetzen, stellen und gegebenenfalls niederziehen. So erhielt man im Laufe der Zeit Hunde, die sich je nach Anforderung im Verhalten und Aussehen ähnelten. Diese Vorgehensweise bei der Verpaarung und Haltung von Hunden finden wir auch heute noch in einigen stark ländlich geprägten Regionen der Erde.
© Gila Fichtlmeier
FRANZÖSISCHE BULLDOGE Eine Rasse, die auch Spaß am Suchen und Apportieren von Objekten hat.
Soziale Ordnung in der Hundewelt
Nähe suchen, sich abgrenzen, Ressourcen sichern, partizipieren lassen, drohen, beschwichtigen. Diese Mechanismen gestatten dem Hund, sich mit Artgenossen und artübergreifend mit dem Menschen als das zu empfinden, was er ist: ein Hund.
HUNDE SIND KEINE WÖLFE
Der Hund ist ein gruppendynamisches Tier, das in sozialen Gemeinschaften lebt. Er darf keinesfalls analog zu den Wölfen als ein Rudeltier verstanden werden. Der Hund lebt losgelöst von den relativ engen Strukturen, wie sie in einem Familienverbund von Wölfen gelebt werden. Er ist jedoch überaus gesellig und schließt sich gerne einem Sozialpartner an, wenn dieser die vom Hund gezeigten Befindlichkeiten entsprechend reflektiert. Ein Hund kommuniziert ähnlich dem Menschen durch seine Mimik, seine Gesten, seine Empfindungslaute und über sein Verhalten, das aus dem jeweiligen sozialen Kontext, in dem er lebt, ableitbar ist.
© Gila Fichtlmeier
TSCHECHOSLOWAKISCHER WOLFHUND Sein Ausdrucksverhalten zeigt viel wölfisches Erbe.
HUNDE SIND BINDUNGSFLEXIBEL
Der Hund ist seiner Natur nach flexibel im Aufbau, aber auch im Abbruch von Beziehungen. Er kann von einer Gruppe in eine andere verbracht werden. Immer schafft er es, sich in kürzester Zeit einzugliedern. Er ist ein Meister der Eingliederung. Da er jedoch letztlich gar nicht anders kann, als sich immer wieder aufs Neue einzufügen und sich mit anderen abzugleichen, zwingt ihn das, seiner Art entsprechend, mit seinem Umfeld zu kommunizieren.
WOHLBEFINDEN STATT HERRSCHAFT
Ein Hund muss sich anlagebedingt in unterschiedlichste soziale Gruppen einordnen und dieser Prozess vollzieht sich innerhalb kürzester Zeit, ja oft innerhalb weniger Augenblicke. Nach meinen Beobachtungen erfolgt die Übermittlung von Informationen zu den verschiedenen „Gesprächsthemen“ indirekt als Übermittlung eines Gefühlszustandes (= Befindlichkeit).
Ein Beispiel
Arko (Hund eins) zeigt als Sender ein bestimmtes Verhaltensmuster, das seine Bedürfnisse, seine innere Gestimmtheit und seine Gefühle übermitteln soll. Dieses Gefühlsmuster wird von Ferdi (Hund zwei) empfangen und tendenziell nachempfunden. Durch Kopplung an das dargestellte Gefühlsmuster von Arko wird bei Ferdi eine Empfindung ausgelöst, die dieser wiederum seinem eigenen Gefühl entsprechend reflektiert und dadurch eine Gefühlsveränderung in Arko bewirkt. Es kommt so lange zu einem wechselseitigen Austausch von Gefühlsmustern, bis das Thema zufriedenstellend abgeklärt ist oder einer der Beteiligten das kommunikative Interesse verliert. Dabei suchen die Hunde hauptsächlich emotionales Wohlbefinden und nicht Herrschaft über den anderen.
Info
DER HUND IST EIN GRUPPENDYNAMISCHES TIER
Der Prozess in einer Gruppe umfasst die Verteilung der Rollen, die Bestimmung der Ziele und Aufgaben, die Aufnahme neuer Mitglieder, den Umgang mit anderen Gruppenmitgliedern sowie mit Außenstehenden. Jedes aktive Handeln in der Gruppe gehört zum Prozess und ist dynamisch.
DIE VERANTWORTUNG DES MENSCHEN
Vor allem in der Beziehung zum Menschen, von dem der Hund abhängig ist, steht nicht Herrschen und Beherrschen-Wollen im Vordergrund. Viel wichtiger ist, dass der Mensch den Hund mit Nahrung versorgt, ihn vor Gefahren schützt und ihm Geborgenheit und liebevolle Nähe vermittelt. Des Weiteren benötigt der Hund in dieser Art Sozialverband einen Partner, der ihm über ein klares Regelwerk Orientierung und soziale Kompetenz vermittelt. Das gestattet ihm, in sozialen Gruppierungen erfolgreich zu agieren.
© Gila Fichtlmeier
WOHLBEFINDEN Emotionales Wohlbefinden ist für einen Hund wichtiger, als sich in Dominanzgebärden zu verlieren.
DURCH BINÄRSPRACHE SOZIALKOMPETENZ VERMITTELN
Damit im gemeinsamen Alltag ein harmonisches und stressfreies Miteinander von Mensch und Hund realisiert werden kann, kommen wir nicht umhin, unseren Hunden neben unserer Fürsorge und Zuneigung ein klares Regelwerk anzubieten, das ihnen hilft, ihr Leben an unserer Seite zu führen. Dieses Regelwerk fußt auf dem simplen Ja-Nein-Prinzip:
1. Der Hund darf oder soll etwas tun (= Ja)
2. Der Hund darf etwas nicht tun bzw. soll etwas unterlassen (= Nein)
Diesem Grundprinzip habe ich die Bezeichnung Binärsystem gegeben. Eine ausführliche Beschreibung dieser bewährten Methode in all ihren Anwendungsfacetten finden Sie in meinem Buch „Grunderziehung für Welpen“. Die Binärsprache ermöglicht eine klare und eindeutige Kommunikation, die jeder Hund sofort verstehen kann.
Wenn ein Hund von seinen Sozialpartnern nicht zufriedenstellend reflektiert und geführt wird, verliert er seine innere Balance.
BALANCE IN DER GRUPPE
Damit eine Gruppe in sich und in ihr jedes einzelne Gruppenmitglied in Balance kommen kann, bedarf es der Verständigung zwischen allen Gruppenmitgliedern. Voraussetzung dafür ist wechselseitiges Verständnis für einander. Unsere Hunde zeichnet ein Streben nach prosozialer Einheit in der Gruppe aus. Sie unterliegen einem besonderen Mechanismus, der dazu führt, dass alle beteiligten Sozialpartner so lange einen kommunikativen Prozess führen, bis soziale Einigkeit hergestellt ist und sich alle mit allen in Balance befinden. Das wichtigste Element in diesem gruppendynamischen Prozess ist das „Wechselseitige-Sich-Reflektieren“. Wenn jeder Emotionen und Bedürfnisse des anderen erkennt und anerkennt, braucht es keine übersteigerten, unkontrolliert ablaufenden, aggressiven Interaktionen mehr. Es entsteht ein homöostatisches Modell. (System, hält sich in stabilem Zustand gegenüber der Umwelt). Als Ergebnis tritt bei jedem Individuum innere Balance ein. Dadurch kommt es in der Gruppe zu einem Gleichgewicht, jeden einzelnen Interaktionspartner gleichermaßen betreffend.
© Gila Fichtlmeier
ABGRENZUNG über Drohen ist fester Bestandteil hündischer Kommunikation.
© Gila Fichtlmeier
WICHTIG Dominanzbeziehungen gehören mit zum sozialen Rahmen einer Gruppe.
© Gila Fichtlmeier
SCHNUPPERN kann z.B. im Rahmen einer sozialen Interaktion als Konfliktverhalten gezeigt werden oder, wie hier, als Orientierungsverhalten, weil zuvor Enten am Ufer saßen.
PROSOZIALE AGGRESSION ALS REGULATIV
Das zentrale psychosoziale Regulativ beim Abgleich von Interessen ist prosoziale Aggression. Dies funktioniert nach dem Verhaltensschema „Drohung“ und der entsprechenden Reaktion darauf. Beanspruchen beispielsweise zwei Hunde zeitgleich eine Beute, ein Territorium, einen Liegeplatz oder Ähnliches, wird dieser Interessenkonflikt üblicherweise durch Drohen, Imponieren und weitere dem gemäße Reaktionen kommuniziert und abgeklärt. Hunde versuchen, dabei möglichst wenig Schaden zu nehmen oder zu verursachen.
Wichtig
AUS DEM KONTEXT INTERPRETIEREN
Um das Kommunikationsverhalten von Hunden zu beurteilen, müssen die beobachteten Signale und Verhaltensmuster immer aus dem jeweiligen Kontext heraus interpretiert werden.
RITUALISIERTER INTERESSENABGLEICH IST KEIN SPIEL
In der Kommunikation zwischen Hunden in einer Gruppe findet ein ritualisierter Abgleich von Interessen mit Bezug auf einen eventuell zukünftig eintretenden Ernstfall auf einer besonderen Ebene statt. Diese Ebene der Kommunikation definiere ich als Funktionskreis „Gruppenorganisierende Verhaltensmuster“. Hunde können sich nicht aussuchen, ob sie auf dieser Kommunikationsebene interagieren oder nicht. Das Erkennen und Anerkennen gezeigter Emotionen und Bedürfnisse sowie die Abstimmung des eigenen Verhaltens auf den anderen und die Akzeptanz des anderen in seiner Befindlichkeit, das sind die Parameter für die soziale Ordnung in der Welt unserer Hunde.
Wer „Gruppenorganisierende Verhaltensmuster“ vom allgemeinen Spielbegriff loslöst und sie nicht mehr undifferenziert als Spiel bezeichnet, sondern als Funktionskreis begreift, wird erstaunt darüber sein, wie viel besser sich Hundesprache in ihrer Komplexität erfassen lässt.
WAS IST SPIEL?
Der Begriff „Spiel“ als Bezeichnung für soziale Interaktionen zwischen Hunden ist weder klar und eindeutig, geschweige denn allgemein verbindlich definiert. Es existieren eine ganze Menge Spieltheorien und Erklärungsmodelle für diverse Funktionen von Spielverhalten.
Daraus ergibt sich für den Laien eine fast unüberschaubare Vermischung von Funktionen: Spiel, das dem Spiel als Selbstzweck dient. Spielen, um sich im Partner zu reflektieren. Spielen, um Bewegungsmuster auszuprobieren und vieles mehr.
Es gibt jedoch eine Eigenschaft von „Spiel“, die sich in allen Spielbegriffen findet. Die lautet: Damit „Spiel“ stattfinden kann, braucht es einen entspannten Rahmen. Ein Bezug zum Ernstfall sollte nicht gegeben sein. Man kann „Spiel“ noch so wissenschaftlich angehen und sezieren, es liegt immer im Auge des Betrachters, ob er sein Handeln und seine Interaktionen mit dem Hund als Spiel versteht.
Ich unterscheide beim Begriff „Spiel“ grundlegend zwischen zwei Bedeutungen: Zum einen ist da Spiel, das als reiner Selbstzweck angesehen werden kann. Zu dieser Art von Spiel finden Sie Genaueres im Kapitel „Lass uns mal richtig spielen“. Zum anderen sind da Interaktionsspielmuster innerhalb des Funktionskreises „Gruppenorganisierende Verhaltensmuster“, die unter anderem dazu dienen, mittels Signalen mit feststehender Symbolik (Bedeutung), Übereinkünfte zwischen den Kommunikationspartnern zu treffen.
© Gila Fichtlmeier
WELPENSPIEL Dieses Quäntchen Ernsthaftigkeit im Blick der Welpen lässt den sensiblen Beobachter bereits erkennen, dass es sich hier nicht mehr um unbedarftes Welpenspiel handelt.
Gruppenorganisierende Verhaltensmuster
Treffen Hunde aufeinander, kann es aufgrund ihrer Bindungsflexibilität zu „Gruppenorganisierenden Verhaltensmustern“ kommen. Dieser Funktionskreis ist essenziell für die soziale Ordnung in der Hundewelt.
WELPEN BEGEGNEN SICH NOCH UNBEDARFT SPIELERISCH
Treffen Welpen aufeinander, laufen die Begegnungen noch relativ unkoordiniert und dem Zufallsprinzip folgend ab. Finden solche Begegnungen in einem sogenannten entspannten Feld statt, spricht man landläufig von Spiel.
Spätestens mit dem Zahnwechsel organisieren sich aufeinandertreffende Hunde, die eingezäuntes Gebiet oder fremdes Territorium betreten und dort verweilen, mehr oder minder zwangsweise, in lockeren sozialen Gruppen. Sie bilden Verbände und schließen Allianzen untereinander. Diese Bindungsflexibilität und Eingliederungsfähigkeit der Hunde wird durch „Gruppenbildende Verhaltensmuster“ bedient. Die dabei gezeigten Verhaltensmuster werden von mir des besseren Verständnisses wegen geordnet. Im nachfolgenden Kasten finden Sie die hierarchische Anordnung dazu:
1. GRUPPENBILDENDES INTERAKTIONSMUSTER
Ein Beispiel: Mehrere Hunde befinden sich im Freilauf. Ein Rüde nähert sich einer Hündin, um an ihr zu schnuppern. Wenn beide Hunde jetzt andere Anwesende mit einbeziehen, also nicht nur Artgenossen, sondern auch Menschen – was durch das Aufnehmen von Blickkontakt zu einem oder mehreren der Anwesenden erkennbar ist – startet damit ein „Gruppenbildendes Interaktionsmuster“. Die Hündin reagiert auf die Distanzunterschreitung des Rüden, indem sie leicht den Kopf hebt und den Rüden mit einem drohenden Blick fixiert. Reagiert der Rüde darauf, wird die Hündin sich zurücknehmen. Ignoriert der Rüde dieses Signal, wird sie ihr Drohen eventuell noch kurz verstärken, indem sie leicht die Lefzen hochzieht und die Zähne zeigt. Wendet sich der Rüde jetzt ab, kann die Hündin sich wieder entspannen.
Verändert der Rüde sein Verhalten jedoch nicht, kommt es unweigerlich zu einer reglementierenden Attacke durch die Hündin, die so lange fortgesetzt und intensiviert wird, bis sich der Rüde zurücknimmt. Augenblicklich wird die Hündin daraufhin ihre Attacke einstellen. In beiden Fällen wird eine Übereinkunft getroffen, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann, solange sie nicht wegen sich verändernder Umstände neu verhandelt werden muss. Das in diesem Kommunikationsprozess gezeigte Verhalten ist zugleich auch als Botschaft an den Rest der Anwesenden zu sehen, denn damit erübrigt sich für den einen oder anderen aus der Gruppe ein eigener direkter Abgleich zum eben behandelten Thema.
INTERESSENABGLEICH IST KEIN SPIELVERHALTEN
Trifft ein Hund auf einen Artgenossen, wird er immer als erstes versuchen, ihn möglichst genau einzuschätzen. Wie steht der andere zu mir? Freundlich oder nicht? Kann ich mit ihm auskommen? Erkennt er meine Signale an? Nimmt er sich zurück, wenn ich verunsichert bin? Zeige ich ihm, dass ich mich zurücknehme, wenn er sich verunsichert fühlt? Respektiert er meine Position? Kann ich ihn in seiner Position respektieren? Lässt er mich partizipieren, lasse ich ihn teilhaben an vorhandenen Ressourcen? Können wir miteinander auskommen oder gehen wir uns besser aus dem Weg? Hier ist es für die meisten Hundehalter klar ersichtlich, dass die Hunde sich abgleichen und antagonistisches Verhalten (konkurrierendes Verhalten mit zeitgleicher Bereitschaft zur Kooperation) zeigen. Findet das jedoch nicht während einer zufälligen Begegnung auf dem Spazierweg, sondern auf der Hundewiese und in einer Gruppe statt, wird es von den meisten Menschen leider als Spielverhalten (ohne tieferen Bedeutungsinhalt) wahrgenommen, anstatt es als „Gruppenbildendes Interaktionsmuster“ zu erkennen, was es eigentlich ist. Es versuchen hier die Individuen, sich gegenseitig einzuordnen und sie kommunizieren das über ein „So-Tun-als-ob“ in Gestalt ritualisierter Verhaltensmuster mit Symbolcharakter, die auch in die Zukunft verweisen können.
Innerhalb der „Gruppenbildenden Verhaltensmuster“ gibt es fest definierte Formen von Interaktionsmustern, ich nenne sie Interaktionsspielmuster, die jeweils als Verweis auf ein anderes Ereignis, eine Handlung oder als generalisierter Anspruch gegenüber den übrigen Mitgliedern der Gruppe fungieren. Es sind dies symbolhafte Handlungsabläufe, über die der Hund dem Sozialpartner Mitteilungen über komplexe Zusammenhänge machen kann. Dabei wird der symbolische Inhalt einer Aktion durch Hinzunahme von Objekten, welche der Hund mit seinem Maul aufnehmen kann, verstärkt.
Hunde können die Bedeutung von Symbolen erkennen und zuordnen und sie bedienen sich verschiedener Signale mit Symbolcharakter, die bereits arttypisch in ihrem Verhaltensrepertoire vorhanden sind.
Wir Menschen können uns das zunutze machen, indem wir solche Signale bewusst zum Einsatz bringen. Wichtig ist dabei, dass die Symbole eindeutig kommuniziert werden und wir den Symbolwert der Signale nicht auflösen.
© Gila Fichtlmeier
GRUPPENORGANISIERENDE VERHALTENSMUSTER beinhalten individuelles Respekt-Einfordern
© Gila Fichtlmeier
… Interesse bekunden und entsprechend die Unsicherheit des Anderen reflektieren …
© Gila Fichtlmeier
… sensibles gegenseitiges Sich-Annähern und rechtzeitiges Zurücknehmen …
© Gila Fichtlmeier
… Imponierkauen mit der symbolischen Information „Bitte Abstand halten!“
Wichtig
Ein Symbol ist ein Signal, das mit einem Bedeutungsinhalt verknüpft ist. Es beinhaltet alle damit in Zusammenhang gebrachten Erinnerungen und Erfahrungen.
2. GRUPPENBILDENDES INTERAKTIONSSPIELMUSTER
Die Drohungen der Hündin und das Sich-Zurücknehmen des Rüden aus dem vorhergehenden Beispiel haben insgesamt bewirkt, dass beide von der wechselseitigen Möglichkeit der Beeinflussung wissen und auf den Bedeutungsinhalt der gezeigten Signale vertrauen können. Jeder fühlt sich vom anderen verstanden und weil keiner der anderen Hunde sich aktiv in den Abgleich mit eingebracht hat, können die beiden davon ausgehen, dass ihr Verhalten allgemeine Akzeptanz fand.
Das eröffnet ihnen die Möglichkeit, in einem Gruppenbildenden Interaktionsspielmuster, das als generelle Information an die Gruppe weitergegeben werden kann, weitere soziale Aspekte ritualisiert abzuklären. Beispielsweise kann das Überlassen von Beute nun auch unter Zuhilfenahme von Objekten und unter Einbringung eigener Ideen aller Individuen geklärt werden. Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen bleibt die Übereinkunft für die beteiligten Hunde bestehen. Die Hunde erachten sie als gültig und werden darauf zurückgreifen. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Mensch in dieses Kommunikationsmuster mit einbezogen wird und dies vom ihm sogar bewusst initiiert werden kann. Die meisten Hundehalter haben jedoch keinerlei Kenntnisse über solche Interaktionsspielmuster. Interaktionsspielmuster werden auch oft mit Übersprungshandlungen verwechselt oder der sogenannten Grauzone innerhalb von Spielverhalten zugeordnet.
3. GRUPPENBILDENDES STRUKTURIERUNGSMUSTER
Fehlverhalten einzelner wird seitens dazu veranlagter Artgenossen im Rahmen eines „instinktiven Wertesystems“ durch Strukturierungsmuster reglementiert. Diese Strukturierungsmuster werden nach meinem Erkenntnisstand entsprechend der Rasse und Individualität des Hundes gezeigt. Oberflächlich betrachtet wirkt es wie ein Gruppenbildendes Interaktionsspielmuster. Es unterscheidet sich jedoch von diesem, da es sich auf die ganze Gruppe bezieht.
Ein Beispiel
Die Hunde einer Hundegruppe befinden sich im Freilauf. Anfangs herrscht ein heilloses Durcheinander. Ein Hund, mit der angeborenen Tendenz zu strukturieren, bemüht sich, Ordnung in die Gruppe zu bringen. Dazu nähert er sich jedem einzelnen Individuum, das an der „Unordnung“ innerhalb einer Gruppe beteiligt ist und fordert von diesem ein kurzes Stehenbleiben und Beschwichtigen ein. Das setzt er so lange fort, bis ein entspanntes Miteinander unter den Hunden stattfindet und Ordnung erkennbar wird. Dabei behält er den Rest der Gruppe immer im Auge.
INSTINKTIVE MORAL
Hunde unterliegen einem instinktiven Gefühl für „richtig“ oder „falsch“. Diese instinktive „Moral“ zeigt sich unter anderem auch darin, dass sich ein Hund in den Dialog zweier anderer Hunde „einmischt“, um denjenigen Hund, der sich nicht angemessen verhält, „zur Ordnung“ zu rufen. Das lässt darauf schließen, dass der einzelne Hund nicht nur individuelle Bedürfnisse und Interessen kommuniziert, sondern gleichzeitig auch ein Bewusstsein für das Gruppeninteresse hat und sich aktiv daran beteiligt. Das dient dazu, Balance im sozialen Gefüge einer Gruppe herzustellen und zu bewahren.
© Gila Fichtlmeier
INSTINKTIVE MORAL Ein entsprechend veranlagter Hund steht auch Hunden, die er nicht kennt, beschützend zur Seite.
Mensch und Hund in verschiedenen Realitäten
Es gibt einige grundlegende Unterschiede in der Wahrnehmung und Interpretation von Realität bei Mensch und Hund. Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, dass der Mensch seine Wahrnehmung und Erfahrung in Worte fassen kann.
Diese Wortkonstrukte lösen daraufhin Bilder, Gedanken und Gefühle aus, die er dann wiederum durch Worte zu übermitteln versucht. Bei Hunden werden zwar durch Worte ebenfalls Bilder erzeugt, wir können aber davon ausgehen, dass die meisten Hunde Worte lediglich als Laute wahrnehmen und hauptsächlich situativ zuordnen. Wenn wir an einer gelungenen Kommunikation zwischen Mensch und Hund interessiert sind, sollten wir darauf achten, uns dem Hund auf möglichst einfache Weise verständlich zu machen. Dazu müssen wir von dem, was wir übermitteln wollen glaubwürdig überzeugt sein und am besten auf Worte gänzlich verzichten.
© Gila Fichtlmeier
KLARES GESAMTSIGNAL Der Hund hat den Bedeutungsinhalt des nonverbalen Körpersignals verstanden: In die Hocke gehen und Arme ausbreiten heißt: Hinsausen, es gibt Leckerlis.
SEIEN SIE ÜBERZEUGEND
Ihr Gesamtsignal kommuniziert nur dann einen klar definierten Bedeutungsinhalt, wenn Sie von dem, was Sie ausdrücken wollen, absolut überzeugt sind. Dies gilt für angenehme Botschaften wie Zuwendung oder fröhliches Toben gleichermaßen wie für „Negativ-Kommentare“, die dem Hund deutlich machen sollen, dass er gerade soziales Fehlverhalten zeigt. Der erste und alles entscheidende Schritt für gelingende Kommunikation ist daher: Werden Sie sich zunächst einmal klar darüber, was Sie dem Hund vermitteln wollen und dann vermittlen Sie ihm genau das und nichts anderes. Tun Sie dies nonverbal und mit jeder Faser Ihres Körpers. Sie werden sehen, es klappt dann nahezu augenblicklich, dass Ihr Hund Sie richtig versteht.
Wenn ich darüber nachdenke, wie ich einen Bedeutungsinhalt ohne Worte optimal „formuliere“, erkenne ich ganz schnell, ob der Inhalt auf diesem Weg kommuniziert werden kann oder ob dieser Inhalt zu komplex ist. Außerdem verliere ich so nie aus den Augen, dass Hunde nicht spracheinsichtig sind und dass das Ausweichen auf für den Hund leere Worthülsen rein gar nichts mit Kommunikation zu tun hat. Anstatt nach Worten zu suchen, denke ich darüber nach, welche Aktionen dem, was ich zu übermitteln versuche, am nächsten kommen.
EIN HUND IST KEIN THEORETIKER
Ein Hund analysiert Situationen nicht in der Komplexität, wie dies der Mensch tut. Er kann die vielen Wechselwirkungen verschiedener Einflussfaktoren, die in einer Situation wirken, nicht in ihrer Vielschichtigkeit erkennen. Er stellt nicht in Frage, ob sein Verhalten, das er gemäß seiner Empfindung zeigt, in einer bestimmten Situation richtig oder angemessen ist oder war.
Der Hund empfindet sich in einer Situation und reagiert aus der Empfindung dieser Situation heraus. Direkt und unverzüglich. Er trifft jede Entscheidung in dem Moment, in dem er mit der speziellen Problemstellung konfrontiert ist, wie zum Beispiel bei der Begegnung mit seinem „Erzfeind“.
Der Mensch hingegen kann vorausschauend handeln, und so zu erwartende Probleme in seinem Tun berücksichtigen. Bemerkt er beispielsweise noch bevor dies sein Hund tut, dass sich dessen „Erzfeind“ nähert, kann er durch rechtzeitiges Anleinen, durch Umkehren oder Meiden des Kontaktes das Problem umgehen oder das Verhalten des Hundes durch Erweiterung dessen sozialer Interaktionsfähigkeiten in andere Bahnen lenken.
ERST DENKEN – DANN REAGIEREN
Zu erwartende Konflikte lassen sich entschärfen, wenn wir die Reaktionsmöglichkeiten des Hundes erweitern und modifizieren. Der Hund soll nicht nur in einem antrainierten Rahmen Kommandos befolgen, sondern verstärkt im dynamischen Prozess sozialer Interaktionen sein Handeln auf das soziale Miteinander ausrichten.
Wenn wir dabei die Gewichtung auf kommunikativen Signalfluss und gegenseitiges Reflektieren legen, erzeugen wir zudem im Hund ein Sich-selbst-Reflektieren in der Situation, in welcher er sich gerade befindet.
Auf diese Weise erliegt der Hund nicht mehr so stark den Reizen seines Umfeldes. Zudem lässt der Hund sich dadurch leichter auf erwünschtes Verhalten umlenken. Das kann sehr gut über diverse Aufgabenstellungen im Bereich Suchen und Apportieren bewerkstelligt werden.
HÜNDISCH
Gesten statt Worte
NONVERBALES INTERAKTIONSMUSTER unter Hunden durch Zuhilfenahme von Ersatzbeute (Stock) als Symbol für allgemeine Ressourcen.
Diese wortlose Verständigungsebene wird oft durch unbedarftes Beutespiel modifiziert (Werfen und Zerren). Dies geht bis zur Unfähigkeit des Hundes, sich weiterhin auf hündische Weise zu artikulieren.
© Gila Fichtlmeier
© Gila Fichtlmeier
© Gila Fichtlmeier
© Gila Fichtlmeier
© Gila Fichtlmeier
LASS UNS MAL RICHTIG SPIELEN
Gedanken zu Spiel mit und ohne Objekte
Bevor ich Ihnen jetzt meinen Weg zeige, auf dem Sie mit Ihrem Hund gemeinsam Spaß und Spannung bei abwechslungsreichen Übungen zum „Suchen und Apportieren“ erleben können, möchte ich Ihnen Gedankenanstöße zum Spielen geben.
Ein „Spielen mit dem Hund“ habe ich im Praxisteil als Aufgabenbereich bewusst ausgeklammert, da es für mich keine schlüssigen Bedienungsanleitungen dafür gibt. Richtig ausgeführt können Sie „Spiel“ immer mit dazunehmen, beispielsweise als Belohnung nach einer toll gemeisterten Aufgabe, um den Hund zwischen Übungen aufzulockern, oder als Zeitvertreib, eben „just for fun“.
SPIELEN – JUST FOR FUN
Spielen um des Spielens willen
Meine Sichtweise des Hundes und mein Verständnis vom „Spielen der Hunde“ haben Sie im vorangegangenen Kapitel erfahren. Im Folgenden möchte ich Ihnen meine Gedanken über ein Spielen des Menschen mit Hunden näherbringen. Danach können Sie entscheiden, wie Sie mit Ihrem Hund spielen möchten. Für mich hat „Spiel“ zum einen die Funktion einer Belohnung, zum anderen gemeinsam Spaß zu haben. Warum nun macht Spiel „just for fun“ überhaupt Sinn?
Spielen erzeugt Nähe
Spielen mit dem Hund erzeugt vertraute Nähe und festigt die Bindung. Es hilft dabei, dass sich die Spielpartner immer besser kennen und vertrauen lernen. Anspannungen lösen sich und dieses Loslassen kann dann ins Alltagsgeschehen mitgenommen werden. Wenn man sich über den Partner „ausprobieren“ darf, wächst die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen wird gestärkt. Wenn wir uns mit unserem ganzen Wesen authentisch auf das Spiel mit dem Hund einlassen, senden wir in sich stimmige Gesamtsignale, die sich aus den fünf Faktoren innere Gestimmtheit, Geruch, Gestik, Mimik und stimmliche Modulation zusammensetzen. Dadurch bewirken wir einen unmittelbaren Kommunikationsfluss auf der Empfindungsebene. Das wirkt sich nachhaltig auf die Kommunikationsbereitschaft der Hunde aus.
Spiel als Selbstzweck – die reinste Form des Spiels
Spielen, um zu spielen und ausschließlich um zu spielen, lässt uns eintauchen in ein Spiel, das ich gerne als Spiel in seiner reinsten Form bezeichne. Es erzeugt in den Spielpartnern ein beglückendes Wir-Gefühl.
Nicht ich spiele mit dir oder du mit mir, es ist nicht dein oder mein Spiel, das da stattfindet, sondern wir werden gespielt vom Zufall, dessen Regelwerk dem Chaosprinzip folgt. Unvorhersehbarer Reigen aus Gefühlsübermittlungen. Freude und Vergnügen pur. Ohne Hintergedanken an Trainingsziele. Denn spielerisches Lernen ist etwas grundlegend anderes als reinstes Spiel. Beim Aufflackern der kleinsten Ernsthaftigkeit verliert das Spiel seinen Zauber und das eigene Ego rückt in den Vordergrund und überschattet den Rahmen des unbedarften Miteinanders.
Info
Freies Spiel
Die Suche nach dem freien Spiel gleicht oft einer Suche nach Erleuchtung. Wir suchen sie und bemerken dabei nicht, dass sie bereits in uns vorhanden ist. Ich bin Spiel und lasse mich treiben im Geschehen mit dir. Ich lasse zu, dass es geschieht. Es spielt uns, so wie der Wind mit den Blättern spielt. Es geschieht, solange es nicht behindert wird.
Körperliches Spiel als Basis
Das Spiel mit dem Hund ohne Verwendung von Objekten ist die Basis für jede Form von Spiel. Es kann viele Elemente beinhalten. Miteinander ringen, den anderen abdrängen, übereinanderkullern, sich sanft und spielerisch knuffen, nach den Pfoten schnappen, das Hinterteil präsentieren, den Partner auf den Rücken rollen, sich imponierend auf den Rücken legen und die Scheinangriffe abwehren, so wie dies vor allem Welpen im Selbsterfahrungsspiel mit gleichaltrigen Artgenossen zeigen. Hier kann man sich alles von den Welpen abschauen. Der richtige Zeitpunkt folgt dem Zufall und der Intuition der Spielpartner. Einer spielt das Beutetier, es flieht, stellt sich, schlägt zurück. Und jetzt ist der andere dran! Spiel lässt uns freie Hand für schnellen, fast nicht vorhersehbaren Rollenwechsel.
© Gila Fichtlmeier
KÖRPERLICHES SPIEL Aus einer Spontaneität heraus liegt der Fokus auf der Übermittlung von Zuneigung und im Genießen von gegenseitigem Berühren.
© Gila Fichtlmeier
SCHMUSEN schafft eine andere Nähe als Bälle werfen.
© Gila Fichtlmeier
EMPFINDUNGSSPIEL, wie man es hier zwischen Michl und „Wolle“ sieht, entsteht aus dem Augenblick heraus und bewegt sich im Rahmen einer vertrauten Eigendynamik.
Info
Empfindungsspiel