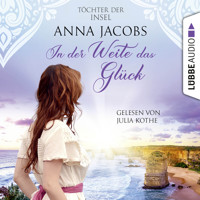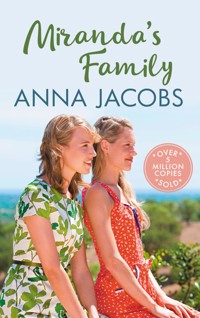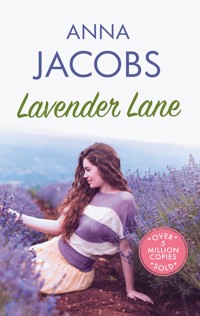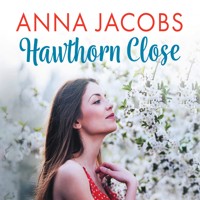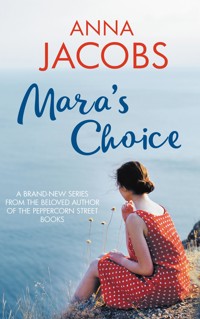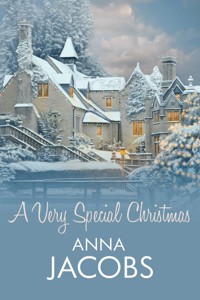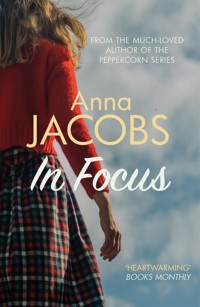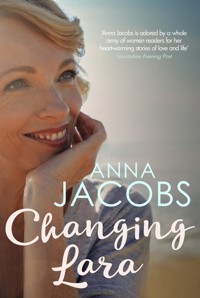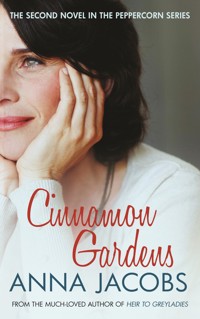6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Swan River Saga
- Sprache: Deutsch
Ein Aufbruch voller Hoffnung
England im 19. Jahrhundert. Cassandra Blake ist eine starke junge Frau: Nach dem Tod der Mutter hat sie ihre drei Schwestern allein großgezogen. Doch ihre Existenz wird bedroht, als in Amerika der Bürgerkrieg ausbricht. Denn die Baumwollversorgung in das englische Lancashire wird gestoppt, die Fabriken stehen still, und es gibt keine Arbeit mehr. Die Schwestern stehen vor einer harten Entscheidung: bleiben und den Hungertod riskieren, oder aufbrechen und an einem fernen Ort ein neues Leben beginnen?
Cassandra verliebt sich in Reece Gregory, aber er kann ihr keine sichere Zukunft bieten. Als er die Chance bekommt, ein neues Leben in Australien zu beginnen, macht er sich auf und verspricht, sie nachzuholen. Doch dann reißt eine alte Fehde die Familie auseinander. Cassandra wird entführt, und ihre Schwestern in das australische Fremantle verschifft. Aber Cassandra gibt nicht auf. Allein und mittellos ist sie entschlossen, nach Australien zu segeln und ihre Schwestern zu finden. Ist sie bereit, den hohen Preis zu zahlen, der von ihr verlangt wird?
Der erste Teil der Swan-River-Saga über die vier Blake Schwestern - ein bewegender Love-and-Landscape-Roman vor der atemberaubenden Kulisse Australiens.
LESER-STIMMEN
"Liebend gern würde man die Schwestern im Kampf gegen die unmenschlich agierende angeheiratete Tante unterstützen und kann die Ohnmacht der jungen Frauen durch das realistisch gezeichnete Bild der damaligen Zeit gut nachempfinden." (Danni, Lesejury)
"Eindrucksvoll lässt Anna Jacobs tragisch, aber auch hoffnungsvoll auf eine Zeit blicken, in der alles verloren scheint." (Mesanach_90, Lesejury)
"Anna Jacobs hat mit diesem Roman einen wirklich tollen Start hingelegt. Ihre Figuren sind sehr realistisch dargestellt und haben Gesichter. (...) Allein das verträumte Cover lädt schon ein und wir werden auch hier nicht enttäuscht. Bildgewaltig, stark und klar präsentiert uns Jacobs ihren Schauplatz." (Kristall86, Lesejury)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Träume im Glanz der Morgenröte: Töchter des Horizonts
Sehnsucht unter weitem Himmel: Töchter des Horizonts
Goldene Stunde in der Ferne: Töchter des Horizonts
Hoffnung unter dem Südstern: Töchter des Horizonts
Silberstreif des Glücks: Töchter des Horizonts
Über dieses Buch
Ein Aufbruch voller Hoffnung
England im 19. Jahrhundert. Cassandra Blake ist eine starke junge Frau: Nach dem Tod der Mutter hat sie ihre drei Schwestern allein großgezogen. Doch ihre Existenz wird bedroht, als in Amerika der Bürgerkrieg ausbricht. Denn die Baumwollversorgung in das englische Lancashire wird gestoppt, die Fabriken stehen still, und es gibt keine Arbeit mehr. Die Schwestern stehen vor einer harten Entscheidung: bleiben und den Hungertod riskieren, oder aufbrechen und an einem fernen Ort ein neues Leben beginnen?
Cassandra verliebt sich in Reece Gregory, aber er kann ihr keine sichere Zukunft bieten. Als er die Chance bekommt, ein neues Leben in Australien zu beginnen, macht er sich auf und verspricht, sie nachzuholen. Doch dann reißt eine alte Fehde die Familie auseinander. Cassandra wird entführt, und ihre Schwestern in das australische Fremantle verschifft. Aber Cassandra gibt nicht auf. Allein und mittellos ist sie entschlossen, nach Australien zu segeln und ihre Schwestern zu finden. Ist sie bereit, den hohen Preis zu zahlen, der von ihr verlangt wird?
Der erste Teil der Swan-River-Saga über die vier Blake Schwestern – ein bewegender Love-and-Landscape-Roman vor der atemberaubenden Kulisse Australiens.
Über die Autorin
Anna Jacobs hat bereits über siebzig Bücher verfasst. Sie wurde in Lancashire geboren und wanderte 1970 nach Australien aus. Sie hat zwei erwachsene Töchter und wohnt mit ihrem Mann in einem Haus am Meer.
DIEAUSTRALIEN-TÖCHTER
ANNA JACOBS
Wo die Hoffnungdich findet
Aus dem Englischen vonNina Restemeier
beHEARTBEAT
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment | Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © by Anna Jacobs 2009
Titel der britischen Originalausgabe: Farewell to Lancashire
Originalverlag: Hodder & Stoughton, Hachette UK
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Clarissa Czöppan
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: Miriam Verlinden / Guter Punkt, München
Unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Nejron Photo | bmphotographer und © LifeofRileyDesign/gettyImages
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6874-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Widmung
In liebevollem Gedenken an meine Mutter,Lucy Sheridan, die im Jahr 2008 verstarb. Ich hoffe, dass sie und Dad nun, da sie wieder zusammen sind, »dort oben« tanzen.
Und Dank an meine wunderbare Schwester Carol,die sich hingebungsvoll um Mum gekümmert hat, als ich es nicht konnte.
Für euch beide, in Liebe
Anna
Prolog
1861 – Outham, Lancashire
Es war ein kühler Samstagnachmittag im Mai. Edwin Blake ließ die Zeitung sinken und legte sie auf seinem Schoß ab. Eine oder zwei Minuten lang schaute er ins Leere, dann sah er sich im Zimmer um, und beim Anblick seiner vier Töchter wurde sein Ausdruck unwillkürlich milder. Er konnte sich wirklich glücklich schätzen, mit solchen Kindern gesegnet zu sein. Wenngleich sie keine Kinder mehr waren. Seine Mädchen waren erwachsene Frauen, und er wusste nicht, ob er es begrüßen oder bedauern sollte, dass noch keine von ihnen verheiratet war und sie alle noch bei ihm lebten.
»Geht es dir gut, Dad?«, fragte Cassandra.
Er hätte es wissen müssen, dass sie seine Unruhe bemerken würde. Als Älteste versuchte sie, für sie alle zu sorgen; das tat sie, seit sie im Alter von vierzehn Jahren ihre Mutter verloren hatte.
»Ich habe gerade etwas über diesen Krieg in Amerika gelesen.«
»Aber es ist doch gut, dass sie die Sklaven befreien wollen, oder nicht?«
Er nickte. »Natürlich ist das gut. Nur … wenn der Norden und der Süden damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu bekriegen, was wird dann aus der Baumwolle? Wer pflanzt und erntet sie ohne die Sklaven?«
»Sie werden eben Leute dafür bezahlen müssen.«
»Und woher sollen sie das Geld nehmen? Ein Krieg ist teuer, mein Mädchen. Schau doch, was gerade erst vor ein paar Jahren auf der Krim geschehen ist.«
Er schwieg einen Augenblick, bevor er seine größte Sorge aussprach: »Und selbst wenn sie weiterhin Baumwolle produzieren, wie wollen sie die über das Meer zu uns nach Lancashire transportieren? Im Krieg gibt es Blockaden, dann kommt kein Schiff durch.«
»Es hat schon früher Zeiten gegeben, in denen weniger gearbeitet wurde«, sagte Xanthe. »Das werden wir schon überstehen.«
»Weniger Arbeit ist eine Sache. Ich habe darüber nachgedacht, und so wie ich es sehe, werden wir überhaupt keine Arbeit mehr haben, wenn keine Baumwolle mehr in Lancashire ankommt.«
Stille trat ein, und er konnte sehen, dass sie über seine Worte nachdachten. Er hatte seine Töchter stets dazu ermuntert, sich ihre eigenen Gedanken zu machen. Nur weil sie einfache Arbeiterinnen waren, brauchten sie sich noch lange nicht wie Schafe zu benehmen und sich von anderen beeinflussen zu lassen.
»Der Krieg wird doch sicher nicht länger als ein paar Monate dauern?«, fragte die sanftmütige Maia. »Da kämpfen Brüder gegen Brüder. Ich mag gar nicht darüber nachdenken. Die Vorstellung, dass eine meiner Schwestern plötzlich mein Feind sein könnte …« Beim bloßen Gedanken daran stiegen ihr Tränen in die Augen.
»Seit Anbeginn der Zeit kämpfen Brüder gegeneinander«, erwiderte Edwin. »Denk an Kain und Abel in der Bibel. Und euer Onkel Joseph hat seit über zwanzig Jahren kein Wort mit mir gesprochen. Nicht einmal zur Beerdigung eurer Mutter ist er gekommen. Er läuft auf der Straße an mir vorbei, als wären wir Fremde, als hätten wir als Kinder nicht im gleichen Bett geschlafen und zusammen gespielt. Er behauptet, es liege daran, dass ich Methodist geworden bin, aber das scheint mir ein schwaches Argument zu sein.«
»Ich glaube, es liegt an seiner Frau«, seufzte Cassandra. »Sie schaut uns an, als würde sie uns hassen. Als Kind habe ich mich immer gefürchtet, wenn ich auf der Straße an ihr vorbeigehen musste.«
»Ich mag diese Frau auch nicht, aber sie würde euch niemals etwas antun.«
»Sie schaut uns aber so an, als wollte sie es.«
»Sie und Joseph haben nie Kinder bekommen, wahrscheinlich kann sie euch deshalb nicht leiden.«
»Aber das ist doch nicht unsere Schuld.«
Er erwiderte nichts. Es tat noch immer weh, dass sein Bruder ihn mied. Hin und wieder musste er darüber reden, um seiner Bitterkeit ein wenig Luft zu machen. Seine Schwägerin war eine gehässige Person, die ihnen mit keinem Handschlag geholfen hatte, als seine Frau so schwer krank geworden war. Er hatte versucht, ihr zu verzeihen, denn so lehrte man es in der Kirche, trotzdem wollte er nichts mit ihr zu tun haben. Normalerweise war er nicht abergläubisch, aber irgendetwas an ihr war einfach … böse. Das war das einzige Wort, das ihm zu ihr einfiel.
»Du brauchst niemanden sonst, du hast doch uns.« Pandora beugte sich vor und legte eine Hand auf seine krummen Finger.
Er blickte hinab auf ihre glatte junge Haut. Seine Hand war rau vom Leben und von harter Arbeit, morgens waren die Gelenke steif und schmerzten. Mit ihren zweiundzwanzig Jahren waren Pandoras Hände zart und hübsch, wenn auch gerötet von der Arbeit. »Aber ihr dürftet gar nicht mehr bei mir sein. Ihr solltet inzwischen alle verheiratet sein und euer eigenes Heim und eure eigene Familie haben.«
Abrupt stand sie auf und trat an den Herd, um das Stew umzurühren. Sie drehte sich erst wieder um, als sie sich ein wenig gefasst hatte. Edwin war wütend auf sich selbst, weil er Pandora mit seinen unbedachten Worten verletzt hatte. Sie war die einzige seiner vier Töchter, die schon einmal verlobt gewesen war, mit einem anständigen, aufgeweckten Burschen. Sie wäre inzwischen längst verheiratet, wenn der arme Bill nicht im letzten Jahr unerwartet an einer Lungenentzündung gestorben wäre.
Doch so schmerzhaft das Thema auch war, beim Anblick seiner ältesten Tochter musste er sagen, was er zu sagen hatte: »Du bist jetzt achtundzwanzig, Cassandra. Warte nicht zu lange damit, dir einen Mann zu suchen, meine Liebe. Es wäre zu traurig, wenn du ohne Kinder alt werden müsstest. Ihr vier seid die Freude meines Lebens.«
»Wen sollte ich schon heiraten? Ich werde niemals einen Mann finden, der auch nur halb so klug ist wie du«, erwiderte sie leichthin.
Er sah sie stirnrunzelnd an. »Das ist es, was dir bei einem Mann am wichtigsten ist? Dass er klug ist?«
Sie nickte. »Und dass er freundlich ist, so wie du. Einen dummen oder langweiligen Mann könnte ich nicht ertragen. Ich habe es einmal versucht, als Tom Dorring mir den Hof machte, weil er so nett war. Aber das hat nicht gereicht. Er hat von nichts anderem geredet als von der Arbeit und den Nachbarn.«
Edwin rang sich ein Lächeln ab, doch das war auch so eine Sache, die ihm Sorgen bereitete. Alle seine Mädchen waren klug, aber Cassandra hatte den schärfsten Verstand von allen. Das war der einzige Grund, weshalb er sich manchmal wünschte, reich zu sein. Dann hätte er ihnen bessere Möglichkeiten bieten können, ihren Verstand auch zu benutzen. Er hatte ihnen die beste Schulbildung verschafft, die er sich hatte leisten können, damit sie, wenn sie erst arbeiteten, gut genug lesen konnten, um sich selbst fortzubilden, so wie er es getan hatte.
Die ganze Familie lieh regelmäßig Bücher aus der Bibliothek aus. Ach ja, diese Leihbücherei war schon eine wunderbare Sache! Er wünschte, es hätte sie schon gegeben, als er noch jünger gewesen war. Sie war erst 1852 eröffnet worden, denn das Gesetz besagte, dass die Steuerzahler darüber abstimmen mussten und das Geld erst bei einer Mehrheit von zwei Dritteln ausgegeben werden durfte. Es war eine knappe Entscheidung gewesen, ob Outham eine Bibliothek bekommen sollte, aber glücklicherweise hatten genug Menschen dafür gestimmt.
Doch vielleicht hätten seine Töchter ihre Klugheit manchmal ein bisschen weniger zeigen sollen, einfach weil sie Mädchen waren. Die meisten Männer mochten es nicht, wenn das Weibsvolk schlauer war als sie.
Nein, Cassandra tat gut daran, auf einen Mann zu bestehen, dessen Verstand es mit dem ihren aufnehmen konnte. Er wollte seine Mädchen nicht an einfältige Männer verlieren, die an nichts anderes dachten als daran, woher die nächste Mahlzeit kommen werde und ob ihr Arbeitsplatz sicher sei.
»Das Stew ist fertig. Wollen wir jetzt essen?«, fragte Pandora.
Edwin ging voraus zum Tisch, doch schon nach ein paar Bissen legte er sein Besteck nieder und schnitt das nächste Thema an, das er auf dem Herzen hatte. »Ich kann keine Griechischstunden mehr nehmen.«
»Aber du lernst doch so gern Griechisch«, warf Cassandra ein.
»Ich kann eine Zeit lang allein weiterlernen.«
»Aber warum willst du aufhören?«
»Wegen dieses Krieges. Ich glaube, wir sollten alle anfangen, auf unser Geld zu achten, jeden Penny zweimal umdrehen und so viel sparen, wie wir können. Schwere Zeiten stehen uns bevor, schwerere, als wir jemals erlebt haben.«
So. Nun hatte er alles ausgesprochen, was ihn beschäftigte. Er brach ein Stück Brot ab, nahm seinen Löffel wieder auf und aß langsam sein Stew.
Die Mädchen schwiegen, während sie über die Worte ihres Vaters nachdachten, und er versuchte nicht, eine Unterhaltung zu erzwingen. Wenn schwere Zeiten bevorstanden, dann war es am besten, wenn sie den Tatsachen ins Auge blickten, darüber nachdachten, Vorkehrungen trafen.
Kapitel 1
Anfang November verlor Cassandra ihre Arbeit, als die kleine Baumwollfabrik, in der sie arbeitete, geschlossen wurde. Nachdem ihre Mutter gestorben war, hatte sie einige Jahre mit der Arbeit ausgesetzt, um den Haushalt zu führen und für die jüngeren Mädchen zu sorgen, deshalb hatte man sie als Erste entlassen. Ihre Schwestern arbeiteten seit einiger Zeit nur noch halbtags, und nun war ihr Vater der Einzige mit einer Vollzeitstelle.
Keine Arbeit mehr zu haben war ihr schrecklich unangenehm. »Ich übernehme den Haushalt und die Einkäufe, und ihr könnt sicher sein, dass ich auf jeden Penny achten werde«, erklärte sie ihren Schwestern. »Es hat keinen Sinn, mir eine neue Stelle zu suchen. In der ganzen Stadt gibt es keine Arbeit.«
Als sie sich am nächsten Morgen von den anderen verabschiedete, lächelte sie, doch kaum war sie allein, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten und gestattete sich einen Augenblick der Schwäche. Dann wischte sie sich über die Augen und beschloss, das ganze Haus von oben bis unten zu putzen. Vom Frühstück war noch warmes Wasser übrig, aber sie würde keine Kohle verschwenden, um noch mehr zu erhitzen. Wasser gab es umsonst, also konnte man putzen, auch wenn man es sich nicht leisten konnte, es zu erwärmen.
Kaum hatte sie den Eimer gefüllt, klopfte es an der Hintertür, und als sie öffnete, stand der kleine Junge vor ihr, der zwei Häuser weiter wohnte.
»Ich habe Hunger, Miss«, sagte Timmy.
Sie rang mit sich und verlor, also gab sie ihm den Brotkanten, den sie sich fürs Mittagessen aufgespart hatte. Er war in Schande geboren, und obwohl der Mann seiner Mutter ihr uneheliches Kind angenommen hatte, wussten doch alle, dass der arme Junge nicht geliebt wurde und nicht so gut versorgt wurde wie die anderen Kinder.
Cassandra seufzte und schloss die Tür wieder. Timmys Traurigkeit stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Seine drei jüngeren Halbbrüder waren größer und stämmiger als er. Wie konnte man ein Kind nur so schlecht behandeln?
Sie machte sich an die Arbeit und schrubbte den Küchenboden, doch immer wieder hielt sie nachdenklich inne. Ihr Vater hatte recht gehabt vor all den Monaten. Wegen des Krieges erreichten kaum noch Baumwolllieferungen das Land, und in der Kleinstadt waren düstere Zeiten angebrochen. Die Leute sagten immer, bevor es besser werde, müsse es erst noch schlimmer werden, und das war ein erschreckender Gedanke.
Einige Familien erhielten bereits Unterstützung von der Armenfürsorge, andere verkauften nach und nach ihre Möbel oder überzählige Kleidungsstücke, um nur nicht auf Almosen angewiesen zu sein. Wenn man Unterstützung erhielt, verlor man alle Unabhängigkeit, denn die Beamten der Fürsorge schnüffelten im ganzen Haus herum und zwangen einen, alles zu verkaufen, was man besaß, bevor sie einem etwas gaben.
Cassandra und ihre Familie kamen über die Runden – dank der Weitsicht ihres Vaters. In der Blechbüchse in seinem Kleiderschrank war immer noch Geld. Doch die Ersparnisse schmolzen schneller dahin, als sie sollten, denn Edwin konnte es nicht lassen, Nachbarn mit kleinen Kindern, die vor Hunger weinten, etwas abzugeben. Es war eine Sache, wenn Erwachsene hungerten, aber den Anblick eines hungrigen Kindes konnte er nicht ertragen. Und obwohl er jedes Mal nur ein paar Pennys gab, leerte sich die Sparbüchse zusehends.
Und sie hatte gerade dem Nachbarskind das Brot gegeben, das sie fürs Mittagessen vorgesehen hatte. Heute würde sie hungrig bleiben. Aber wenigstens der arme Timmy nicht.
Als Edwin einige Abende später von der Arbeit heimkam, war er erschöpft und traurig.
»Der Besitzer der Spinnerei hat mir heute Morgen gesagt, dass er nur noch für drei Monate Baumwolle hat«, erzählte er beim Abendessen, das in letzter Zeit kärglich ausfiel, meistens Brot oder Kartoffeln mit ein wenig Butter. »Und um überhaupt so lange durchzuhalten, wird er noch mehr Arbeiter entlassen müssen.« Er blickte die Zwillinge an. »Ihr werdet nächste Woche eure Arbeit verlieren, Xanthe und Maia. Mr Darston versucht, wenigstens eine Person aus jeder Familie in Lohn und Brot zu halten, solange er es kann, und das wäre in unserem Falle ich. Er ist ein guter Mann, der sein Bestes tut, um die wenige Arbeit, die es noch gibt, gerecht zu verteilen.«
»Was werden die Leute machen, wenn dieser Krieg immer weitergeht und es überhaupt keine Arbeit mehr gibt?«, fragte Maia. »Manche sehen jetzt schon halb verhungert aus. Ich fühle mich schuldig, weil wir noch immer jeden Tag etwas zu essen haben.«
»Die Königin wird nicht zulassen, dass die Bevölkerung von Lancashire verhungert«, erklärte Edwin entschieden. »Wenn ihr bewusst wird, wie schlimm es steht, wird sie die Regierung anweisen, uns zu helfen, da bin ich mir sicher.« Er hatte großes Vertrauen in Ihre Majestät, die mit ihrem Gatten und ihren Kindern ein gutes Leben führte und für ihre Untertanen sorgte.
Xanthe drückte ihrer Zwillingsschwester die Hand. »Ich möchte niemals um Unterstützung bitten müssen. Was, wenn sie uns zwingen, ins Armenhaus zu ziehen? Da würde ich lieber verhungern. Es läuft mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich nur daran vorbeigehe.«
Edwin konnte ihre Abneigung verstehen. Der Gemeindepfarrer, für das gemeinschaftliche Armenhaus dieser und fünf angrenzender Gemeinden verantwortlich war, war ein kaltherziger Mann, der die Armen wie Verbrecher behandelte. Unter seiner Leitung wurden Almosen nur äußerst widerwillig verteilt.
Das Gesetz besagte, dass die Bedingungen in ihnen schlimmer sein mussten als außerhalb, doch während die wenigsten Armenhäuser in Nordengland diese Regel strikt befolgten, hielt sich das in Outham streng an das Gesetz. Die Bewohner waren kurz davor zu verhungern, während sich der Pfarrer zu Hause den Bauch vollschlug, bis er aussah, als würde ihm jeden Augenblick der Knopf von seinen Hosen springen. Er achtete außerdem streng darauf, Männer und Frauen voneinander zu trennen, um »Unzucht zu vermeiden«, sogar die Alten, die sich nichts mehr aus solchen Dingen machten.
Edwin hielt diesen Pfarrer für keinen aufrechten Gottesmann, und das war auch der Grund, weshalb er zu den Methodisten konvertiert war.
»Das Armenhaus bleibt unser letzter Ausweg, der allerletzte«, sagte er sanft. »Wir werden noch eine Weile unser Auskommen haben. Aber wenn es darum geht, ins Armenhaus zu gehen oder zu sterben, dann entscheidest du dich hoffentlich für das Leben, Xanthe, Liebes. Ich würde das jedenfalls.«
Cassandra hakte sich bei ihm unter. »Ich habe heute gehört, dass in der Pfarrkirche eine Suppenküche für die Arbeitslosen eingerichtet werden soll. Man braucht dafür kein Gemeindemitglied zu sein. Sie soll dreimal in der Woche stattfinden: Montag, Donnerstag und Samstag. An diesen Tagen könnten wir dort eine Mahlzeit bekommen, das wäre uns eine große Hilfe.«
Edwin war sich nicht sicher, ob es gut war, die Suppenküche in der Pfarrkirche unterzubringen. Er hatte gehofft, der Pastor seiner eigenen Gemeinde, ein barmherzigerer Mann, würde etwas organisieren. Doch der Stadtrat hatte in seiner Weisheit beschlossen, dass alle Wohltätigkeitsbemühungen gebündelt werden sollten, um eine weitreichende Hilfe zu ermöglichen. Und da die Pfarrkirche über den mit Abstand größten Gemeindesaal verfügte, sollte die Suppenküche dort eingerichtet werden.
Was war das nur für eine Welt, in der seine Mädchen das magere Brot der Barmherzigkeit essen mussten?
Maia arbeitete immer noch zwei Tage die Woche, deshalb stellten sich am ersten Montag, an dem die Suppenküche öffnete, die drei anderen Schwestern an, um eine Essensmarke zu bekommen. Geduldig warteten die Leute in der Schlange vor dem Gemeindehaus, niemand redete viel. Es war beschämend, auf Almosen angewiesen zu sein, und sie spürten die Demütigung deutlich.
Baumwollarbeiter waren es vielleicht gewohnt, den Gürtel enger zu schnallen, wenn der Handel rückläufig war, aber fast ganz ohne Arbeit zu sein, das kannten sie nicht. Einige hatten die Stadt bereits verlassen und suchten Arbeit in der Wollindustrie im nahe gelegenen Yorkshire. Andere hatten sich in den Süden gewagt, wo die Menschen anders sprachen und die Landschaft sanfter war. Es hieß, dort sei noch Arbeit zu finden.
Die Männer, denen es zu schwerfiel fortzugehen, wanderten wie verlorene Seelen in Outham herum und wussten nicht, womit sie die Zeit totschlagen sollten. Für die Frauen war es einfacher: Sie hatten zumindest den Haushalt zu führen und ihre Kinder zu versorgen.
Als sie den Anfang der Schlange erreichten, mussten Cassandra und ihre Schwestern Fragen zu ihrer Situation beantworten, bevor man ihnen etwas gab.
Der Mann aus dem Komitee, ein Mitglied der Pfarrkirche, befragte sie mit scharfer, ungeduldiger Stimme und sagte dann knapp: »Ich hoffe, Sie danken dem Schöpfer auf Knien für diese Großzügigkeit.« Er winkte sie brüsk weiter. »Am nächsten Tisch bekommen Sie Ihre Essensmarken.«
Dort fragte wieder eine Frau: »Name?«
»Cassandra Blake.« Sie sah, wie die Frau »Cass Blake« aufschrieb.
»So heiße ich nicht.« Ihr Vater hatte sich immer geweigert, ihre Namen abzukürzen, weil es schöne Namen seien, die Namen griechischer Göttinnen, von denen er in den Büchern gelesen hatte, die sein Pastor ihm geliehen hatte.
Die Frau starrte sie empört an und wandte sich dann der Person neben ihr zu: »Wie unverschämt von dieser Kreatur! Bettelt hier um Essen und korrigiert dann, was ich schreibe.«
Der Pfarrer kam herüber. »Gibt es hier ein Problem, liebe Mrs Greaves?«
»In der Tat. Das junge Fräulein hat es tatsächlich gewagt zu korrigieren, was ich geschrieben habe.«
»Aber Sie haben mich nach meinem Namen gefragt und dann etwas anderes aufgeschrieben«, verteidigte sich Cassandra.
Der Pfarrer beugte sich über das große Buch, in das die Namen eingetragen wurden. »Cass Blake.«
»Mein Name ist Cassandra. In meinem ganzen Leben hat mich noch nie jemand Cass genannt.«
»Mein liebes junges Fräulein, Sie sollten dankbar sein, dass diese Dame Ihnen so großzügig ihre Zeit schenkt, um Ihnen zu helfen, also machen Sie jetzt keinen Aufstand wegen so unwichtiger Details.« Hochnäsig blickte er auf sie herab. »Auf jeden Fall ist Cassandra ein höchst unpassender Name für eine Person Ihres Standes. Ich weiß nicht, woher Ihre Eltern das haben, aber in meiner Kirche hätte ich Sie niemals auf einen solchen Namen getauft. Nehmen Sie Ihre Marken, und gehen Sie weiter, oder ich lasse Sie aus dem Saal entfernen. Das Essen ist da drüben. Eine Marke für jeden Tag, merken Sie sich das.«
Er sprach mit ihr, als wäre sie zu dumm, ihn zu verstehen. Sie zögerte, so empört war sie. Aber sie hatte schon seit mehr als einem Tag so gut wie nichts gegessen, denn gestern Abend hatte sie den größten Teil ihrer Portion ihrem Vater und Maia überlassen, weil die immer noch zur Arbeit gehen mussten und weil ihr Vater in letzter Zeit so müde aussah.
Als sie dorthin kam, wo die Suppe ausgegeben wurde, stand ihr auf der anderen Seite des Tisches die Frau ihres Onkels Joseph gegenüber.
Ohne sich etwas anmerken zu lassen, sagte ihre Tante: »Geben Sie mir Ihre Marke, und nehmen Sie sich eine Schüssel!«
Die nächste Dame schöpfte etwas Suppe in die Schüssel, und eine dritte gab Cassandra ein Stück trockenes Brot und einen verbogenen alten Löffel.
»Bitte sehr. Vergessen Sie nicht, die Schüssel und den Löffel auf dem Tisch dort drüben abzustellen, wenn Sie fertig sind.«
Cassandra brachte ein »Danke« heraus und hastete zu einem der aufgestellten Tische, so weit wie möglich von den missbilligenden Blicken ihrer Tante entfernt. Mit zitternden Händen stellte sie ihr Essen ab, erschüttert von der Begegnung. Was für ein Hass!
Wenig später kam Pandora dazu. Sie hatte rote Flecken auf den Wangen, und ihre Augen funkelten vor Wut. »Diese Frau hat mich als ›Dora‹ eingetragen. Dora! Und der Pfarrer hat mich zurechtgewiesen, als ich sie korrigieren wollte.«
Xanthe folgte ihr und stellte den Teller ab, wobei etwas Suppe auf den Tisch schwappte. »Bei mir hat sie ›Susan‹ eingetragen.«
Ein junger Mann kam an ihren Tisch. »Ich habe gehört, was diese Frau zu Ihnen gesagt hat. Ich finde es beschämend. Absolut beschämend. Mit welchem Recht ändern sie Ihre Namen?«
Cassandra sah, wie Pandora ihn anlächelte und er ihr zuzwinkerte. Schon wieder war ein Mann von ihrer jüngsten Schwester verzaubert, die sich ihrer Wirkung auf Männer nicht einmal bewusst war. Sie war definitiv die Schönheit in der Familie, mit Haaren, so dunkel, dass sie fast blauschwarz waren, und leuchtend blauen Augen.
»Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten?«, fragte er. »Ich bin allein und kenne hier niemanden.«
»Sie können sich gerne zu uns setzen«, antwortete Cassandra.
Sie begannen zu essen. Das Brot war so alt und hart, dass sie es in die Suppe tunken mussten, um es aufzuweichen, was kein gutes Benehmen war und verächtliche Blicke des Pfarrers auf sich zog, als er an ihnen vorbeikam. Aber man durfte kein Essen verschwenden.
Bald war der Saal voll. Die Suppe war wenig schmackhaft und bestand hauptsächlich aus Kohl, Kartoffeln und Knochen, aber niemand ließ einen Tropfen übrig.
»Armseliges, dünnes Zeug ist das!«, murmelte Pandora. »Da hätte ich selbst etwas Besseres kochen können. Und das Brot ist mehrere Tage alt.«
»Wenigstens ist es nicht verschimmelt. Und es kostet nichts.« Xanthe seufzte. »Ich verstehe, warum Vater nicht mehr in diese Kirche geht, wenn man hier so behandelt wird. Glauben die, ärmere Menschen hätten keine Gefühle?«
Als sie nach draußen gingen, verabschiedeten sie sich von dem jungen Mann und machten sich langsam auf den Heimweg. Früher sind alle immer schnell gegangen, dachte Cassandra, als sie die anderen die Straße entlangschlendern sah. Nun mussten sie so viel Zeit totschlagen, dass sich niemand beeilte.
Wenn sie aufblickte, sah sie nur ein paar dünne Rauchschleier anstatt der dichten Rauchsäulen aus den Fabrikschornsteinen, die sonst in den Himmel stiegen. Es sah falsch aus, als wäre dies nicht mehr ihre Stadt, nur noch der Geist von Outham.
Erst als sie fast zu Hause waren, sprach Pandora aus, was alle dachten: »Unsere Tante sah aus, als würde sie uns hassen, oder?«
»Ja. Erzähl Vater nicht, dass wir sie gesehen haben. Es würde ihn nur aufregen.«
Pandora schwieg bis zum Ende der Straße, dann sagte sie nachdenklich: »Sie schaut uns immer so seltsam an.«
»Scher dich nicht um sie«, sagte Xanthe. »Ich will mir neue Bücher aus der Bibliothek ausleihen. Zumindest können wir das jetzt tun, wann immer wir möchten.«
»Ich glaube, wir werden noch sehr dankbar für diese Bibliothek sein«, sagte Cassandra. »Wenigstens kostet uns das Lesen nichts.«
Joseph Blake schloss seinen Lebensmittelladen wie jeden Abend um neun Uhr, verabschiedete sich von seinen Mitarbeitern und verriegelte die Tür. Widerwillig stieg er die Treppe hinauf zu den gemütlichen Zimmern, die er und seine Frau seit dem Tod ihrer Eltern bewohnten. Um sechs Uhr hatte er mit Isabel eine Mahlzeit eingenommen, ihre üble Laune bemerkt und behauptet, er habe im Laden noch etwas Dringendes zu erledigen. Während er seine Mitarbeiter unterwiesen und die wichtigeren Kunden persönlich bedient hatte, hatte er herauszufinden versucht, worüber sie jetzt schon wieder so wütend war.
Sie war in letzter Zeit oft schlecht gelaunt. Ihr armes Dienstmädchen war regelmäßig in Tränen aufgelöst, aber Dot brauchte die Arbeit, weil ihre Familie keine andere Einkommensquelle hatte, also musste sie sich damit abfinden. Wenn Joseph versucht hätte einzugreifen, wäre Isabel noch härter zu dem Mädchen gewesen, also hielt er den Mund und begnügte sich damit, Dot gelegentlich einen Leckerbissen aus dem Laden zuzustecken, einen zerbrochenen Keks oder die Schinkenreste. Er wusste, dass Isabel darauf achtete, wie viel ihr Dienstmädchen aß, und sie war nicht großzügig.
Vielleicht hatte seine Frau seine Nichten gesehen, als sie unterwegs gewesen war. Das versetzte sie immer in schlechte Laune. Sie waren hübsch, die Jüngste geradezu schön. Er bedauerte, dass er sie nicht näher kannte, aber Isabel hatte vor ihrer Heirat sehr deutlich gemacht, dass er, wenn er sie wollte, die Verbindung zu seinem Bruder abbrechen musste, und er hatte ihr sein Wort gegeben und geglaubt, er könne sie später dazu überreden, ihre Meinung zu ändern. Aber das hatte sie nie. Sie stammte aus einer ausgesprochen frommen Familie und war stolz darauf; mit den »scheinheiligen Methodisten«, wie sie sie nannte, wollte sie nichts zu tun haben.
Dabei war sie die Scheinheilige, fand Joseph, die leere religiöse Phrasen nachplapperte und genau das Gegenteil von dem lebte, was die Bibel lehrte. Sie war extrem eifersüchtig auf Catherine gewesen, die Frau seines Bruders Edwin, die zwar keine Schönheit gewesen war, aber mit ihrem Lächeln und ihrer freundlichen Art überall Freunde gefunden hatte. Isabel hatte nur wenige Freunde, und ihr unscheinbares Gesicht wurde durch seinen säuerlichen Ausdruck noch reizloser.
Es wäre vielleicht anders gewesen, wenn sie Kinder gehabt hätten. Kurz nach ihrer Heirat war Isabel schwanger geworden, und mit jedem Monat schien sie weicher und freundlicher zu werden. Aber nach sieben Monaten hatte sie das Baby verloren und wäre dabei fast selbst gestorben, hatte der Arzt gesagt. Er hatte hinzugefügt, dass sie nicht in der Lage sein werde, noch weitere Kinder zu bekommen, also solle sie es vermeiden, noch einmal schwanger zu werden. Sie war so lange krank gewesen, dass sie hier bei ihren Eltern eingezogen waren, wo ihre Mutter sich um sie gekümmert hatte. Und von diesem Tag an hatten sie nie wieder das Bett miteinander geteilt. Was eine Erleichterung war.
Er war bald dazu übergegangen, so viel Zeit wie möglich im Laden zu verbringen, und hatte schnell verstanden, warum sein Schwiegervater das auch tat. Man fand dort immer etwas zu tun, konnte die Regale überprüfen, sich vergewissern, dass der Laufbursche alle Lieferungen prompt erledigt hatte, die Handelsreisenden der verschiedenen Firmen treffen, von denen sie ihre Waren bezogen, oder einfach ruhig nach Ladenschluss dasitzen und so tun, als würde man die Geschäftsbücher prüfen, während man in Wirklichkeit eine Zeitung oder ein Buch las.
Nachdem seine Schwiegereltern gestorben waren, hatte er den Namen des Ladens in Blakes Gemischtwarengeändert, was seine Frau erzürnt hatte, aber ausnahmsweise hatte er ihr die Stirn geboten. Dennoch führte er den Laden größtenteils so weiter wie bisher, weil sein Schwiegervater ein guter Geschäftsmann gewesen war.
Seit dem Krieg in Amerika hatte sich vieles geändert. Heutzutage war es nicht mehr nötig, so viel Ware zu bestellen, da die Baumwollknappheit alle Schichten der Bevölkerung betraf. Die wohlhabenderen Leute würden vermutlich nicht aufhören, die Dinge für den täglichen Bedarf zu kaufen, anstatt wie ihre ärmeren Nachbarn Hunger zu leiden, was bedeutete, dass er weiterhin sein Auskommen haben würde. Aber fast alle in der Stadt hatten ihre Ausgaben reduzieren müssen, sodass seine Gewinne zurückgegangen waren.
Er konnte es nicht länger hinauszögern und öffnete die Tür. Isabel erwartete ihn in ihrem Sessel am Kamin, der Rücken steif, die Lippen fest zusammengepresst, die Hände auf dem Schoß gefaltet. »Wie lief das Geschäft heute?«
»Die Einnahmen sinken, aber wir verdienen immer noch ordentlich.«
»Du solltest den jüngsten Burschen entlassen, damit wir weiter Gewinn machen.«
»Es gibt keine Arbeit in der Stadt, und er ernährt seine Familie ganz allein, also werde ich ihn so lange behalten, wie es mir möglich ist.«
»Mein Vater hätte ihn schon längst entlassen.«
»Ich bin nicht dein Vater.«
Sie stieß ein wütendes Knurren aus, aber das war ihm egal, weil sie ohnehin nichts ausrichten konnte. Der Laden war ihm vermacht worden, nicht ihr, Gott sei Dank, denn Mr Horton war davon überzeugt gewesen, dass Frauen nichts vom Geschäft verstanden.
»Ich werde nach Kakao und Keksen schicken«, sagte sie unvermittelt.
Erst als sie vor dem Kamin saßen, verriet sie ihm den Grund für ihre schlechte Laune. »Ich habe heute diese Mädchen gesehen. Jedenfalls drei von ihnen, wo die Vierte steckte, weiß ich nicht. Sie kamen in die Suppenküche.« Ihre schmale Brust hob sich vor Entrüstung, als sie hinzufügte: »Wie Bettler! Es war mir so peinlich, dass ich nicht wusste, wo ich hinsehen sollte. Ich habe natürlich so getan, als hätte ich sie nicht erkannt.«
Er war überrascht. »Sind sie so knapp bei Kasse? Ich dachte, Edwin verdient immer noch etwas.«
»Sie müssen arbeitslos sein, sonst hätten sie keine Marken bekommen. Was werden die Leute hinter unserem Rücken tuscheln, wenn sie erfahren, dass unsere Verwandten auf Almosen angewiesen sind?«
»Viele Menschen in der Stadt brauchen jetzt Hilfe. Es ist nicht die Schuld meiner Nichten, dass es keine Arbeit für sie gibt.«
»Das hätte ich mir denken können, dass du sie in Schutz nimmst. Ich bin mir sicher, dass diese faulen Flittchen einfach nicht arbeiten wollen.«
Er widersprach nicht, nippte nur an seinem Kakao und blickte ungerührt drein, während sie nicht aufhörte zu lamentieren. Ihm blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten, wenn Isabel in einer solchen Stimmung war, Beleidigungen vermutete, wo es keine gab, und seine Nichten verleumdete, die anständige Mädchen waren.
Er hatte gewusst, dass sie keine einfache Frau war, aber nicht geahnt, wie schlimm das Leben mit ihr sein würde. Er hatte den Laden gewollt, den sie mit in die Ehe gebracht hatte, den Laden, in dem er zehn Jahre lang hart gearbeitet hatte, und als klar war, dass kein anderer Mann sie heiraten würde, wagte er es, seinen Arbeitgeber um die Erlaubnis zu bitten, seiner dreißigjährigen alleinstehenden Tochter den Hof zu machen.
Seinen Bruder Edwin dürstete es nach Wissen, aber Joseph dürstete es nach Geld und Annehmlichkeiten. Und vor allem nach einem eigenen Laden.
Er hatte geglaubt, Kinder würden Isabel milde stimmen. Jetzt wusste er, dass nichts sie je erweichen würde. Ihr Geist war so vergiftet von Bosheit und Zorn, dass er manchmal sogar an ihrem Verstand zweifelte.
Aber er würde das Versprechen halten, das er ihrem Vater gegeben hatte: Er würde sich immer um sie kümmern, so schwierig sie auch war, im Gegenzug dafür, dass er den Laden bekommen hatte.
Kapitel 2
Ende November empörte sich das ganze Land über die Trent-Affäre, als ein Schiff der US-Marine aus den Nordstaaten ein britisches Postschiff stoppte, das gerade seine Reise von Kuba nach England angetreten hatte. Mit vorgehaltener Waffe verhafteten sie zwei Passagiere, Gesandte der Konföderierten, die sich auf einer diplomatischen Mission nach London befunden hatten.
Die Nation geriet in Rage, und selbst diejenigen, die wegen der Baumwollknappheit Hunger litten, vergaßen für eine Weile ihr Elend und brachten ihre Empörung zum Ausdruck. Großbritannien befand sich nicht im Krieg mit Amerika, weder mit den Nordstaaten noch den Südstaaten, sondern hatte seine Neutralität erklärt. Die Amerikaner durften das nicht! Viele Menschen forderten eine Kriegserklärung gegen den Norden.
Edwin schüttelte den Kopf darüber. »Krieg ist eine schändliche Art, einen Streit beizulegen, und ich bin sicher, unsere liebe Königin wird es nicht zulassen.«
»Aber der Kapitän der Nordstaaten war im Unrecht«, protestierte Cassandra. »Er hatte kein Recht, ein britisches Schiff zu stoppen.«
»Überhaupt kein Recht.« Er lächelte sie an. Es gefiel ihm, wie sie verstand, was in der Welt vor sich ging, obwohl manche Leute behaupteten, Politik sei nichts für Frauen.
Wenn sich die Blake-Schwestern ärgerten, dass es keine Arbeit mehr gab, so bereiteten ihnen die Neuigkeiten über die lokale Baumwollindustrie, die ihr Vater Anfang Dezember mit nach Hause brachte, noch größere Sorgen. Sein Arbeitgeber hatte ihm erzählt, dass neunundzwanzig Baumwollfabriken in Lancashire die Produktion eingestellt hätten und mehr als hundert andere nur noch eingeschränkt arbeiteten.
»So viele Menschen sind arbeitslos, so viele hungern«, sagte Maia. »Warum gibt es keine richtigen Hilfsprogramme für uns statt dieser Suppenküchen?«
»Sie reden davon, direkt vor der Stadt ein Arbeitslager für Männer einzurichten«, sagte Edwin. »Einen Steinbruch.«
»Aber das ist Sträflingsarbeit!«, rief Pandora aus.
»Das war die Idee des Pfarrers. Dieser Saunders ist ein strenger Mann, er sagt, die Leute sollten für jede Arbeit dankbar sein, und zumindest kann die Stadt mit den Steinen die alten Straßen ausbessern und neue bauen. Sie zahlen den Männern einen Schilling pro Tonne Steine, die sie abbauen.«
Einen Augenblick lang herrschte Stille, dann fragte Cassandra: »Und wie lange dauert es, eine Tonne Steine zu brechen?«
»Einen Tag, haben sie gesagt, vielleicht etwas weniger, wenn ein Mann stark ist.«
»Sechs Schilling pro Woche reichen nicht aus, um eine Familie vernünftig zu ernähren!«
»Nein.«
»Nun, ich würde alles tun, um wieder Geld zu verdienen«, sagte Xanthe, »sogar im Steinbruch arbeiten. Aber Frauen lassen sie nicht. Wir sind immer von unseren Männern abhängig.«
»Und ihr habt nur mich«, fügte Edwin hinzu. »Ich wünschte, ihr hättet geheiratet, meine lieben Mädchen, oder zumindest eine oder zwei von euch, damit ihr euch auf junge Männer verlassen könntet und nicht auf einen alten Kerl wie mich.«
»Ich werde nicht heiraten, bevor ich einen Mann kennenlerne, den ich lieben und bewundern kann«, beteuerte Xanthe, »und der erkennt, dass ich genauso klug bin wie er.«
»Ich frage mich manchmal, ob es solche Männer für Frauen unserer Klasse überhaupt gibt«, sagte Maia traurig.
Cassandra sorgte sich mehr darum, dass ihr Vater sich als »alt« bezeichnete. Er hatte in letzter Zeit ein paar Mal so geredet. Bekam er sein Alter zu spüren?
Und er hatte recht. Was würden sie tun, wenn ihm etwas zustieße, vor allem in diesen Zeiten?
Der Dezember war ein sehr milder Monat, und das war ein Segen für all diejenigen, die sich keinen Brennstoff zum Heizen ihrer Häuser leisten konnten. Aber dann erschütterte ein schwerer Schicksalsschlag die ganze Nation, denn am Vierzehnten starb der Prinzgemahl. In allen Kirchen und Kapellen beteten die Menschen für ihre Königin. Alle hatten schon einmal den Verlust eines geliebten Menschen erlebt und wussten, wie schmerzhaft es war.
Doch in den Zeitungen hieß es, die Königin sei untröstlich, ihre Trauer gehe über das normale Maß hinaus.
»Die arme Frau trägt eine schwere Last als Monarchin«, sagte Edwin. »Sie brauchte Prinz Alberts Unterstützung noch mehr, als andere Frauen ihre Männer brauchen. Und letzten März hat sie schon ihre Mutter verloren, also war es ein wirklich trauriges Jahr für sie. Aber wenigstens hat sie ihre Kinder. Kinder sind ein wunderbarer Trost, ein Zeichen, dass das Leben weitergeht.«
Er sah sich um und lächelte seine Töchter an. »Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte, als eure Mutter starb.« Dann wandte er sich an Cassandra und bewies, dass seine Augen noch genauso scharf waren wie eh und je. »Nimm sofort das Stück Kartoffel zurück, das du mir gerade auf den Teller geschoben hast. Alles, was wir haben, wird gerecht geteilt. Ich will nicht, dass du für mich hungerst.«
»Du siehst in letzter Zeit so müde aus.« Außerdem hatte er seine griechischen Bücher kaum angerührt.
»Ich werde alt. Ich bin immerhin schon sechzig.«
Sie sagte es nicht, aber ihr Onkel war zwei Jahre älter als er und sah trotzdem rosig und kräftig aus. Vielleicht würde ihr Vater durch gutes Essen wieder zu Kräften kommen? Nur wusste sie nicht, wo sie es herbekommen sollte. »Du würdest uns doch sagen, wenn es dir nicht gut gehen würde, oder?«
»Ich bin nur müde, das ist alles, mein liebes Mädchen. Mach dir um mich keine Sorgen. Und Mr Darston sagt, ich kann weiter arbeiten, zumindest halbtags. Mein Arbeitgeber ist wirklich ein guter Mann.«
Da es ein schöner Sonntag war, ging Reece Gregory die fünf Meilen von der Farm, wo er Arbeit und einen Platz zum Schlafen gefunden hatte, zu Fuß nach Outham. Die Dobsons, Verwandte von ihm, zahlten ihm nicht viel, aber er bekam anständige Mahlzeiten, und wenn sie konnten, gaben sie ihm einen Schilling oder zwei, was in Zeiten wie diesen viel wert war. Weitaus besser, als auf die Armenfürsorge angewiesen zu sein.
Er machte sich auf den Weg zum Friedhof, wo er sich auf die Steinbank neben dem Grab seiner Frau und seines Kindes setzen wollte. Es war nun zwei Jahre her, seit sie gestorben waren, und der schlimmste Schmerz hatte inzwischen nachgelassen, trotzdem fand er es tröstlich, von Zeit zu Zeit hier bei ihnen zu sitzen. Der Himmel wusste, er war nicht der Einzige, der seine Frau im Kindbett verloren oder ein Baby bekommen hatte, das nur wenige Tage gelebt hatte.
An diesem friedlichen Ort dachte er über sein Leben nach, versuchte Pläne zu schmieden, und wenn er sie gemacht hatte, verwarf er sie wieder und machte neue. Er hatte sich schon eine Weile treiben lassen, das wusste er. Nun war es Zeit, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen.
Heute saß zu seiner Enttäuschung bereits jemand auf der Bank, eine junge Frau mit einem Buch in der Hand, obwohl sie mehr in die Ferne zu starren und zu seufzen schien, als zu lesen.
Er trat ein Stück zurück und wollte einen anderen Platz zum Sitzen finden, aber seine Schritte knirschten auf dem Kies, und sie sah sich um.
»Verzeihung. Ich wollte Sie nicht stören«, sagte er.
Die Rathausuhr begann die Stunde zu läuten, und sie stand auf. »Es ist gut, dass Sie das getan haben. Es wird Zeit, dass ich nach Hause gehe.«
Sie ließ ihr Buch fallen, und als er sich bückte, um es aufzuheben, fiel sein Blick unwillkürlich auf den Titel: Eine Reise nach Ägypten. Es war ein schwerer Wälzer für eine junge Frau, aber er hätte alles gelesen, was er in die Finger bekam. Er hatte schon immer gerne gelesen, aber auf dem Hof gab es keine Bücher, außer den wenigen, die er mitgebracht hatte, und die hatte er wieder und wieder gelesen, bis er sie beinahe auswendig kannte.
Er lächelte, als er den Titel erkannte. »Ich gehe regelmäßig in die Bibliothek, seit sie eröffnet wurde. Dieses Buch habe ich vor einigen Jahren gelesen. Seitdem habe ich den Wunsch, nach Ägypten zu reisen.«
Sie lächelte, als sie es ihm abnahm. »Ich auch. Ich war noch nie irgendwo anders als in Outham, und das werde ich wohl auch nie. Aber wenn wir nicht reisen können, können wir diese Orte wenigstens durch die Augen derer sehen, die mehr Glück hatten als wir selbst.«
Es platzte aus ihm heraus, bevor ihm bewusst wurde, was er da sagte: »Die wenigsten Frauen haben das Verlangen zu reisen.«
Sie hob das Kinn. »Nun, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich habe das Glück, von einem Vater erzogen zu werden, der seine Töchter dazu ermutigt, etwas über die Welt zu lernen. Haben Sie das Buch desselben Autors über Griechenland gelesen?«
»Nein. Und ich bezweifle, dass ich das jemals werde. Seit die Baumwollfabrik geschlossen wurde, arbeite ich auf der Farm meines Vetters, und ich schaffe es nicht, in die Stadt zu kommen, wenn die Bibliothek geöffnet hat. Ich komme nur manchmal sonntags, um das Grab meiner Frau zu besuchen.«
»Sie muss sehr jung gestorben sein.«
»Vierundzwanzig. Kindbett.«
»Mein herzliches Beileid.«
»Es ist jetzt zwei Jahre her. Der schlimmste Schmerz hat inzwischen nachgelassen.« Er lächelte, denn er fand die Klugheit, die ihr Gesicht erstrahlen ließ, sehr attraktiv.
Sie nickte und wandte sich zum Gehen, doch dann drehte sie sich um und kam zurück. »Hören Sie … Wenn Sie möchten, könnte ich für Sie Bücher aus der Bibliothek ausleihen und sie Ihnen am Sonntag geben. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sich jemand nach etwas zu lesen verzehrt.«
Ihr Angebot überraschte ihn, denn sie hatte es ihm gemacht, als wären sie einander ebenbürtig. »Vertrauen Sie mir denn, dass ich die Bücher wieder zurückbringe?«
»Sie sehen mir nicht wie ein Dieb aus. Ich brauche allerdings Ihren Namen und Ihre Adresse für den Bibliothekar, und vielleicht könnten Sie ein Papier unterschreiben, in dem Sie mich bitten, in Ihrem Namen Bücher auszuleihen. Warum kommen Sie nicht mit zu mir nach Hause und erledigen das, dann habe ich nächste Woche schon ein Buch für Sie hier.« Sie streckte ihm die Hand entgegen, wie es ein Mann getan hätte. »Ich bin Cassandra Blake.«
Er nahm ihre Hand und schüttelte sie. »Reece Gregory. Ich nehme an, Sie sind mit Edwin Blake verwandt?«
»Ja, das ist mein Vater.«
Das erklärte ihre offene Art. Jeder wusste, dass Blake seinen Töchtern beigebracht hatte, zu lesen und frei zu denken. Zu frei, behaupteten manche, aber Reece war der Meinung, dass die Gedanken frei sein sollten.
»Ich habe Ihren Vater bei einem Vortrag kennengelernt und seitdem ein- oder zweimal in der Bibliothek getroffen. Er ist ein interessanter Gesprächspartner.« Er sah, wie ihr Lächeln ihr schmales Gesicht erstrahlen ließ, dass es beinahe schön war.
»Er ist der allerbeste Vater. Er lässt mich die Welt mit anderen Augen sehen, so wie ich sie selbst niemals wahrgenommen hätte.«
»Wie kommen Sie zurecht?« Er brauchte nicht zu erklären, was er damit meinte. Das war heutzutage eine oft gestellte Frage.
Sie zuckte mit den Achseln. »Dad arbeitet immer noch weniger als früher. Meine Schwestern und ich gehen drei Tage die Woche in die Suppenküche.«
Im Hause der Familie Blake traf Reece auch Edwin wieder, und er war schockiert, wie sehr dieser in den letzten Monaten gealtert war. Sie verabredeten, dass er am nächsten Sonntag wieder herkommen würde, um das Buch abzuholen, das sie für ihn aussuchen würden. Dann ging er langsam zurück zur Farm, genoss den schönen, aber kühlen Tag und wünschte sich, er müsse nicht im Haus eines anderen Mannes leben und sich so benehmen, als wäre er wieder ein Junge. Vor diesem verdammten Krieg in Amerika war er ein Mann gewesen, der seine Angelegenheiten im Griff gehabt hatte.
Mehrmals in dieser Woche dachte er an Cassandra Blake. Sie war eine seltsame junge Frau, ganz anders als alle, die er jemals kennengelernt hatte. Sie äußerte ihre Meinung so freimütig wie ein Mann – und ihre Meinung war vernünftiger als die der meisten Männer, die er kannte. Sie war nicht unbedingt schön, aber ihre Augen funkelten klug, wenn sie sprach. Er wollte mehr Zeit mit ihr verbringen.
Er versuchte, solche Gedanken nicht zuzulassen. Ein Mann ohne Erwerbsmöglichkeiten hatte kein Recht, sich zu einer jungen Frau hingezogen zu fühlen.
Im Januar 1862 richtete die Stadt Wigan ein Hilfskomitee ein, das sich mit den Folgen der Baumwollknappheit beschäftigen sollte, die erste Stadt in Lancashire, die dies ernsthaft tat.
Es dauerte noch bis Ende März, bis die Armenfürsorge in Outham auf die Idee kam, dasselbe zu tun, und selbst dann wurde erst wochenlang darüber diskutiert, bevor tatsächlich etwas unternommen wurde. Sie hätten schon längst damit anfangen sollen, dachte Cassandra verärgert, anstatt hier und da kleine Hilfsleistungen an Einzelpersonen zu verteilen und diejenigen zu vergessen, die zu stolz waren, um um Hilfe zu bitten. Die beiden bestehenden Suppenküchen, die eine in der Pfarrkirche, die andere in der römisch-katholischen Kirche, waren nicht annähernd ausreichend. Niemand konnte mit ein paar Tellern dünner Suppe pro Woche stark und gesund bleiben.
Von nun an sollte jeden Tag Essen zur Verfügung gestellt werden, und eine Sammlung von Kinder- und Babybekleidung wurde organisiert, denn auch in Zeiten wie diesen kam immer wieder neues Leben in die Welt. Mehr Männer sollten zur Arbeit in den Steinbruch geschickt werden, und die Arbeit besser organisiert werden – was auch dringend nötig war. Der Verantwortliche war Küster in der Pfarrkirche und verstand nichts von der Aufgabe. Der neue Vorarbeiter war erfahrener – und auch freundlicher, munkelte man.
Für die Frauen und Mädchen sollten Nähkurse organisiert werden, und wer daran teilnahm, sollte dafür bezahlt werden. Cassandra und ihre Schwestern warteten ungeduldig darauf, dass es losging. Was glaubten die, was die Leute in der Zwischenzeit tun würden? Ihre Besitztümer verkaufen, dachte sie wütend. Manche Leute besaßen nur noch die Kleider, die sie am Leib trugen.
Sie war froh, dass sie nie geheiratet hatte, denn obwohl es ihr wehtat zu sehen, wie unglücklich ihre Schwestern waren, wie viel schlimmer musste es erst sein, die Kinder leiden zu sehen, die man selbst geboren hatte? Oder sie sogar sterben zu sehen? Die Zahl der Armenbegräbnisse nahm stetig zu, und die winzigen Särge trieben ihr stets Tränen in die Augen. Der kleine Nachbarsjunge Timmy war dünner als je zuvor, aber sie hatte nichts übrig, das sie ihm hätte abgeben können.
Seufzend schob sie ein wenig mehr Essen auf den Teller ihres Vaters, bevor sie das einfache Mahl servierte. Sie selbst begnügte sich mit dem, was übrig blieb, und verteilte es auf ihrem Teller, damit es nach mehr aussah. Aber als sie auf ihre Hand hinabblickte, war sie plötzlich erstaunt, wie dünn sie geworden war. Zwei karge Mahlzeiten am Tag reichten eben nicht aus. Sie warf ihren Schwestern einen verstohlenen Blick zu. Sie sahen genauso aus, waren viel dünner als früher, die Kleider hingen schlaff an ihnen herab, ihre Haut war blass und die Haare stumpf.
Wie lange sollte dieser Krieg noch dauern? Wussten die Menschen, die ihn ausfochten, wie stark Lancashire betroffen war? Wusste der Rest Englands davon?
Livia Southerham war immer froh, wenn sie aus dem Haus ihrer Schwiegereltern fliehen und mit ihrem frisch angetrauten Ehemann einen flotten Spaziergang durch das Moor machen konnte. Sie schritt neben Francis her, froh, dass der Tag mild war und sie nicht mit den anderen Frauen der Familie, die längst nicht so lebhaft waren wie sie, im Haus bleiben musste.
»Hast du heute Morgen schon mit deinem Vater gesprochen? Weißt du inzwischen, wie lange wir bei deinen Eltern bleiben werden?«, fragte sie, als sie eine Verschnaufpause auf den Hügeln einlegten, wo die Steinmauern endeten und das Farmland ins Moor überging.
Er legte ihr einen Arm um die Schultern und seufzte. »Es ist mir noch nicht gelungen, Vater zu überreden, uns für den Umzug nach Australien seinen Segen zu geben. Ich bitte ihn ja nicht um ein Vermögen, aber wir brauchen etwas Geld von ihm, um uns dort etwas aufzubauen. Er könnte es sich locker leisten, mir schon jetzt einen Teil meines Erbes auszuzahlen, anstatt es mir erst zu überlassen, wenn er stirbt.«
Sie erwiderte nicht, dass sein Vater vermutlich deshalb so zurückhaltend war, weil er schon früher erlebt hatte, wie die Begeisterung seines Sohnes für verschiedene Projekte rasch wieder nachließ. Aber Francis war begierig darauf auszuwandern, seit ihm sein Cousin von der Swan River Colony berichtet hatte, und er ging die ganze Sache sehr gezielt an. Nun, zumindest so gezielt, wie man es von einem so unbekümmerten Mann erwarten konnte.
»Ich glaube nicht, dass es einfach werden wird, ein Vermögen zu machen«, fuhr Francis fort. »Warum sollte es dort anders sein als hier? Aber Paul schreibt, für tatkräftige Männer gibt es dort ausgezeichnete Möglichkeiten, und solange wir ein anständiges Leben führen können, genügt mir das.«
»Mir auch. Ich dachte, dein Vater hätte seine Meinung geändert, so wie er gestern Abend beim Essen sprach.«
»Das dachte ich auch. Aber meine Mutter kann sich mit der Idee, dass ich England verlassen könnte, nicht anfreunden. Sie hat ihn angefleht, uns nicht zu unterstützen.«
»Sie wird dich vermissen.«
»Du meinst wohl, sie wird es vermissen, mich zu kontrollieren.«
Sie hörte die Bitterkeit in seiner Stimme und drückte ihm mitfühlend den Arm. Francis war ein kränkliches Kind gewesen und vielleicht ein wenig zu sehr verwöhnt worden. Er war zu Hause unterrichtet worden und hatte nie gelernt, zu arbeiten oder Geld zu verdienen. Aber er war der jüngste Sohn, und wenn seine Eltern starben, wäre es unwahrscheinlich, dass sein Bruder ihn finanzieren würde.
»Ich will lernen, wie man sich um Schafe und Kühe kümmert«, sagte er unvermittelt. »Ich werde so tun, als würde ich morgens reiten gehen, aber stattdessen werde ich auf einer Farm mithelfen. Neulich, als ich in den Hügeln spazieren ging, habe ich einen Mann namens Reece Gregory kennengelernt. Er arbeitet für seinen Vetter, einen Farmer, und er hat mir angeboten, für sie zu arbeiten, wenn ich will. Er würde mir sogar Kleidung leihen, damit Mutter keinen Verdacht schöpft, wie ich meine Tage verbringe.«
Na also. Das war sinnvoll, fand Livia. Erkannte sein Vater wirklich nicht, dass das hier keine vorübergehende Laune war? »Ich wünschte, ich käme auch aus dem Haus und hätte etwas, womit ich mich beschäftigen kann.«
»Warum bietest du nicht dem Hilfsprogramm für die Arbeitslosen deine Unterstützung an?«
Sie verzog das Gesicht. »Dann müsste ich mit diesem Pfarrer zusammenarbeiten. Ich mag weder Mr Saunders noch seine Helferinnen.«
Doch schließlich war sie so verzweifelt, aus dem überhitzten Haus und vor den Belanglosigkeiten ihrer Schwiegermutter zu fliehen, dass sie sich freiwillig beim Frauenausschuss meldete. Und natürlich nahmen sie ihr Angebot nur zu gern an, denn in der Regel mischte sich der Landadel nicht unter die Stadtbevölkerung.
Vielleicht konnte sie etwas Gutes tun, bis sie England verließen, so wie sie vor ihrer Heirat ihrem Vater bei seinen Pflichten in der Gemeinde geholfen hatte. Sie hoffte es.
Als Reece in der folgenden Woche wieder zum Haus der Blakes kam, fand er Edwin in Plauderlaune vor, und ein Buch über Australien wartete auf ihn: Unsere Antipoden von einem gewissen Mr Mundy.
»Das hat Cassandra ausgesucht. Sie sagte, Sie mögen Bücher über Reisen.«
»Das stimmt.« Reece schlug es auf und blickte gierig auf die Seiten, bis ihm aufging, wie unhöflich das war, und er es entschlossen wieder zuklappte. »Ist sie heute gar nicht da?«
»Sie ist mit ihren Schwestern spazieren gegangen. Aber sie werden bald zurück sein, um uns eine Tasse Tee zu kochen.«
Offenbar erwartete Edwin, dass Reece bleiben und mit ihm plaudern würde, und das tat er, denn er fand Edwins ironische Bemerkungen über die Welt unterhaltsam. Doch in Wirklichkeit wollte er nichts lieber, als Cassandra wiederzusehen, auch wenn sein Interesse an ihr im Augenblick völlig aussichtslos war.
Als die vier Schwestern zurückkamen, nahm er die Einladung zu einer Tasse Tee an, doch er aß nichts, weil er wusste, wie knapp das Essen bei vielen Leuten war. »Ich bekomme auf der Farm mehr zu essen als die meisten anderen hier, auch wenn mir meine Verwandten keinen hohen Lohn zahlen können.«
»Werden Sie dort bleiben?«, fragte Cassandra.
»Bis ich klarer sehe, wohin mein Weg mich führt. Mir ist klar geworden, dass ich nicht noch einmal in einer Baumwollfabrik arbeiten möchte. Mir tut es gut, an der frischen Luft zu sein, und es gefällt mir, für die Tiere zu sorgen. Mein Vetter Sam verarbeitet Holz, und er bringt mir alles bei, was er weiß. Ginny macht Käse, den sie auf dem Markt verkauft, und das ist auch interessant.«
Als er zurückging, das kostbare Buch zum Schutz unter seiner Jacke verborgen, war Reece so glücklich wie schon lange nicht mehr. Er hatte neue Freunde gefunden und … Ein Bild von Cassandra tauchte vor seinem inneren Auge auf, und er wusste, es war mehr als das. Er hatte eine intelligente Frau mit einem lebhaften Interesse an der Welt kennengelernt, die ihn in vielerlei Hinsicht anzog.
Bis bessere Zeiten kamen, konnten sie wenigstens Freunde sein, oder nicht?
Er dachte an das Buch. Er freute sich darauf, über Australien zu lesen und herauszufinden, warum Francis Southerham ohne Unterlass von diesem fernen Land sprach.
»Das ist ein anständiger junger Mann«, sagte Edwin, nachdem Reece gegangen war.
Seine Töchter sahen ihn misstrauisch an.
»Willst du uns etwa verkuppeln, Dad?«, fragte Xanthe.
Er zuckte mit den Achseln. »Es kann nichts schaden, einen Mann kennenzulernen. Wie wollt ihr sonst heiraten?«
»Ein Mann ohne richtige Beschäftigung kann sich keine Heirat leisten«, protestierte Pandora. »Und außerdem ist Reece zu alt für mich.«
»Und zu ernst für mich«, sagte Xanthe.
»Er ist überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Viel zu dunkel und nachdenklich.« Maia wandte sich neckend an Cassandra. »Also bleibst nur du übrig. Hast du Interesse an Reece, Liebes?«
Ihre Schwester errötete und überraschte damit nicht nur alle anderen, sondern vor allem sich selbst. Sie versuchte es zu überspielen und sagte laut: »Seid nicht albern!« Dann räumte sie die Teetassen ab, doch sie war sich der hochgezogenen Augenbrauen und der vielsagenden Blicke ihrer Familie nur allzu bewusst.
Zu ihrer Erleichterung sagten sie nichts weiter über Reece Gregory. Sie selbst auch nicht.
Aber als sie in dieser Nacht im Bett lag, musste sie sich eingestehen, dass er … interessanter war als andere Männer. Sie hatte die Unterhaltung mit ihm wirklich genossen, fühlte sich auch wohl, wenn sie neben ihm ging, denn im Gegensatz zu den meisten Männern war er größer als sie. Und was hatte Maia mit »zu dunkel« gemeint? Sie liebte seine dunklen Haare und seine dunkelbraunen Augen. Er war wirklich sehr gut aussehend, kein hübscher Junge, sondern ein erwachsener Mann.
Im Juni 1862 hatten die Blakes nur noch wenig Geld in ihrer Sparbüchse.
»Dad, du darfst den anderen nichts mehr geben«, warnte Cassandra. »Nicht einen Penny. Wir brauchen alles, was du nach Hause bringst, für uns selbst.«
»Ich kann es nicht mit ansehen, wenn ein Baby verhungert.«
»Kannst du stattdessen mit ansehen, wenn wir verhungern?«
Der Schmerz auf seinem Gesicht tat ihr weh, aber er musste den Tatsachen ins Auge sehen. Ohne seine Freigiebigkeit hätten ihre Ersparnisse viel länger gereicht.
Als bekannt gegeben wurde, dass endlich die Nähstunden für die Frauen, die wegen des Baumwollmangels keine Arbeit mehr hatten, beginnen sollten, war es für die Schwestern wie ein Geschenk des Himmels. Es hieß, sie würden sechs Pennys pro Person erhalten, wenn sie vier Stunden lang teilnehmen und hart arbeiten würden.
»Andere Hilfskomitees bezahlen neun Pennys«, meckerte Pandora. »Zumindest bekommt Marys Cousine so viel, dort wo sie wohnt.«
»Wir müssen dankbar sein für alles, was wir verdienen können«, sagte Maia, wie immer die Schlichterin.
»Ich verstehe nicht, warum sie uns nicht anständiger behandeln können.« Xanthe ärgerte sich am meisten von ihnen über ihre derzeitige Lage, im Gegensatz zu ihrer sanftmütigen Zwillingsschwester, und beklagte sich über den Mangel an sinnvollen Tätigkeiten. Sie freute sich nicht auf den Unterricht, wusste, dass sie wegen ihrer schlechten Nähkünste vorgeführt werden würde. Genau wie ihre Schwestern las sie lieber, anstatt zu nähen oder zu kochen. Ihre Mutter hatte Cassandra die Grundlagen der Handarbeit beigebracht, doch nach der Geburt der Zwillinge war sie gesundheitlich angeschlagen und nicht mehr in der Lage gewesen, sich mit ihren anderen Töchtern die gleiche Mühe zu machen.
Nach dem Tod ihrer Mutter war Cassandra zu Hause geblieben, um den Haushalt zu führen, und nachdem die drei jüngeren Schwestern angefangen hatten zu arbeiten, war nach den langen Stunden in der Baumwollfabrik nicht mehr viel Zeit zum Nähen geblieben. Abgesehen davon waren sie mit fünf arbeitenden Erwachsenen als Familie relativ gut gestellt gewesen und hatten genug Geld gehabt, um andere dafür zu bezahlen, ihre Kleidung zu nähen oder zu ändern.
»Nun, zumindest darf ich hin und wieder schrubben«, sagte Maia. »Ich weiß nicht, ob Mrs Matterley aus der Kirche mich wirklich braucht oder ob sie uns bloß helfen will, aber ich sorge dafür, dass sie auch etwas für ihr Geld bekommt. Sie hat gesagt, sie will mich ihren Freundinnen empfehlen, damit ich ihnen an den Waschtagen helfen kann. Nur dann und wann einen Tag, aber jedes bisschen hilft. Obwohl ich nicht gerne wasche. Es macht meine Hände so rot und wund.«
»Ich würde jederzeit mit dir tauschen«, seufzte Xanthe. Mrs Matterley war sehr freundlich zu ihrer Schwester. Maia bekam dort nicht nur eine herzhafte Mahlzeit, sondern für ihren langen Arbeitstag sogar einen ganzen Schilling.
Sie half Cassandra, das schmutzige Geschirr wegzuräumen, und löschte das Feuer im Ofen, um Kohle zu sparen. Es war merkwürdig, dass sie die meiste Zeit über keinen Hunger hatte, oder falls sie hungrig war, bemerkte sie es nicht. Man gewöhnte sich einfach an das leere Gefühl und daran, viel weniger Energie zu haben als sonst. Aber es gab ja auch nicht so viel zu tun, und solange sie wenigstens einmal am Tag etwas zu essen bekäme, würde sie schon zurechtkommen.
Zu ihrem Entsetzen stellte Cassandra fest, dass ihre Tante die Nähstunde leitete. Abgesehen von empört aufgerissenen Augen ließ sich Isabel Blake nicht anmerken, dass sie ihre Nichten erkannt hatte.
Sie sollten grobe Schürzen für das Waisenhaus nähen, und der Stoff, mit dem sie arbeiteten, fühlte sich unangenehm rau an und weigerte sich, ordentlich zu liegen. Den Anfängern wurde beigebracht, wie man gerade Säume nähte, anschließend wurden sie mit dieser einfachen Aufgabe betraut. Diejenigen mit mehr Erfahrung sollten die einzelnen Stoffstücke aneinanderheften und sie zusammennähen, sobald man ihre Arbeit für gut befunden hatte.
Ihre Tante wanderte im Raum herum und beobachtete die Mädchen bei der Arbeit. Doch immer wieder kehrte sie zu ihren Nichten zurück, kritisierte ihre Arbeit und ließ sie das, was sie schon mehrmals zusammengenäht hatten, wieder auftrennen. Irgendwann schaute die andere Dame, die sie beim Unterrichten unterstützte, sie verwundert an. Isabel warf ihren Nichten einen verächtlichen Blick zu und ging dann zu ihrer Kollegin, um ihr etwas zuzuflüstern.
Danach hackte auch die andere Dame auf ihnen herum, und Cassandra fragte sich, was ihre Tante wohl über sie erzählt haben mochte. In diesem Tempo kamen sie nicht weiter, sondern arbeiteten immer wieder an den gleichen Nähten, trennten sie erneut auf und fingen dann wieder mit demselben zerknitterten Stück Stoff an.
Nach der Nähstunde kam ein Mädchen, das sie aus der Kirche kannten, zu ihnen. »Ich habe gehört, was diese alte Hexe über euch gesagt hat.«
Sie blieben stehen.
»Was hat sie gesagt?«, fragte Cassandra.
»Sie sagte, ihr wärt alle bekanntermaßen lasterhaft und solltet nicht mit anständigen Mädchen zusammen unterrichtet werden.«
Vor Schreck keuchten sie auf. »Bist du dir sicher?«, fragte Pandora.
Das Mädchen lächelte bitter. »Ganz sicher. Ich habe Lippenlesen gelernt, wegen der lauten Maschinen in der Fabrik. Warum erzählt sie solche Lügen über euch? Sie ist doch eure Tante, nicht wahr?«
Nachdem die andere weitergegangen war, wandte sich Cassandra an ihre Schwestern. »Ihr zwei geht nach Hause. Ich muss noch etwas erledigen.«
»Was denn erledigen?«, fragte Xanthe. »Wir haben kein Geld, um heute noch etwas anderes zu kaufen als Brot.«
»Ich muss mit jemandem sprechen.«
»Hat es etwas mit dem zu tun, was unsere Tante gesagt hat?« Pandora hielt ihre Schwester am Arm fest, um sie am Weggehen zu hindern. »So ist es doch, oder?«
Cassandra zuckte mit den Achseln.
»Du kannst nichts dagegen tun, und es spielt wirklich keine Rolle. Wir kennen die Wahrheit und unsere Freunde auch.«