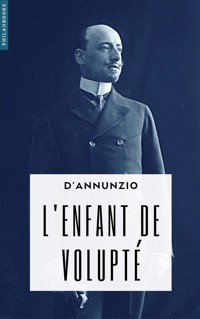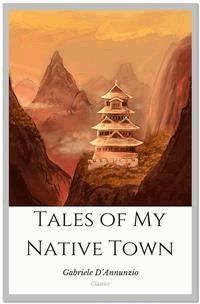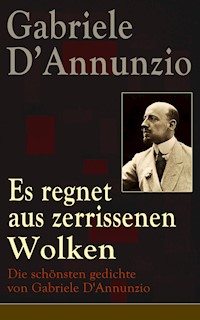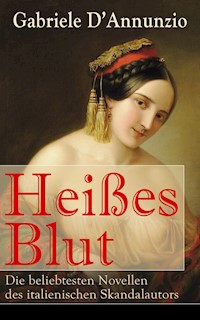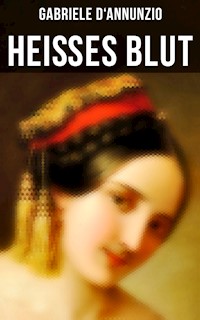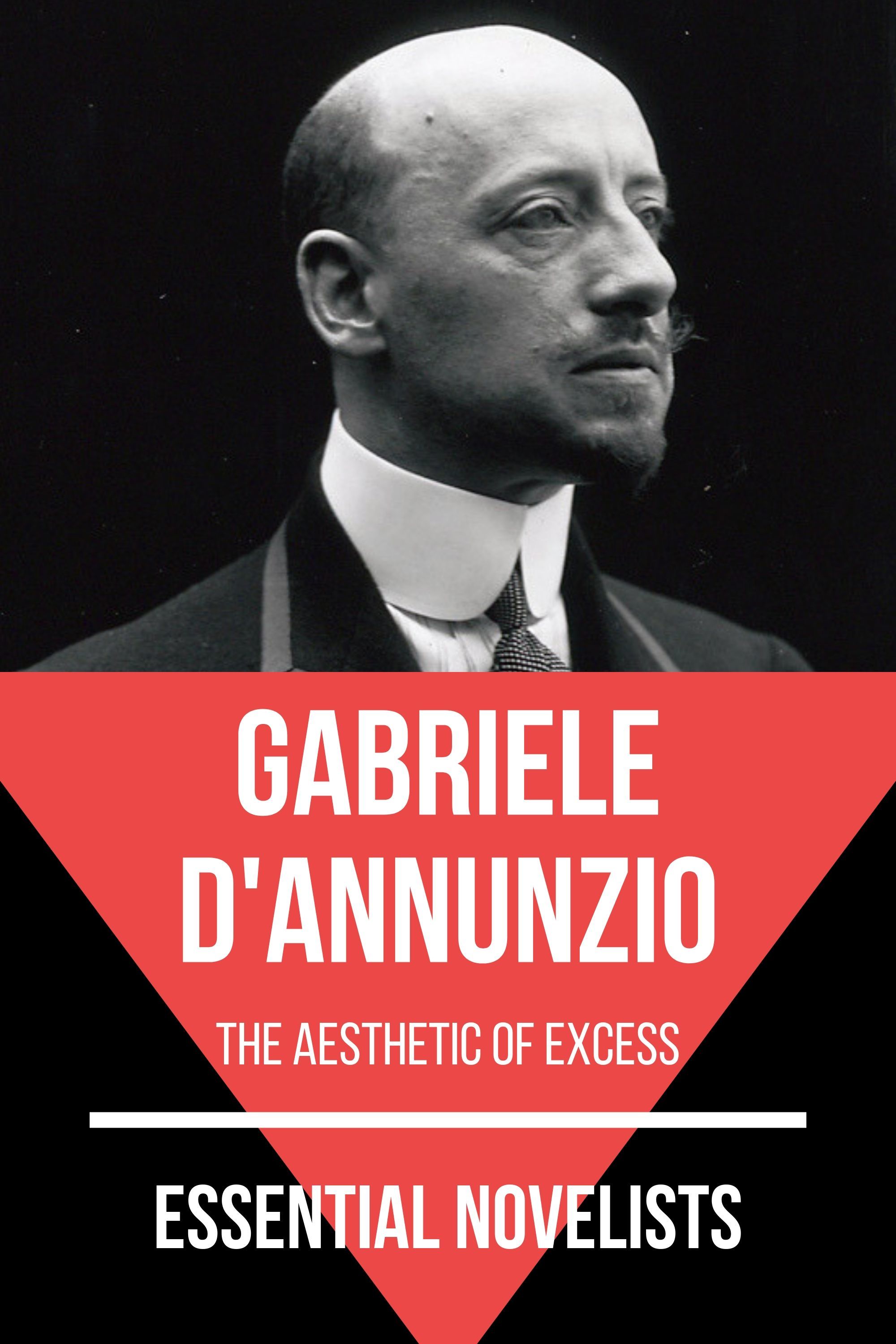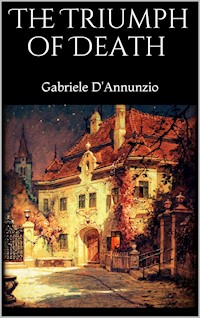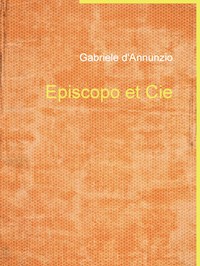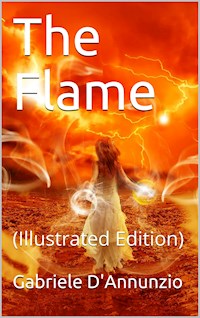0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Die bekanntesten Werke von Gabriele D'Annunzio" präsentiert der Autor eine sorgfältige Auswahl der bedeutendsten literarischen Schöpfungen des italienischen Schriftstellers, Dichters und Dramatikers. D'Annunzio, ein Vertreter des Decadentismus, verbindet in seinem literarischen Stil leidenschaftliche Sprache mit einer tiefen Ästhetik, die oft von Themen wie dem Leben, der Liebe und der Vergänglichkeit geprägt ist. Der Text bietet nicht nur Einblicke in D'Annunzios innovative Erzählweise, sondern beleuchtet auch den übergreifenden Einfluss seiner Werke auf die italienische Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, ein Zeitraum, der von politischen Umwälzungen und künstlerischen Neuorientierungen geprägt ist. Gabriele D'Annunzio (1863-1938) war nicht nur ein herausragender Schriftsteller, sondern auch eine schillernde Persönlichkeit der italienischen Geschichte. Sein Leben war durch eine Verbindung von Kunst und politischem Aktivismus gekennzeichnet; er war ein überzeugter Nationalist, der im Ersten Weltkrieg eine zentrale Rolle spielte. Diese komplexe Mischung aus künstlerischer Schaffenskraft und politischer Ideologie spiegelt sich in seinen Werken wider und bietet einen faszinierenden Kontext für das Verständnis seiner literarischen Beiträge. Dieses Buch ist eine essenzielle Lektüre für jeden Literaturinteressierten, da es nicht nur die künstlerische Genialität D'Annunzios würdigt, sondern auch seine Fähigkeit zeigt, die menschliche Erfahrung in all ihren Facetten zu hinterfragen. Leser werden eingeladen, in die vielschichtigen Themen und Protagonisten einzutauchen, die D'Annunzios Werke prägen und die zeitgenössische Relevanz seiner Schriften beleuchten. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die bekanntesten Werke von Gabriele D'Annunzio
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Kuratorische Vision
Diese Sammlung vereint zentrale Texte von Gabriele D’Annunzio mit markanten zeitgenössischen Stimmen, die seine Figur reflektieren: Hugo von Hofmannsthal, Carl von Ossietzky und Hanns Heinz Ewers. Ausgewählt wurden Werke, in denen Leidenschaft, Ruhm, Erinnerung, Natur und Konflikt ein Spannungsfeld bilden, das die Selbstinszenierung des Künstlers sichtbar macht. Leitmotivisch steht die Frage nach dem Verhältnis von Schönheit und Macht, von Rausch und Verantwortung. Kuratorisches Ziel ist, einen Bogen von lyrischer Verführung bis zur kritischen Gegenrede zu spannen. So entsteht ein Panorama, das die bekannte Strahlkraft nuanciert und ihr eine vielstimmige, dialogische Tiefenschärfe gegenüberstellt.
Die ausgewählten Titel wie Feuer, An die Lorbeeren, Der Held oder Der Regen im Pinienhain umkreisen den Aufstieg des Ruhmes ebenso wie seine Grenzen. Ihnen zur Seite stehen Texte, die Verlust, Täuschung und Trost verhandeln, etwa Der Betrug, Trost, Ein traum und Eine Erinnerung. Zusammengenommen zeichnet sich ein Pfad von der glühenden Behauptung des Ichs bis zur stillen Prüfung des Gewissens. Der Schwerpunkt liegt auf dem inneren Umschlag: vom ekstatischen Ton zur kontemplativen Geste, vom Bild des Siegers zur Figur des Zweifelnden, von öffentlichem Mythos zu persönlicher Empfindung. So entsteht Beweglichkeit statt Starrheit.
Im Unterschied zu früheren Einzelveröffentlichungen steht hier nicht die isolierte Wirkung eines Textes im Zentrum, sondern seine Resonanz im Nebeneinander mit Stimmen über D’Annunzio. Hofmannsthal, Ewers und Ossietzky rahmen die poetischen und erzählerischen Stücke, indem sie Perspektiven auf Persönlichkeit, Mythos und öffentliche Wahrnehmung eröffnen. Diese Konstellation verschiebt die Blickachse: Pointierte Selbstaussagen wie An die Lorbeeren und Der Held treten in Beziehung zu skeptischen Gegenakzenten und erzielten Facetten von Betrug, Trost und Erinnerung. Der Gewinn liegt in einer Lektüre, die Strahlkraft und Schatten zugleich sichtbar macht. So entsteht eine konzentrierte, zugleich widerständige Gesamtschau.
Das leitende Motiv ist die Gestaltung des Selbst an der Schnittstelle von Kunst, Ethos und Öffentlichkeit. Feuer und Regen, Lorbeeren und Betrug, Heldentum und Trost markieren Pole einer poetischen Anthropologie. Die Sammlung verbindet lyrische Verdichtung, erzählerische Szene und essayistische Profilierung, ohne den Primat der jeweiligen Form zu dominieren; der Fokus liegt auf der wechselseitigen Erhellung. Ziel ist eine Lesebewegung, die das Schöne nicht gegen das Wahre ausspielt, sondern in produktive Spannung versetzt. Daraus erwächst ein offener Resonanzraum, in dem die Texte einander prüfen, spiegeln, steigern und widerlegen. So klärt sich Wirkung zu Verantwortung.
Thematisches und ästhetisches Zusammenspiel
Die Texte treten in ein lebendiges Wechselgespräch, in dem Motive wandern und sich verwandeln. Der Regen im Pinienhain entfaltet eine sensuelle Naturpoetik, deren Klang in Ein traum und Eine Erinnerung nachhallt, während Feuer den Impuls der Entgrenzung markiert. Candias Ende und Der Brückenkrieg skizzieren Schwellen, Übergänge und Konflikte, die sich in inneren Landschaften spiegeln. San Pantaleone verleiht dem Motiv des Schutzes eine kontemplative Fassung. Sancho Panzas Tod fügt eine Reflexionsfigur hinzu, die heroische Pose und nüchternes Maß gegeneinander abwägt, ohne die Spannung aufzuheben. So werden Tonlagen hörbar, die vom Hymnischen bis zum prüfenden Innehalten reichen.
Durchlaufende Motive geben Orientierung: Feuer und Wasser, Regen und Licht, Brücken und Wege, Lorbeeren und Masken. Sie bündeln Fragen nach Ruhm und Vergänglichkeit, nach Loyalität und Täuschung, nach Schutz und Preisgabe. Der Betrug und Trost spiegeln zwei Seiten derselben Sehnsucht; Eine Erinnerung und Ein traum verknüpfen Gedächtnis und Möglichkeit. In Der Held verdichten sich Ansprüche des öffentlichen Bildes, während An die Lorbeeren die Semantik des Erfolgs prüft. Im Zusammenspiel gewinnen diese Symbole Bewegungsenergie, die nicht auf Eindeutigkeit zielt, sondern Ambivalenz als Erkenntnismodell akzeptiert. Daraus erwächst eine Poetologie des Übergangs und der inneren Prüfung.
Kontraste treiben den inneren Austausch voran. An die Lorbeeren artikuliert die Verheißung öffentlicher Anerkennung, während Trost den Blick auf Verletzbarkeit richtet. Der Held spricht in großen Gesten, Der Betrug hält dagegen mit entzauberndem Ton. Der Brückenkrieg evoziert Härte und Entscheidung, deren Wirkung Der Regen im Pinienhain mit einem gegenläufigen, aufmerksamen Hören der Welt kontert. Diese Gegensätze erzeugen Reibung, die produktiv bleibt, weil sie Maß und Überschreitung, Pathos und Lakonie, Nähe und Distanz nicht trennt, sondern ineinander verschränkt und auf Verständigung hin öffnet. So entsteht eine dialogische Spannung, die den Blick schärft.
Die drei Autoren, die D’Annunzio porträtieren oder beurteilen, treten mit den literarischen Stücken in ein erkennbares Verhältnis. Hofmannsthals Gabriele d’Annunzio entwirft eine konturierte Gestalt, die sich mit Aussagen aus Der Held und An die Lorbeeren kreuzt. Hanns Heinz Ewers’ Gabriele D’Annunzio betont die Faszination, deren Unterstrom in Feuer und Ein traum wiederzuerkennen ist. Carl von Ossietzkys D’Annunzio stiftet ein Denkmal und Der Fall D’Annunzio: Das Ende einer Komödie setzen gezielte Gegenakzente, die Pathos, Geltung und Mythos prüfen und so das Gesamtbild kritisch balancieren. Gemeinsam entsteht eine nachvollziehbare Topographie der Wirkung.
Langfristige Wirkung und kritische Rezeption
Die Sammlung bleibt aktuell, weil sie die Spannweite zwischen künstlerischem Charisma und ethischer Verantwortung freilegt. Der Regen im Pinienhain sensibilisiert für eine Wahrnehmung, die Schönheit als Beziehung erfahrbar macht; Trost und Der Betrug markieren die Kante zwischen Selbstschutz und Ernüchterung. Eine Erinnerung und Ein traum halten die Verbindung von Gedächtnis und Möglichkeit offen. Der Held und An die Lorbeeren fragen nach der Legitimität von Glanz. In dieser Konstellation spiegeln sich Debatten um Selbstbild, Öffentlichkeit und Gewissen, die über Zeiten hinweg tragfähig und prüfbar geblieben sind. Gerade diese Balance trägt zur heutigen Lesbarkeit bei.
Die kritische Rezeption verläuft vielstimmig und prägt das Verständnis der Texte bis heute. Innerhalb der hier versammelten Stimmen markieren Hofmannsthals Gabriele d’Annunzio, Hanns Heinz Ewers’ Gabriele D’Annunzio sowie die beiden Beiträge von Carl von Ossietzky erkennbare Zäsuren: von emphatischer Profilierung über Faszinationsanalyse bis zur scharfen Prüfung öffentlicher Pose. Diese Wegmarken sind weithin bekannt und haben die Lektüre der Werke gelenkt, indem sie Resonanzräume benannten, Einordnungen ausprobierten und Widerspruch formulierten. In dieser Dialektik gewinnt das literarische Œuvre Kontur, ohne auf ein einziges Urteil reduziert zu werden. Gerade im Nebeneinander entfaltet sich ihre Aussagekraft.
Auf kultureller Ebene wirken die hier verhandelten Fragen weiter: Die Verschränkung von Ästhetik, Ruhm und Gewissen hat künstlerische Antworten provoziert und wissenschaftliche Deutungen herausgefordert. Ossietzkys Texte befeuern Debatten um Ethos und öffentliche Symbolpolitik, Hofmannsthal und Ewers zeigen die Kraft der Darstellung, die Bewunderung und Analyse zugleich sein kann. In Bezugnahmen, Spiegelungen und Gegenlesungen setzt sich das Ringen um Maß, Pose und Verantwortung fort. Diese Nachwirkungen sind weniger eine Linie als ein Feld, in dem die Motive der Sammlung immer wieder neu konfiguriert werden. Dadurch bleibt der Diskurs lebendig und überprüfbar.
Im Ergebnis lädt die Sammlung zu einer Haltung der aufmerksamen Unterscheidung ein. Sie fordert dazu auf, D’Annunzios kraftvolle Sprachbilder gemeinsam mit kritischer Selbstprüfung zu lesen und den Wechsel zwischen Selbstbehauptung und Skepsis ernst zu nehmen. Der Zusammenschluss unterschiedlich ausgerichteter Texte macht erkennbar, wie poetische Form, öffentlicher Auftritt und moralische Frage einander bedingen. Diese Struktur schärft die Wahrnehmung für Nuancen und eröffnet Wege zu vertiefter Lektüre, Lehre und Forschung. Indem das Gespräch offen gehalten wird, entsteht Zukunftsfähigkeit: Die Werke bleiben ansprechbar und auslegbar. So gewinnt das Ganze Maß und Beweglichkeit zugleich.
Historischer Kontext
Sozio-politische Landschaft
Die in dieser Anthologie versammelten Texte entstanden vor dem Hintergrund des späten italienischen Liberalismus, monarchischer Kontinuitäten und eskalierender nationalistischer Selbstvergewisserung. Zwischen Parlament und Patronage formierte sich eine Öffentlichkeit, in der Gabriele D’Annunzio als schillernder Akteur wahrgenommen wurde. Kriegsmetaphorik und Ehrenkult, wie sie in Der Brückenkrieg, Der Held und An die Lorbeeren resonieren, stehen in Dialog mit Kolonialprojekten und imperialer Selbstdarstellung. Die Begleitstimmen von Hugo von Hofmannsthal, Hanns Heinz Ewers sowie Carl von Ossietzky spiegeln zeitgenössische Debatten über Kunst, Politik und Verantwortung. Zensur blieb situativ, doch moralische Regulative und verlegerische Strategien kanalisierten die öffentliche Wirkung.
Klassenlagen prägten die Rezeption: Industrielle Aufbrüche im Norden standen ländlicher Armut gegenüber, während aristokratische Salons und großstädtische Bohèmen unterschiedliche Publikumserwartungen bildeten. San Pantaleone, Eine Erinnerung und Trost behalten den Blick für soziale Schichtung und feine Alltagsregulative, ohne programmatisch zu werden. Die Verbreitung verlief über Zeitungen, Bühnen und Übersetzungen; deutschsprachige Fassungen schufen eine zweite Öffentlichkeit, in der Hofmannsthal und Ewers D’Annunzios Profil vermittelten. Patronagebanden, Freundschaftsdienste und verlegerisches Kalkül bestimmten Erscheinungsorte, Auflagen und Tonlage. Zwischen Markt und Moral balancierten Herausgeber die Spannung von Sensation und Seriosität, was die Lektüreerwartungen nachhaltig konditionierte. Gleichzeitig verschoben Migration und Urbanisierung die sozialen Koordinaten des Publikums.
Geschlechterhierarchien strukturierten die Darstellung von Begehren, Ehe und Öffentlichkeit. In Der Regen im Pinienhain, Feuer und Der Betrug treten moderne Empfindungsweisen auf, die jedoch an patriarchale Normen und bürgerliche Sittlichkeitsdiskurse rückgebunden bleiben. Die rechtliche Lage zu Ehe, Scheidung und weiblicher Erwerbstätigkeit lieferte Reibungsflächen, an denen Figuren psychologisch ausagieren, während Leserinnen als Marktsegment zugleich umworben und moralisch adressiert wurden. Zensur erfolgte weniger durch Verbote als durch Gatekeeping der Presse und Theaterdirektionen. Diese Konstellation förderte symbolreiche, doppeldeutige Redeweisen, die erotische, religiöse und politische Register zugleich berührten. So entsteht Ambivalenz, die individuelle Freiheit behauptet und soziale Kontrolle spiegelt.
Die Ära war von Kriegen und Krisen durchzogen: das Vorfeld imperialer Konflikte, schließlich der Weltkrieg und seine sozialen Erschütterungen. Der Brückenkrieg lässt militärische Semantiken in urbane und existenzielle Zonen ausfransen; Sancho Panzas Tod und Candias Ende reflektieren Loyalität, Übermut und Bruchstellen einer Ordnung, die sich selbst feiert und zugleich erodiert. Ossietzkys Der Fall D’Annunzio: Das Ende einer Komödie reagiert auf die Politisierung des Ruhms und auf spektakuläre Machtdemonstrationen, deren Nachwirkungen europäische Debatten spalteten. Zwischen Veteranenkult und Ernüchterung entzündeten sich Fragen von Opfer, Verantwortung und öffentlicher Erinnerung. Krisenökonomien verstärkten zudem soziale Spaltungen und kulturelle Alarmbereitschaft.
Nationalistische Gesten verdichteten sich in Ritualen des Gedenkens und in der Aufladung von Kunst zu Staatsrepräsentation. An die Lorbeeren verhandelt Ruhm, Verdienst und die Verführung durch symbolische Kränze; Ossietzkys D’Annunzio stiftet ein Denkmal legt die Mechanik solcher Akte frei, von Geldflüssen über Presseorchestrierung bis zur ideologischen Rahmung. Die Politik der Übersetzung – italienische Stoffe im deutschen Sprachraum – fungierte als Kulturdiplomatie und Wettbewerbsfeld zugleich. Der Held spiegelt den Hang zur Heroisierung, während Der Betrug die Schattenseiten von Ruhmessucht andeutet. So entstehen Reibungen zwischen ästhetischer Autonomie und instrumenteller Vereinnahmung. Publika reagierten zugleich fasziniert und misstrauisch.
Die Veröffentlichungspfade wurden durch Netzwerke geadelt: private Kreise, Verleger, Bühnenleiter, Kritiker. Hofmannsthal situierte Gabriele d’Annunzio innerhalb eines mitteleuropäischen Kulturraums, wodurch dessen italienischer Glanz mit Habsburgischer Erfahrung verschaltet erschien. Ewers’ Gabriele D’Annunzio popularisierte das Sensationelle und erweiterte die Leserschaft, während Ossietzky die demokratische Prüfung schärfte. Koloniale Vorstellungswelten und mediterrane Stereotypen beeinflussten Wahrnehmungen von Differenz, oft unreflektiert. San Pantaleone und Eine Erinnerung registrieren Volksbräuche und soziale Grenzziehungen, die zugleich ethnische Markierungen transportieren konnten. Zwischen Markt, Moral und Macht formten diese Filter den öffentlichen D’Annunzio maßgeblich. Zugleich erschwerte Konkurrenz zwischen Zeitschriften die nachhaltige Kanonisierung einzelner Texte.
Intellektuelle und ästhetische Strömungen
Die Texte stehen im Zeichen fin-de-siècle-hafter Dekadenz, vitalistischer Überspannung und symbolistischer Verdichtung. Der Regen im Pinienhain und Ein traum entfalten eine Klang- und Bildsprache, die Naturerfahrung, Erotik und Transzendenz synästhetisch verschränkt. Feuer inszeniert gesteigerte Sensibilität als Risiko und Versprechen ästhetischer Selbstüberbietung. Hofmannsthal deutet D’Annunzios Gestus als künstlerische Souveränität, die zwischen Mythos und Moderne navigiert. In dieser ästhetischen Konstellation werden innere Zustände höher gewertet als dokumentarische Genauigkeit, wodurch die Grenze zwischen Bekenntnis und Pose bewusst oszilliert. Das Pathos dient als Labor für neue Emotionstechniken. So entsteht eine Poetik, die Intensität als Erkenntnismodus behauptet.
Im intellektuellen Feld prallten rationalistische, positivistische und religiös grundierte Deutungen auf kulturkritische Skepsis, sozialreformerische Impulse und dionysische Selbstbehauptung. Ewers’ Gabriele D’Annunzio betont theatralische, bisweilen okkult gefärbte Atmosphären und das Charisma des Autors als Medium einer gesteigerten Wahrnehmung. Ossietzky kontert mit nüchterner, demokratischer Prüfung von Machtgesten, Ruhmökonomien und politischer Symbolarbeit. Hofmannsthal vermittelt, indem er stilistische Erfindung und historische Situiertheit zusammendenkt. Diese Spannungen prägen die Lektüre der Erzählungen und Gedichte ebenso wie die Bewertung öffentlicher Auftritte: zwischen ästhetischer Ausnahmebehauptung und bürgerlicher Verantwortungsforderung. So entsteht ein diskursives Dreieck, das Begeisterung, Skepsis und Vermittlung produktiv verschränkt.
Parallelentwicklungen in anderen Künsten und Technologien erweiterten die Horizonte: experimentelle Bühnenformen, gestenreiche Bildprogramme, neue Druck- und Beleuchtungstechniken. Elektrizität, Fotografie und Massenpresse veränderten Wahrnehmungsrhythmen, erzeugten Celebrity-Ökonomien und beschleunigten Skandalisierungslogiken. In Der Held und An die Lorbeeren strukturieren Metaphern von Geschwindigkeit, Maschinenkraft und Körpertraining die Semantik des Erfolgs. Der Brückenkrieg modelliert Infrastruktur als Schauplatz innerer und sozialer Spannungen. Diese tektonischen Verschiebungen rücken die Figur des Autors vom einsamen Genie zur medial verwalteten Erscheinung, deren Aura durch Reproduzierbarkeit zugleich vergrößert und gefährdet wird. Eben darin liegt die Modernität der Pose, aber auch ihr Risiko.
Die Sammlung kartiert ein Spannungsfeld zwischen psychologischem Realismus, impressionistischer Wahrnehmungsnähe und symbolistischer Überhöhung. Der Betrug und Eine Erinnerung insistieren auf innerer Motivierung und situativer Feinzeichnung; San Pantaleone verbindet ethnografische Beobachtung mit bildlicher Stilisierung. Der Regen im Pinienhain perfektioniert musikalische Perioden und Naturfarben als Träger unaussprechlicher Affekte. Candias Ende und Sancho Panzas Tod loten intertextuelle und parabolische Verfahren aus, die Tradition reaktivieren, ohne bloß epigonal zu wirken. Diese Vielstimmigkeit schärft das Profil eines Autors, der Schulen absorbiert, gegeneinander spiegelt und in persönlicher Diktion neu verschaltet. So entsteht ein bewegliches Arsenal, das Konvention und Innovation balanciert.
Manifesthafte Rivalitäten bestimmten den Ton der Zeit: technikverliebte Beschleunigungstendenzen standen humanistischen, klassizistischen und katholisch grundierten Selbstentwürfen gegenüber. In den Texten der Sammlung erscheinen diese Konflikte als Stilwechsel, Metaphernkampf und rhetorische Temperatursprünge. Ossietzky diagnostiziert die Gefahr, wenn ästhetische Exzesse zur politischen Pose verhärten; Hofmannsthal registriert zugleich die unverwechselbare Formkraft. Der Held, An die Lorbeeren und Der Brückenkrieg verdichten den Kult des Neuen, während Trost, Eine Erinnerung und Ein traum Gegenakzente kontemplativer Verlangsamung setzen. So entsteht ein polarisierter Möglichkeitsraum, in dem Kunst zwischen Kult und Kritik oszilliert. Ewers verstärkt die Attraktion, Ossietzky die Kontrolle des Blicks.
Naturwissenschaftliche Weltdeutungen, Evolutionstheorien und urbane Soziologien verschoben das Menschenbild hin zu Kontingenz und Anpassung. Zugleich stimulierten Telegrafie, Eisenbahnen und die Energie von Märkten neuartige Rhythmen des Erzählens. Sancho Panzas Tod aktiviert literarische Erinnerung als Prüfstand für Moderne: Tradition wird weder museal eingefroren noch bedenkenlos überfahren. Candias Ende stellt Fortschrittsversprechen unter ironische Beobachtung, während Trost die Innenwelt gegen äußere Beschleunigung behauptet. Diese Konstellation macht den Kanon durchlässig: nicht als starre Schule, sondern als Feld dynamischer Transfers, in dem Stil, Technik und Ideologie miteinander ringen. Damit verbinden sich Ästhetik, Wissenschaft und Alltag zu beweglicher Erfahrungspolitik.
Vermächtnis und Neubewertung im Lauf der Zeit
Nach den Erschütterungen des 20. Jahrhunderts verschob sich die Bedeutung vieler Motive. Militärische Emphase in Der Held oder Der Brückenkrieg wurde im Lichte realer Vernichtung neu gelesen: als riskante Ästhetisierung oder als Symptom einer Epoche, die Gewalt ästhetisch sublimierte. Ossietzkys Der Fall D’Annunzio: Das Ende einer Komödie erhielt retrospektiv den Rang eines Prüfsteins, weil es Ruhmstrategien an politische Folgen rückbindet. Zugleich behielten Der Regen im Pinienhain und Ein traum die Geltung eines sensiblen Natur- und Klangarchivs, das jenseits politischer Tageslagen Resonanz entfaltet, ohne unhistorisch zu werden. Diese Doppelbewegung strukturierte Unterricht, Kritik und Editionen langfristig.
Nach 1945 konkurrierten zwei Lektüremodelle: das eine trennte strenger zwischen Kunstwerk und politischer Biografie, das andere las ästhetische Formen als Index gesellschaftlicher Macht. Hofmannsthal blieb wichtig, weil sein Porträt D’Annunzios ästhetische Autonomie nicht ohne historische Einfassung begreift. Ewers’ akzentuierte Darstellung des Spektakulären wurde ambivalenter rezipiert, da sie den Kultwert betont, den spätere Leserinnen und Leser skeptisch beurteilten. So bildete sich ein diskursiver Korridor, innerhalb dessen poetische Virtuosität anerkannt, aber mit erinnerungspolitischer Wachsamkeit flankiert wurde. Editorische Sorgfalt und genaue Datierungen gewannen an Gewicht. Diese Balance prägte Vorworte, Lehrpläne und Ausstellungstexte der Nachkriegszeit.
Adaptionen in Rundfunk, Lesung und Bühne hielten Motive präsent, oft als Ausschnitte, die die musikalische Prosa betonten und politisch brisante Kontexte rahmten. Der Regen im Pinienhain wurde zu einem bevorzugten Reservoir für Stimmenkunst, während An die Lorbeeren und Der Held in Ausstellungen zur Kulturgeschichte des Ruhms verhandelt wurden. Wissenschaftliche Editionen und zuverlässige Übersetzungen schufen stabile Bezugstexte; mit dem Auslaufen von Schutzfristen verbreiteten digitale Archive Quellmaterial, das Vergleichsstudien erleichtert. Diese Infrastruktur begünstigte eine nüchternere Neubewertung jenseits polarisierender Lager. Auch Hörbild-Formate zu Hofmannsthal, Ewers und Ossietzky schärften Kontextwissen. Archive erleichterten Quervergleiche zwischen Essays und Dichtung.
Aktuelle Forschung liest Naturdarstellungen vermehrt ökokritisch: Der Regen im Pinienhain, San Pantaleone und Eine Erinnerung werden als sensible Chroniken von Landschaft, Klang und Brauch untersucht, die ökologische Wahrnehmungsweisen historisieren. Gender Studies nehmen Feuer und Der Betrug in den Blick, um Begehrenssemantiken, Machtgefälle und bürgerliche Moralarrangements sichtbar zu machen. Intermedialitätsforschung analysiert, wie mediale Inszenierungen in den Essays von Hofmannsthal, Ewers und Ossietzky die Rezeption strukturierten. So verlagert sich der Akzent von Einzelgenie zu Netzwerken, Praktiken und Materialitäten. Damit öffnen sich produktive Brücken zwischen Poetik, Politik und Umweltgeschichte. Archivfunde treiben Detailstudien zu Bühnenfassungen und Übersetzungsvarianten voran.
Im Zuge postkolonialer und erinnerungskultureller Debatten werden Heroisierungen und Monumentpolitiken neu akzentuiert. An die Lorbeeren und Der Held dienen als Fallbeispiele für Rhetoriken des Ruhms, deren politische Anschlussfähigkeit geprüft wird. Ossietzkys D’Annunzio stiftet ein Denkmal und Der Fall D’Annunzio: Das Ende einer Komödie bleiben dafür unverzichtbar, weil sie die operative Vernetzung von Geld, Presse und Symbolen sichtbar machen. Zugleich rückt die Übersetzungspolitik in den Fokus: deutschsprachige Fassungen schufen Interpretationsfilter, die heute transparent gemacht werden, um die historischen Vermittlungen, ihren Nutzen und ihre blinden Flecken mitzulesen. So wird transnationale Literaturgeschichte als Kritik der Vermittlung lesbar.
Synopsis (Auswahl)
Feuer
Ein venezianischer Künstlerroman über den Dichter Stelio Effrena und die Schauspielerin La Foscarina, der die magnetische Anziehung von Kunst und Liebe in einem von Ehrgeiz und Selbststilisierung geprägten Milieu verfolgt. Im Zentrum stehen die Spannungen zwischen ästhetischem Anspruch, persönlicher Leidenschaft und öffentlicher Wirkung.
Der Regen im Pinienhain
Ein sinnenreiches Naturgedicht, in dem Stimmen, Düfte und Klänge von Wald und Regen mit Liebesempfindungen verschmelzen. Die Sprache imitiert den Rhythmus des Regens und entfaltet eine pantheistische Einheit von Mensch und Landschaft.
Erzählungen (Sancho Panzas Tod; Candias Ende; Der Held; Der Brückenkrieg; San Pantaleone)
Kurzprosa, die vom psychologischen Kammerspiel bis zur schicksalhaften Dorfchronik reicht: Ehre, Verrat, Kriegserfahrung und Heiligen- bzw. Heldenbilder bündeln sich in prägnanten Wendepunkten. Häufig führen ein moralisches Dilemma oder eine symbolisch aufgeladene Entscheidung zu einer leisen, aber folgenreichen Verschiebung des Lebenswegs der Figuren.
Kurzprosa und lyrische Miniaturen (An die Lorbeeren; Trost; Der Betrug; Eine Erinnerung; Ein Traum)
Knappe Szenen und Gedankengedichte über Ehrgeiz, Trostsuche, Täuschung und Erinnerung, die Atmosphäre und Symbolik über ausgreifende Handlung stellen. Sie verdichten innere Bewegungen zu Momentbildern zwischen Sehnsucht und Ernüchterung.
Zeitgenössische Essays und Porträts über D’Annunzio (Hugo von Hofmannsthal; Hanns Heinz Ewers; Carl von Ossietzky)
Von ästhetischer Würdigung bis polemischer Kritik: Diese Texte beleuchten Stil, Mythos und Selbstinszenierung D’Annunzios sowie seine politische Rolle. Sie spannen den Bogen vom Dichterkult über biografische Skizzen bis zu scharfen Kommentaren über Nationalismus, öffentliche Gesten und das Fiume-Abenteuer.
Die bekanntesten Werke von Gabriele D'Annunzio
Feuer
Stelio, klopft Ihnen das Herz nicht zum erstenmal?« – fragte die Foscarina mit schwachem Lächeln, die Hand des schweigsamen Freundes, der an ihrer Seite saß, leicht berührend. – »Ich sehe Sie ein wenig bleich und nachdenklich. Welch schöner, sieghafter Abend für einen großen Dichter!«
Mit einem Blick ihrer empfänglichen Augen umfaßte sie die ganze göttliche Schönheit, die der letzte Dämmerschein des Septemberabends ausströmte. In diesem leuchtend dunkeln Himmel umkränzten Lichtgirlanden, vom Ruder im Wasser erzeugt, die aufragenden Engel, die in der Ferne auf den Glockentürmen von San Marco und San Giorgio Maggiore schimmerten.
»Wie immer« –- fuhr sie mit ihrer süßesten Stimme fort – »wie immer ist alles Ihnen günstig. Welche Seele könnte sich an einem Abend, wie heute, den Träumen verschließen, die Sie durch Ihre Worte heraufbeschwören werden? Fühlen Sie nicht schon, wie die Menge bereit ist, Ihre Offenbarung zu empfangen?«
So umschmeichelte sie den Freund in zarter Weise, liebkoste ihn mit Schmeichelworten, hob seine Stimmung durch unablässiges Lob.
«Man konnte kein prächtigeres und ungewöhnlicheres Fest ersinnen, einen so reizbaren Dichter, wie Sie, aus dem elfenbeinernen Turm zu locken. Ihnen allein war die Freude vorbehalten, zum erstenmal zu einer Menge zu sprechen an einem so erhabenen Ort, im Saal des Großen Rates, auf der Tribüne, von dereinst der Doge zu der Versammlung der Patrizier sprach, das ›Paradies‹ des Tintoretto als Hintergrund und über sich den ›Ruhm‹ des Veronese.«
Stelio Effrena blickte ihr in die Augen.
»Wollen Sie mich berauschen?« – sagte er mit plötzlicher Heiterkeit. – »Das ist der Becher, den man denen reicht, die zum Tode geführt werden. Nun wohl, meine Freundin, ich gestehe Ihnen, mein Herz klopft ein wenig.«
Der Lärm geräuschvoller Zurufe tönte von dem Traghetto San Gregorio herüber, hallte wider über den Canale Grande und wurde von den beiden kostbaren Disken aus Porphyr und Serpentinstein zurückgeworfen, die das Haus der Dario schmücken, das geneigt steht, wie eine gealterte Courtisane unter der Pracht ihres Geschmeides.
Die königliche Gondel fuhr vorüber.
»Sehen Sie hier die unter Ihren Hörerinnen, der beim Beginn zu huldigen die Etikette Ihnen vorschreibt« – sagte die schmeichelnde Frau, auf die Königin anspielend. – »In einem Ihrer ersten Bücher, dünkt mich, gestehen Sie Ihren Respekt und Ihre Vorliebe für alles Zeremonielle. Eine Ihrer seltsamsten Phantasien hat einen Tag Karls des Zweiten von Spanien zum Motiv.«
Da die königliche Barke dicht an ihrer Gondel vorbeifuhr, grüßten die beiden. Die Königin wandte sich, als sie den Dichter der ›Persephone‹ und die große Tragödin erkannte, in unwillkürlicher Neugier: blond und rosig, von ihrem schonen unermüdlichen Lächeln verklärt, das sich in dem lichten Gewoge der buranesischen Spitzen verlor. An ihrer Seite saß die Herrin von Burano, Andriana Duodo, die auf der kleinen betriebsamen Insel einen Garten von Spitzen zog, in dem antike Blumen in wunderbarer Weise neu erstanden.
»Scheint es Ihnen nicht, Stelio, als ob das Lächeln dieser beiden Frauen einander gleicht wie Zwillinge?« – sagte die Foscarina und blickte auf das Wasser, das in der Furche der enteilenden Barke aufflammte, auf der der Widerschein des zwiefachen Lichts sich zu verlängern schien.
»Die Gräfin hat eine reine und herrliche Seele, eine jener seltenen venetianischen Seelen, in denen die alten Bilder sich lebendig spiegeln« – sagte Stelio mit Dankbarkeit. »Ich hege eine tiefe Bewunderung für ihre sensitiven Hände. Es sind Hände, die vor Entzücken beben, wenn sie eine schöne Spitze oder schönen Samt berühren, und sie verweilen darauf mit einer Anmut, die fast sich schämt, allzu weich zu sein. Eines Tages als ich sie durch die Säle der Academia begleitete, blieb sie vor dem ›Bethlehemitischen Kindermord‹ des ersten Bonifazio stehen (– Sie erinnern sich gewiß des grünen Gewandes bei der zu Boden geworfenen Frau, die der Soldat des Herodes eben töten will: ein unvergeßlicher Ton! –); sie blieb lange davor stehen, auf ihrem Gesicht leuchtete die Freude über diesen vollkommenen Genuß, dann sagte sie zu mir: ›Führen Sie mich fort, Effrena. Ich muß meine Augen auf diesem Gewand lassen und kann nichts anderes mehr sehen.‹ Ach, teure Freundin, lächeln Sie nicht! Sie war offen und aufrichtig, da sie so sprach: sie hatte in Wirklichkeit ihre Augen auf jenem Stückchen Leinwand gelassen, das die Kunst durch ein bißchen Farbe zum Mittelpunkt eines unendlich erhabenen Mysteriums gemacht hat. Und in Wirklichkeit führte ich eine Blinde, von tiefer Ehrfurcht ergriffen für diese bevorzugte Menschenseele, über die die Macht der Farbe eine solche Gewalt hatte, daß sie für einige Zeit jede Spur des alltäglichen Lebens verwischte und jede andere Mitteilung verbot. Wie wollen Sie das nennen? Den Kelch bis zum Rande füllen, dünkt mich. Das ist es zum Beispiel, was ich heute abend tun wollte, wenn ich nicht entmutigt wäre.«
Neues Rufen, stärker und anhaltender, erhob sich zwischen den beiden schützenden Granitsäulen, als die Prunkgondel bei der belebten Piazetta anlegte. Die schwarze und dichte Menge wogte dazwischen hin und her, und die leeren Nischen der herzoglichen Loggien füllte ein wirres Geräusch, wie das Brausen, das die Höhlen der Seemuscheln zu beleben scheint. Dann plötzlich stieg erneutes Rufen in die leuchtend klare Luft auf, brach sich oben an dem schlanken Marmorwald, erhob sich über die Köpfe der hohen Statuen, erreichte die Zinnen und die Kreuze und verlor sich in der abenddämmernden Ferne. Unveränderlich, erhaben über die Bewegung unter ihr, verblieb in der neuen Pause die vielfältige Harmonie der heiligen und profanen Gebäude. Und darüber zogen sich, wie eine leichte, bewegliche Melodie, die jonischen Modulationen der Bibliotheca hin, und erhob sich die Spitze des kahlen Turmes wie ein mystischer Schrei. Und diese stumme Musik der unbeweglichen Linien war so mächtig, daß sie die fast sichtbare Vision eines schöneren und reicheren Lebens erzeugte, die erhabener war als das Schauspiel der unruhigen Menge. Die Menge fühlte die Göttlichkeit der Stunde; und in dem jauchzenden Zuruf, den sie dieser neuen Form von Königshoheit zollte, die an dem antiken Ufer landete, dieser schönen blonden Konigin, die von einem unversiegbaren Lächeln verklärt war, strömte sie vielleicht das dunkle Sehnen aus, die engen Schranken des Alltagslebens zu durchbrechen und die Gaben der ewigen Poesie zu empfangen, die über diesen Steinen und diesen Wassern verstreut sind. Die habgierige und starke Seele der Väter, die den heimkehrenden Triumphatoren auf dem Meere zujubelten, erwachte unklar in diesen durch die öde Langeweile und die Drangsal der langen Tage niedergedrückten Menschen; es war darin etwas von der Luft, die noch von dem Flattern der mächtigen Kriegsbanner bewegt war, wenn diese gleich den Fittichen der Siegesgöttin nach beendetem Flug eingezogen wurden, oder von dem Knirschen der Helden, das unversöhnlich blieb, auch wenn das Geschwader in die Flucht geschlagen war.
»Kennen Sie Perdita« – fragte Stelio plötzlich – »kennen Sie irgendeinen anderen Ort der Welt, der in gewissen Stunden imstande ist, die menschliche Lebenskraft anzuregen und alle Wünsche bis zum Fieber zu steigern, wie Venedig? Kennen Sie eine gewaltigere Verführerin?«
Die Frau, die er Perdita nannte, hielt ihr Haupt geneigt, wie um sich zu sammeln, sie antwortete nicht; aber in allen Nerven fühlte sie das unbeschreibliche Beben, das die Stimme des jungen Freundes ihr verursachte, wenn sie plötzlich zur Offenbarerin einer leidenschaftlichen und ungestümen Seele wurde, zu der sie eine grenzenlose Liebe und eine grenzenlose Furcht zog.
»Frieden! Vergessen! Finden Sie diese Dinge dort unten im Grunde Ihres einsamen Kanals, wenn Sie heimkehren, erschöpft und fiebernd von der Luft des Parketts, die eine Bewegung von Ihnen zu frenetischem Jubel hinreißt? Ich für meinen Teil fühle, wenn ich auf diesem toten Wasser bin, mein Leben sich vervielfältigen mit schwindelnder Schnelle; und zu manchen Stunden scheint es mir, als ob meine Gedanken sich entzündeten, wie beim Ausbruch des Deliriums.«
»Die Kraft und die Flamme sind in Ihnen, Stelio« – sagte die Frau fast demütig, ohne die Augen zu erheben.
Er schwieg absichtlich, denn in seinem Geiste erstanden Bilder und leidenschaftliche Melodien, wie durch plötzliche Befruchtung, und er freute sich an dem Reichtum, der ihm unerwartet zuströmte.
Noch dauerte die Stunde des Vesperläutens, die er in einem seiner Bücher die Tizianische Stunde genannt hatte, weil dann alle Dinge gleich den nackten Geschöpfen dieses Künstlers in ihrem eigenen reichen Licht zu strahlen und fast den Himmel zu erleuchten schienen, statt ihr Licht von ihm zu empfangen. Aus seinem eigenen grünlichen Schatten tauchte der achteckige Tempel auf, den Baldassare Longhena einem Traume des Polifilo nachbildete, mit seiner Kuppel, seinen Voluten, mit seinen Statuen, seinen Säulen, seinen Pilastern, seltsam und prächtig, wie ein Meerschloß, das den gewundenen Formen der Muschel nachgebildet weißlich wie Perlmutter schimmert, und auf dem sich in den Höhlungen der Steine durch den feuchten Salzgehalt etwas Frisches, Silbriges und Funkelndes abgesetzt hatte, das die Vorstellung weckte von perlmutterfarbenen Muscheln, die sich auf den heimischen Wassern öffnen.
»Perdita« – sagte der Dichter, der sein ganzes Sein wie von einem geistigen Glücksrausch ergriffen fühlte, als er sah, wie seine Phantasien alles um ihn her belebten – »scheint es Ihnen nicht, als folgten wir dem Trauerzug des gestorbenen Sommers? In einer Trauerbarke ruht die Göttin des Sommers, in Gold gekleidet wie eine Dogaressa, wie eine Loredana, oder eine Morosina oder eine Soranza des leuchtenden Jahrhunderts, und der Trauerzug geleitet sie nach der Insel Murano, wo ein gebietender Geist des Feuers sie in einen opalschillernden Glasschrein betten wird, auf daß sie, in die Lagune versenkt, wenigstens durch ihre durchsichtigen Lider dem weichen Spiel der Algen zuschauen und sich einbilden kann, um den Körper noch immer das wollüstige Wogen ihres Haares zu spüren, während sie der Stunde der Auferstehung entgegenharrt.«
Ein unwillkürliches Lächeln erschien auf dem Gesicht der Foscarina, das von den Augen ausging, die die schöne Erscheinung in Wahrheit gesehen zu haben schienen. Dieses improvisierte Gleichnis – das Bild, wie der Rhythmus – gab in der Tat die Stimmung wieder, die rings umher über allen Erscheinungen lag. Wie der bläuliche Milchton des Opal voller verborgener Feuer ist, so barg das gleichmäßig bleiche Wasser des großen Beckens einen versteckten Glanz, den die Ruderschläge enthüllten. Jenseits des starren Waldes von Schiffen, die vor Anker lagen, stand San Giorgio Maggiore wie eine große rosenfarbene Galeere, den Bug der Fortuna zugewendet, die sie von der Höhe ihrer goldigen Sphäre an sich zog. Dazwischen öffnete sich der Kanal der Giudecca, gleich einem friedlichen Hafen, in den die auf Flußstraßen hergereisten Lastschiffe mit der Ladung frischen, gespaltenen Holzes zugleich den Geist der Wälder zu tragen schienen, die sich über ferne Ströme neigten. Und von dem Molo, wo über dem Doppelwunder der der Volksgunst geöffneten Säulengänge das rot und weiße Mauerwerk aufragte, bestimmt, die Gesamtheit der herrschenden Gewalten einzuschließen, dehnte sich das Ufer in weicher Bogenlinie den schattigen Anlagen, den fruchtbaren Inseln zu, als wollte es den Gedanken, der durch die kühnen Symbole der Kunst erregt war, mittels der natürlichen Formen zur Ruhe geleiten. Und fast, als gelte es die Beschwörung des Herbstes zu begünstigen, glitt eine Reihe mit Früchten hochbeladener Barken vorüber, großen schwimmenden Körben vergleichbar, die den Duft der Obstgärten über die Wasser trugen, in denen sich das unveränderliche Blattwerk der Giebel und Kapitäle spiegelte.
»Ist Ihnen, Perdita« – begann Stelio von neuem, indem er mit heller Freude auf die gelben Trauben und die lila Feigen blickte, die nicht ohne eine gewisse Harmonie vom Bug bis zum Steuer des Schiffes aufgespeichert lagen – »ist Ihnen eine höchst anmutige Eigentümlichkeit aus der Chronik der Dogengeschichte bekannt? Zur Bestreitung der Kosten für ihre Prunkgewänder genoß die Dogaressa einige Privilegien von dem Zoll der Früchte. Ist es nicht ein hübscher Einfall, Perdita? Die Früchte der Inseln kleideten sie mit goldenen Gewändern und gürteten sie mit Perlen. Pomona, die Arachne den Lohn reicht: eine Allegorie, die Veronese in das Deckengewölbe des Vestiario malen könnte. Ich freue mich, wenn ich mir die Dame auf den hohen diamantengeschmückten Schuhen vorstelle und dabei denke, daß sie etwas Herbes, Frisches zwischen den Falten ihres schweren Gewandes trägt: den Zins der Früchte. Welch frischen Duft erhält dadurch ihr Prunk! Nun, meine Freundin, stellen Sie sich vor, daß diese Trauben und diese Feigen des neuen Herbstes den Preis des güldenen Kleides zahlen, in das die tote Sommergöttin eingehüllt ist.«
»Welch köstliche Phantasie, Stelio!« – sagte die Foscarina, die, sich in ihre Jugend zurückversetzend, verwundert lächelte, wie ein Kind, dem man ein Bilderbuch zeigt. – »Wer nannte Sie doch eines Tages den Bilderreichen?«
»Ah, die Bilder!« – rief der Dichter, ganz ergriffen von befruchtender Glut der Empfindungen. – »Wie man in Venedig nur Musik empfinden kann, so kann man nur Bilder denken. Von allen Seiten strömen sie uns zahllos und mannigfaltig zu, sie sind wirklicher und lebendiger als die Menschen, die uns in den engen Gassen mit dem Ellbogen streifen. Wir können uns zu ihnen neigen, um die Tiefe ihrer verfolgenden Blicke zu erforschen, wir können die Worte, die sie zu uns sprechen werden, aus dem Schwung ihrer beredten Lippen erraten. Einige sind tyrannisch gleich herrischen Liebhabern und halten uns lange im Joch ihrer Macht. Andere wieder erscheinen uns ganz in Schleier gehüllt, wie die Himmelsbräute, oder fest gewickelt, wie die Neugeborenen, und nur wer es versteht, die Hüllen zu zerreißen, kann sie zu vollkommenem Leben erheben. Heute morgen, beim Erwachen schon, war meine Seele ganz voll davon. Sie glich einem schönen mit Chrysaliden beladenen Baum.«
Er hielt inne und lachte.
»Wenn heute abend sich alle öffnen« – fügte er hinzu – »so bin ich gerettet. Bleiben sie geschlossen, dann bin ich verloren.«
»Verloren?« – sagte die Foscarina, ihm mit Augen so voller Vertrauen ins Gesicht blickend, daß unermeßliche Dankbarkeit ihn erfüllte. – »Sie können sich nicht selbst verlieren, Stelio. Sie sind Ihrer selbst immer sicher. Ihr Schicksal tragen Sie in Ihren Händen. Ich glaube, daß Ihre Mutter niemals für Sie gezittert haben kann, nicht einmal in den schlimmsten Zeiten. Nicht wahr? Nur in Stolz erzittert Ihr Herz ...«
»Ach, teure Freundin, wie liebe ich Sie, und wie dankbar bin ich Ihnen hierfür!« – gestand Stelio aufrichtig, ihre Hand ergreifend. – »Sie sind es, die meinen Stolz nährt und mir die Illusion gibt, als besäße ich schon alle jene Gaben, nach denen ich unablässig strebe. Zuweilen dünkt es mich, als hätten Sie die Macht, den Dingen, die meiner Seele entspringen, irgendeine göttliche Eigenschaft mitzuteilen, so daß sie meinen eigenen Augen fern und anbetungswert erscheinen. Sie erzeugen zuweilen in mir das religiöse Staunen jenes Bildhauers, der, nachdem er am Abend die Bildsäulen der Gotter, noch warm von seiner Arbeit, und fast möchte ich sagen, noch mit dem Abdruck seines plastischen Daumens, in den Tempel gebracht hatte, sie am Morgen darauf auf ihren Piedestalen erblickte, eingehüllt in eine Wolke von Wohlgerüchen und aus allen Poren des spröden Stoffes, in dem seine vergänglichen Hände sie geformt, ihre Gottheit ausströmend. Wenn Sie in meine Seele dringen, ist es nur, um solche Begeisterung zu entfachen. Und so kommt es, daß jedesmal, wenn mir ein gütiges Geschick gestattet, an Ihrer Seite zu weilen, Sie mir unentbehrlich scheinen zu meinem Leben. Und dennoch kann ich in den allzu langen Trennungszeiten leben, und Sie können leben, obwohl wir beide wissen, welcher Glanz von der vollkommenen Vereinigung unserer beiden Leben ausgehen könnte. Und trotzdem, obwohl ich weiß, was Sie mir geben und mehr noch, was Sie mir geben könnten, betrachte ich Sie als für mich verloren, und in dem Namen, mit dem ich Sie so gerne nenne, will ich diese meine bewußte Empfindung ausdrücken und mein unendliches Bedauern ...«
Er unterbrach sich, da er das Beben der Hand fühlte, die er noch in der seinen hielt.
»Wenn ich Sie Perdita nenne« – fuhr er nach einer Pause mit leiserer Stimme fort – »so scheint es mir, als müssen Sie sehen, wie mein Wunsch Ihnen naht, den tödlichen Stahl in der keuchenden Flanke. Und gelingt es ihm dennoch, Sie zu fassen, so ergreift der Tod schon mit eisigem Erstarren die Spitzen seiner beutegierigen Finger.«
Sie empfand einen ihr wohlbekannten Schmerz bei diesen schönen und vollendeten Worten, die von den Lippen des Freundes mit einer Natürlichkeit flossen, die bewies, daß sie aufrichtig waren. Sie hatte auch vorher schon eine Unruhe und eine Furcht empfunden, die sie sich selbst nicht zu deuten wußte. Es schien ihr, als verliere sie das Bewußtsein ihres eigenen Lebens und sei in eine Art intensiven, blendenden Scheinlebens versetzt, in dem sie nur schwer atmen konnte. Hineingezogen in diese Atmosphäre, die die Glut einer Schmiede ausströmte, fühlte sie sich fähig, alle die Verwandlungen zu erdulden, die der Beleber an ihr vollzog, um sein beständiges Bedürfnis nach Schönheit und Poesie zu sättigen. Sie fühlte, daß ihr eigenes Bild in dem dichterischen Geist der toten Sommergöttin glich, die in dem opalschimmernden Schrein verschlossen ruhte, und zwar so deutlich, daß es greifbar schien. Und eine fast kindische Lust ergriff sie, sich in seinen Augen wie in einem Spiegel zu erblicken, um den Reflex ihres wirklichen Seins zu sehen.
Was ihren Schmerz noch peinvoller machte, war die Erkenntnis einer unbestimmten Übereinstimmung zwischen dieser Erregung und der Sehnsucht, die sich ihrer bemächtigte, sich in das phantastische Bild hinein zu versetzen, um ein erhabenes Geschöpf der Kunst zu verkörpern. Lockte er sie nicht hinauf, um in dieser Sphäre eines erhabeneren Lebens zu leben? Und damit sie ihrer Alltagspersönlichkeit ledig in die Erscheinung treten könne, bedeckte er sie nicht mit glänzenden Larven? –
Aber während es ihr nicht gegeben war, auf so angespannter Höhe zu verharren, es sei denn mit einer äußersten Kraftanstrengung, sah sie den andern sich dort mit Leichtigkeit behaupten, wie in seiner natürlichen Daseinssphäre, und sich ohne Ende an einer Wunderwelt freuen, die er in beständiger Schöpferkraft erneute.
Ihm war es gelungen, in sich selbst die innige Verbindung der Kunst mit dem Leben zu vollenden und im Innern seiner Wesenheit eine unversiegbare Quelle von Harmonien zu finden. Es war ihm gelungen, in seinem Geiste ohne Unterbrechungen die geheimnisvolle Eigenschaft lebendig zu erhalten, der das Werk der Schönheit entspringt, und so mit einem Mal die flüchtigen Erscheinungen seines wechselreichen Lebens in ideale Gestalten umzuwandeln. Auf diese seine Fähigkeit wies er hin, als er einer seiner Gestalten die Worte in den Mund legte: »Ich beobachtete in meinem eigenen Innern die beständige Genesis eines höheren Lebens, in dem alle Erscheinungen sich verwandelten, wie durch die Kraft eines Zauberspiegels.« Er war mit einer ungewöhnlichen Gabe des Wortes ausgestattet, und ihm gelang es im Augenblick, selbst die kompliziertesten Arten seiner Sensibilität mit einer Exaktheit und lebendigen Plastik in seine Sprache zu übersetzen, daß sie zuweilen, kaum ausgesprochen, nicht mehr zu ihm zu gehören schienen, durch die isolierende Kraft des Stils gegenständlich wurden. Seine klare und durchdringende Stimme, die die musikalische Figur jedes Wortes mit einer scharfen Kontur zu umziehen schien, verstärkte noch den Eindruck dieser Besonderheit seiner Sprache. So daß in denen, die ihn zum erstenmal hörten, ein aus Bewunderung und Abneigung gemischtes Gefühl entstand für ihn, der sich selbst in so bestimmten Formen offenbarte, die sich aus einem Willen zu ergeben schienen, der beständig darauf bedacht war, zwischen sich und den Außerhalbstehenden eine tiefe, unübersteigliche Kluft festzustellen. Aber da seine Sensitivität seinem Intellekt gleichkam, so war es für die, die ihm nahe standen und ihn liebten, ein leichtes, durch den Kristall seiner Rede hindurch die Wärme seiner leidenschaftlichen und ungestümen Seele zu empfangen. Sie kannten die unendliche Mannigfaltigkeit seiner Empfindungs- und Einbildungskraft, sie wußten, aus welchem Feuer die schönen Bilder erstanden, in die er die Wesenheit seines inneren Lebens umzuwerten pflegte.
Wohl wußte sie es, die er Pierdita nannte. Und wie der fromme Mensch vom Herrn den überirdischen Beistand für seine Erlösung erwartet, so schien sie darauf zu warten, daß er sie endlich in den notwendigen Gnadenzustand versetze, damit sie sich zu jenem Feuer erheben und darin verharren könne, zu dem sie getrieben wurde von einem tollen Wunsch, in Flammen aufzugehen und sich aufzulösen, aus Verzweiflung, auch die letzte Spur ihrer Jugend verloren zu haben, und in der Furcht, sich allein in grauer Einsamkeit zu finden.
»Jetzt sind Sie es, Stelio« – sagte sie mit ihrem schwachen, lauschenden Lächeln, indem sie ihre Hand sanft aus des Freundes Hand löste – »jetzt sind Sie es, der mich berauschen will.«
»Sehen Sie« - rief sie, um den Zauber zu brechen, auf eine schwerbeladene Barke deutend, die ihnen langsam entgegenkam – »sehen Sie Ihre Granatäpfel.«
Aber ihre Stimme klang bewegt. Und sie sahen in dem traumhaften Dämmerlicht auf dem Wasser, dessen zartes Silbergrün an die neuen Blätter der Flußweide gemahnte, die Barke vorübergleiten, hoch beladen mit der symbolischen Frucht, die die Vorstellung von reichen und verborgenen Schätzen erweckte, fast wie scharlachrote Lederschreine, die die Krone des königlichen Gebers zierte, einige geschlossen, andere über den innen angehäuften Edelsteinen halb geöffnet.
Mit leiser Stimme sprach die Frau die Worte, die Hades in dem erhabenen Drama an Persephone richtet, während die Tochter des Demeter von der verhängnisvollen Frucht genießt:
»Wenn du die Herbstzeitlose in der Blüte wirst pflücken auf den weichen Wiesen der Oberwelt, zur Seite deiner Mutter in dem blauen Peplon – und wenn die schönen Okeaniden dann eines Tages mit dir spielen werden, mit dir auf weichem Rasen –, dann wird in deinen unsterblichen Augen Unmut sich plötzlich zeigen, Unmut, des Ursach' Licht: dein Herz wird schlagen, o Persephone, die große Seele, des tiefen Traumes eingedenk, Persephone, beraubt des unterirdschen Reichs. Du wirst die Mutter dann im blauen Peplon abseits im Schweigen Tränen weinen sehen. Und du wirst zu ihr sprechen: – O Mutter, mich rufet in des Reiches Tiefe Hades; mich rufet, fern vom Tag zu herrschen über Schatten, Hades; mich ruft allein in nimmersatter Liebe Hades...«
»Ah, Perdita, wie Sie verstehen, Ihre Stimme zu beschatten!« – unterbrach sie der Dichter, der das Gefühl hatte, als ob eine melodische Nacht die Silben seiner Verse verdunkelte. – »Wie Sie verstehen, nächtlich zu werden vor Einbruch der Nacht! Erinnern Sie sich der Szene, in der Persephone hinabsteigen will in die Unterwelt, während der Chor der Okeaniden wehklagt? Ihr Gesicht gleicht dem Ihren, wenn es sich verdüstert. Regungslos in ihrem safranfarbenen Peplon neigt sie das gekrönte Haupt nach hinten, und es ist, als ob durch ihre blutlos gewordenen Adern die Nacht rinne und sich unter dem Kinn, in den Augenhöhlen, um die Nasenflügel verdichte und sie in eine düstere tragische Maske verwandle. Es ist Ihre Maske, Perdita. Die Erinnerung an Sie half mir die göttliche Gestalt heraufbeschwören, als ich an meinem Mysterium arbeitete. Das Bändchen von safranfarbenem Samt, das Sie fast immer um den Hals tragen, brachte mich auf die richtige Farbe für Persephones Peplon. Und eines Abends, als ich mich in Ihrem Hause von Ihnen verabschiedete, auf der Schwelle eines Zimmers, in dem die Lampen noch nicht angezündet waren (an einem stürmischen Abend des verflossenen Herbstes, wenn Sie sich erinnern), gelang es Ihnen durch eine einzige Bewegung, in meiner Seele das Geschöpf lebendig zu machen, das bis dahin noch verborgen ruhte; und dann verschwanden Sie, ohne die plötzliche Geburt zu ahnen, die Sie herbeigeführt, im inneren Dunkel Ihrer Unterwelt. Ach, ich war sicher, Ihr Schluchzen zu hören, und dennoch durchströmte mich eine unbezähmbare Freude. Ich habe Ihnen das nie erzählt, nicht wahr? Ich hätte Ihnen mein Werk widmen müssen, wie einer idealen Lucina.«
Sie litt unter dem Blick des Belebers; sie litt unter der Maske, die er auf ihrem Gesicht bewunderte, und unter der Freude, die sie in seinem Innern unablässig sprudeln fühlte wie einen unversiegbaren Quell. Sie litt unter ihrem ganzen Selbst; unter der Veränderlichkeit ihrer eigenen Züge; unter der mimischen Fähigkeit ihrer Gesichtsmuskeln und unter jener unfreiwilligen Kunst, die ihren Gesten die Bedeutung verlieh, und unter jenem ausdrucksvollen Schatten, den sie so oft auf der Bühne in einer Minute bangen Schweigens über ihr Gesicht breiten konnte wie einen wunderbaren Schleier des Schmerzes; und unter dem Schatten, der jetzt die Furchen füllte, die die Zeit in ihr nicht mehr junges Fleisch gegraben hatte. Sie litt grausam durch diese Hand, die sie anbetete. Durch diese Hand, die so zart und so vornehm war und ihr dennoch so weh tun konnte mit einem Geschenk oder einer Liebkosung.
»Glauben Sie nicht, Perdita« – sagte nach einer Pause Stelio, indem er sich dem lichten und gewundenen Gang seiner Gedanken hingab, der wie die Windungen des Flusses, die Inseln im Tal bilden, sie umgürten und ernähren, in seinem Geist einsame, dunkle Flecken ließ, von denen er wohl wußte, daß er dort in gelegener Stunde neue Schätze entdecken würde – »glauben Sie nicht an die gute Vorbedeutung der Zeichen? Ich spreche nicht von der Wissenschaft der Sterndeutung, noch von horoskopischen Zeichen. Ich meine, daß gleich denen, die glauben, sich mit den magischen Kräften eines Sternbildes in Verbindung bringen zu können, wir eine ideale Wechselbeziehung herstellen können zwischen unserer Seele und irgendeinem Gegenstand, der im Erdreich wurzelt, in der Weise, daß dieser, indem er allmählich unsere Wesenheit in sich aufsaugt und sich in unserer Einbildungskraft zu großer Bedeutung entfaltet, uns fast als die Verkörperung unserer unbekannten Schicksale erscheint und fast eine geheimnisvolle Gestalt annimmt, die in gewissen Zeitverhältnissen unseres Lebens in die Erscheinung tritt. Das, Perdita, ist das Geheimnis, unserer ein wenig verdorrten Seele wieder einen Teil der ursprünglichen Frische zuzuführen. Ich weiß aus Erfahrung, welch wohltätigen Einfluß die innige Verbindung mit einem im Erdreich wurzelnden Gegenstand auf uns ausübt. Es ist notwendig, daß unsere Seele von Zeit zu Zeit der Hamadryade gleich wird, um die frische Lebenskraft des mitlebenden Baumes in sich kreisen zu fühlen. Sie haben schon verstanden, daß ich mit meinen Worten auf die Äußerung anspiele, die Sie vorher beim Vorübergleiten jener Barke taten. Sie haben mit dunkler Kürze diese Gedanken ausgedrückt, als Sie sagten: ›Sehen Sie Ihre Granatäpfel!‹ Für Sie und für alle, die mich lieben, können es nur meine sein. Für Sie und für diese andern ist der Gedanke meiner Person unauflöslich mit der Frucht verknüpft, die ich mir zum Sinnbild erkoren, und auf die ich mehr ideale, bedeutungsvolle Eigenschaften gehäuft habe, als ihr Inneres Kerne birgt. Wenn ich in jener Zeit gelebt hätte, in der die Menschen beim Ausgraben der griechischen Marmorgötter in der Erde auf die noch feuchten Wurzeln der antiken Sagen stießen, so hätte mich kein Künstler auf der Leinwand darstellen können ohne den Granatapfel in meiner Hand. Von diesem Symbol meine Person trennen, es wäre dem arglosen Künstler gewesen, als löse er einen lebendigen Teil von mir; denn seiner heidnischen Auffassung würde es erschienen sein, als sei die Frucht mit dem Menschenarm verwachsen, wie mit ihrem natürlichen Zweig; er hätte, wie gesagt, von meinem Wesen keine andere Anschauung gehabt, als er sie von Hyacinthos oder Narcissus oder Ciparissus haben mußte, die ihm bald als pflanzliche Erscheinungen, bald in Jünglingsgestalt vorschweben mußten. Aber es gibt auch in unserer Zeit manchen lebhaften und phantasiebegabten Geist, der den Sinn meiner Erfindung begreifen und seinen vollen Wert würdigen kann. Sie selbst, Perdita, ziehen Sie nicht in Ihrem Garten einen schönen Granatbaum, um mich in jedem Sommer blühen und Früchte tragen zu sehen? Einer Ihrer Briefe, beflügelt wie ein göttlicher Bote, schilderte mir die anmutige Feier, in der Sie den ›effrenischen‹ Strauch mit güldenen Ketten schmückten, an dem Tag, an dem das erste Exemplar der Persephone an Sie gelangte. So habe ich also für Sie und für jene, die mich lieben, einen alten Mythos erneuert, indem ich mich in idealer und symbolischer Weise in eine Form der ewigen Natur verwandle, so daß, wenn ich tot sein werde (und die Natur wolle mir vergönnen, daß ich mich ganz und gar in meinem Werke offenbare, bevor ich sterbe!), meine Schüler mich unter dem Zeichen des Granatapfels ehren werden; und in der spitzen Form des Blattes und in der flammenden Farbe der Blüte und in dem rubinartigen Fleisch der Frucht werden sie manche Eigenschaften meiner Kunst erkennen, und ihre Intellekte werden von diesem Blatt, von dieser Blüte und von dieser Frucht wie durch posthume Ermahnungen ihres Meisters in ihren Werken zu dieser Klarheit, zu dieser Flamme und zu diesem inneren Reichtum geführt werden. Jetzt, Perdita, entdecken Sie den tiefen Sinn. Ich selbst bin durch Wahlverwandtschaft dazu geführt, mich entsprechend dem herrlichen Genius der Pflanze zu entwickeln, in der ich so gerne mein Trachten nach einem reichen und glühenden Leben versinnbildliche. Mir scheint, daß dieses mein pflanzliches Abbild imstande ist, mich zu überzeugen, daß meine Kräfte sich immer naturgemäß entwickeln, um auf natürlichem Wege das Ziel zu erreichen, für das sie bestimmt sind. ›Natur hat mich dazu bestimmt‹, war das Lionardische Motto, das ich auf das erste Blatt meines ersten Buches setzte. Nun wohl, der blühende und fruchttragende Granatbaum wiederholt mir unaufhörlich dieses einfache Wort. Und wir gehorchen nur den Gesetzen, die eingeschrieben sind in unsere Wesenheit. Und deshalb bleiben wir, trotz aller Zersetzung, unversehrt in einer Einheitlichkeit und Fülle, die unsere Freude sind. Es ist kein Mißklang zwischen meiner Kunst und meinem Leben.«
Er sprach voller Hingabe, fließend, fast, als sähe er den Geist der gespannt lauschenden Frau sich öffnen wie einen Kelch, um diesen Strom der Beredsamkeit in sich aufzunehmen und sich bis zum Rande zu füllen. Ein immer klareres intellektuelles Glücksgefühl ergriff ihn, gleichzeitig mit einem vagen Bewußtsein des geheimnisvollen Vorgangs, durch den sein Geist sich für den nächsten Ansturm bereitete. Dann und wann, während er sich zu der einsamen Freundin neigte und dem Ruderschlag lauschte, der das aus den unendlichen Lagunen aufsteigende Schweigen durchmaß, sah er, wie in einem Blitz, das Bild der vielköpfigen Menge, die sich in dem tiefen Saal zusammendrängte; und ein flüchtiger Schauder beschleunigte die Schläge seines Herzens.
»Es ist recht sonderbar, Perdita« – begann er wieder, seine Augen über die ferne, farblose Wasserfläche gleiten lassend, wo bei der niedrigen Flut der Meerschlamm schwärzlich zu schimmern begann, – »wie leicht der Zufall unsere Phantasie unterstützt, dem Zusammenströmen gewisser Erscheinungen bei einem uns vorschwebenden Ziel einen geheimnisvollen Charakter zu verleihen. Ich begreife nicht, warum die heutigen Dichter so voller Unwillen gegen die Vulgarität unserer gegenwärtigen Zeit sind und bedauern, zu früh oder zu spät geboren zu sein. Ich denke, daß jeder Mann von Intellekt, heute wie immer, seine eigene schöne Fabel im Leben schaffen kann. Man muß in das wilde Gewühl des Lebens mit demselben phantastischen Geist blicken, mit dem den Schülern Lionardos von ihrem Meister geraten wurde, die Flecke auf den Wänden, die Asche im Feuer, den Straßenkot und andere ähnliche Sachen zu betrachten, um darin ›Wunderbare Ersinnungen‹ und ›unendliche Dinge‹ zu finden. In derselben Weise, fügte Lionardo hinzu, werdet Ihr in dem Ton der Glocken jedes beliebige Wort und jeden Vokal hören. Dieser Meister wußte wohl, daß der Zufall – wie schon der Schwamm des Apelles beweist – immer Freund des genialen Künstlers ist. Für mich zum Beispiel sind die Leichtigkeit und die Anmut, mit der der Zufall die harmonische Entwicklung meiner Erfindung unterstützt, eine beständige Quelle des Erstaunens. Glauben Sie nicht, daß der finstere Hades seine Gemahlin die sieben Kerne essen ließ, um mir den Stoff zu einem Meisterwerk zu liefern?«
Er brach in sein jugendlich-frisches Lachen aus, daß die angeborene Lebensfreude, die ihm im Grunde eigen war, so deutlich offenbarte.
»Sehen Sie selbst, Perdita« – fuhr er lachend fort – »sehen Sie selbst, ob ich die Wahrheit sage. An einem der ersten Oktobertage des vergangenen Jahres war ich bei Donna Andriana Duodo in Burano eingeladen. Den Vormittag verbrachten wir in dem Spitzen-Park, am Nachmittag besuchten wir Torcello. Da ich damals schon angefangen hatte, mich mit dem Mythus der Persephone zu tragen, und das Werk schon im geheimen in mir Gestalt gewann, so hatte ich das Gefühl, auf stygischen Wassern zu schwimmen und in das ›jenseitige‹ Land zu gleiten. Nie habe ich reinere und süßere Todesfreuden empfunden, und dieses Gefühl verlieh mir eine Leichtigkeit, daß ich über die mit Asphodelos bewachsenen Wiesengründe hätte wandeln können, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es war eine graue, feuchte und weiche Luft. Die Kanäle schlängelten sich zwischen den mit farblosen Gräsern bedeckten Sandbänken hindurch. (Sie kennen Torcello vielleicht bei Sonnenschein.) Aber inzwischen sprach, disputierte, deklamierte irgend jemand in dem Nachen des Charon! Ein klingendes Lob weckte mich. Mit einer Anspielung auf mich bedauerte Francesco de Lizo, daß ein vornehmer Künstler von so köstlicher Sinnlichkeit – das waren seine Worte – gezwungen sei, abseits zu leben, fern von der stumpfsinnigen und feindlichen Menge, und die Feste ›der Töne, der Farben und der Formen‹ im Palaste seines einsamen Traumes zu feiern. Und mit lyrischem Schwung erinnerte er an das glänzende gefeierte Leben der venetianischen Künstler, an die Zustimmung des Volks, die sie wie ein Wirbelwind zu den Gipfeln des Ruhmes emportrug, an die Schönheit, die Kraft und die Freude, die sie um sich her vervielfältigten, und die sich in zahllosen Bildern an den gewölbten Decken und an den hohen Wänden widerspiegelten. Da sagte Donna Andriana: ›Nun wohl, ich verspreche feierlich, daß Stelio Effrena sein Triumphfest in Venedig haben soll.‹ Die Dogaressa hatte gesprochen. In diesem Augenblick sah ich auf dem niedrigen, grünlich schimmernden Ufer, wie eine Halluzination, einen früchtebeladenen Granatbaum die endlose Eintönigkeit unterbrechen. Donna Orsetta Contarini, die neben mir saß, stieß einen Jubelschrei aus und streckte beide Hände ungeduldig danach aus. Es gibt nichts, was mich so entzückt, wie der reine und starke Ausdruck des Begehrens. ›Ich liebe die Granatäpfel über alles!‹ rief sie, als spürte sie schon den herb-lieblichen Geschmack auf der Zunge. Und sie war ebenso kindlich, wie ihr Name archaistisch! Ich war gerührt; aber Andrea Contarini schien die Lebhaftigkeit der Gattin ernsthaft zu mißbilligen. Er ist ein Hades, der, wie es scheint, kein Vertrauen hat in die von dem legitimen Gatten erprobte mnemonische Kraft der sieben Kerne. Aber auch die Bootführer waren gerührt und stießen die Barke ans Land, so daß ich als erster herausspringen konnte auf das Gras, und ich machte mich daran, den blutsverwandten Baum zu plündern. Man konnte hier mit heidnischem Mund die Worte des heiligen Abendmahls anwenden: ›Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der für euch gegeben ist; tut solches zu meiner Erinnerung.‹ Was meinen Sie dazu, Perdita? Glauben Sie nicht, daß ich erfinde. Ich spreche die Wahrheit.«
Sie ließ sich verführen von diesem freien und feinen Spiel, in dem er die Beweglichkeit seines Geistes und die Leichtigkeit seiner Redegabe zu erproben schien. Es war in ihm etwas Wogendes, Flackerndes und Mächtiges, etwas, das in ihr die zwiefache und verschiedenartige Vorstellung von Flamme und Wasser weckte.
»Nun« – fuhr er fort – »hat Donna Andriana ihr Versprechen gelöst. Geleitet von dem Geschmack antiker Prachtliebe, der sich in ihr so lebendig erhalten hat, hat sie in dem Dogenpalast eines jener wahrhaft fürstlichen Feste vorbereitet, wie man sie am Ausgang des Cinquecento feierte. Sie hat daran gedacht, die Ariadne des Benedetto Marcello der Vergessenheit zu entreißen, und läßt sie an demselben Ort klagen, wo Tintoretto die Tochter des Minos gemalt hat, in dem Augenblick, da sie von Aphrodite die Sternenkrone empfängt. Erkennen Sie nicht in der Schönheit dieses Gedankens die Frau wieder, die ihre lieben Augen zurückließ auf dem unvergleichlichen grünen Gewand? Und nun nehmen Sie dazu, daß diese Musikaufführung in dem Saal des Großen Rates ein antikes Seitenstück besitzt. In demselben Saale wurde im Jahre 1573 eine mythologische Schöpfung von Cornelio Frangipani mit Musik von Claudio Merulo zu Ehren des allerchristlichsten Heinrich III. aufgeführt. Gestehen Sie, Perdita, daß meine Gelehrsamkeit Sie verblüfft. Ach, wenn Sie wüßten, wieviel ich über diesen Gegenstand gesammelt habe. Wenn Sie einmal eine schwere Strafe verdient haben, werde ich Ihnen meine Rede vorlesen.«
»Aber diese Rede, werden Sie sie nicht heute abend halten auf dem Fest?« – fragte die Foscarina erstaunt und beunruhigt, in der Furcht, er möchte bei seiner bekannten Pflichtvergessenheit den Entschluß gefaßt haben, die allgemeine Erwartung zu enttäuschen.
Er verstand die Unruhe der Freundin und wollte sie nicht beschwichtigen.
»Heute abend« – antwortete er mit ruhiger Bestimmtheit – »werde ich bei Ihnen im Garten einen Sorbet nehmen und mich an dem Anblick des unter dem Firmament im Juwelenschmuck strahlenden Granatbaumes erfreuen.«
»Oh, Stelio! Was wollen Sie tun?« – rief sie aus und stand auf.
In ihrem Wort wie in ihrer Bewegung lag ein so lebhaftes Bedauern, und gleichzeitig rief sie eine so seltsame Vorstellung der wartenden Menge hervor, daß er davon betroffen war. Das Bild des schreckhaften Ungeheuers mit den zahllosen menschlichen Gesichtern tauchte wieder vor ihm auf zwischen dem Gold und dem dunkeln Purpur des gewaltigen Saales, und er fühlte im voraus den festen Blick und den heißen Atem auf seiner Person und bemaß plötzlich die Gefahr, der zu trotzen er beschlossen hatte, indem er sich einer einzigen momentanen Eingebung überließ, und er empfand Entsetzen über diese plötzliche Geistesverdunklung, diesen plötzlichen Schwindel.
»Beruhigen Sie sich,« – sagte er – »ich habe gescherzt. Ich werde ad bestias gehen; und ich gehe unbewaffnet. Haben Sie vorher das Zeichen nicht gesehen? Glauben Sie, daß es umsonst war, nach dem Wunder von Torcello? Auch als Warnung ist es mir einst erschienen, daß ich keine andern Pflichten auf mich nehme, als wozu Natur mich bestimmt. Sie wissen nun recht gut, liebe Freundin, daß ich nur von mir selbst sprechen kann. Ich muß also von dem Throne der Dogen herab zu der Versammlung von meiner teuren Seele sprechen, unter dem Schleier irgendeiner verführerischen Allegorie und mit dem Zauber einer schönen harmonischen Kadenz. Das werde ich ex tempore tun, wenn der Feuergeist des Tintoretto mir von seinem Paradies die Leidenschaft und den kühnen Mut mitteilt. Das Wagnis reizt mich. Aber auf welch sonderbaren Irrtum war ich verfallen, Perdita. Als die Dogaresse mir das Fest ankündigte und mich einlud, ihr die Ehre zu erweisen, machte ich mich daran, eine pomphafte Rede auszuarbeiten, weitschweifig und feierlich, wie einer der violetten Talare, die in den Glasschränken des Museo Civico eingeschlossen sind; nicht ohne einen tiefen Kniefall vor der Königin in der Einleitung und einen dichten Blätterkranz für das Haupt von Serenissima Andriana Duodo. Und für einige Tage gefiel es mir ganz besonders, in dem Geiste eines venetianischen Edelmannes aus dem 16.Jahrhundert zu leben, einer Zierde aller Wissenschaften, wie der Kardinal Bembo war, der der Schule der Uranici oder der Adorni angehörte, ein treuer Besucher der muranesischen Gärten und der asolanischen Hügel. Gewiß, ich fühlte eine Ähnlichkeit zwischen dem Bau meiner Perioden und den massiven Goldrahmen, die die Bilder in dem Saale des Rates einfassen. Aber ach, als ich gestern in der Frühe in Venedig eintraf und, über den Canale Grande gleitend, meine Müdigkeit in dem feuchten und durchsichtigen Schatten badete, und der Marmor noch seine nächtlichen heiligen Schauer ausströmte, fühlte ich, daß meine Aufzeichnungen wertloser waren als die toten Algen, die die Flut hereinspült, und sie schienen mir ebenso fremd wie die darin erwähnten und besprochenen Triumphe des Celio Magno und die Seegeschichten des Anton Maria Consalvi. Was also tun?«
Er forschte mit den Blicken umher am Himmel und auf dem Wasser, wie um eine unsichtbare Gegenwart zu entdecken, irgendeine plötzliche Erscheinung wahrzunehmen. Ein gelblicher Schimmer breitete sich dem Lido zu aus, der sich am Horizont in feinen Linien, wie die undurchsichtigen Adern im Achat, abzeichnete; weiter zurück nach Maria Della Salute war der Himmel mit leichten rosigen und violetten Dunstwölkchen bestreut, einem grünlichen, von Medusen bevölkerten Meere gleichend. Von den nahen Gärten sanken die Düfte des mit Licht und Wärme gesättigten Laubwerks so schwer nieder, daß sie fast aromatischen Ölen gleich auf dem bronzefarbenen Wasser zu schwimmen schienen.
»Fühlen Sie den Herbst, Perdita?« – fragte er die in Gedanken versunkene Freundin mit der Stimme des Weckers.
Die Vision der verblichenen Sommergöttin, in dem opalschillernden gläsernen Schrein verschlossen und in die Tiefe der algenreichen Lagune versenkt, tauchte wieder vor ihr auf.
»Er lastet auf mir,« erwiderte sie mit melancholischem Lächeln.
»Haben Sie ihn nicht gestern gesehen, als er sich über die Stadt senkte? Wo waren Sie gestern bei Sonnenuntergang?«
»In einem Garten der Giudecca.«
»Ich hier, auf der Riva. Scheint es Ihnen nicht so? Wenn menschliche Augen ein solches Schauspiel von Schönheit und Freude genießen durften, müssen die Lider sich für immer senken und fest versiegelt bleiben. Ich möchte heute abend von diesen intimen Stimmungen sprechen, Perdita. Ich möchte in meinem Innern die Hochzeit Venezias mit dem Herbste feiern, und mit einer Farbenharmonie, die nicht zurückstehen sollte hinter Tintorettos Farbenglanz auf seinem Bilde, die Hochzeit der Ariadne und des Bacchus, in dem Saale des Anticollegio: – himmelblau, purpur und gold. Gestern ganz plötzlich öffnete sich in meiner Seele der alte Keim eines Gedichts. Ich erinnerte mich des Bruchstückes eines vergessenen Poems, in neunzeiligen Strophen, das ich vor einigen Jahren begonnen hatte, als ich zum erstenmal im Anfang des Septembers zu Schiff nach Venedig kam. Die Allegorie des Herbstes war der Titel, nicht mehr mit Weinlaub bekränzt nahte der Gott, sondern mit Edelsteinen gekrönt, wie ein Fürst des Veronese, und flammende Leidenschaft in den wollüstigen Adern, in die meerentstiegene Stadt mit den marmornen Armen und den tausend grünen Gürteln einzuziehen. Damals hatte der Gedanke noch nicht die innere Reifekraft erreicht, die zu der künstlerischen Entfaltung notwendig ist, und instinktiv verzichtete ich auf die Anspannung des Geistes, die die Ausführung erfordert hätte. Aber da im lebendigen Geist wie in fruchtbarem Erdreich kein Samenkorn verloren geht, so ersteht er mir jetzt im gelegenen Augenblick von Neuem und verlangt mit einer Art Dringlichkeit nach Ausdruck. Welch geheimnisvolle und gerechte Mächte regieren die Sinnenwelt! Es war notwenig, daß ich diesen ersten Keim schonend behandelte, damit er heute in mir seine vervielfältigte Kraft ausbreiten konnte. Dieser Vinci, der mit seinem Blick jede Tiefe ergründet hat, hat zweifellos eine solche Wahrheit mit seiner Fabel von dem Hirsekorn ausdrücken wollen, das zur Ameise sagt: ›Wenn du so freundlich sein willst und meine Keimlust mich genießen lassen, so will ich mich dir hundertfältig wiedergeben.‹ Bewundern Sie diesen anmutigen Griff der Finger, die das Eisen zersplitterten! Ah, er ist immer der unvergleichliche Meister. Wie kann ich ihn vergessen, um mich den Venetianern hinzugeben?«