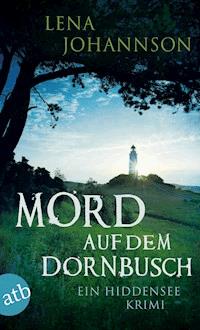9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Heldin von Usedom.
Usedom, 1629: Während des Dreißigjährigen Krieges, als auf Usedom Not und Elend herrschen, entdeckt die Pfarrerstochter Maria eine Bernsteinader. Mit dem Erlös hilft sie den Armen und Hungernden. Zum großen Missfallen des Amtshauptmannes, der seine Macht auf der Insel schwinden sieht. Also sinnt er auf Rache und streut das Gerücht, dass Maria eine Hexe sei. Ob es ihrer großen Liebe Rüdiger gelingen wird, sie vor dem sicheren Flammentod zu bewahren?
Die packende Geschichte einer mutigen Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie als Reisejournalistin ihre beiden Leidenschaften Schreiben und Reisen verbinden konnte. Seit ihrem ersten Roman »Das Marzipanmädchen«, der 2007 erschien, arbeitet sie als freie Autorin. Sie lebt an der Ostsee.
Bei Aufbau sind neben »Große Fische. Ein Krimi auf Rügen« außerdem ihre Romane »Himmel über der Hallig«, »Rügensommer«, »Dünenmond. Ein Sommer an der Ostsee«, »Der Sommer auf Usedom«, »Die Inselbahn. Ein Sommer auf Sylt« und »Standzauber. Ein Rügenroman« lieferbar.
Mehr zur Autorin unter www.lena-johannson.de.
Informationen zum Buch
Die Heldin von Usedom.
Usedom, 1629: Während des Dreißigjährigen Krieges, als auf Usedom Not und Elend herrschen, entdeckt die Pfarrerstochter Maria eine Bernsteinader. Mit dem Erlös hilft sie den Armen und Hungernden. Zum großen Missfallen des Amtshauptmannes, der seine Macht auf der Insel schwinden sieht. Also sinnt er auf Rache und streut das Gerücht, dass Maria eine Hexe sei. Ob es ihrer großen Liebe Rüdiger gelingen wird, sie vor dem sicheren Flammentod zu bewahren?
Die Geschichte einer mutigen Frau.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Die Bernsteinhexe
Ein historischer Roman von Usedom
Inhaltsübersicht
Über Lena Johannson
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel I
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Epilog
Glossar
Nachwort
Impressum
Kapitel I
Der Winter des Jahres 1629 war hart und ohne Gnade. Er hielt das Land fest in seinen eisigen Krallen, drosselte es, presste den letzten Funken Leben aus ihm heraus. Dieser Winter hieß Krieg. Er dauerte schon elf lange Jahre. Mit jedem Monat, jedem Tag, jeder einzelnen Stunde wurden die Qualen mehr, und die Menschen, die die Torturen überstanden, wurden immer weniger. Wie ein Ausschlag breiteten sich die Kämpfe von Süd nach Nord, loderten zuerst im Königreich Böhmen auf, in Kursachsen und fraßen sich schließlich hoch bis in das auf dem Papier neutrale Pommern. Kaiserliche Truppen, Schweden, Dänen trampelten nieder, was sich ihnen in den Weg stellte, plünderten, saugten das Land aus. Viele, ob Bürger oder Bauer, ob Fürst oder Fischer, waren von Flugschriften aufgehetzt, die den Katholikenhass schürten, andere versuchten alles, um Luthers Werk doch noch rückgängig zu machen, um den Ablasshandel zurückzubekommen, der ihre Kassen füllte. Wieder andere waren einfach nur gierig nach Macht. Doch die größte Zahl derer, die die Gräueltaten begingen, war selbst in höchster Not. Unzählige Fußmärsche vom Morgengrauen bis zur hereinbrechenden Nacht und zahllose Auseinandersetzungen Mann gegen Mann lagen hinter Soldaten und Söldnern, hatten ihnen das Fleisch von den Knochen und damit die letzte Kraft geraubt.
Dörfer, Kirchen und Klöster wurden zu Schlachtfeldern, Frauen wurden unter den Augen ihrer Ehemänner geschändet, Priester im Angesicht ihres Altars zerstückelt. Man schälte ihnen die Haut vom Leib. Ungeborene wurden dem Bauch der Mutter brutal entrissen.
In ihrer Not aßen die Menschen Schnecken, Frösche, ja sogar die Eingeweide der Toten sollen sie verspeist haben, erzählte man sich. Wer das nicht übers Herz brachte, trank lieber gleich Gift, um ein schnelles und gnädiges Ende zu finden. Manche Jungfrau ging ins Wasser und ertränkte sich, ehe einer der ausgemergelten verbitterten Soldaten ihrer habhaft werden konnte.
Warum nur war all das Leiden, all das Elend über die Welt gekommen? Pfarrerstochter Maria Schweidler konnte es nicht verstehen, sooft sie auch darüber nachgrübelte. Sie versuchte dankbar zu sein, dass sie hier oben auf ihrer Insel zwischen Achterwasser und Ostsee weitgehend verschont geblieben waren. Bisher. Noch reichte, was an Angeln und in Netzen landete, um sie zu ernähren. Zwar waren die kaiserlichen Truppen unter Wallenstein durchgezogen und hatten sich eine geraume Zeit eingenistet. Wie man hörte, hatten sie nicht unerheblichen Schaden angerichtet. Die Pfarrkirche von Benz, weiter südlich und westwärts zum Großen Haff hin gelegen, sollte es schlimm erwischt haben. Dann waren die Dänen gekommen, griffen überraschend an und besetzten weite Teile des Eilands. Doch ihr Triumph dauerte nicht lange, ehe die Kaiserlichen sie vertrieben und wieder selbst auf Usedom hausten. In den Mündungen von Swine und Pene waren Wehranlagen entstanden, auf dem Streckelsberg hielten Wächter an manchem Tag Ausschau nach kleinsten Anzeichen eines Überfalls. Maria hätte nicht zu sagen vermocht, ob vom Meer Angreifer hätten kommen können, die noch grausamer waren als jene, die vom Land her überall unterwegs waren. Im Großen und Ganzen jedoch fühlte sie sich so sicher, wie man sich eben fühlen konnte, wenn alle Welt den Verstand zu verlieren schien, wenn Fürsten, Könige, Heerführer und gar der Papst, der sich doch Vertreter Gottes auf Erden schimpfte, an ihren eigenen Interessen festhielten und bereit waren, ihnen das Leben Unschuldiger zu opfern. Maria war dankbar, dass ihre Mutter die Düsternis dieser Zeit nicht mehr erleben musste. Ihre zarte Seele wäre bald daran zerbrochen. Glücklicherweise war die Ruhr dem Krieg zuvorgekommen und hatte sie hingerafft, als Maria gerade einmal acht Jahre alt gewesen war.
Die nackten Füße in einfachen zerschlissenen Schuhen, ein altes Unterkleid ihrer Mutter, das bereits elf Winter mehr oder weniger gute Dienste geleistet hatte und sicher noch einige Winter würde halten müssen, ein viel zu dünnes Baumwollkleid und darüber der alte Mantel ihres Vaters, um den Kopf einen löchrigen Schal geschlungen, so hatte Maria sich auf den Weg gemacht, um zu sehen, ob der Wald noch etwas Essbares hergab. Vielleicht konnte sie an dem einen oder anderen Strauch noch einige rot leuchtende Hagebutten finden, aus denen sich ein Mus herstellen ließe, das den Körper stärkte.
Vor nicht allzu langer Zeit war sie jeden Morgen mit ihrem Vater im dichten Wald gleich vor den Grenzen ihres kleinen Dorfes Coserow gewesen. Viele Bewohner der Siedlung, alte und junge, hatten damals ihre Häuser verloren. Sie hatten sich notdürftig Verschläge gezimmert. Bei der geringsten Gefahr oder auch nur der Ahnung davon verließen sie diese und retteten sich in den Schutz der dichtstehenden Bäume, die dem, der sich nicht darin auskannte, ein nahezu undurchdringliches Revier boten. Pfarrer Schweidler hatte jeden Tag aufs Neue seine Schäfchen zusammensuchen müssen, als wären sie tatsächlich eine Herde wolliger Vierbeiner, hatte mit ihnen gebetet, ihnen Trost gespendet und war ihnen beigestanden. Es war ein Wunder, dass damals Pfarrhaus und Kirche bei dem bis zum heutigen Tage schwersten Überfall kaum beschädigt worden waren. Nur einige Fenster waren zu Bruch gegangen. Aus Angst um ihr nacktes Leben hatten Maria und ihr Vater sich in einer Erdhöhle oben auf dem Streckelsberg verkriechen müssen. Ein Lächeln huschte über Marias Gesicht. Wahrhaftig, dass sie trotz Kälte und Hunger, trotz durchziehender Kaisertreuer überlebt hatten, war auch so ein Wunder.
Ihr Vater hatte sie gelehrt, die Hoffnung nie aufzugeben. Wie stand es schon in Lukas 12, Vers 24? Seht auf die Raben: Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keinen Speicher und keine Scheune; denn Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel! Maria war gewiss, dass der Herr auch ihren Vater und sie nähren würde. Und so lehrte es sie auch ihre Erfahrung. Die Ostsee und das Achterwasser waren reich an Fisch, der für den Winter getrocknet oder eingesalzen werden konnte. Sie besaßen einen kleinen Gemüsegarten mit spärlichem Ertrag, denn der sandige Boden gab nicht viel her. Und sie besaßen eine letzte Kuh, von der sie immerhin einige Schluck Milch bekamen. Solange es dem Herrn im Himmel gefiel, brauchte sie sich nicht zu sorgen, dass sie verhungerten. Das war einer der Gründe, warum sie einzig dem Herrn im Himmel gehorchte und sonst keinem. So hatte ihr Vater es sie gelehrt. Ebenso wie er ihr beigebracht hatte, beim Beten nicht die Augen zu schließen.
»Du musst stets hinsehen«, hatte er ihr eingebläut, »ob du irgendwo etwas Falsches erkennst, das du in Ordnung bringen kannst. Dir darf nicht entgehen, wenn Hilfe gebraucht wird. Darum halte immer und auch beim Beten die Augen offen!«
Ein Knacken ließ sie herumfahren. Kein Zweifel, der Laut eines Zweiges, der unter einer Schuhsohle gebrochen war. Maria entdeckte den Mann nicht gleich. Es war ein grauer Tag, nur wenig Licht fiel durch die Wipfel der Rotbuchen. Hinter ihren von letzten trockenen, orange leuchtenden Blättern geschmückten Ästen konnte sich der Fremde leicht verbergen. Doch eine Bewegung verriet ihn.
»Wer bist du? Zeig dich, bitte, mein Freund.« Hoffentlich hatte Marias Stimme in seinen Ohren so fest und unerschrocken geklungen, wie sie es beabsichtigt hatte. Nichts.
»Bist du von hier, von Usedom? Gehörst du gar zu unseren Leuten aus Coserow?« Hoffentlich kein Soldat des Kaisers, ein eingefleischter Katholik womöglich. Eine schlimmere Vorstellung konnte es nicht geben. »So zeig dich doch!«, forderte sie ihn erneut auf. Zwei Wimpernschläge vergingen, ehe der Mann sich rührte. Ein Rascheln, dann schob ein Arm in einem höchst sonderbaren Ärmel energisch einige Äste beiseite. Der Fremde trat aus dem Schutz des Gestrüpps auf sie zu.
»Nein, Ihr seid nicht aus unserem Dorf«, stellte sie leise fest. Nicht nur der Ärmel war sonderbar, der gesamte Mantel war es. Dem Anschein nach bestand er aus mehreren Kleidungsstücken, die jemand zusammengefügt hatte. So war ein buntes Gewand entstanden, das an keiner Seite so lang war wie an der anderen. Ein schneller Blick in sein Gesicht. Viel war davon nicht zu erkennen, denn ein Bart, so dicht wie der Urwald, der große Teile der Insel bedeckte, verbarg seine Züge. Ihm länger in die Augen zu sehen, um einzuschätzen, ob er ein gutes Herz hatte, wagte sie nicht.
»Du kannst ruhig weiter mit mir sprechen, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ich bin nur ein einfacher Mann.« Die Stimme war rau und hatte einen harten Klang.
»Vor Gott sind wir alle einfach und doch alle kostbar.« Sie spürte ihr Herz schlagen. Was sollte sie sagen? Sollte sie sich nicht am besten rasch verabschieden und zurückziehen? Es waren gefährliche Zeiten. Selbst als noch Frieden herrschte, wäre es für eine junge Frau nicht gerade ratsam gewesen, mit einem Fremden allein im Wald einen Plausch zu halten. Nicht einmal wenn Frieden wäre, hätte sie eine Vorstellung davon, wie sie sich ihm gegenüber verhalten sollte.
»Auch dann noch, wenn wir gesündigt haben?« Die Bitterkeit in seiner Stimme ging ihr durch Mark und Bein. »Möge der Heilige Johannes Nepomuk mein Geheimnis bewahren«, fügte er kaum hörbar hinzu. Der Schreck fuhr Maria durch die Glieder, ein Katholik, ein Feind!
»Wenn du mit ganzer und reiner Seele büßt, wird Jesus Christus dir vergeben.«
Ängstlich sah sie ihn an, ihre Blicke trafen sich. Welch ein Schmerz lag in seinen Augen! Was mochten sie gesehen haben? Es versetzte ihr einen Stich. Gleichzeitig glaubte sie, direkt in sein Herz sehen zu können. Das war nicht das Herz eines bösen Menschen. »Woher kommst du?« Sie wusste nicht, was sie sonst sagen sollte. Ihr fehlte jede Erfahrung im Umgang mit Männern, von Alten, Kranken oder anderen Bedürftigen einmal abgesehen. Ihr Vater hatte ihr noch keinen zum Heiraten vorgeschlagen, obwohl sie nun wohl das richtige Alter dafür hatte. In diesen Zeiten hatte er andere Sorgen, und ihr fehlte die Gelegenheit, dem Richtigen zu begegnen. War dies womöglich eine solche Gelegenheit? Unsinn! Der Mann sah aus wie ein Wilder. Schorf auf der Nase verriet, dass er sich verletzt hatte. Wie es aussah, war das nicht die einzige Wunde, die er sich eingefangen hatte. Mit Wasser war seine Haut wohl länger nicht in Berührung gekommen, von Seife gar nicht zu reden. Die Augen lagen in tiefen Höhlen und waren gerötet, die Wangenknochen standen zwischen dem Haargestrüpp spitz hervor. Trotzdem, irgendetwas an ihm rührte ihr Herz.
»Lebst du schon immer auf dieser Insel?«, wollte er wissen, ohne ihre Frage beantwortet zu haben.
Maria lächelte zaghaft. »Ja, mein ganzes Leben.«
»Wie, sagtest du, heißt dein Dorf gleich?«
»Coserow. Mein Vater ist …« Sie zog erschrocken die Luft ein und starrte ihn an.
»Ja? Was ist dein Vater?«
Der Pfarrer hier, ein Protestant, der Feind, hämmerte es in ihrem Schädel. Sie hatte ihm anbieten wollen, sich im Pfarrhaus aufzuwärmen, sich zu waschen. Das war unmöglich.
»Er ist gut angesehen bei den Dorfbewohnern.« Maria starrte auf die Spitzen ihrer ausgetretenen Schuhe, als hätte sie gerade ein weiteres Loch darin entdeckt. »Und woher, sagtest du, kommst du gleich?«, fragte sie eilig, um ihn von ihrem Vater abzubringen.
Zum ersten Mal schmunzelte er ein wenig. Zumindest sah es so aus, denn sein Bart zog sich in die Breite. »Ich sagte gar nichts, und das weißt du gut.« Er legte den Kopf schief. »Wie ist dein Name?«
»Verrätst du mir, woher du kommst, sage ich dir meinen Namen.« Sie reckte das Kinn.
Jetzt lachte er, wobei sein Gebiss sichtbar wurde. Die Ecke eines Zahns war abgebrochen. Vielleicht von altem Brot oder rohen Rüben. »Sollte dieser elende Krieg wirklich einen Menschen übriggelassen haben?« Sie verstand nicht gleich. Er wurde schon wieder ernst. »Du bist weder ängstlich noch eine Gefahr. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, jemandem zu begegnen, der das von sich sagen kann. Du gefällst mir.« Sie zog den Schal über ihr Kinn gegen den schneidenden Wind und um ihre Schamesröte zu verbergen. »Ich komme aus Böhmen«, flüsterte er. »Dort war ich zuletzt. Jetzt bin ich heimatlos.«
Was sollte das heißen, dort war ich zuletzt? Böhmen also, damit konnte sie etwas anfangen. Dort hatte alles begonnen. Ihr Vater hatte ihr an den Abenden, die sie zu zweit im Pfarrhaus verbracht hatten, davon erzählt.
»Du musst lernen, Maria«, hatte er sie immer wieder ermuntert. »Nur wer weiß und versteht, kann klug handeln.« Er hatte ihr das Lesen beigebracht, als sie noch ein Kind und ihre Mutter noch am Leben war. Später hatte er sich mit ihr an den Texten von Ovid, Horaz und Vergil erfreut, mit ihr Aristoteles und Heraklit debattiert und sie lateinische Verse abgefragt. Die gemeinsamen Stunden, in denen sie beieinandersitzen und reden konnten, waren mittlerweile weniger geworden. Doch wann immer sich die Möglichkeit ergab, hatte ihr Vater versucht, ihr zu erklären, was in der Welt vorging, was das bedeutete, was die Zeitungen berichteten. So hatte er ihr auch von den ersten Aufständen in Böhmen erzählt.
»Heimatlos, so, so.« Sie lächelte ihn an. »Usedom ist eine gute Heimat.« Und nach kurzem Zögern sagte sie: »Mein Name ist Maria.«
Sie hatte ihm lange und atemlos zugehört. Nicht einmal die Eiseskälte, die ihr die Zehen abzuknabbern drohte, hatte sie gespürt, so gefesselt war sie von den Schilderungen des Mannes gewesen,der sich ihr als Georg vorgestellt hatte. Als ältester Spross eines verarmten Adelsgeschlechts hatte er es für seine Pflicht gehalten, die Familie zu ernähren. Darum war er Söldner geworden, hatte so die eigene Verpflegung gesichert. Von seinem Sold konnten die Eltern, sein Bruder und die beiden Schwestern leben, wenn sie sich bescheideten. Das wenigstens hatte man ihm in Aussicht gestellt. Was kam, war etwas völlig anderes gewesen.
»Der Herzog hatte wenig Freude daran, in seine Privatschatulle zu greifen, um sein gewaltiges Heer zu bezahlen.« Er schnaubte verächtlich. »Wir sollten uns selbst versorgen. Gefechte gegen den Feind, für die wir doch eingestellt und ausgebildet worden waren, kamen kaum vor. Stattdessen verbrachten wir die Stunden, in denen wir nicht gelaufen sind, damit, Bauern und Bürger zu plündern.« Er machte eine Pause. »Die meiste Zeit jedoch sind wir gelaufen. Gelaufen, bis das Blut aus den Schuhen tropfte, gelaufen, bis du die Beine nicht mehr gespürt hast«, erzählte er heiser. »Es sind wohl tausend Meilen, die ich zu Fuß gegangen bin. Von Bayern quer über den Kontinent bis nach Böhmen hinein. Wir hatten das Töten gelernt. Also töteten wir für einen Kanten Brot oder eine Schale Haferbrei. So hungrig waren wir, so erschöpft.« Maria wäre am liebsten davongelaufen, hätte sich die Ohren zugehalten, doch sie spürte, dass Georg reden musste. Und es hätte ihr das Herz gebrochen, ihn an seinen Qualen ersticken zu lassen. »Der Herzog und sein Hofstaat waren dagegen gut versorgt. Neben ihren Reisekutschen wurden sie von Frachtwagen begleitet, die überquollen an Vorräten.« Er schüttelte den Kopf. »Sogar einen Mönch hatten sie dabei. Denk dir, er reiste in einer Sänfte mit Kristallfenstern! Dass wir nur den Mut nicht verlieren sollten, trug er ein Bildnis der Heiligen Jungfrau Maria vor uns her.« Er bekreuzigte sich und sah sie erschrocken an. Sie tat so, als habe sie die Geste nicht gesehen, die man bei einem Protestanten vergeblich gesucht hätte. »Ehe ich einen der Frachtwagen überfallen oder den Mönch an Ort und Stelle geschlachtet hätte, bin ich eines Nachts auf und davon.« Wieder ein unsicherer Blick. Maria ließ sich nichts anmerken. »Wie gut, dass du nur eine Frau bist. Du kannst nicht verstehen, was das bedeutet.«
Dass sie ihn aufknüpfen würden, den Deserteur und Verräter, wenn sie ihn zu fassen bekämen, das bedeutete es, dachte sie. »Und nun lebst du im Wald?« Er nickte. »Du bist von Böhmen zu Fuß bis hierher in den höchsten Norden gelaufen?«
»Auf die paar Meilen kommt es auch nicht mehr an.« Seine Augen wurden groß, sein Blick war starr ins Nirgendwo gerichtet. »Ich hatte kein Ziel, bin immer nur weiter und weiter in die stets gleiche Richtung gegangen. Wenn ich Glück hatte, habe ich eine verlassene Scheune gefunden, in der ich schlafen konnte. Wenn nicht, habe ich mich zwischen Sträuchern und Bäumen verborgen, mir eine Mulde gegraben und mich für die Nacht mit Laub und Baumrinde zugedeckt. Als ich bei der Stadt Wolgast das Wasser gesehen habe, wusste ich, dass ich weit genug von der Truppe des bayerischen Schinder-Herzogs fort war.«
»Bestimmt bist du das. Du solltest dich trotzdem in Acht nehmen. Auf Usedom sind Soldaten des Kaisers einquartiert. Mir scheint, sie könnten in deinem Mantel Fetzen einer Uniform erkennen.«
Er sah an sich herunter. »Du hast recht. Ich werde vorsichtig sein.«
Das letzte Tageslicht wich allmählich der Abenddämmerung. Maria und Georg standen sich unschlüssig gegenüber. Er rieb die Hände, die in fingerlosen Handschuhen steckten, hauchte dagegen.
»Warum kommst du nicht mit mir? Mein Vater hat immer eine Mahlzeit für einen übrig, der Hunger hat. Auch ein Lager für die Nacht sollte für dich zu finden sein.«
Was mochte jetzt in seinem Kopf vorgehen? Sie wurde noch ein bisschen unsicherer. Es war ihr nicht vertraut, dass jemand ihr so lange ins Gesicht sah, ohne ein Wort zu sagen.
»Ihr seid keine Katholiken«, stellte er schließlich fest.
Maria lachte auf. »Denkst du, das macht uns zu schlechten Menschen?«
Er schüttelte langsam den Kopf. »Gewiss nicht. Nicht schlechter, als alle Menschen ohnehin sind. Glaube mir, Maria, wir sind nicht kostbar und gut. Wir sind die grausamsten Raubtiere auf Gottes Erde. Ohne Skrupel und voller Selbstsucht.« Hatte er zu ihr gesprochen oder zu sich selbst? »Was ich meine katholischen Brüder tun sah, war so abgrundtief schlecht. Das muss euch Protestanten das Fürchten lehren.« Sie wollte etwas einwenden, doch er sprach weiter: »Ich danke dir für dein Angebot. Du hast ein großes Herz. Doch ich bringe euch nur in Bedrängnis, wenn ich Gast in eurem Hause bin. Das will ich nicht, und darum kann ich es nicht annehmen.« Es war beinahe dunkel, als Maria an der stattlichen Kirche vorüberhuschte, die Männer an dieser Stelle aus Feldsteinen errichtet hatten, lange bevor ihr Vater und dessen Vorväter das Licht der Welt erblickt hatten. Sie machte sich auf eine Strafpredigt gefasst, denn es war spät geworden. Sie hätte längst zu Hause sein müssen. Als sie das Pfarrhaus betrat, kam ihr Vater ihr bereits entgegen. Hatte sie es doch geahnt.
»Endlich! Da bist du ja.« Sie wollte zu einer Entschuldigung ansetzen. Sie hatte sich genau überlegt, was sie sagen konnte, ohne schwindeln zu müssen, aber auch ohne zu viel über Georg zu verraten. »Ein Bote von diesem unsäglichen Hauptmann von Appelmann war hier«, schnaubte er. »Du glaubst nicht, was dieser ungehobelte Schrat sich herausnimmt!«
»Vater!«, tadelte sie ihn. Maria konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Einerseits weil ihr klar geworden war, dass er nicht wegen ihres langen Fortbleibens in Rage war, andererseits weil er für Peter von Appelmann immer wieder die kuriosesten Bezeichnungen erdachte. Der Hauptmann war von Herzog Philipp Julius von Pommern eingesetzt worden, das Kloster zu Pudgla zu verwalten. Gleichzeitig war er für sämtliche Kirchen der Insel zuständig, hatte ihnen regelmäßig Gelder auszuzahlen, die zur Erhaltung der Gebäude, zur Anschaffung von Chorgestühl oder wenigstens Altarlichten und zur Armenspeisung verwendet werden konnten. Kurzum: Von Appelmann war der Schlüssel zur Schatulle, von der Pfarrer Abraham Schweidler abhängig war. Seit Jahren schon war diese Schatulle fest verschlossen, der Hauptmann war dem Pfarrer die Summe, die der Herzog festgelegt hatte, ein ums andere Mal schuldig geblieben. Immer wieder hatte Schweidler ihn ermahnt, hatte Beträge für bestimmte Erledigungen angefordert und war nicht müde geworden, von Appelmann vor der versammelten Gemeinde scharf anzugreifen. Ohne Erfolg. So war es auch dieses Mal. Seit die Scheiben zu Bruch gegangen waren, pfiff der Wind erbarmungslos durch das Pastorat, welches nicht nur Schweidler und Maria, sondern oft genug auch den verbliebenen zehn Familien Coserows als Unterschlupf diente. Zudem waren nur noch Restexemplare des Katechismus aufzufinden, die übrigen waren nach und nach verschwunden. Es war anzunehmen, dass sich mancher weniger an den darin enthaltenen Worten gewärmt hatte als an einem Feuer, das sich durch das Papier hatte entzünden lassen. Pfarrer Schweidler hatte Hauptmann von Appelmann also um Geld für die Fenster und neue Ausgaben des Katechismus angeschrieben.
»Claus Ewing hat er geschickt, diesen verschlagenen Nichtsnutz«, polterte Schweidler aufgebracht und ging vor ihr her in die Küche, in der es noch ein heiles Fenster gab und es daher etwas milder war. »Er hat es nicht einmal für nötig erachtet, ein Schreiben aufzusetzen. Schickt mir nur diesen Knecht, um mir eine Nachricht zu übermitteln.« Er ballte beide Hände zu Fäusten und fuhr sich im nächsten Augenblick durch das volle Haar, in dem Maria kürzlich die ersten Silberfäden entdeckt hatte. Die Geste war ein sicheres Zeichen, dass er soeben einen Fluch unterdrückt hatte. »Für neue Fenster sei kein Geld vorhanden«, sagte er. »Und die Anschaffung der Lehrbücher sei nicht nötig. Wenn wir sie nur schnell und oft genug selber abschrieben, dann bekämen wir warme Hände, und es sei allen geholfen.« Maria schüttelte den Kopf. Dieser von Appelmann war wirklich kaum zu ertragen. Es war immer das Gleiche. »Du kannst dir vorstellen, was es ihm für eine Freude bereitet hat, diesem sogenannten Kirchenvorsteher Ewing, mir diese Antwort des Hauptmanns zu überbringen. Dümmlich gegrinst hat er die ganze Zeit«, schimpfte Schweidler und ballte schon wieder die Fäuste.
***
Seine Wut war auch am nächsten Morgen noch nicht verflogen. Er stapfte mit einer solchen Wucht über den Ziegelboden nach vorne zu seinem Altar, dass es von den Holzbalken der Decke nur so widerhallte. Maria ließ ihren Blick durch die Reihen der Kirchenbänke wandern. Ihr bot sich das immer gleiche traurige Bild, ein kleines Grüppchen zusammengekauerter Menschen mit rotgefrorenen Nasen und Wangen, die meisten von ihnen nur noch Haut und Knochen, aber anscheinend alle noch bei brauchbarer Gesundheit. Nein, doch nicht alle. Der alte Ernst fehlte, ein Fischer, der unermüdlich dafür sorgte, dass die Leute in Coserow zu essen bekamen. Was er übrig hatte, brachte er in sämtliche Winkel der Insel, um Scholle oder Dorsch gegen Getreide und Gemüse zu tauschen. Wo mochte er stecken? Hoffentlich hatte er sich in dem kalten Wasser, durch das er bei Wind und Wetter watete, nichts weggeholt. Voller Sorge ging Maria noch einmal die Reihen der Leute durch. Vielleicht hatte sie Ernst übersehen. Man konnte ja kaum einen vom anderen unterscheiden, so wie sie alle in derbe Stoffe eingewickelt waren. Ihr schoss der Schreck durch die Glieder. Ewing war da. Ausgerechnet. Ihre Blicke trafen sich, und er nickte ihr zu, die bläulichen Lippen zu einem bösen Lächeln verzogen. Maria erwiderte seinen Gruß so zurückhaltend, dass kaum etwas zu sehen war.
Pfarrer Abraham Schweidler brachte Eröffnung, Anrufung, Verkündigung und Bekenntnis so schnell hinter sich, als erwarte er jederzeit die kaiserlichen Truppen, die über ihn und seine Schäfchen hereinbrechen könnten. Dann war er bei der Predigt angelangt, dem Kern des Gottesdienstes, dem er sich stets mit größter Hingabe widmete.
»Ich will euch vom Gleichnis vom bittenden Freund erzählen, das uns im Evangelium nach Lukas überliefert ist«, begann er mit donnernder Stimme. Maria ahnte Böses. »Es geht darum, dass Männer Gäste bei sich aufnehmen. Diese Männer haben für ihren Besuch nichts zu essen. Also gehen sie, klopfen an eine Tür und bitten um Brot. Nicht für sich, sondern einzig für ihre Gäste, die derjenige, der ihnen geöffnet hat, gar nicht kennt. Doch die Männer, die vor seiner Tür stehen, sind ihm wohl bekannt, sie sind Freunde. Darum gibt er ihnen drei Laibe Brot.« Er machte eine wirkungsvolle Pause, in der sein Blick durch die Reihen der Gläubigen streifte. Er blieb an Ewing hängen, Schweidlers Augen wurden zu Schlitzen. »Das hat er gut getan. Und nun hört, was mir widerfahren ist!«, tönte er, ohne sich von Ewing abzuwenden oder auch nur zu blinzeln. »Ich habe für euch an eine Tür geklopft. Gewissermaßen. Ich habe ein Schreiben an Hauptmann von Appelmann gesandt, der uns eine über die Jahre auf bemerkenswerte Höhe angewachsene Summe schuldig ist.« Maria schloss die Augen und atmete tief ein. Ihr Vater verstand es vorzüglich, Dinge nicht direkt auszusprechen, sie so zu formulieren, dass niemand ihm daraus einen Strick drehen konnte, obgleich ein jeder wusste, was hinter seiner Rede steckte. Leider zog er es nicht selten vor, darauf zu verzichten und sogar Namen zu nennen. Das war nicht sonderlich klug. »Wenigstens das Nötige sollte er uns bezahlen, dass wir die Fenster des Pfarrhauses in Ordnung bringen können. Ich habe ihm erklärt, dass es nicht um mich geht, sondern dass ihr, brave Fischer und Bauern, eine Zuflucht braucht, in der ihr euch aufwärmen könnt. Bis ihr euren Hütten wieder ein Dach aus Stroh aufgesetzt habt, bis der Frühling kommt. Doch dieser Hauptmann ist nicht wie der Mann aus dem Gleichnis. Er verweigert den Hungernden das Brot.« Schweidler hatte die Stimme gesenkt. Ob die Leute wussten, dass das Gleichnis nichts mit Brot oder sonstigen milden Gaben zu tun hatte, sondern dass es bedeutete, man solle nur beten und vertrauensvoll daran glauben, dass Gott die Gebete erhört? »Er will euch den Schutz vor Sturm und Kälte nicht gönnen.« Schweidler hatte begonnen, vor seinem Altar auf und ab zu gehen. »So ist die Obrigkeit! Dumm, schmutzig, den Tieren gleich, das sind Bauern in ihren Augen.« Ein leises Raunen setzte ein. Maria warf einen verstohlenen Blick zu Ewing. Hätte er doch nur wütend ausgesehen oder entgeistert. Doch er lächelte sein teuflisches Lächeln. Wahrscheinlich dachte er selbst nicht viel besser vom Hauptmann. Was er hörte, bescherte ihm Schadenfreude und Munition, um gegen Schweidler zu schießen, den er vermutlich noch weniger leiden konnte als von Appelmann.
»In Wahrheit sind es die Bauern und die Fischer, die das gesamte Volk ernähren«, sprach Schweidler weiter. »Und nicht nur das Volk, sondern die vielen einquartierten Soldaten noch dazu.« Er blickte in die Runde. »Obendrein die Gebildeten und Wohlgenährten«, fügte er voller Abscheu hinzu. Beifälliges Murmeln. Schweidler erhob die Stimme: »Dumm ist der, wer die Bauern und die Fischer geringschätzt. Die, die ihre Seele verhökert haben, statt sie dem Herrn zu schenken, werden seine Strafe zu spüren bekommen«, endete er.
Ewing würde umgehend zu von Appelmann rennen und sich einen boshaften Kommentar nicht verkneifen können, dessen war Maria sicher. Es kam noch schlimmer. Noch ehe der Gottesdienst vorüber war, stahl der Kirchenvorsteher sich davon, so eilig hatte er es, dem Hauptmann die Ungeheuerlichkeit zu berichten. Vor der Kirche musste der Pfarrer Fragen beantworten. Die Menschen in Coserow wollten Näheres über Schweidlers Schreiben und die Antwort des Hauptmannes wissen. Was genau habe der ausrichten lassen? Habe er sie wahrhaftig als dumm und schmutzig bezeichnet? Maria versuchte indes herauszufinden, was mit dem Fischer Ernst sei.
»Er liegt im Bett«, erzählte sein Weib ihr niedergeschlagen. »Glüht wie ein Ofen, mein armer Mann. Ich fürchte, Maria, es steht schlecht um ihn.«
Hoffentlich gefiel es dem Herrn nicht, Ernst schon jetzt zu sich zu rufen. Die anderen erfahrenen Fischer hatten Hunger und Not bereits dahingerafft, oder sie hatten sich aus dem Staub gemacht, um in Wolgast oder sonst wo womöglich leichter etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Beklommen ging Maria zurück ins Pfarrhaus und machte sich daran, ihr Tagewerk zu erledigen.
***
Was war das? Maria richtete sich von ihrem Nachtlager auf und starrte in die Dunkelheit. Ihr Herz klopfte. Was hatte sie so abrupt aus dem Schlaf gerissen? Sie lauschte mit angehaltenem Atem. Nichts, kein Laut, außer dem gleichmäßigen Schnarchen ihres Vaters in der Kammer nebenan. Vielleicht hatte sie auch nur schlecht geträumt. Das kam in den letzten Jahren immer häufiger vor. Sie versuchte sich zu entsinnen, doch die Erinnerung war schwach. Da war ein Mann gewesen, ein Mann im Wald. Hatte sie von diesem Georg geträumt? Wie es ihm wohl ergehen mochte? Sie kauerte sich unter ihrer Decke zusammen und fröstelte. Der Ziegel, den sie vor dem Zubettgehen im Ofen aufgeheizt hatte, war längst kalt. Wie eisig mochte es draußen im Wald unter freiem Himmel sein? Allmählich schlug ihr Herz wieder langsamer, ihre Lider wurden schwer. Noch einmal meinte sie etwas zu hören, spitzte die Ohren, dann schlief sie wieder ein.
***
Wie an jedem Tag war sie auch an diesem früh auf den Beinen, obwohl sie noch ein weiteres Mal aus dem Schlaf hochgeschreckt und nun entsprechend matt war. Sie hätte schwören können, sie habe Schritte gehört. Oder sogar Stimmen? Gleichgültig, es war keine Zeit für Hirngespinste oder für Müdigkeit. Maria hatte am Vortag nach Ernst gesehen. Viel war nicht mehr übrig von dem einst kräftigen Mann. Wenn er sich weiter so schindete, um die Bewohner des Dorfes zu ernähren und um seine eigene Familie durchzubringen, würde es böse enden. Wenn es mal nicht schon so weit war. Maria würde tun, was in ihrer Macht stand, um ihm zu helfen. Sie hatte noch etwas von dem Grünkohl im Garten stehen lassen, den sie dem Boden abgerungen hatte. Den würde sie ihm bringen. Er hatte ihn jetzt nötiger als sie und ihr Vater. Sein Weib konnte ihm einen Brei daraus zubereiten. Die schlechten Blätter waren immer noch gut genug, um Umschläge damit zu machen. Maria richtete Haferschleim für ihren Vater und für sich an. Sobald das erste bleierne Licht Coserow erhellte, warf sie sich ihren Mantel über und trat ins Freie. Die Luft stach ihr kalt in die Lunge, doch schwebte nicht auch schon eine Ahnung von Frühling darin? Um wie vieles leichter würde wieder alles sein, wenn die Temperaturen stiegen, wenn die Natur ihnen den Tisch mit Früchten und Getreide deckte. Beschwingt von dem Gedanken daran, dass es bald wärmer und freundlicher sein würde, hüpfte sie die drei steinernen Stufen vor dem Haus hinab und folgte dem Pfad in den Pfarrgarten. An der Pforte blieb sie stehen, als sei sie in diesem Moment zu einer Statue erstarrt, wie sie sie von Gemälden aus dem Alten Rom oder Griechenland kannte.
»Lieber Gott, wer hat das nur getan?«, flüsterte sie atemlos, den Blick auf das Bild der Zerstörung gerichtet, das sich ihr bot. »Und warum nur?« Maria konnte sich ihre Fragen leicht selbst beantworten. Ganz gewiss hatte Ewing nichts Eiligeres zu tun gehabt, als zu von Appelmann zu rennen und zu berichten, was er in der Kirche gehört hatte. Üble Ausschmückungen inbegriffen, versteht sich. Und offensichtlich hatte der Hauptmann in der Nacht seine Schergen geschickt, damit die den Garten des Pfarrers Schweidler verwüsten. Es wäre nicht das erste Mal, dass von Appelmann ihren Vater drangsalierte. Hatte sie also doch nicht geträumt. Wenn sie doch nur ein Licht angezündet und nach dem Rechten gesehen hätte. Vielleicht wären die Feiglinge dann geflüchtet und sie hätte Schlimmeres verhindert. Oder sie hätten sie an Ort und Stelle erschlagen. Unter einem groben Holzbrett lugten grüne Blätter hervor. Maria schossen die Tränen in die Augen. Diese Dummköpfe hatten nicht einmal den Grünkohl gerettet, um ihn selbst zu verspeisen. Dann hätte der wenigstens noch jemandem nutzen können, wenn auch bösen Kreaturen, denen sie ihr mühevoll angebautes Gemüse am wenigsten gönnte. So war er verloren, ganz ohne jeglichen Sinn zerstört. Sie hob das Brett an und warf es zur Seite. Nein, damit war nichts mehr anzufangen. Der letzte Rest Grünzeug, der in dem Beet gediehen war, war dahin. Obendrein hatte jemand eine stinkende Brühe ausgekippt. Sie hielt sich die Hand vor Mund und Nase und bemühte sich, nur flach zu atmen. Was war das? Maria ging die Wege zwischen den Beetabschnitten entlang. Überall dunkle, fast schwarze Flecke. Das konnte Pech sein. Sie blieb stehen, stemmte die Hände in die Hüften und stieß einen tiefen Seufzer aus. Dann ging sie zurück ins Haus. Aus dem Keller, der unter einem Teil des Pfarrhauses lag und in dem man nicht aufrecht stehen konnte, so niedrig war er, holte sie einen Spaten und stapfte wieder hinaus. Mit Wucht trieb sie das Metall in die Erde. Der Boden in diesem Teil der Insel war sandig. Hoffentlich nahm die Krume es ihr nicht zusätzlich übel, dass sie sie in ihrer winterlichen Ruhe stören musste. Schaufel um Schaufel trug Maria ab, bis ihr der Schweiß auf der Stirn stand und den Rücken hinablief. Zuletzt schaufelte sie das lose Material ab, trug es Eimer für Eimer an das hinterste Ende des Grundstücks und bedeckte anschließend das umgegrabene Beet mit Kiefernzweigen, die sie eigentlich geschnitten hatte, um die Kirche für das Weihnachtsfest zu schmücken. Seit ihr Vater davon gehört hatte, dass eine schlesische Herzogin den Brauch eines Weihnachtsbaumes pflegte, bat er Maria jedes Jahr darum, das Gotteshaus mit Zweigen zu dekorieren, in die sie Äpfel und winterliche Beeren zu legen pflegte. Äpfel gab es in den letzten Jahren nicht mehr, doch auf die Kiefern mochte niemand mehr verzichten. Um sie zu verbrennen, hatte Maria sie in dem kleinen Unterstand trocken gelagert, in dem ihre Kuh, das letzte von drei Tieren, Zuflucht vor Wind und Kälte fand. Gottlob hatten die Unholde den Vorrat an getrocknetem Holz in der Dunkelheit nicht bemerkt.
Sie war eben mit der Arbeit fertig und wollte den Spaten zurücktragen, als sie Helena über den Platz vor der Kirche laufen sah. Mit schnellen Schritten kam die Tochter des Fischers Ernst auf das Pfarrhaus zu, rutschte aus und wäre um ein Haar gestürzt. Kein Wunder, es hatte zu regnen begonnen, und das Wasser gefror augenblicklich auf dem eisigen Boden. Maria blieb an der Haustür stehen, das Werkzeug in der Hand.
»Der Pfarrer muss kommen. Schnell«, brachte Helena atemlos hervor, als sie Maria erreicht hatte. »Es geht zu Ende. Mein Vater will die Beichte ablegen.« Sie zögerte, dann fuhr sie leise fort: »Was er wohl zu beichten hat? Ich kenne kein reineres Herz.« Tränen schimmerten in ihren Augen.
»Ach, Helena, nein!« Maria legte der keuchenden Frau eine Hand auf die Schulter. Das war zu befürchten gewesen. Dass es nun aber so schnell ging … »Geh du zurück zu ihm, mein Vater wird gleich bei euch sein.«
Helena nickte, machte kehrt und lief im gleichen Tempo davon.
»Mach nur langsam!«, schrie Maria ihr nach. »Nicht, dass du dir noch die Beine brichst.« Dann ging sie hinein. »Vater? Der Fischer Ernst liegt im Sterben«, rief sie, während sie eilig in den Keller hinabrannte. Als sie wieder hinaufstieg, nahm sie zwei Stufen auf einmal. Der Schweiß von der anstrengenden Arbeit war auf ihrer Haut getrocknet, sie fröstelte. »Hast du mich gehört?« War er nicht im Hause?
»Gehört ja, aber nicht verstanden«, brummte er.
Hätte er nicht antworten und nachfragen können? Maria seufzte. Es war immer wieder das Gleiche. Manches Mal wusste sie nicht, ob er überhaupt in der Nähe war, weil er, wenn er sie nicht genau verstehen konnte, einfach schwieg. Jetzt war keine Zeit, ihm einen Vortrag zu halten. Sie riss die Tür zur Studierstube auf, in der er früher theologische Abhandlungen verfasst hatte und heute noch seine Predigten schrieb und den Kindern des Dorfes Religionsunterricht erteilte.
»Der Ernst stirbt. Helena war gerade hier.«
Ohne ein weiteres Wort stand Pfarrer Schweidler auf und verließ den Raum. Maria hatte ihm noch nicht einmal sagen können, was draußen im Garten geschehen war.
Am Abend saßen sie beieinander. Fischer Ernst war gestorben, gleich nachdem er dem Pfarrer seine vermeintlichen Sünden anvertraut hatte.Er hatte bei einem Tauschhandel eine Möhre aufgehoben, die jemandem zu Boden gefallen war. Die hatte er blitzschnell in seine Manteltasche verschwinden lassen, ohne dass sie in der Berechnung des Warenwertes, den Ernst hatte in Fisch aufwiegen müssen, einbezogen worden wäre. Als ob nicht jeder eine solch glückliche Gelegenheit gerne genutzt hätte!
»Es war ihm wichtig,sein Gewissen zu erleichtern.Verständlich, nicht wahr, wenn derartig schlimme Vergehen es belasten?« Schweidler lächelte matt.
»Ein reines Herz«, meinte Maria nachdenklich, »zerbricht eben schon unter der kleinsten Last. Wie viel leichter hat es da der dickfellige Sünder!«
»Aber nur solange er auf Erden wandelt«, wandte Schweidler ein wenig theatralisch ein. Dann zwinkerte er ihr zu. »Ist er tot, schmort er in der Hölle.«
»Bloß kann er dummerweise seine Mitmenschen mit seiner Boshaftigkeit quälen, bis es mal so weit ist«, gab Maria zu bedenken.
»Du denkst nicht zufällig an diesen Appel-Hauptmann?«
»An den und seine Handlanger.« Sie rückte ein Stück näher an den Ofen heran und rieb die kalten Finger, in denen sie eine Näharbeit hielt. Die Strümpfe, die sie zu stopfen versuchte, waren schon das reinste Flickwerk, doch sie fortzuwerfen, kam nicht in Frage. Maria holte Luft. »Ich kam noch nicht dazu, es dir zu erzählen. Jemand hat sich in der letzten Nacht über unseren Garten hergemacht.«
»Sagtest du nicht, wir hätten noch Grünkohl stehen?« Er bekam große Augen, in denen schlimmste Befürchtungen zu lesen waren.
»Das sagte ich.«
»Jemand hat den Grünkohl gestohlen?« Jetzt ballte er beide Fäuste, kniff die Lippen zusammen und atmete tief durch. »Dann muss wohl einer sehr hungrig gewesen sein. Also ist das Gemüse im richtigen Magen gelandet«, brachte er grollend hervor. Da hatte eindeutig der Pfarrer gesprochen, der Mensch Abraham Schweidler konnte die Enttäuschung nicht verbergen. Er aß für sein Leben gern Grünkohl. Allein bei dem Gedanken daran lief ihm das Wasser im Munde zusammen.
»Leider nicht, Vater.« Sie bat ihn, sich nicht übermäßig aufzuregen, obwohl sie wusste, dass ihr dieser fromme Wunsch nicht erfüllt werden würde. Dann berichtete sie, wie sie das kleine Feld hinter dem Haus am Morgen vorgefunden hatte.
»Dieser verfl…, dieser Unmensch von Appelmann!«
»Wir wissen nicht, ob er für die böse Tat verantwortlich ist«, lenkte Maria ohne jede Überzeugung ein. »Wir dürfen ihm nicht die Schuld geben.«
»Wer sonst sollte das wohl getan haben? Wir wissen beide, dass er es war. Nicht er selbst natürlich, dazu wäre er zu feige. Er hat den Mut einer Stubenfliege.« Seine Stirn lag in Falten, seine Augen funkelten. Mit einem Mal seufzte er, und seine Gesichtszüge wurden milder. »Ach, mein Kind, man könnte verzweifeln, wüsste man nicht, dass der Herr im Himmel für einen sorgt. So viel Grünkohl war es wohl nicht mehr, was? Das werden wir schon verschmerzen können.«
»Ich hätte ihn sowieso dem Ernst bringen wollen. Aber ihm hätte das Grünzeug auch nicht mehr geholfen.«
»Nein, für ihn war jede Hilfe zu spät. Er ist jetzt beim Herrn und darf sich den Bauch vollschlagen.« Schweidler lächelte zufrieden. Nach einer Weile meinte er: »Ich habe mit dem Paasch gesprochen. Er sagt, unten im Liper Winkel herrsche Frieden.« Maria hob die Augenbrauen. »Keine einquartierten Soldaten, nichts!«
»Wie sollte das möglich sein?«
»Ich weiß es nicht,mein Kind.Aber siehst du,der Paasch ist Tischler. Er kommt viel herum, um seine Dienste anzubieten. Allerorten geht etwas zu Bruch, da sind seine kräftigen geschickten Hände gefragt.« Schweidler stand auf und legte zwei Ziegelsteine in die Glut, damit sie bald zu Bett gehen und sich daran wärmen konnten. »Die Leute im Liper Winkel müssen natürlich auch die stets wachsenden Abgaben zahlen, mit denen dieser Wahnsinn finanziert wird. Geld bleibt ihnen kaum übrig. Aber wie er berichtet, sind ihre Häuser heil, ihr Vieh steht unbehelligt im Stall. Paasch hat Speck von ihnen bekommen, Eier und Brot.« Er ließ sich wieder auf seinen Stuhl sinken. Vergnügt zwinkerte er ihr zu. »Morgen will er kommen und uns etwas davon bringen. Ich soll für ihn beten, dass er auch weiterhin Arbeit findet, die gut entlohnt wird. Das will ich für eine Scheibe Speck und zwei Eier gern tun.«
Kapitel 2
Wenige Tage nachdem Ernst gestorben war, setzte Tauwetter ein. Die Aussicht auf etwas Wärme, auf die ersten Krokusse, die ihre Köpfe herausstecken und der Welt ein bisschen Farbe schenken würden, war wunderbar. Dummerweise hatte dieser Lichtblick, wie alles im Leben, eine dunkle Seite. Alle Wege, die eben noch knüppelhart gewesen waren, verwandelten sich in Morast. Noch bedeckte der Matsch nur die Ränder der Schuhe. Ging es so weiter, würde man bald bis zum Knöchel darin versinken.
Maria ging, die Röcke gerafft, durch den Garten. Sie wollte sehen, ob sie der Kuh ein Eimerchen Milch entlocken konnte. Am Unterstand angekommen, schrie sie auf. Sie konnte ihren Blick nicht von dem grausamen Bild wenden, das sich ihr bot. Die Kuh lag im Stroh, die toten Augen weit aufgerissen.Überall war Blut.Aus dem Fleisch des Tieres fehlten Stücke,als hätte jemand sie einfach herausgerissen. Die Innereien quollen aus dem leblosen Körper, lagen klebrig auf dem schwarz-weißen Fell.
»Was ist denn los? Ist etwas passiert?« Schweidler eilte herbei. »Du hast mich mit deinem Geschrei erschreckt.« Er blieb wie angewurzelt neben ihr stehen und sagte kein Wort mehr. Doch sein entsetztes Schweigen dauerte nicht lange. »Dieser Teufel!«
»Vater!« Maria starrte ihn an.
»Ich bin ein Mann Gottes, Kind. Sei gewiss, ich erkenne den Teufel oder dessen Handschrift. Und ich weiß, wie ich gegen ihn vorzugehen habe. Ich lasse ihm das nicht durchgehen. Das Maß ist voll«, fauchte er heiser. »Ich werde dem Herzog von Pommern eine Beschwerde senden. Soll der sich mit diesem Scheusal Appelkopp abgeben, ihn zurechtweisen und uns endlich schicken, was uns längst zusteht.«
Maria hatte sich von dem Schock erholt. Sie betrachtete die verendete Kuh genauer. »Und wenn es nicht der Hauptmann war? Dann beschuldigst du ihn zu Unrecht und wirst in Zukunft nur noch mehr Ärger mit ihm haben.« Sie strich sich nachdenklich eine Strähne des rötlichen Haars hinter das Ohr, die aus dem Wolltuch hervorgerutscht war.
»Ich habe der Gemeinde von dem schändlichen Verhalten dieses Appelmann berichtet. Am nächsten Tag ist unser Garten verwüstet, und bald darauf liegt unsere einzige Kuh tot in ihrem Unterstand. Viel hat sie nicht mehr gegeben bei dieser kargen Kost, aber einen Liter oder etwas mehr hatten wir jeden Tag von ihr. Damit ist’s nun auch vorbei. Was glaubst du, wer sonst sich jetzt die Hände reibt und über unser Unglück freut, wenn nicht dieser von Hampelmann?«
»Er wird jedenfalls kein Mitleid mit uns haben, das steht fest.«
»Natürlich nicht, er kennt kein Mitleid. Mit niemandem. Dieser Mann kennt nur seine Habgier. Ein Betrüger ist er und ein Schürzenjäger, der schon mehr als ein Weib verleitet hat, mit ihm in Unzucht zu leben.« Schweidler schüttelte angewidert den Kopf. »Ich werde dem Herzog reinen Wein einschenken. Punktum.«
»Es könnte ein Wolf gewesen sein«, gab Maria zu bedenken. »Die Spuren sehen eher nach Krallen und Klauen aus als nach einem Messer.«
»Hm, ein Wolf also. Unmöglich ist das nicht«, knurrte Schweidler und trat von einem Fuß auf den anderen. »Lauf rüber zum Weber und sag ihm, er soll kommen und das Tier zerlegen. Wenn unsere Kuh schon tot ist, wollen wir wenigstens noch unsere Speisekammer mit ihrem Fleisch füllen.« Er drehte sich um und ging zum Haus zurück. »Das Fell können wir zum Tausch anbieten«, rief er ihr noch über die Schulter zu.
Maria machte sich augenblicklich auf den Weg. Erst der letzte Rest Grünkohl, jetzt auch noch die Kuh. Sie glaubte selbst, dass von Appelmann dahintersteckte, und es fiel ihr schwer, ihren Groll nicht gegen ihn zu richten. Was sie jedoch noch weit mehr beschäftigte, war die Sorge, wovon sie nun leben sollten. Manches Mal war es wahrhaftig nicht leicht, auf Gott zu vertrauen. Wie so oft in solchen Momenten, rief sie sich Lukas 12, Vers 24 ins Gedächtnis. Der Rabe wurde genährt, ohne dass er Vorräte anlegte. Der Herr würde auch sie und ihren Vater nicht vergessen. Das Haus des Schlachters Weber lag etwas außerhalb am anderen Ende des Dorfes Coserow. Sie musste ein Stück auf der Straße in Richtung Damerow laufen. Nicht lange nachdem sie den Dorfplatz mit seiner alten Eiche, das Herz Coserows, und dann auch die letzten Häuser hinter sich gelassen hatte, preschte ihr aus Richtung Damerow ein Reiter entgegen. Sie sprang zur Seite. Schon war er vorüber. Hatte der Kerl den Verstand verloren? Um ein Haar hätte sein Pferd sie erwischt. Sie sah an sich herunter. Na wunderbar, die Hufe des Tieres hatten Matsch durch die Luft geschleudert, der nun an ihrem Kleid klebte. Und sogar an ihrer Wange, wie es sich anfühlte. Während sie sich ärgerlich mit dem Handrücken über das Gesicht wischte, hörte sie, wie der Fremde seinen Gaul mit einem Kommando dazu brachte, langsamer zu werden. Die Flecken auf dem Stoff würde sie besser trocknen lassen und dann ausbürsten.
Das Hufgeklapper hatte aufgehört. Ein dumpfer Schlag auf nassem Boden. Wahrscheinlich hatte der Reiter abgesessen. Maria drehte sich um. Tatsächlich, das Pferd am Zügel führend kam er auf sie zu. Nicht nur, dass er ein Reittier besaß, er war auch noch auffallend gut gekleidet. Es war nicht zu übersehen, dass es diesem Herrn weit besser ging als den armen Dorfbewohnern. Maria verschränkte die Arme vor der Brust und drückte das Kreuz durch.
»Gottlob, wie es aussieht, ist Euch nichts zugestoßen.«
»Was nicht Euer Verdienst ist. Ich verdanke mein Leben meiner Aufmerksamkeit und Schnelligkeit.«
»Ich bitte Euch um Verzeihung, ich wollte Euch nicht erschrecken.« Er lächelte entschuldigend. »Dummerweise ist dieser Hengst nicht zu kontrollieren. Ich mag sein feuriges Temperament, gleichzeitig fürchte ich es auch.« Er klopfte liebevoll das glänzend-braune Fell.
»Wenn Ihr es nicht im Griff habt, solltet Ihr wohl besser ein anderes Reittier wählen oder zu Fuß gehen«, schlug Maria vor.
Er lachte auf und ließ dabei sein makelloses Gebiss sehen. »Zu Fuß bis hinauf an die Mündung des Penestroms! Ihr seid drollig.«
»Andere gehen tausend Meilen quer durch das ganze Reich mit schlechteren Schuhen an den Füßen, als Ihr sie tragt«, entgegnete sie finster.
Er nickte bedächtig. »Wohl wahr.« Jetzt sah er an ihr herunter. »Ich fürchte, wir haben das Kleid der Dame ruiniert«, sagte er und blickte sein Pferd an, als würde er wirklich mit ihm sprechen. Dann wandte er sich Maria zu. »Sagt, wie können wir das wiedergutmachen?«
»Ich glaube kaum, dass der Hengst die beste Wahl ist, wenn es darum geht, die Röcke einer Frau zu reinigen.« Sie musste lächeln. Die Art, wie er mit dem und über das Tier sprach, amüsierte sie.
»Ich muss gestehen, dass auch mir Übung in dieser Disziplin fehlt.« Der Fremde setzte eine zerknirschte Miene auf. Von Hauptmann von Appelmann einmal abgesehen, war dieser Mann seit langem der erste, den sie zu Gesicht bekam, der nicht unter Mangel zu leiden schien. Er wirkte gesund und kräftig, hatte eine schlanke sportliche Figur. Unter einer Fellmütze lugten blonde Haare hervor. Er mochte einige Jahre älter sein als sie, doch nicht eben viele.
»Wollt Ihr mir Euren Namen nennen? Dann sende ich Euch einige Handbreit Stoff, das sollte für ein neues Kleid reichen.« Tischler Paasch wollte Speck und Eier bringen. Dieser Mann hier versprach Stoff. Sie war der Rabe aus dem Gleichnis, ging ihr durch den Kopf.
»Was belustigt Euch so?«
»Nichts, gar nichts.« Maria sah ihm in die Augen. Freundliche blaue Augen, nicht von den Schrecken und Sorgen des Krieges getrübt. »Ich bin Maria Schweidler, die Tochter des Pfarrers von Coserow.«
Ein Schatten huschte über sein Gesicht. »Das seid Ihr«, stellte er fest. »Euer Vater macht viel von sich reden. Nicht nur Gutes, wenn Ihr mir die Bemerkung erlaubt. Er macht sich nicht nur Freunde.«
»Jesus Christus und Gott der Herr sind seine Freunde. Sie wissen, dass er nicht falsch Zeugnis redet.« Sie reckte das Kinn.
Er nickte. »Nicht nur sie wissen das. Betrüblicherweise ist es nicht ungefährlich, stets unverblümt die Wahrheit zu sagen. Das sollte er bedenken.« Er sah sie eindringlich an. Sollte das eine Drohung sein? »Ich muss weiter, Maria Schweidler. Gebt auf Euch acht!« Damit stieg er in den Steigbügel und schwang sich geschmeidig auf den Rücken des Hengstes. Er hob noch einmal die Hand zum Gruß, dann preschte er davon.
Maria blickte dem Reiter noch nach, da kam Magda, die Frau eines Fischers ihr entgegen, den man vor zwei Wintern erschlagen hatte, als er seinen Fang nach Hause trug. Sie war ganz aus der Puste, so hatte sie sich beeilt, zu Maria aufzuschließen.
»Was hattest du denn mit dem zu schaffen?«, wollte sie wissen und deutete in die Richtung, in die das Pferd soeben davongaloppiert war.
Maria zeigte auf ihr derbes Wollkleid. »Frag lieber, was sein Gaul mit mir zu schaffen hatte. Wenigstens hatte der Fremde so viel Anstand, mir den Schaden ersetzen zu wollen. Ich werde beten, dass er sein Wort hält.«
»Der Fremde? Hast du denn das Wappen auf der Satteltasche nicht gesehen?« Maria schüttelte den Kopf. Da war ein blaues Bildchen gewesen, eine Zeichnung vielleicht, fiel ihr ein. Das hatte sie bemerkt, als er aufgesessen und das Pferd in die andere Richtung gewendet hatte. Es war ihr nicht wichtig erschienen. »Das muss einer aus dem Hause von Neuenkirchen gewesen sein. Vielleicht Hans. Das soll der Jüngste sein. Oder Rüdiger. Von dem hört man nichts Übles.«
Gemeinsam setzten die beiden Frauen den Weg fort. Magda wusste erstaunlich viel über das alte Adelsgeschlecht zu berichten. Seit Hunderten Jahren lebten sie angeblich auf Usedom. Zunächst hörte Maria noch voller Spannung zu. Der Name von Neuenkirchen war ihr natürlich schon untergekommen. Die Familie sollte ein Wasserschloss in Mellentin besitzen. Das lag südlich von Coserow und wäre nicht so schwer zu erreichen gewesen, läge das Achterwasser nicht genau dazwischen. Dann wurden die Geschichten, die Magda zum Besten gab, immer bunter und detailreicher. Es sah sehr danach aus, als ginge ihre Phantasie mit ihr durch. Maria begann, ihren eigenen Gedanken nachzuhängen.
»Die Geldsäcke stecken doch sowieso alle unter einer Decke«, sagte Magda gerade wütend. »Soweit ich weiß, ist der von Neuenkirchen ja ganz dicke mit dem von Appelmann. Na, gleich und gleich gesellt sich eben gern.« Maria seufzte. Wenn der Reiter wahrlich aus demselben Holz geschnitzt war wie der bösartige Hauptmann, dann würde sie lange auf Stoff für einen neuen Mantel oder ein warmes Kleid warten können.
Nachdem sie den Auftrag zur Zerteilung der Kuh überbracht hatte, ging Maria an das Ufer der Ostsee. Der Wind hatte aufgefrischt. Vielleicht hatte sie Glück und fand etwas Treibholz, das sie zum Trocknen in den Unterstand legen konnte. Oder einen Brocken Bernstein. Noch immer war es offiziell verboten, sich ohne Grund am Strand aufzuhalten, das wusste sie wohl. Doch seit der Krieg den Menschen ihren Alltag diktierte, war kaum noch ein Strandwächter an den Ufern der Ostsee gesehen worden, der kontrollierte, ob jemand sich womöglich ein Stückchen Bernstein beiseiteschaffen wollte. Maria hatte keine Angst, ein jeder ging mal am Saum der Wellen entlang, um nach dem baltischen Gold Ausschau zu halten. Der Geruch von Algen stieg ihr in die Nase. Sie schob die kalten Hände tief in die Manteltaschen und holte kräftig Luft. Sie liebte diesen Duft, es roch nach Heimat. Der Wind trieb ihr die Tränen in die Augen, hier wo er ungebremst über den hellen Sand fegen konnte. Maria sah sich um. Da war nichts, was sie mit nach Hause hätte nehmen können. Also wandte sie sich ab, um sich auf den Heimweg zu machen. Im letzten Augenblick nahm sie eine Gestalt wahr. War womöglich doch ein Strandwächter unterwegs? Sie hatte nichts aufgelesen, trotzdem würde sie erklären müssen, was sie hier machte. Es hatte den Anschein, als wolle da jemand einige Schritte von ihr entfernt ebenfalls vom offenen Strand in den Schutz der Wälder zurückkehren. Maria blinzelte gegen den Sturm. War das nicht …? Tatsächlich, das musste Georg sein, der Wilde, der aus Böhmen bis hierherauf nach Usedom zu Fuß gegangen war. Georg hatte auch sie erkannt, denn er blieb stehen und winkte ihr zu. Mit der anderen Hand hielt er etwas in die Höhe. Sie zögerte. Was hatte das zu bedeuten? Sie konnte beinahe glauben, er wolle sie zu sich rufen. Wahrhaftig, er formte mit beiden Händen einen Trichter vor seinem Mund, doch seine Stimme schaffte es kaum bis zu ihr, denn sie wurde von einer Böe weggetragen. Maria glaubte jedoch, ihren Namen erkannt zu haben. Sie ging auf ihn zu, langsam erst, dann schneller. Der weiche Sand gab bei jedem Schritt unter ihren Schuhen nach. Als sie bei Georg ankam, musste sie husten und nach Luft ringen.