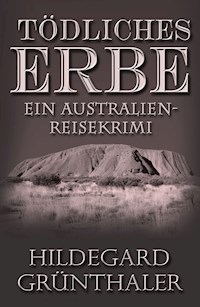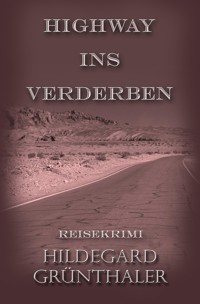Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Er wohnt in einer Flasche und er ist stark und mächtig. Die Götter haben Kalatur, den Geist des Rauches, in grauer Vorzeit geschaffen, damit er den Menschen beistehe und helfe. Aber er hat keinen freien Willen, denn er steht unter dem Zwang einer Beschwörungsformel. Wer diese Formel kennt, ist mächtiger als der mächtige Geist des Rauches, denn auf Befehl muss Kalatur auch gegen seinen Willen Böses zu tun. Die Magierin, die den Dschinn in seiner Flasche bannt, hofft, dass der Zauber so lange wirkt, bis Kalaturs Energie erloschen ist. Fast wäre ihr Plan geglückt. Doch rund 3000 Jahre später begleitet der 12-jährige Philipp Baumann seine Großmutter auf einer Reise durch Marokko, wo sie eine alte, blaue Flasche erstehen ... Philipp befreit Kalatur aus seiner Flasche, und der Geist des Rauches glaubt sich damit auch von den Zwängen der Beschwörungsformel erlöst, denn wer soll die Formel nach 3000 Jahren noch kennen? Doch schon bald muss Kalatur entdecken, dass ihm bereits Dschinnjäger auf den Fersen sind, denn es existiert noch eine alte Keilschrifttafel mit Fragmenten der Beschwörungsformel. Nun ist nicht nur er, sondern auch Philipp in höchster Gefahr, denn die Dschinnjäger glauben, dass Philipp die Beschwörungsformel kennt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE BESCHWÖRUNGSFORMEL
Abenteuer- und Fantasyroman für junge Leser von 9 - 99
von
HILDEGARD GRÜNTHALER
Text: Copyright by © Hildegard Grünthaler
Cover: Copyright by © Hildegard Grünthaler
E-Mail: [email protected]
https://www.schmoekerseite.de
www.wohnmobil-weltreise.de
Inhaltsverzeichnis
2. KALATUR, DER GEIST DES RAUCHES
3. DER BANN
4. EIN SOUVENIR AUS MARRAKESCH
5. HOFFNUNGSSCHIMMER
6. DIE BEFREIUNG
7. FREIHEIT MIT HINDERNISSEN
8. FLIMMERKISTEN UND MÄRCHENGEISTER
9. KOMPLIZIERTE NEUE WELT
10. OMNIBUSABENTEUER
11. ENTDECKT
12. DIE BLACK-DEVILS-MOFAGANG
13. HEIMWEH
14. FLIEGEN IST DOCH SCHWIERIGER ALS BUSFAHREN
15. EIN REISEPASS FÜR KALATUR
16. GEFAHR AUS DER VERGANGENHEIT
17. GEISTERJÄGER
18. EIN EINBRUCH MIT UNGEAHNTEN FOLGEN
19. VERHÄNGNISVOLLE ABKÜRZUNG
20. DIE DSCHINNJÄGER FORMIEREN SICH
21. GEKIDNAPPT
22. AUSTRALIEN
23. BEGEGNUNG IM OUTBACK
24. TÜV-TERMIN
25. DIE MINE
26. OMA WEBERS ÜBERRASCHUNG
27. ROADHOUSE-BEKANNTSCHAFT
»Römer, Ritter, Fußballhelden«
Leseproben aus »Römer, Ritter, Fußballhelden«
Deinen reiselustigen Eltern und Großeltern gefällt ganz sicher:
»Tausend Tage Wohnmobil -
In drei Jahren durch Amerika, Australien und Neuseeland«
von
ÜBER DIE AUTORIN
1. DAS BUCH:
Er wohnt in einer Flasche und er ist stark und mächtig. Die Götter haben Kalatur, den Geist des Rauches, in grauer Vorzeit geschaffen, damit er den Menschen beistehe und helfe. Aber er hat keinen freien Willen, denn er steht unter dem Zwang einer Beschwörungsformel. Wer diese Formel kennt, ist mächtiger als der mächtige Geist des Rauches, denn auf Befehl muss Kalatur auch gegen seinen Willen Böses zu tun.
Die Magierin, die den Dschinn in seiner Flasche bannt, hofft, dass der Zauber so lange wirkt, bis Kalaturs Energie erloschen ist. Fast wäre ihr Plan geglückt. Doch rund 3000 Jahre später begleitet der 12-jährige Philipp Baumann seine Großmutter auf einer Reise durch Marokko, wo sie eine alte, blaue Flasche erstehen...
Philipp befreit Kalatur aus seiner Flasche, und der Geist des Rauches glaubt sich damit auch von den Zwängen der Beschwörungsformel erlöst, denn wer soll nach 3000 Jahren die Formel noch kennen?
Doch schon bald muss Kalatur entdecken, dass ihm bereits Dschinnjäger auf den Fersen sind, denn es existiert noch eine alte Keilschrifttafel mit Fragmenten der Beschwörungsformel. Nun ist nicht nur er, sondern auch Philipp in höchster Gefahr, denn die Dschinnjäger glauben, dass Philipp die Beschwörungsformel kennt …
Dschinn und Flaschengeist?
»Ach so, die alte Geschichte vom Dschinn, der befreit wird und zum Dank die Arme verschränkt, blinzelt und schon sind alle Wünsche erfüllt. Das ist ein alter Hut und langweilig!«
Nein! Stop! Es ist eben nicht die alte Geschichte! Denn niemand kennt die Beschwörungsformel, mit der man Kalatur, den Geist des Rauches in seine Dienste zwingen kann. Natürlich wird Kalatur, der einst so mächtige Dschinn befreit - in eine Welt, die sich in 3000 Jahren gewaltig verändert hat. Kalatur kennt weder elektrisches Licht noch Autos oder gar Hubschrauber und Flugzeuge. Der Geist des Rauches ist auf Philipps Hilfe angewiesen, um sich in dieser modernen Welt zurechtzufinden. Trotzdem gerät er immer wieder in verzwickte Situationen. Wirklich gefährlich wird es für ihn, als skrupellose Dschinnjäger versuchen, ihn und seine Flasche in ihre Gewalt zu bekommen.
2. KALATUR, DER GEIST DES RAUCHES
»Mächtiger Kalatur, allgewaltiger Geist des Rauches, größter aller Dschinn, ich rufe dich, denn ich schwacher Erdenmensch benötige die Hilfe deiner Geisterkraft!« Schrill drang die Stimme von Siduri, der dritten Nebenfrau König Nebukadnezars zu ihm herein. Alles in Kalatur wehrte sich, dem Ruf zu folgen, aber die beringten Finger Siduris drehten und rieben die Flasche, die ihm als Wohnung diente, und Kalatur musste ihrem Ruf gehorchen. Er konzentrierte sich und sammelte seine Energien. Langsam und stetig begann er, als feine, weiße Rauchsäule durch den Flaschenhals nach oben zu strömen. Er bildete einen Wirbel wie ein Zyklon und verdichtete sich dann zu einer menschlichen Gestalt. Kalatur wusste, dass Siduri jedes Mal bis ins Mark ihrer Knochen erschrak, wenn sie ihn sah. Deshalb ließ er seinen Körper zur Größe eines furchterregenden Riesen anschwellen und fragte mit dröhnender Stimme: »Herrin Siduri, ich bin dein Diener. Was willst du von mir?« Dabei funkelte er sie aus seinen dunklen, von buschigen Brauen umrahmten Augen drohend an. Obwohl sie den Rauchgeist schon so oft in ihre Dienste gezwungen hatte, konnte sich Siduri einer Gänsehaut nicht erwehren. Sie wusste, dass Kalatur ihre ehrgeizigen Pläne und Intrigen missbilligte, aber sie wusste auch, dass er ihre Befehle befolgen musste. Es war ihr gelungen, Sanheb, den greisen Oberpriester des Gottes Marduk, zu belauschen, als jener den Geist gerufen hatte. Seither kannte sie die Beschwörungsformel. Wenig später hatte sie Sanheb die Flasche gestohlen, die Kalatur als Wohnung und Ort der Regeneration diente. Nun war der Geist ihr Diener und musste ihr zu Willen sein.
»Ich will, dass mein Sohn Ninzub die Prüfungen als strahlender Sieger verlässt!«
»Herrin Siduri, du überschätzt meine Kräfte. Ich kann deinen Sohn nicht klüger machen, als er in Wirklichkeit ist!«
»Kalatur stell dich nicht so an! Du hast bewiesen, dass du Pfeile lenken und Tiere stolpern lassen kannst, also kannst du auch dafür sorgen, dass Eli heute wieder wie ein Trottel und Dummkopf dasteht! Ich will, dass Ninzub der nächste König von Babylon wird und nicht er.«
»Herrin Siduri, vergiss nicht, dass Gilgal, der die jungen Königssöhne in der Kunst des Lesens und Schreibens unterweist, den König stets über deren Fortschritte unterrichtet. Eli ist ein eifriger, gelehriger Schüler, während dein Sohn Ninzub nur Dummheiten im Kopf hat und die Keilschrift nur mit allergrößter Mühe lesen, geschweige denn richtig schreiben kann!«
»Papperlapapp«, fuhr Siduri den Geist an, »keine faulen Ausreden! Jage Gilgal einen gehörigen Schrecken ein, dann wird er dem König genau das berichten, was du von ihm verlangst! Also fliege nun davon und folge meinem Befehl!«
Kalaturs Körper schrumpfte und wurde wieder zu feinem, weißem Rauch. Langsam und beinahe unsichtbar schwebte er durch den Garten des Palastes. Er sah Siduri durch eine Tür huschen, und weil er ein Geist war, sah er auch, was Siduri nicht gesehen hatte. Die alte Eninki, die einst die Amme des Königs gewesen war, stand hinter einem Baum verborgen und hatte Siduri belauscht. Kalatur machte sich darüber keine Gedanken. Er war ein Geist, und er musste die Befehle derer ausführen, die nach ihm riefen - ganz gleich, ob ihm die Befehle gefielen oder nicht. Unbemerkt flog er durch die königlichen Gärten und die weiträumige Palastanlage, bis er zu dem Raum kam, in dem der Oberschreiber und Lehrer Gilgal die jungen Königssöhne unterrichtete.
Gilgal war alleine im Raum. Er war damit beschäftigt, die Tontafeln für die bevorstehende Prüfung vorzubereiten. Seine Stirn war von Sorgen umwölkt. Etara, der alte Waffenmeister, der bisher die Königssöhne in der Kriegskunst unterwiesen hatte, war beim König in Ungnade gefallen. Gilgal war von heftiger Furcht ergriffen, dass ihn womöglich das gleiche Schicksal ereilen könnte. Er gab sich einen Ruck:
»Sei kein Angsthase Gilgal!«, befahl er sich selbst. »Deine Schüler sind eifrig und machen gute Fortschritte. Einzig Ninzub trübt das gute Bild. Er ist frech und faul und hat nur Unsinn im Sinn. Aber der König weiß das. Er kann es mir nicht anlasten!« Er wollte gerade die metallenen Schreibgriffel bereitlegen, als er den Rauch bemerkte. Es war ein seltsamer Rauch, denn nirgendwo war Feuer. Der Rauch begann sich zu drehen, bildete einen Wirbel und plötzlich wuchs aus ihm ein Riese heraus. Gilgal fielen klappernd die Griffel aus der Hand. Der Riese wuchs weiter und füllte nun beinahe das halbe Zimmer aus. Er trug keine Kleider, nur ein rotes Tuch, das er wie einen Lendenschurz zwischen den Beinen hochgezogen und um die Hüften gewickelt hatte. Gilgal schlotterten vor Angst die Knie, als der Riese sich zu ihm hinunterbeugte. Die langen, schwarzen Haare, die der Riese im Nacken zusammengebunden hatte, fielen dabei nach vorne und kitzelten Gilgal an der Nase. Gilgal musste niesen. »W-w-was w-w-willst du von mir?«, stotterte er zitternd vor Furcht.
»Nicht viel, nur eine Kleinigkeit!« Die Stimme des Riesen dröhnte so laut, dass Gilgal hoffte, der ganze Palast würde zusammenlaufen und ihm zu Hilfe eilen. Schwer legte ihm die furchterregende Gestalt die Hand auf die Schulter.
»Ich stehe zu deinen Diensten, erhabener Herr«, stammelte Gilgal.
»Wunderbar!«, dröhnte der Hüne. »Wenn du zu meinen Diensten stehst, wirst du heute ganz sicher dem König berichten, dass Siduris Sohn Ninzub der fleißigste und klügste deiner Schüler ist!« Und zur Bekräftigung seiner Worte fasste er Gilgal vorne am Obergewand und hob ihn ein wenig in die Höhe.
»Erhabener Herr, das kann ich nicht!«, jammerte Gilgal. Der Riese hob den Oberschreiber noch ein wenig höher.
»Und warum nicht?«
»Es entspricht nicht der Wahrheit. Ninzub ist ein Dummkopf, ein Faulpelz und ein Tunichtgut!«
Der Riese schüttelte Gilgal wie einen leeren Getreidesack.
»Täuschst du dich da nicht?« Seine Stimme klang drohend wie Donnergrollen.
»Nein, erhabener Herr. Ich täusche mich nicht. Ich bin schließlich sein Lehrer!«, wimmerte Gilgal von der Zimmerdecke herunter.
»Oh weh, ich glaube, die Sommersonne hat dein Gehirn vertrocknet!«, dröhnte der schreckliche Hüne. »Aber an der frischen Luft wird dir bestimmt gleich wieder einfallen, dass Ninzub der klügste und eifrigste von allen deinen Schülern ist!« Er klemmte sich Gilgal unter den Arm und schwebte mit ihm zur Tür hinaus.
Gilgal wollte schreien, aber die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Er wagte nicht nach unten zu sehen, als er, gehalten vom Klammergriff des Geistes, über die Dächer Babylons hinweg schwebte.
»Nun«, tönte der Riese, »ist dir jetzt wieder eingefallen, dass Ninzub der klügste und beste deiner Schüler ist?«
»Aber nein, aber nein, das stimmt nicht!«, jammerte Gilgal.
»Dann lass ich dich jetzt in den Euphrat fallen, damit das Wasser des Flusses dein vertrocknetes Gehirn wieder aufweicht!«, drohte der Peiniger des armen Oberschreibers. Gilgal schlug die Augen auf und sah weit unter sich die Fluten des Euphrats im Sonnenlicht glänzen.
»Erbarmen! Hab Erbarmen mit mir! Ich kann nicht schwimmen!«, schrie der Lehrer in höchster Not. Der Geist hielt Gilgal mit einer Hand am Obergewand gepackt.
»Wer ist dein bester Schüler?«
»Ninzub! Ninzub ist mein bester Schüler!«
»Na also!«, ertönte zufrieden die Stimme des Riesen.
»Weh mir«, klagte Gilgal, »der Zorn des Königs wird schrecklich sein!«
»Vergiss des Königs Zorn«, warnte der Riese, »mein Zorn wäre noch viel schrecklicher!«
Nebukadnezar, Herrscher über Babylon und Sieger über das Ost- und Westland, ließ sich würdevoll auf dem reich verzierten Thronsessel nieder, den seine Diener im Schulzimmer der Königssöhne aufgestellt hatten. König Nebukadnezar legte großen Wert auf die Ausbildung seiner Söhne. Nicht nur im Kriegshandwerk, nein, der König wollte, dass sie auch im Lesen und Schreiben der Keilschrift unterwiesen wurden und dass sie rechnen konnten. Und sie sollten die Gesetze kennen, die vor langer Zeit der weise König Hammurabi erlassen hatte, damit auch in Zukunft Gerechtigkeit und Ordnung in der Welt herrschten. Besonders von Eli, dem Sohn seiner ersten Gemahlin, erwartete er, dass er sich vor den Söhnen seiner zahlreichen Nebenfrauen hervortat. Schließlich sollte er der nächste König von Babylon sein. Ein König, der auf das Wissen eines Schreibers angewiesen war, weil er nicht imstande war, den Brief eines fremden Königs zu lesen, konnte belogen und betrogen werden. Ein König durfte weder ein ungebildeter Tölpel noch ein feiger oder ungeschickter Krieger sein. Wenn sich Nebukadnezar allerdings daran erinnerte, welch jämmerliches Schauspiel die jungen Prinzen, allen voran Eli, kürzlich auf dem Exerzierplatz geboten hatten, schwollen ihm noch heute die Zornesadern auf der Stirn. Zuerst war Eli kopfüber vom Streitwagen gefallen und dann, als ihm geheißen ward, mit dem Pfeil den Adler vom Himmel zu holen, hatte er zwar zitternd auf den Greifvogel gezielt – aber den alten Waffenmeister ins Hinterteil getroffen. Und seine anderen Sprösslinge? König Nebukadnezar mochte gar nicht mehr daran denken. Einzig Ninzub, den er immer für einen Feigling und Dummkopf gehalten hatte, war es gelungen, sich mehr schlecht als recht auf dem Streitwagen zu halten und mit dem Pfeil wenigstens in die Nähe des Ziels zu treffen.
Auf einen Wink des Königs teilte Gilgal weiche Tonklumpen aus. Gewissenhaft formten die Prüflinge aus dem Ton flache Tafeln, und als der König sie aufforderte: »Schreibt!«, nahmen sie ihre Schreibgriffel zur Hand.
»Das Schicksal ist ein Hund, es kann gut zubeißen. Es klebt an einem wie schmutzige Lumpen«, zitierte der König ein altes Sprichwort, das er einst als Schüler selbst hatte niederschreiben müssen. Eli beugte sich über seine Tafel, wollte den Griffel in den Ton drücken, aber die Tafel, die gerade noch weich und geschmeidig gewesen war, war plötzlich hart wie Stein, und mit einem lauten Knacks brach sein Griffel ab. Apil, Elis Halbbruder, setzte vorsichtig sein Schreibgerät an, aber auch seine Tafel war urplötzlich hart geworden, und als Apil erschrocken etwas stärker aufdrückte, brach die Tafel entzwei. Zababas Tafel zerfloss unter dem Schreibrohr zu weichem Matsch und Belschunu bekam nur einen tiefen Kratzer zustande, ehe auch sein Griffel zu Bruch ging. Einzig Ninzub gelang es, ein paar Keilschriftzeichen in den Ton zu drücken, wenngleich sie auch schief und krumm und noch dazu voller Fehler waren. Gilgal sah die ersten Zeichen des Unmutes auf des Königs gerunzelter Stirn und auf seine eigene Stirn traten dicke Schweißtropfen.
»Sie sollen aus den Gesetzen des weisen Königs Hammurabi lesen, dessen Stele ich den schändlichen Elamern entrissen und im Triumph nach Babylon zurückgebracht habe!«, befahl der König. [Das Land Elam lag im Südwesten des heutigen Iran] Gilgal verneigte sich tief und teilte, zitternd und schlotternd vor Angst, beschriftete Tafeln aus.
Nebukadnezar deutete auf Eli. »Lies!« Eli konnte sehr gut lesen. »Wenn ein Arzt den gebrochenen Knochen ...«, begann er, ohne zu stocken. Aber plötzlich verschwammen die Schriftzeichen vor seinen Augen, weil feiner Rauch über die Tontafel zog. Mal gab der Rauch dieses Zeichen frei, dann wieder das nächste, oder er bedeckte sie nur zur Hälfte. Er konnte nicht mehr erkennen, was die nächsten Zeichen bedeuten sollten und fing an zu stottern: »... eines M-Mannes – nein, es heißt: einer Frau - nein, eines Kindes – ich, ich weiß nicht ...« Die Zornesfalten auf des Königs Stirn wurden tiefer, und die Schweißtropfen auf Gilgals Stirn begannen abwärts zu rollen. Sie durchnässten seinen sorgsam gelockten Bart und tropften auf sein Obergewand.
»Lies du!«, befahl der König und deutete auf Belschunu.
»Wenn ein Arzt ...«, begann Belschunu und stockte, denn der feine Rauch verdeckte nun plötzlich seine Tafel. »Nein, ich glaube, es heißt: Wenn ein Bauer – nein, wenn ein Vogel – ich – ich kann es nicht lesen«, stotterte Belschunu.
»Was können die überhaupt?«, polterte der König voll Wut.
Gilgal vernahm den feinen, weißen Rauch, der sich in der Zimmerecke kräuselte.
»Erhabener König«, stammelte er und verbeugte sich bis auf den Fußboden, »hab Erbarmen mit deinem Diener! Ninzub kann alles. Ninzub ist der beste Schüler und der fleißigste. Ninzub ist der Klügste von allen. Ninzub ist mein bester Schüler. Ninzub ist mein bester Schüler ...«
Auch als die Wache des Königs den armen Gilgal längst abgeführt hatte, jammerte er noch immer: »Ninzub ist mein bester Schüler! Erbarmen! Ninzub ist mein bester Schüler ...«
Langsam schwebte Kalatur als feine Rauchsäule durch den Garten zurück. Er war nicht stolz auf sein Werk, aber er hatte seinen Auftrag ausgeführt. Er war jetzt müde und wollte sich in seiner Wohnung ausruhen, und als er langsam durch den Flaschenhals glitt, bemerkte er, dass die alte Eninki noch immer im Schutz des Baumes verborgen stand.
3. DER BANN
Die alte Frau stand im Hof ihres Hauses, der von einer Mauer aus Lehmziegeln umgeben war. Sie rührte in einem Kessel, der über dem Herdfeuer hing. Als die Tür aus Schilfgeflecht beiseitegeschoben wurde, hob sie den Kopf.
»Ehrenwerte Eninki, was führt dich in meine bescheidene Hütte?«, fragte sie überrascht.
»Schat-Emach, meine Freundin«, begrüßte die alte Amme die Frau am Herd und zog eine bauchige, blaue Flasche aus den Falten ihres Obergewandes, »ich brauche deinen Rat und deine Hilfe. Du bist klug und weise und kennst dich nicht nur mit heilkräftigen Kräutern aus, sondern auch in den Dingen der Magie.«
»Plagt dich wieder das Reißen in den Gliedern? Soll ich dir einen zauberkräftigen Heiltrank brauen und in dieses Gefäß füllen?«
»Nein, meine Freundin, dein letzter Trank hat meine Schmerzen geheilt. In diesem Gefäß hier, das ich in meiner Hand halte, wohnt ein böser Geist. Ich habe den Hals des Gefäßes mit einem Pfropfen aus Wachs verschlossen. Ich hoffe, dass der Geist nicht durch den Pfropfen entweichen kann.«
»Du hast einen Dschinn in dieser Flasche?«
»Ja, ich glaube, es ist ein Dschinn. Er heißt Kalatur, und er ist böse. Er hilft Siduri, ihren nichtsnutzigen Sohn Ninzub dereinst zum König zu machen. Stell dir vor, was dann aus Babylon wird. Ich muss das unbedingt verhindern!«
»Der Dschinn an sich ist nicht böse«, erklärte die weise Schat-Emach. »Böse sind nur die Menschen, die seine Kräfte für ihre schlechten Absichten missbrauchen. Die Dschinn wurden nämlich vor langer, langer Zeit von den Göttern geschaffen, damit sie den Menschen zu dienen und ihnen helfen. Aber den Göttern hat es an der nötigen Weitsicht gefehlt. Sie haben nicht den Eigennutz der Menschen bedacht, nicht ihre Habgier, ihre Rachsucht, ihre Bosheit. Sie haben nicht vorausgesehen, dass Menschen wie Siduri die Kräfte der Geister für ihre egoistischen, niederen Absichten missbrauchen könnten. Solange dieses Gefäß im Besitz Siduris war, musste Kalatur ihre Befehle befolgen. Aber nun hast ja du glücklicherweise den Dschinn samt seiner Flasche an dich genommen.«
»Ich will ihn aber nicht behalten! Ich will nicht mit einem Geist in der Wohnung leben!«, protestierte Eninki.
»Nein, das wäre nicht gut. Die Flasche könnte dir gestohlen werden. In der Hand schlechter Menschen ist der Dschinn wirklich gefährlich. Kein Mensch darf sich jemals wieder seiner Kräfte bedienen!«
»Schat-Emach, meine weise Freundin, dieses Gefäß, in welchem der Geist wohnt, ist aus Glas. Es ist zwar sehr wertvoll und eigentlich auch sehr dick. Außerdem ist es viel härter als Ton, aber es könnte trotzdem zerbrechen. Dann wäre der Geist wieder frei.«
Schat-Emach warf fünf verschiedene Kräuter und getrocknete Wurzeln in den Kessel und wartete, dass der Sud über dem Feuer aufbrodelte. »Ich werde den Dschinn bannen«, erklärte sie. Dann begann sie die Flasche über dem Dampf zu drehen und murmelte leise unverständliche Worte vor sich hin. Das Glas der Flasche begann sich zu verfärben. Es wurde zuerst grün, dann rot, dann violett, und als es schließlich wieder blau wurde, sagte die weise Frau: »Nun kann niemand die Flasche öffnen oder gar zerbrechen. Der Dschinn ist in der Flasche gefangen!«
»Wie lange wird dein Zauber anhalten?«
»Das vermag ich nicht zu sagen. Tausend Jahre ganz bestimmt, vielleicht zweitausend, oder auch dreitausend. Vermutlich wird die Energie des Dschinns erloschen sein, bevor die Wirkung des Banns nachlässt.«
»Meine Freundin Schat-Emach, ich danke dir. Aber sage mir, was soll ich jetzt mit der Flasche machen?«
»Ehrenwerte Eninki, finde einen Händler, der bis an den Rand der Erde zieht. Er soll die Flasche in den großen Bitterfluss werfen, der die Welt umgibt, dann ist der Geist wirklich für alle Zeit unschädlich gemacht!« [Die Babylonier glaubten, dass die scheibenförmige Erde, in deren Mittelpunkt Babylon liegt, ein Bitterfluss umgibt.]
»Meine Freundin, im Palast des Königs sehe ich jeden Tag viele Händler und Reisende. Sie kommen aus der ganzen Welt, aus Assur, aus dem Land der Phöniker und sogar der Ägypter - aber ich habe noch keinen getroffen, der bis an den Bitterfluss gekommen ist.«
»Dann gib die Flasche einem jener Händler, die mit ihren Schiffen das große Meer befahren. Er soll sie dort ins Wasser werfen, wo es am tiefsten ist!«
4. EIN SOUVENIR AUS MARRAKESCH
Die ausgeleierten Stoßdämpfer des verrosteten Kleinlasters ließen seine hoch aufgetürmte Ladung beängstigend schwanken. Kommoden, ein Kühlschrank, ein bunt geblümtes Sofa, zusammengerollte Teppiche, blau gestreifte Matratzen, rote Kissen und einige Stühle, deren gedrechselte Beine sich wie lange Stacheln nach außen spreizten, bildeten ein schier unentwirrbares Knäuel. Mit langen Stricken war es auf der Ladefläche des Kleinlasters festgezurrt und neigte sich in den Kurven einmal zu dieser und dann wieder zu jener Straßenseite. Philipp drückte staunend die sommersprossige Nase an der Fensterscheibe platt, als der Bus das überladene Gefährt überholte. Es war eine fremde und faszinierende Welt, die da draußen an ihm vorbeizog. Halb verfallene Lehmbauten wechselten mit tristen Mietskasernen, dann ragte wieder das schlanke Minarett einer Moschee gen Himmel, oder das vornehme Haus eines Reichen versteckte sich hinter Palmen und Mauern. Rolf, der Reiseleiter, leierte monoton die Namen der Stadtviertel herunter, durch die sie gerade fuhren, erklärte, wie diese und jene Moschee hieß, oder benannte die Gärten und Paläste, die sie passierten. Alle zwei Wochen fuhr er mit einer neuen Busladung voll Touristen die ewig gleiche Runde, und man merkte, dass es ihn langweilte. Oma Weber hingegen fand Marrakesch aufregend.
»Sieh nur Phips, der Eselskarren!«, rief sie, oder: »Schau mal, wie prachtvoll die Kuppel der Moschee ist!« Dann hob sie zum x-ten Mal ihre kleine Kamera ans Auge und drückte ab. Es war Oma Webers erste große Reise, denn bisher war sie noch nicht weit herumgekommen. Seit 25 Jahren fuhr sie mit schöner Regelmäßigkeit nach Kärnten und machte in der Pension Pichelmeyer am Ossiacher See 14 Tage Urlaub. Hätte sie nicht im Preisausschreiben gewonnen, wäre sie wohl auch heuer wieder an den Ossiacher See gefahren. Seit vielen Jahren machte Oma Weber nämlich so ziemlich bei jedem Preisausschreiben mit. Sie nahm an allen möglichen Lotterien teil, zog Lose und rubbelte angebliche Glücksnummern frei – nur hatte sie bislang so gut wie nie gewonnen. Höchstens mal einen Trostpreis: zwei giftgrüne Eierbecher aus Plastik, ein himmelblaues Staubtuch aus Baumwolle oder einen Kugelschreiber mit eingebauter Quarzuhr. Mine und Uhr hatten innerhalb weniger Tage den Geist aufgegeben, doch nun hatte sie wirklich und wahrhaftig einen der Hauptpreise gewonnen! Zuhause in Alsberg hatte ein neues Einkaufszentrum eröffnet und als besondere Attraktion ein Preisausschreiben veranstaltet. Natürlich hatte auch Oma Weber einen der bunten Teilnahmescheine ausgefüllt und die richtigen Antworten auf ein paar alberne Fragen angekreuzt. Als erster Preis war nämlich ein knallroter Kleinwagen ausgeschrieben, der dritte Preis sollte ein schicker Flachbildfernseher sein. Und weil an Omas altem Auto der Rost nagte, und auch der Fernseher erste Macken zeigte und mitunter streikte, hatte sie natürlich insgeheim mit dem ersten oder dem dritten Preis spekuliert. »Aber wie üblich gewinne ich ja ohnehin nichts«, hatte sie gesagt, als sie ihren Teilnahmeschein durch den Schlitz der bunten Pappbox geworfen hatte. »Und wenn ich ganz viel Glück habe, wird es der 4. bis 100. Preis: eine Schachtel Pralinen.« Doch dann hatte sie tatsächlich den zweiten Preis gewonnen: zwei Wochen Marokko für zwei Personen.
»Ja was soll ich denn in Marokko? Da war ich ja noch nie!«, hatte Marianne Weber gerufen, als die Glücksbotschaft ins Haus geflattert war.
»Dann ist es doch wirklich höchste Zeit, dass du mal was anderes siehst, als immer nur den Ossiacher See«, hatte Philipps Vater gesagt. »Reisen bildet!«
»Aber es ist doch eine Reise für zwei Personen und ich bin alleine!«
»Vielleicht lässt sich die Reise in die Osterferien legen, dann kannst du Phips mitnehmen!«, hatte Philipps Mutter vorgeschlagen.
»Zwei Wochen lang in einem Reisebus sitzen? Womöglich noch mit lauter alten Zauseln? Nein, da bleibe ich lieber zu Hause und treffe mich mit meinen Freunden!« Reisen und Urlaub – das war für Philipp Baden in Italien oder Kroatien, Windsurfen in Holland oder Dänemark oder Skifahren irgendwo in den Bergen. Reisebusferien mit der Großmutter gehörten nun wirklich nicht dazu. Doch dann hatte er zusammen mit Oma Weber in Merian- und Geoheften geblättert, hatte sich die Fotos von Marokko angesehen, einen Beitrag über die Suqs, die Märkte von Marrakesch gelesen und schließlich gesagt: »Oma, wenn du möchtest, komme ich gerne mit!«
Jetzt machte ihm die Reise Spaß. Nur Friedhelm Bartelmann, pensionierter Oberstudienrat, der unglücklicherweise im Bus genau hinter ihm saß, nervte. Nervte gewaltig. Da Herr Bartelmann keine Schüler mehr hatte, die er triezen konnte, hielt er sich an Philipp schadlos. Und wenn er nicht gerade mit seiner Videokamera durchs Busfenster filmte, ließ er keine Gelegenheit ungenutzt, den einzigen Schüler weit und breit dessen er habhaft werden konnte, dieses oder jenes abzufragen. Dann drehten sich die Mitreisenden gespannt um und warteten auf Philipps Antwort. Nicht etwa, dass sie selbst die richtige Antwort gewusst hätten. Aber von einem Gymnasiasten der 6. Klasse erwarteten sie wohl, dass er so etwas Ähnliches wie eine wandelnde Enzyklopädie wäre.
»Philipp, wie heißen die höchsten Berge des Atlas Gebirges?«, wollte die pensionierte Nervensäge hinter ihm gerade wissen. Natürlich hatte Philipp gelesen, dass das Gebirge, an dessen Fuß Marrakesch lag, einige Gipfel mit über 4000 Metern Höhe aufzuweisen hatte. Dass es das höchste Gebirge Nordafrikas war, wusste er auch, aber die arabischen Namen der Berge hatte er sich nicht merken können. Glücklicherweise ging der Expauker inzwischen auch Oma Weber gewaltig auf den Geist:
»Wenn Philipp, so wie Sie, gerade in den Reiseführer geguckt hätte, dann wüsste er es auch!« Die Mitreisenden lachten, Herr Bartelmann blickte verdattert drein, und Philipp hatte für eine ganze Weile Ruhe.
***
»Pass auf Oma, wir verlieren den Anschluss an unsere Reisegruppe!« Ungeduldig zerrte Philipp seine Großmutter am Ärmel. Mustafa winkte mit einem zusammengefalteten, roten Regenschirm, damit sich seine Schutzbefohlenen im Gewimmel und Gewirr der Suqs an ihm orientieren konnten und nicht verloren gingen. Der Reiseleiter hatte Mustafa engagiert, als Dolmetscher und als Führer über den Markt und hatte sich dann im Bus zu einem Nickerchen ausgestreckt. Nun lotste sie Mustafa, der Student, der zu Turnschuhen, Bluejeans und Sweatshirt einen kunstvoll gewickelten Turban trug, durch verwinkelte Gässchen aus bunten Verkaufsständen, bahnte ihnen zwischen den Marktschreiern hindurch den Weg. Marianne Weber legte erschrocken die Lederbrieftasche, die sie gerade begutachtet hatte, auf den Verkaufsstand zurück. Philipp zog sie zwischen bärtigen Männern in langen Kaftanen und Frauen, deren dichter langer Schleier gerade mal die Augen freiließ, der Reisegruppe hinterher. Es war wie in einem Märchen aus ›Tausendundeine Nacht‹. Nur die bunt gekleideten Touristen, die sich, mit Videokameras und Fotoapparaten behängt, durch das Gewirr von Menschen und Waren drängelten, erinnerten daran, dass der Markt ein reales Geschehen und keine Fiktion war. Auch Friedhelm Bartelmann hatte aufgeschreckt seine Videokamera ausgeschaltet und sich an Philipps Fersen geheftet. Allerdings hätte Philipp nichts dagegen gehabt, wenn sich der lästige Abfrager auf Nimmerwiedersehen irgendwo im Gedränge zwischen den Kupfer- und Eisenschmieden oder bei den Ledergerbern und Teppichhändlern verlaufen hätte.
Mustafa hob ein paar Mal seinen roten Regenschirm in die Höhe, so, als wolle er damit ein paar Löcher in den Himmel stochern. Als sein Häuflein Touristen sich um ihn versammelt hatte, erklärte er: »Wir kommen jetzt zum alten Sklavenmarkt. In den vergangenen Jahrhunderten wurden hier die schwarzen Sklaven versteigert.«
»Wie barbarisch!«, entrüstete sich Philipps Großmutter!«
»Jetzt haben sich hier die Gewürzhändler und Apotheker niedergelassen!«, fügte Mustafa hinzu. Das stimmte Oma Weber wieder milde. Sie befreite sich energisch aus Philipps Klammergriff und umrundete prüfend Säcke und Schalen mit exotisch duftenden Kräutern und Wurzeln, öffnete neugierig Fläschchen und Tiegel und schnüffelte an Mixturen. Laut Mustafas Übersetzung sollten sie gegen Magenleiden, Schlaflosigkeit, schlechte Träume, Appetitmangel und tausend andere Wehwehchen helfen.
»Und was ist in dieser Flasche? Sie geht nicht auf?« Philipps Großmutter hatte aus einer Kiste eine staubige, mattblaue Flasche herausgewühlt und versuchte, den Pfropfen, der sie verschloss, zu lösen. »Ich suche nämlich ein Mittel gegen mein Rheuma im rechten Knie!«
Mit ehrerbietigen Verbeugungen und einem Schwall arabischer Worte versuchte der alte Mann im gestreiften Kaftan, der bis jetzt auf einem Kissen vor der Ladentür gesessen hatte, die Gunst der Stunde zu nutzen.
»Er weiß leider nicht, was in dieser Flasche ist«, übersetzte Mustafa, »aber er sagt, sie wäre schon sehr, sehr alt und deshalb auch sehr wertvoll!« Mit Händen und Füßen gestikulierend redete der Alte weiter.
»Er sagt, er hätte sie im Haus seines Ururgroßvaters gefunden, der aus Ägypten stammte und sie wahrscheinlich von dort mitgebracht hätte.«
»Wie interessant, eine alte Glasflasche aus Ägypten!« Marianne Weber hatte ihr Rheuma im rechten Knie schon längst vergessen. »Wie alt mag sie wohl sein? Zweihundert Jahre? Oder dreihundert?« Der Alte schüttelte heftig den Kopf.
»Viele tausend Jahre!«, übersetzte Mustafa.
»Vermutlich nicht mal tausend Tage«, ließ sich Friedhelm Bartelmann hinter dem Objektiv seiner surrenden Kamera vernehmen.
Oma Weber ließ sich nicht gerne dreinreden. »Was soll die Flasche denn kosten?«
Der Mann im Kaftan beehrte sie mit noch mehr Verbeugungen. Philipp schloss aus dem Klang der Worte, dass der Alte einen unverschämten Preis in zahllose Flunkereien und Schmeicheleien verpackte.
»Er will 430 Dirham«, sagte Mustafa, der keine Lust hatte, den gesamten Wortschwall zu übersetzen.
Oberstudienrat a. D. Friedhelm Bartelmann hatte die Videokamera ausgeschaltet und den Taschenrechner gezückt. »Frau Weber, das sind 38 Euro! Der Schlaumeier glaubt, er hätte eine Dumme gefunden!«
»Vielleicht ist die Flasche ja wirklich alt!«, meinte Oma Weber ein wenig trotzig.
»Wetten, dass im Laden nebenan die gleiche Flasche steht? Der Inhaber wird Ihnen dann wahrscheinlich erzählen, dass sie sein Urururonkel in den Ruinen von Karthago gefunden hat. - Oder dass sie einst irgendeinem Kalifen von Bagdad oder vielleicht sogar der Königin von Saba gehört hat.«
»Mir ist schnuppe, wem die mal angeblich gehört hat. Die Flasche gefällt mir. Sie passt gut in mein neu gefliestes Badezimmer. Ich könnte Dr. Maußners-35-Kräuter-Öl hineinfüllen, mit dem ich immer mein Knie einreibe.«
»Oma, vergiss nicht, die Flasche geht nicht auf!«, warnte Philipp.
»Na, so wie ich dich kenne, wird dir schon was einfallen, wie wir den Pfropfen herausbekommen«, meinte Frau Weber leichthin, und zu Mustafa sagte sie:
»Sagen Sie dem Mann, für 33 Dirham nehme ich die Flasche. Sie geht nicht auf und ist nur alter Plunder!«
Friedhelm Bartelmann tippte auf seinem Rechner herum und murmelte: »3 Euro, das wäre akzeptabel!«
Der Alte im gestreiften Kaftan rang die Hände und ließ eine Flut klagender Worte vernehmen. »Er sagt, Sie ruinieren ihn. 280 Dirham wäre das Mindeste, was er bekommen müsse!«, lautete Mustafas knappe Übersetzung.
»25 Euro«, soufflierte Bartelmann, nachdem er seinen Rechner befragt hatte.
»50 und keinen Dirham mehr!« Das Schachern und Handeln bereitete Philipps Großmutter sichtliches Vergnügen.
»Oh nein! 200 Dirham muss ich mindestens bekommen. Sie berauben einen armen Mann!«, jammerte der Händler. Bei 73 Dirham wurden sich Oma Weber und der Händler schließlich handelseinig. Der Alte verabschiedete sie gestenreich und Mustafa übersetzte: »Er wünscht ihnen Allahs Segen, ein langes Leben und noch viele Enkelkinder!«
»Danke, mein Enkel Philipp reicht mir!«, lachte Frau Weber, und Friedhelm Bartelmann befragte noch einmal seinen Rechner: »Sechs fünfzig, na, es ist ja Ihr Geld«, monierte er. »Aber ich wette, nebenan kriegen sie die Flasche für die Hälfte!«
***
»Mist«, jetzt hab ich deine Nagelfeile auch noch abgebrochen«, schimpfte Philipp. Seine Großmutter, die ihre blond gefärbten Haare auf Lockenwickler gedreht hatte, zog sich einen Metallpikser aus den Wicklern: »Hier, probier das mal!« Philipp klemmte sich die blaue Flasche zwischen die Knie und bearbeite den Pfropfen mit dem Lockenwickelpikser.
»Das Ding sitzt wie festzementiert«, schimpfte er. »Vielleicht wurde die Flasche absichtlich zugeklebt, weil ihr Inhalt gefährlich ist. Gift oder Säure - oder weiß der Teufel, was da sonst noch drin sein könnte.«
»Vermutlich war da überhaupt nie was drin. Ich schätze, die blöde Flasche wurde verpfropft, um dumme Touristen wie mich neugierig zu machen und ihnen dann das Geld aus der Tasche zu ziehen«, meinte Oma Weber lakonisch.
»Na, wenn das die Absicht war, ist sie voll geglückt«, lachte Philipp.
»Ich hätte die blöde Flasche ja nicht kaufen müssen. Vermutlich habe ich es auch nur deshalb getan, weil sich der oberschlaue Expauker alle Mühe gegeben hat, es mir auszureden. Aber ich bin ja schon froh, dass er diese blaue Flasche kein zweites Mal auf dem ganzen Markt entdeckt hat, obwohl er jeden Stand und jeden Laden durchstöbert hat. Da wäre er sich doch glatt nochmal so klug vorgekommen.« Oma Weber drehte die Flasche nach allen Seiten, schüttelte sie und hielt sie ans Licht: »Ich kann mir nicht helfen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie wirklich uralt ist. Das matte Blau – und dann ist das Glas ja auch gar nicht durchsichtig, – vermutlich ist es sehr dick.« Sie ging ans Waschbecken des Hotelzimmers, drehte den Wasserhahn auf und hielt den Flaschenhals unter den Wasserstrahl: »Probieren wir es noch einmal mit heißem Wasser«, schlug sie vor. »Wenn sich das Glas erwärmt, dann dehnt es sich. Vielleicht löst sich dann der Pfropfen.«
Als sie eine Stunde später zum Abendessen ins Restaurant hinuntergingen, hatte Philipp neben der Nagelfeile nicht nur Omas Stielkamm abgebrochen, sondern auch sämtliche Messerchen und Werkzeuge seines roten Schweizer Messers demoliert. »Blöde Flasche«, schimpfte Frau Weber.
»Weißt du was«, meinte Philipp, »Wenn du die Flasche nicht gebrauchen kannst, dann schenk sie doch ganz einfach mir!«
5. HOFFNUNGSSCHIMMER
Kalatur hatte neue Hoffnung geschöpft. Er hatte gespürt, wie nach langer Zeit wieder einmal jemand versucht hatte, den Pfropfen der Glasflasche zu lösen. Aber der Bann der alten Schat-Emach wirkte noch immer, obwohl sie selbst schon vor vielen Jahrtausenden zu Staub zerfallen sein musste. Der Bann würde womöglich seine langsam verlöschenden Energien überdauern. Kalatur wusste nicht, wie oft er schon den Tag verwünscht hatte, an dem er sich von Sanheb, dem alten Mardukpriester, hatte überreden lassen, von seiner einfachen Kürbiskalebasse in die wertvolle Glasflasche umzuziehen. Er hatte seit Anbeginn in Kalebassen gewohnt. Sie waren zweckmäßig und bequem, und wenn sie anfingen zu verrotten, hatte er sich eine Neue besorgt. Kurzzeitig hatte er auch einmal in einem Tonkrug gewohnt. Der war zwar wesentlich geräumiger gewesen, aber wegen der weiten Öffnung hatte er seine Energien nicht so gut sammeln können. Nach ein paar Tagen war er wieder in seine gewohnte Kalebasse zurückgekehrt. Dann war plötzlich Sanheb mit der blauen Glasflasche aufgetaucht. »Kalatur, mächtiger Geist des Rauches«, hatte der Priester zu ihm gesprochen, »dieser ausgehöhlte Kürbis, in dem du wohnst, ist deiner nicht würdig. Er taugt als Nutzgefäß für Bauern und einfache Leute, aber nicht als Wohnung für einen mächtigen Geist.« Mit einer großen Geste hatte Sanheb die blaue Glasflasche aus seinem Gewand gezogen. Kalatur hatte noch nie zuvor ein solch großes Gefäß aus Glas gesehen. Meist wurden nur kleine Tiegel und Behältnisse aus Glas hergestellt, und nur sehr reiche Leute konnten sich ein Salbentöpfchen aus buntem Glas leisten. »Die Flasche ist ein Geschenk von König Nebukadnezar«, hatte er gesagt. »Sie ist ein Kunstwerk. Ein Handwerker aus Assur hat sie um einen Kern aus Sand gefertigt. Ich möchte sie dir schenken, als Dank für deine Dienste.«
Kalatur hatte sich geschmeichelt gefühlt und war in die Flasche gezogen. Der diffuse blaue Lichtschein, der ins Innere drang, hatte ihm gefallen, und er war geblieben, obwohl die Flasche wesentlich enger war als seine alte Kalebasse. Es hatte ihm nichts ausgemacht. Jeden Tag war er durch den Flaschenhals geströmt, hatte sich zur Riesengestalt anwachsen lassen, war als Rauchsäule umhergeschwebt, hatte die Wünsche Sanhebs und später die Befehle Siduris befolgt. Um neue Energie zu sammeln, hatte er sich wieder in seine Wohnung zurückgezogen – bis zu jenem unglückseligen Tag, an dem Eninki die Flasche verschlossen hatte. Da war die Flasche zu seinem Gefängnis geworden. Anfangs hatte er die Tage seiner Gefangenschaft gezählt, die Wochen, Monate, Jahre, die Jahrhunderte. Irgendwann, vor endlos langer Zeit, als bereits mehr als zweitausend Jahre vergangen waren, hatte er aufgehört zu zählen. Und nun war es ihm, als vernehme er ein stetes, leises Brummen und Dröhnen und er hatte das Gefühl, als wenn er durch die Lüfte flöge.
»Aber kann ich denn meinen Wahrnehmungen noch trauen?«, fragte er sich. »Welcher Adler könnte die glatte Glasflasche mit seinen Klauen packen? Oder hat jemand die Flasche in das große Meer geworfen, das die Phöniker mit ihren Schiffen befahren? Dann versinke ich jetzt womöglich in einer nicht endenden Tiefe? Aber nein, mir war doch, als hätte man meine Flasche in eine Truhe oder Kiste gepackt, so finster ist es rings um mich. Nicht der geringste Lichtschein dringt in mein Gefängnis. Ach, wie oft bin ich wohl samt meiner Flasche, in Packen und Körben verstaut, schon in der Welt herumtransportiert worden? Auf rumpelnden Eselskarren und auf dem schaukelnden Rücken von Kamelen! Früher konnte ich noch alles verstehen, was draußen gesprochen wurde. Ich habe gehört, was ringsum geschah, habe mit angehört, wie die alte Königsamme jenem fremden Händler einen ganzen Beutel voll Gold mitgegeben hat – nur, damit er mich an den Rand der Welt bringt. Längst sind seine Gebeine in der Wüstensonne ausgebleicht und zerfallen, weil er wegen des Goldes von Räubern ausgeraubt und erschlagen wurde. Ich konnte ihm nicht helfen, musste hilflos zuhören. Sie haben sein Gold an sich genommen und all seine Habe - und meine Flasche natürlich auch. Kostbare Öle haben sie in der Flasche vermutet. Lange haben sie sich mit dem Pfropfen abgeplagt und schließlich vor lauter Wut versucht, das Glas zu zerschlagen.« Kalatur seufzte in seinem Gefängnis ungehört vor sich hin. »Ach, ich habe auch aufgehört zu zählen, wie oft Menschen versucht haben, die Flasche zu öffnen. In allen nur erdenklichen Sprachen haben sie gesprochen, und ich bin immer weiter transportiert worden – bis nach Ägypten. Lange, lange Zeit muss meine Flasche dann in irgendwelchen Ecken oder Kisten herumgelegen haben, und nur ab und zu hat sich jemand vergeblich mit dem Pfropfen abgemüht. Und dann bin ich ganz plötzlich wieder weitertransportiert worden. Es muss ein seltsames, gefährliches Tier gewesen sein, auf dessen Rücken man mich samt meiner Flasche geladen hat. Es schaukelte nicht wie die Kamele, sondern rumpelte und dröhnte ganz fürchterlich. Und weil ich die Stimmen der Menschen nur noch als leises, unverständliches Murmeln vernehmen kann, weiß ich weder, wie das Tier hieß noch wo ich jetzt bin.« Kalatur drehte und kringelte sich. »Wenn ich nicht bald aus dieser Flasche herauskomme, ist es aus mit mir«, stöhnte er.
6. DIE BEFREIUNG
Zorro hatte dösend auf seiner Decke gelegen. Nun hob er den Kopf, stellte die Ohren auf und knurrte. »Sei still«, befahl Philipp, »ich hab eine grässliche Hausaufgabe auf und muss meine grauen Zellen anstrengen!« »Dear Mark,« hatte er bis jetzt in sein Heft geschrieben. »I spent my Easter holydays in …« Suchend blätterte Philipp im Wörterbuch. »Aha, ›Marokko‹ heißt auf Englisch ›Morocco‹. Für diese verflixte Hausaufgabe muss ich ganz bestimmt noch tausend Wörter nachschlagen«, schimpfte er. - Zorros Knurren steigerte sich zu einem dunklen Donnergrollen.
»Ich hätte dich mit in die Schule nehmen sollen, damit du unseren Mr. Bean anknurrst. So eine Schnapsidee von dem: ›Stellt euch vor, ihr hättet einen Brieffreund in London. Schreibt ihm, wie ihr eure Osterferien verbracht habt!‹ Also ganz ehrlich, wenn ich bei dir zu Hause geblieben wäre, hätte ich mich leichter getan: ›Ich ging jeden Morgen mit meinem Hund Gassi und spielte nachmittags mit meinen Freunden Fußball.‹ Punkt und fertig! Das hätte ich ganz schnell übersetzt. Gut, was ›Gassi gehen‹ auf Englisch heißt, weiß ich auch nicht. Aber zwei Wochen mit dem Bus durch Marokko – Fes, Rabat, Marrakesch – immer mit einem abgehalfterten Pauker im Nacken und einer Großmutter, die auf jedem Markt einkauft wie eine Wilde – Lederbeutel, Silberarmbänder, alte, blaue Glasflaschen – das wird ein endlos langer Brief! Aber warum erzähl ich dir das alles? Du bist ja nur ein dummer Hund und versteht nichts von dem, was ich dir sage!« Zorro war von seiner Decke aufgesprungen. Sein schwarzes Fell sträubte sich, und mit hochgezogenen Lefzen fletschte er drohend die Zähne.
»He, war nicht so gemeint«, witzelte Philipp, »du bist selbstverständlich der klügste und schlauste Hund, den ich kenne. Aber bei dem blöden Brief kannst du mir leider nicht helfen!« Philipp stemmte den Ellbogen auf den Schreibtisch und stützte den Kopf ab. »Also, ich schreibe am besten, dass wir bis nach Agadir geflogen und dann mit dem Bus gefahren sind, dass wir viele Moscheen besichtigt haben ... Was heißt wohl Moschee auf Englisch?« Philipp griff wieder nach dem Wörterbuch und blätterte. »K, l, m ...«, murmelte er vor sich hin, »mo... – Morphium, morsch, Mörser, Mörtel ...«, suchend fuhr er mit dem Finger über die Zeilen. »Verflixt nochmal Zorro, warum bellst du das Regal an? Sei endlich still!« Zorro hörte auf zu bellen und verlegte sich wieder auf sein dumpfes Grollen. »‹Mosque‹ – ich hab’s gefunden. Moschee heißt ›mosque‹! Philipp notierte es auf einem Schmierblock. Zorro sprang mit wütendem Gebell vor dem Regal in die Höhe. »Zorro, du führst dich auf, als wenn sich des Nachbarn fetter Kater in meinem Regal versteckt hätte! Oder ist es am Ende die Flasche, die dich so aufregt?« Philipp hatte den Stift beiseitegelegt und war von seinem Schreibtisch aufgestanden. Einen kurzen Moment lang war es ihm so vorgekommen, als hätte die blaue Glasflasche, die seine Großmutter nicht mehr hatte haben wollen, violett geschimmert. »So ein Quatsch«, sagte er und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. »Aber das könnte ich übrigens auch schreiben: ›Meine Großmutter kaufte eine alte, blaue Flasche. Leider konnten wir den Pfropfen nicht öffnen.‹« In diesem Moment kam Philipp eine zündende Idee: »Mensch, wir haben doch ›ne Bohrmaschine! Die kleine, handliche Akkumaschine, die mein Vater neulich gekauft hat. Damit könnte ich es mal probieren!« Im nächsten Moment war er aufgesprungen und hatte die verflixte Hausaufgabe vergessen. Er schnappte sich Oma Webers Souvenir aus Marrakesch, das er auf eines der oberen Borde in seinem Regal gestellt hatte, und stieg die Kellertreppe hinunter. Zorro rannte mit wütendem Gebell hinter ihm her.
»Komisch«, dachte sich Philipp, »bisher ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Flasche in verschiedenen Farben schimmert. Jetzt sieht sie beinahe rot aus. Wird wohl an der neuen Leuchtstoffröhre liegen, die mein Vater neulich in seiner Kellerwerkstatt installiert hat.« Philipp suchte sich aus Vaters Bohrern einen passenden aus und spannte ihn ins Bohrfutter der Bohrmaschine, während Zorro unablässig knurrte und bellte.
»Mist«, schimpfte er, »Ich kann die Maschine nicht mit einer Hand halten. Was mach ich jetzt? Ich weiß es - ich spanne die Flasche in den Schraubstock. Das Glas ist ja so dick, das geht bestimmt nicht kaputt!« Vorsichtshalber wickelte er die Flasche in ein altes Handtuch, bevor er langsam und vorsichtig die Backen des Schraubstocks zudrehte.
»Jetzt sieht die Flasche auf einmal grün aus«, fand Philipp. »Das kommt wohl vom Handtuch. Das ist auch grün.« Mit beiden Händen fasste er die Bohrmaschine und setzte den Bohrer am hartnäckigen Pfropfen an, aber die Flasche begann zwischen den Backen des Schraubstockes zu rutschen. Philipp legte die Bohrmaschine auf der Werkbank ab, drehte den Schraubstock noch ein wenig fester – und plötzlich zerbarst die Flasche mit einem ohrenbetäubenden Knall!