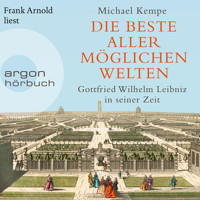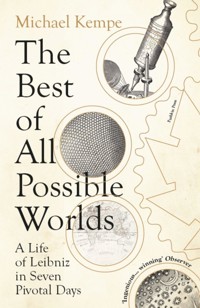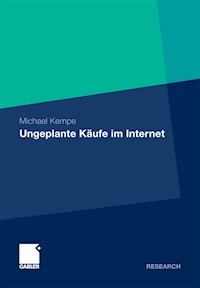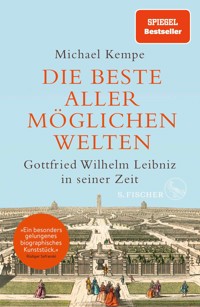
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Michael Kempe hat die Leibniz-Biographie für unsere Zeit geschrieben: Sieben ausgewählte Tage, die für das Ganze stehen, sieben Facetten eines großen und widersprüchlichen Bildes«, schreibt Daniel Kehlmann zu diesem Buch über das große deutsche Universalgenie Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Der war ein Tausendsassa, Philosoph, Erfinder, Mathematiker, Reisender und Netzwerker. Hier lernen wir seine ganze Welt kennen, sein Leben, Denken und Arbeiten. Elegant erzählt der Historiker und Leibniz-Kenner Michael Kempe von sieben Tagen in Leibniz' übervollem Leben. Sieben Tage in sieben verschiedenen Jahren, an denen Leibniz' Leben und Werk eine neue Wendung nehmen. 1675 treffen wir ihn in Paris an, wo er morgens im Bett sitzt und arbeitet, umgeben von einem Berg an Notizzetteln – an diesem Tag bringt er erstmals das Integralzeichen »∫« zu Papier. Es ist ein großer Moment in der Mathematik – und ein zeitlebens währender Streit mit Isaac Newton und dessen Anhängern. In Hannover plaudert Leibniz 1696 am Hof mit der Kurfürstin Sophie über den Trost in der Philosophie. Sein wohl größter Wurf aber ist die Skizze einer Maschine, die mit den Zahlen 0 und 1 rechnet – Grundlage des Digitalcodes und damit des Computers. Doch auch als Philosoph hat Leibniz uns heute noch viel zu sagen. Gott mag unter allen möglichen Welten die beste geschaffen haben, wie er in seiner berühmten »Theodizee« andeutet, doch der Mensch muss sie durch sein Handeln weiter verbessern. Wissenschaft braucht nicht nur den Bund mit der Macht, sondern auch die Freiheit des Denkens. Hinter Perücke und Gehrock zeigt sich Leibniz so als modernes Individuum. Mit seinem grenzenlosen Optimismus fordert er uns auf, nie die Hoffnung aufzugeben, sondern Lösungen zu suchen. Eine spannende, vergnügliche und lebendige Reise in den Kopf eines der größten deutschen Denker. »Michael Kempe hat die Leibniz-Biographie für unsere Zeit geschrieben. Es ist schwer, diesem reichen Geist auch nur im Ansatz gerecht zu werden. Kempe aber gelingt es: Sieben ausgewählte Tage, die für das Ganze stehen, sieben Facetten eines großen und widersprüchlichen Bildes. « Daniel Kehlmann »Eine großartige Idee: von einzelnen Tagen auszugehen, an denen Leibniz' Leben und Werk eine neue Wendung nehmen, und schließlich eine ganze Welt zu entfalten. Ein besonders gelungenes biographisches Kunststück.« Rüdiger Safranski »Michael Kempe gelingt in diesem großartigen Portrait das Kunststück, Leibniz' Denken für unsere Zeit verständlich zu machen und ihn zugleich in seiner eigenen Zeit zu verorten, der Epoche des Barock und der frühen Aufklärung.« Jürgen Osterhammel, Autor von »Die Verwandlung der Welt«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michael Kempe
Die beste aller möglichen Welten
Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit
Biographie
Über dieses Buch
Philosoph, Tausendsassa, Erfinder, Reisender und Netzwerker – all das war Gottfried Wilhelm Leibniz. Heute gilt er als das letzte Universalgenie und als Wegbereiter der Moderne. Als Mensch und als Philosoph war er zutiefst optimistisch, aufgeben war für ihn nie eine Option.
Hier lernen wir Leibniz’ ganze Welt kennen. An sieben Tagen seines Lebens zwischen 1675 und 1716 sehen wir ihm über die Schulter: In Paris treffen wir ihn im Bett an, wo er morgens seine besten Gedanken entwickelt. In Hannover plaudert er am Hof mit der Kurfürstin, im Harz tüftelt er über Windmühlen. Sein größter Wurf ist die Skizze einer Maschine, die mit den Zahlen 0 und 1 rechnet – Grundlage des Digitalcodes und damit des Computers.
Michael Kempe erzählt elegant von Leibniz’ Leben, Denken und Arbeiten – und zeichnet zugleich eine farbige Kulturgeschichte des Barock zwischen Paris, Wien, Berlin und Hannover.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Professor Dr. Michael Kempe, geboren 1966, ist Historiker und lebt mit seiner Familie in Hannover. Er ist dort seit 2011 Leiter der Leibniz-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen beim Leibniz-Archiv der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Leibniz, dem Menschen, Philosophen, Historiker, Mathematiker und Erfinder. Dessen schriftlicher Nachlass ist mit ca. 100.000 Blatt und ca. 20.000 Briefen einer der größten Gelehrtennachlässe der Weltgeschichte.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114,
D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: Schloß und Parkanlage Herrenhausen, um 1708 (Historisches Museum Hannover)
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490804-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Einleitung
Kapitel 1 Paris, 29. Oktober 1675
Die Fliege
Kaffee, ein wenig Wein und reichlich Zucker
Träume der Großstadt
Am Ufer der Seine
Die weiße und schwarze Magie von Papier und Tinte
Leibniz was a Rolling Stone
Die Welt als Rechnung
Signatur des Unendlichen
Ein welthistorischer Zettel
Kapitel 2 Zellerfeld (Harz), 11. Februar 1686
Silbergaleonen aus Veracruz
Tüftler und Bastler am Fürstenhof
Viel Wind um die Mühlen
Weißer Schnee, schwarze Tinte
Dreiecksbeziehung
Jenseits der Physik
Mögliche Adame, mögliche Welten
Nur eine beste Welt
Konnexion der Dinge
Alles in Bewegung
Weltverbesserung als Verwaltungsprojekt
Erze aus Sumatra
Kapitel 3 Hannover, 13. August 1696
Ausgebrannt und überhitzt
Im Bann des Hofes
Die Freiheit der Selbstverpflichtung
Wasserkünste in Herrenhausen
Sommerliche Plaudereien
Die Wiedererweckung der Fliegen
Es gibt nichts Totes in der Welt
Maschinen, die schreien
Autobiographische Rückblenden
Verschwommene Unendlichkeiten
Seelen-Wüsten
Wie viele Leibnize in einer Person?
Lebensformen im Wandel
Monade 2.0
Kapitel 4 Berlin, 17. April 1703
Auf der Suche nach der Weltformel
Summer of Love
In der Brüderstraße
Live-Übertragung
Lagebericht aus Europa
Von China lernen
Digitale Träume
Eine Welt aus Nullen und Einsen
Ein chinesisches Orakel in binärer Struktur
Magisches Quadrat mit dyadischen Zeichen
Strukturen der Wirklichkeit
Transfer in die Zukunft
Kapitel 5 Hannover, 19. Januar 1710
Alles eine Frage der Sichtweise
Draußen vor der Bibliothekstür
Pelzstrümpfe und Filzsocken
Werkzeug des Historikers
Eine Frau auf dem Papststuhl?
Gott vor Gericht
Positivierungen des Schlechten
Zornig und brutal – der letzte König Roms
Zwei Gestalten zwischen Wahrheit und Fiktion
Das Nacheinander der Zeit
Kapitel 6 Wien, 26. August 1714
Noch einmal Durchatmen
Erfolg und Einsamkeit
Die ferne Nähe zur Macht
Schwierige Fernbeziehungen
Turbulente Tage
Auf gepackten Koffern
Liebe und Geometrie
Mit Gott um die Wette rechnen
Seelen ohne Fenster?
Tomorrow never knows
Kapitel 7 Hannover, 2. Juli 1716
Über sich hinausdenken
In Saft und Kraft
Zu den Quellen
Für ein neues Europa
Gute Laune, eingetrübt
Universalgelehrte als Seelenverwandte
Wie alt ist die Erde?
Der Salamander, der aus der Hitze kam
Kann es einen Anfang geben?
Die Rückkehr des Gestern
Die Fliege verstehen
A day in the life
Epilog
Dank
Abkürzungen
Literatur
Lektüreempfehlungen
Bildnachweise
Personenregister
Für Clara Emilia,
Christiane
und eine kleine Fliege
Einleitung
Warum gibt es überhaupt eine Welt, und weshalb diese? Nicht schlecht für den Anfang. Diese Frage katapultiert uns mitten hinein ins Gedankenlabyrinth von Gottfried Wilhelm Leibniz. Unter der unendlichen Zahl von möglichen Welten gibt es eine beste, so lautet Leibniz’ Antwort, sonst würde Gott sich nicht entschlossen haben, überhaupt eine Welt zu erschaffen. Und wenn es eine bessere als diese gäbe, dann hätte Gott sie erschaffen. Ehe wir uns versehen, finden wir uns mit diesen Worten in einer Welt zwingender Vernunftschlüsse und rigoroser Rationalität wieder, die nicht nur den Menschen, sondern auch Gott den ehernen Gesetzen notwendiger Wahrheiten zu unterwerfen scheint. So über die Welt zu reden, ist uns heute fremd geworden. Zum einen, weil spätestens mit der kantischen Vernunftkritik solche Aussagen als unzulässige Grenzüberschreitung der menschlichen »ratio« erachtet werden. Zum anderen aber auch, weil schon lange niemand mehr in der Lage ist, sämtliche Wissenschaften zu überschauen und gleichzeitig in vielen Bereichen davon Exzellentes zu leisten. Umso faszinierter blicken wir zurück auf eine Zeit, als so etwas noch möglich schien, und auf Personen, die solches zu versuchen wagten. Einer von ihnen war Leibniz, als universales Genie – wie viele meinen – vielleicht einer der letzten seiner Art, auf jeden Fall Vertreter einer verlorenen Zeit: der im Barock beginnenden europäischen Frühaufklärung. Eine Zeit also, die für Vernunftoptimismus und Fortschrittsglaube steht, für die Zuversicht, die Menschheit werde auf der Basis einer rationalen Religion und vorangetrieben durch die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik in eine lichte Zukunft schreiten. Heute scheinen ein kritischer Blick auf Fortschritt und Wachstum, die Säkularisierung und die starke Ausdifferenzierung der Wissenschaften es unmöglich zu machen, an die Gedanken- und Ideenwelt des barocken Universalgelehrten anzuknüpfen.
Warum also eine Welt und dann noch ausgerechnet diese? Leibniz’ Antwort ist heute vor allem durch Voltaires Erzählung »Candide« von 1759 bekannt und von ihr nahezu vollständig überblendet. Von der besten aller möglichen Welten zu reden, scheint daher nur möglich, wenn man diese Aussage kritisiert und verwirft, ja ins Lächerliche zieht und verspottet. Ob Voltaires Kritik an Leibniz so überhaupt zutrifft, ist heute umstritten. Um Leibniz’ Welt zu verstehen, seine Sicht der Dinge und die Zeit, die jene Weltsicht hervorgebracht hat, zu begreifen, ist es erforderlich, hinter diese Kritik zurückzugehen. Leibniz im Alltag zu begegnen, ihn im täglichen Vollzug seines Denkens und Schaffens zu beobachten, verspricht nicht nur eine spannende Reise in eine faszinierende Zeit. Es ermöglicht auch ein vertieftes Verständnis seiner Philosophie, Mathematik und universalwissenschaftlichen Unternehmungen. Auf einmal erscheint Leibniz gar nicht mehr so fremd, in vielem mag er seltsam vertraut wirken, denn mit so manchen seiner Fragen und Probleme schlagen sich auch die Menschen heutiger Zeit tagtäglich herum. Allongeperücke und Gehrock erscheinen dann nicht mehr als Ausdruck für Wesenszüge einer unerreichbaren Figur aus einer vergangenen Epoche. Stattdessen entpuppen sie sich als bloß äußerliche Hülle. Lässt man sie beiseite, tritt eine Person zutage, die Ähnlichkeit hat mit dem dauerkommunizierenden, zugleich in sich selbst zurückgezogenen, isolierten Ich der Gegenwart.
Unglück und Leid, Menschen, die einander quälen, und dann noch entsetzliche Naturkatastrophen wie das verheerende Lissaboner Erdbeben 1755 – Voltaire lässt Candide, bestürzt, blutend und zitternd, zu sich selbst sagen: »Wenn dies die beste aller möglichen Welten ist, wie müssen dann erst die andern sein?«[1] Leibniz betrachtet das Problem von einer anderen Seite. Das, was ist, können wir rückwirkend nicht mehr ändern, wohl aber können wir versuchen, das Bestehende zu verbessern. Leibniz sieht die Welt von ihren Möglichkeiten her. Nicht alles, was möglich ist, muss und kann jemals Wirklichkeit werden. Aber zumindest einiges davon lässt sich realisieren, vielleicht mehr, als es zuweilen den Anschein hat. Würde alles in der Welt mit Notwendigkeit geschehen, könnte der Mensch für sein Handeln nicht verantwortlich gemacht werden, es gäbe keine Moral und auch keine Freiheit. Frei ist nicht nur Gott gewesen, zwischen verschiedenen möglichen Welten auszuwählen, auch und vor allem dem Menschen steht es frei, die Welt zu verändern, sie mitzugestalten.
Lange Zeit ist dieser Gedankengang lediglich als abstrakte Reflexion streng rationalistischer Prägung gedeutet worden. Leibniz ist jedoch keineswegs, wie oft behauptet, ein spröder Rationalist gewesen, der seinen Kopf stets in den Wolken trug und die Erfahrung verachtete. Vielmehr stand er mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität, in seinem Fall der Realität des barocken Fürstenstaates. Dabei suchte er nicht bloß die Unterstützung der Mächtigen für seine ehrgeizigen Weltverbesserungspläne, sondern zugleich die Unabhängigkeit von ihnen, um ein freier Wissenschaftler bleiben zu können. Freiheit lässt sich bei Leibniz konkret verorten. Nicht nur versunken am Schreibtisch, auch auf Reisen zwischen den Fürstenhöfen, denen er dient, öffnet sich ihm ein willkommener Freiraum. Seine Dienstreisen nach Braunschweig und Wolfenbüttel beispielsweise nutzt er eine Zeitlang gerne für Abstecher nach Ermsleben, einem kleinen Ort südlich von Halberstadt, um dort ein paar Tage Pfarrer Jakob Friedrich Reimmann zu besuchen. Leibniz genießt die ungezwungenen Stunden. Er speist am Familientisch, begnügt sich mit Hausmannskost und ergeht sich in langen gelehrten Gesprächen im Arbeitszimmer Reimmanns. Leibniz, so schreibt Reimmann zurückblickend, »hat zuweilen bis 12. und 1. Uhr in der Nacht bey mir gesessen, und immer weggeredet«.[2]
Bis tief in die Nacht hinein über Gott und die Welt plaudern, als ob es keinen Morgen gäbe. Dass jeder Tag sich einmal dem Ende zuneigt, bevor ein neuer beginnt, daran kann auch ein Leibniz nichts ändern. Ihn im Alltag zu begleiten, ihn an sieben Tagen in unterschiedlichen Lebensphasen und an verschiedenen Orten zu beobachten, eröffnet die Chance, sein Denken und Handeln besser zu verstehen, den Zusammenhang zwischen Welterfahrung und Weltsicht schärfer zu erkennen. An jedem dieser Tage können wir Leibniz aus einer veränderten Perspektive betrachten, so wie auch seine Philosophie es fordert, beständig den Standpunkt zu wechseln und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Freilich: Die hier ausgewählten Tage können nur jeweils kleine Ausschnitte bieten. Einiges kann nur für Momente aufblitzen. Doch zeigt sich dabei, wie es Leibniz immer wieder gelingt, weit voneinander liegende Wissensfelder miteinander zu verbinden. Dabei muss sein Diktum, alles hänge mit allem zusammen, zuweilen als Ausrede herhalten, um die Weitläufigkeit seiner Studien, die oft verhindert, dass er etwas abschließen kann, zu entschuldigen. Ein Universalgelehrter kann es sich einfach nicht erlauben, irgendeinen Wissensbereich zu vernachlässigen. Die Welt verbessert man nicht nur im Großen, sondern auch in den kleinen Dingen. Zum Beispiel indem man einen Nagel so einritzt, dass er sich beim Versuch, ihn wieder aus der Wand oder einem Brett herauszuziehen, im Holz verkeilt – eine Art Dübel also, den Leibniz mal so nebenbei erfindet und der heute unsere Welt im Kleinen buchstäblich zusammenhält.[3]
Wie konkret kann oder darf eine Philosophie überhaupt werden? Ohne Kaffee und Schokolade jedenfalls hätte Leibniz, wie wir noch sehen werden, die Welt wohl kaum als bestmögliche betrachtet. Jedenfalls sind es gerade die konkreten Beispiele, die Leibniz’ Ansichten anschaulich machen. So habe sich Gott beispielsweise entschieden, Löwen zu erschaffen, obwohl sie gefährlich für den Menschen seien, denn ohne Löwen wäre die Welt weniger perfekt gewesen. Vielfalt oder Diversität ist bereits vor Leibniz ein Aspekt gewesen, bei dem die ansonsten eher trocken und sperrig argumentierenden Theologen der spanischen Spätscholastik im 17. Jahrhundert erstaunlich gegenständlich werden konnten. Eine Welt etwa, die nur aus Fliegen besteht, so der spanische Jesuit Antonio Perez, komme auf keinen Fall in Betracht, selbst wenn Gott nicht zur Schaffung des Weltoptimums genötigt gewesen wäre.[4] Apropos Fliege, sie spielt in Leibniz’ Philosophie zwar keine große, wohl aber eine kleine Rolle. Sie taucht deshalb auch im vorliegenden Buch gelegentlich auf: Anfänglich fiktiv, surrt sie wieder davon, um dann und wann plötzlich erneut (und nun als Gegenstand von Leibniz’ Denken) zu erscheinen – wie eine Art metaphysisches Alter Ego zu Leibniz.
Hartnäckige Unbekümmertheit hat Leibniz mit Fliegen gemeinsam. Auch er lässt sich nicht abwimmeln, stört penetrant die Ruhe mächtiger Fürsten, um sie für seine Fortschrittspläne zu gewinnen. Umgekehrt lässt sich Leibniz durch die kleinen summenden Nervensägen nie lange vom Schreiben abhalten. Ohnehin ist es kaum begreiflich, dass jemand, dem jede Ablenkung willkommen ist, der jede Anregung sofort aufnimmt, nichts verschiebt, sondern alles auf einmal machen will, zugleich in der Lage ist, sich überall und in jeder Situation auf das Lesen und Schreiben zu konzentrieren. Kein Lärm, kein Gestank, kein Schlagloch auf einer Kutschfahrt, kein Kummer hält ihn davon ab, ein Stück Papier nach dem anderen mit Buchstaben, Zahlen und Zeichnungen zu füllen. Graphomanie in Gelassenheit. Leibniz scheint morgens schreibend aufzustehen und abends schreibend ins Bett zu gehen. Und so ganz nebenbei türmt sich ein Papierberg neben dem anderen auf, Türme gewaltigen Ausmaßes, Blätter verschiedenster Größen und winzige Papierfetzen. Hinterlassen hat Leibniz ein Papiergebirge aus etwa 100000 Blatt mit Konzepten, Notizen und Briefen. Der größte Teil ist heute in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek/Niedersächsische Landesbibliothek in Hannover aufbewahrt. Mit etwa 1300 Personen hat Leibniz korrespondiert. Die Briefe von und an Leibniz zählen seit 2007 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe, und die von zwei Akademien getragene historisch-kritische Leibniz-Edition wird wohl noch Jahrzehnte brauchen, um all das Material zu veröffentlichen. Kein Fliegengewicht also unter den Geistesgrößen der Weltgeschichte.
Trifft man Leibniz auf seinen Reisen, am Schreibtisch inmitten seiner Manuskripte, beim Briefverkehr mit Gelehrten aus ganz Europa oder im Gespräch mit Fürstinnen und Fürsten, so wird zugleich deutlich, dass seine Grundhaltung stets optimistisch ist. Doch dieser Optimismus hat eine ganz bestimmte Ausprägung, die ihn deutlich von der schwärmerischen Fortschrittseuphorie des späten 18. Jahrhunderts unterscheidet. Mitunter kommt hinter diesem Optimismus auch eine gewisse Schwermut zum Vorschein. Oft habe er, schreibt Leibniz einmal, mit Kummer an all die Übel gedacht, denen wir Menschen unterworfen sind: die Kürze des Lebens, die Eitelkeit, die Krankheiten, schließlich der Tod, der unsere Leistungen, unser Mühen zu vernichten drohe: »Diese Meditationen stimmen mich melancholisch.«[5] Die Hoffnung, es werde in der Welt bergauf gehen, scheint somit ein Stück weit der Sorge zu entspringen, dass dies, wenn es schlecht läuft, vielleicht auch nicht geschehen könnte.
Ohne eigene Anstrengung jedenfalls geht es nicht. Leibniz’ Welt ist nur deshalb die bestmögliche, weil in ihr zugleich die Möglichkeit des Menschen, das Beste anzustreben, mitgedacht ist. Die beste Welt immer von neuem zu realisieren, wird zur beständigen Aufgabe – zum Tagesgeschäft einer Welt im Modus des permanenten Aufbruchs. Wie ein kleiner Gott steht jeder Mensch jeden Tag vor der Herausforderung, zwischen vielen Möglichkeiten diejenige auszuwählen, die wirklich werden soll. Alle möglichen Welten, so Leibniz, streben danach, wirklich zu werden, doch nur eine kann tatsächlich existieren, während alle anderen im Raum des bloß Möglichen verbleiben müssen. Für Leibniz, der seine Gedanken vor allem durch Tinte und Feder Realität werden lässt, bedeutet dies, Tag für Tag zu entscheiden, was er zu Papier bringt und dann beim Schreiben weiterentwickelt. In dem Moment, bevor seine Feder die weiße Leere der Schreibfläche berührt, liegen alle Möglichkeiten gleichermaßen in der Schwebe, doch im Augenblick des Berührens tritt eine davon in die Welt.
Kapitel 1Paris, 29. Oktober 1675
Fortschrittsoptimismus und rastloses Unterwegssein
»Es ist nicht gut, wenn eins den ganzen Tag lang grübelt.
Das Denken schadet der Gesundheit, Metaphysicus.
Sieh lieber zu, was da am Schlammgrund zuckt und gluckst.«
DURS GRÜNBEIN, Vom Schnee oder Descartes in Deutschland, Frankfurt/M. 2003, S. 35
Die Fliege
Von der Zimmerdecke zieht sie surrend ihre Bahnen durch die Wohnung, dabei wechselt die Stubenfliege immer wieder ruckartig die Flugrichtung. Ihre Bewegungen sind längst nicht mehr so schnell, die Tage sind kürzer geworden, und die Fliege sinkt träge auf die Fensterbank. Die Kühle lässt sie erstarren, doch als der Ofen zu wärmen beginnt, schwirrt sie erneut durch die von Fackelschein und Kerzen erleuchtete kleine Stube. Am Fenster gibt es eine weitere Wärmequelle. Auf dem Tisch daneben befinden sich Essensreste, eine Tasse mit Kaffee und Zucker. Die süße Nahrung lockt die Fliege, sie fliegt zum Tisch. Dort beginnt die dunkle Wärmequelle sich zu bewegen. Eine zum Schlag erhobene Hand wirft einen Schatten, blitzschnell entwischt das Insekt. Während die Person mit der Hand nur etwa zwanzig Einzelbilder pro Sekunde verarbeitet, nimmt die Fliege in derselben Zeit ungefähr zweihundert Bilder wahr. Die Hand bewegt sich für sie ungeheuer langsam – wie in Zeitlupe –, längst schon ist das störende Insekt in Richtung Ofen davongeflogen. Von dort aus beobachtet der Winzling den großen warmen, auf einem Stuhl scheinbar ewig verharrenden Schatten, um von Zeit zu Zeit erneut in die Nähe des begehrten Zuckers zu fliegen …
Kaffee, ein wenig Wein und reichlich Zucker
Tief gebeugt sitzt am Tisch eine unablässig lesende und schreibende Gestalt, gelegentlich mit der Hand eine lästige Fliege vertreibend, die wie sie den Zucker liebt. So können wir uns Gottfried Wilhelm Leibniz vorstellen, wie er vermutlich seit dem späten Vormittag pausenlos an diesem Platz sitzt und arbeitet. Sich das Geschehen aus dem Blickwinkel einer Fliege vorzustellen, fällt ihm jedenfalls nicht schwer, besteht doch die ganze Welt seiner Auffassung nach aus einer Vielzahl perspektivischer Wahrnehmungen unterschiedlicher Akteure. Längst ist der in Paris in diesem Jahr besonders trockene Spätsommer vorbei, allmählich wird es kühler.[1] Ohne beheizten Ofen hält man es kaum aus, den Tag vorwiegend sitzend zu verbringen. Dabei ist dies die bevorzugte Lebensart des aus Sachsen stammenden Gelehrten. Leibniz ist neunundzwanzig Jahre alt, mittelgroß, etwas hager und trägt bräunliches Haar. Sich selbst beschreibt er als einigermaßen ausgeglichen, weder zu Impulsivität noch Melancholie neigend, ebenso schnell denkend wie lebhaft empfindend. Vor allem aber fürchtet er, anhaltendes Studieren im Sitzen und zu wenig Bewegung könnten ihm eines Tages einen frühen Tod bescheren.[2] Tagsüber trinkt er stark gezuckerten Kaffee, abends nur ein wenig Wein, den er zur Freude der Fliegen ebenfalls gerne etwas nachsüßt. In Frankreich, wo der gregorianische Kalender gilt, ist heute Dienstag, der 29. Oktober 1675. Leibniz wohnt im Faubourg St. Germain in der etwa 220 Meter langen schnurgeraden Rue Garancière, die damals noch außerhalb des Stadtzentrums lag.
An diesem trüben Dienstag Ende Oktober bringt Leibniz in Paris zum ersten Mal ein Zeichen zu Papier, das die Mathematik grundlegend verändern wird. Was heute zum Schulstoff in der höheren Mathematik zählt und ihm an jenem Tag aus der Feder fließt, ist ein einfaches Symbol, das auf vortreffliche Weise das Wissen der besten Mathematiker des 17. Jahrhunderts in sich bündelt und von seinem Erfinder zu einem Schlüsselsymbol einer neuen mathematische Methode weiterentwickelt wird. Gemeint ist das »ʃ«, ein überlanges »s«, heute bekannt als Integralzeichen, mit dessen Hilfe sich Kurvenverläufe wie auch Flächen unter einem Kurvenbogen mit ein und demselben Rechenkalkül elegant berechnen und prägnant darstellen lassen. Der 29. Oktober markiert einen Höhepunkt in Leibniz’ jahrelanger Arbeit zur Infinitesimalmathematik. Er kreiert, wie sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate herausstellen wird, mit dem »ʃ« ein Zeichen, das entscheidend zur Entwicklung einer Rechenmethode mit unendlich kleinen Größen im Rahmen eines leicht handhabbaren Formelapparats beiträgt. Doch der Reihe nach.
Am Abend vor jenem Dienstag ist Leibniz wahrscheinlich wieder spät zu Bett gegangen. Wie so oft. »Sitzt lang zu Nacht und steht später auf«, weiß er über sich zu berichten.[3] Unermüdliches Arbeiten bis tief in die Nacht hinein, während andere schon schlafen, ist er gewohnt. Seit etwa einem Jahr bereits lebt der eifrige Spätarbeiter hier in der engen und dunklen Straße unweit des Jardin du Luxembourg. Was aber hat Leibniz nach Paris verschlagen? Der Weg aus dem fernen Sachsen hierher hätte abenteuerlicher nicht sein können. 1646 in Leipzig in einem Akademikerhaushalt geboren – seine Mutter war die Tochter eines bekannten Anwalts, sein Vater Notar und Universitätsprofessor –, wuchs er in einer Zeit des politischen und geistigen Umbruchs auf. Große Teile Mitteleuropas lagen in Schutt und Asche. Der verheerende Krieg war vorbei, geblieben aber waren ein zerstrittenes Europa und ein tief gespaltenes Christentum mit kaum versöhnlichen Konfessionen. Ebenso drohte die Einheit von Glaube und Vernunft durch die neuen, aufstrebenden Wissenschaften des Rationalismus und Empirismus zu zerbrechen. Mit acht Jahren brachte sich der junge, helle Kopf in der häuslichen Bibliothek – sein Vater war zwei Jahre zuvor gestorben – autodidaktisch Griechisch, Latein und Hebräisch bei, verschlang ein Buch nach dem anderen, lernte sie sogar teilweise auswendig.
Zunächst schien der hochbegabte Junge in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, er studierte in seiner Heimatstadt und später in Altdorf bei Nürnberg Philosophie und Rechtswissenschaften. Doch die ihm nach der Promotion und Habilitation angebotene Professur schlug er aus und ging stattdessen – unablässig neues Wissen suchend und in sich aufsaugend – auf Reisen: etwas planlos, aber mit einem Interesse für alles und jeden zunächst in Richtung Holland, um in Frankfurt und dann 1668 in Mainz hängenzubleiben. Dort gelang es ihm, in den Dienst des Kurfürsten und Erzbischofs Johann Philipp von Schönborn zu treten und an einem größeren Projekt zur Rechtsreform teilzunehmen. Schon in Mainz zeigte sich seine typische Arbeitsweise des Hin- und Herspringens zwischen verschiedensten politischen, religiösen und wissenschaftlichen Fragen. Als Kind des Dreißigjährigen Kriegs und seiner Folgen suchte er nach Wegen, das politisch verkrachte Europa zu versöhnen, die Christenheit wieder zu vereinen und einen umfassenden Fortschritt in allen Bereichen menschlicher Gesellschaft und Zivilisation zu fördern. Weltweite Ausbreitung eines christlichen Glaubens auf Vernunftbasis, Förderung des allgemeinen Wohlstands, Verbesserung des Lebens durch Wissenschaft und Technik – ein Leben lang wird sich Leibniz diesen Idealen verpflichtet fühlen.
Doch wie das alles schaffen? Leibniz braucht ein universales Wissenschaftskonzept und viele Verbündete, gleichgesinnte Gelehrte und vor allem mächtige Unterstützer. Und das am besten in einer der Metropolen Europas. Leibniz zögert daher nicht, als sich ihm im Frühjahr 1672 die Gelegenheit bietet, in diplomatischer Mission nach Paris zu fahren, wo er daran mitwirken soll, die französische Regierung von einem Krieg gegen Holland und Deutschland abzuhalten. Er entwickelt einen Plan zur Besetzung Ägyptens durch eine Militäroperation Ludwigs XIV., nicht nur um den machthungrigen König von einer Offensive im Osten fernzuhalten, sondern um Frankreich strategisch in die Lage zu versetzen, zu den Reichtümern in Indien und Südostasien vorzudringen. Leibniz schlägt dafür sogar den Bau eines Kanals zwischen Mittelmeer und Rotem Meer vor. Doch der »Ägyptische Plan«, der die Idee des Suezkanals vorwegnimmt, aber nie das Ohr des französischen Monarchen erreicht, erledigt sich von selbst, als kurz darauf Frankreich die Niederlande angreift.[4]
Macht nichts, denkt sich Leibniz, Hauptsache Paris, neben London das Zentrum von Wissenschaft und Kultur in Europa. In Frankreichs Hauptstadt leben fast eine halbe Million Menschen, Leibniz findet sich inmitten einer modernen Metropole wieder. Auf den Straßen und Alleen sind zahllose Kutschen und Karossen unterwegs. Selbst nach Anbruch der Dunkelheit reißt der Verkehr nicht ab. Die Straßen sind beleuchtet von Öllampen, die jeden Abend neu entzündet werden, die weltweit erste flächendeckende Beleuchtung in einer Großstadt. Leibniz ist elektrisiert, taucht begeistert in den Strudel urbaner Modernität ein. Voller Tatendrang sucht er die Nähe zur gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Elite, vor allem zur Académie des sciences, wo die führenden Köpfe der Wissenschaft forschen und arbeiten. Er knüpft Kontakte zu mehreren Akademiemitgliedern, trifft sich unter anderem mit dem königlichen Bibliothekar Pierre de Carcavy, mit Giovanni Domenico Cassini, der am Pariser Obervatorium arbeitet, und wird auch zu Gesprächsrunden im Haus des bekannten Theologen und Philosophen Antoine Arnauld eingeladen. Hier gelingt ihm sogar der Kontakt zum mächtigen Finanz- und Wirtschaftsminister Jean Baptiste Colbert.
Zu dieser Zeit ist in Paris gerade die Philosophie des René Descartes in aller Munde. Die Anhänger Descartes’ teilen die Welt in einen strengen Dualismus von Geist und Materie ein, sie interpretieren Tiere als künstliche Automaten. Trotz ihrer Komplexität würden sich tierische Lebewesen, so behaupten sie, nicht grundsätzlich von einem Uhrwerk oder einer Wasserpumpe unterscheiden. Überhaupt begeistert sich das kulturelle und wissenschaftliche Paris für Automaten und Maschinen. Deren Präsenz nimmt im Alltag zu, ob als Spielzeugautomaten für Kinder des Adels, als Belagerungsmaschinen bei der Armee, als Spieluhren mit beweglichen Figuren bei Hofe oder als hydraulische Orgeln in der Kirche. Feinmechaniker tüfteln an lauffähigen Robotern. Auf der Bühne werden Stücke mit beweglichen Maschinen aufgeführt, in derselben Straße wie Leibniz wohnt Alexandre de Rieux, Marquis de Sourdéac, ein einflussreicher Gesellschafter und begeisterter Anhänger des Maschinentheaters.
Auch Leibniz, der in Paris den Descartes-Nachlass untersuchen wird, ist fasziniert von dieser Automatenwelt, versteht aber, anders als die Cartesianer, die Natur und das Leben nicht als kompliziertes Maschinenwerk. Bewusstsein und Geist hält er keineswegs für exklusive Eigenschaften des Menschen, überall in der Natur seien sie vorhanden, wenn auch in unterschiedlichen Graden. Das meint Leibniz, wenn er sagt, die ganze Welt sei durch und durch beseelt. Selbst so winzige Wesen wie Flöhe oder Fliegen stellten keine dumpfen Automaten dar, sondern besäßen Wahrnehmung und Bewusstsein, wenn auch in sehr einfacher, rudimentärer Form. Moderne Neurobiologen geben Leibniz recht. Experimente mit eingepflanzten Elektroden zeigen, dass Stubenfliegen über elementare kognitive Fähigkeiten und eine primitive Form der Aufmerksamkeit verfügen. Fliegen sind zwar auch für Leibniz lästige Wesen, doch betrachtet er die Konkurrenten um seinen geliebten Zucker anders als die cartesianischen Philosophen nicht als bloße fliegende Maschinen.
Träume der Großstadt
»Sein nächtlicher Schlaf ist ununterbrochen«, schreibt Leibniz über sich selbst.[1] Solche Schlafgewohnheiten sind im 17. Jahrhundert eher untypisch, legen doch viele Menschen eine oder mehrere Wachphasen in der Nacht ein.[2] Die meisten Europäer schlafen nicht acht Stunden am Stück, sondern in Etappen. Nach einer ersten Periode von drei bis vier Stunden folgt zumeist eine zwei bis drei Stunden lange Schlafpause, bevor man sich für den zweiten Schlaf wieder bis zum Morgen aufs Ohr legt. Die Wachphase wird zum Beten, Lesen, für amouröse Entspannung oder zum Unterhalten genutzt; manche verlassen sogar ihr Schlafzimmer, um Nachbarn zu besuchen. Leibniz hingegen verschläft solche Aktivitäten, genießt lieber die Bettruhe und träumt. Was er in dieser Nacht zum 29. Oktober 1675 genau geträumt hat, wissen wir nicht. Doch Träume spielen in seiner Weltanschauung eine wichtige Rolle. Sie dienen ihm als Beleg dafür, dass die mechanistische Naturauffassung der Cartesianer auch hier ins Leere greift. Denn nicht nur der wache Mensch verfüge über ein Bewusstsein, vielmehr seien ebenso im schlafenden und träumenden Menschen unmerkliche Bewusstseinsaktivitäten vorhanden. Dass wir im Schlaf Träume für real halten, erörtert Leibniz in einem Brief an seinen Freund, den in Paris lebenden Gelehrten Simon Foucher, anhand einer Episode über den Traum eines morgenländischen Kalifen.[3] Die Hauptstadt Frankreichs war ein guter Ort für solche Traumgeschichten aus dem Kulturkreis des Halbmondes. Um 1675 erfuhr der in Paris geborene Pétis de La Croix, der sich zu dieser Zeit im Orient aufhielt, von der als verschachtelte Traumerzählung abgefassten Märchensammlung »Tausendundein Tag«, die er später ins Französische übersetzte und zwischen 1710 und 1712 veröffentlichte.
Die Pariser Jahre zählen zu den fruchtbarsten in Leibniz’ Leben; über Briefe und mit Hilfe seiner bereits bestehenden Kontakte baut er systematisch ein Netzwerk mit Gelehrten in ganz Europa aus. Die Stadt wird zur Erleuchtung für ihn, er sprüht förmlich vor Ideen, arbeitet an unterschiedlichsten Projekten gleichzeitig und gerät phasenweise regelrecht in einen Fieberrausch des Forschens. Die Breite seiner universalwissenschaftlichen Interessen ist praktisch unbegrenzt. Der Radius seiner Aktivitäten umfasst – neben vielem anderen – beispielsweise theologische Probleme wie den Streit zwischen Katholiken, Protestanten und Reformierten um die Abendmahlslehre (Eucharistie), ebenso philosophische Fragen zu Freiheit, Moral oder dem Aufbau der Welt. Hinzu kommt ein atemberaubend weites Panorama naturwissenschaftlicher und medizinischer Themengebiete: darunter etwa physikalische Experimente zu Stoßkraft, Elastizität oder Statik, Untersuchungen in Anatomie und Heilkunde, Versuche mit Wasseruhren, chemischen Substanzen oder Filteranlagen zur Entsalzung von Meerwasser. Selbst kuriose Dinge wie die mit den Füßen erstellte Schriftprobe einer Frau ohne Arme entfachen seine Neugier.[4]
Leibniz träumt von einer Anstellung in Paris – am liebsten bei der Académie des sciences. Trotz eifriger Bemühungen ist ihm dies bis zum 29. Oktober 1675 noch immer nicht gelungen, obwohl er in kurzer Zeit fließend Französisch gelernt hat. Aber Frankreichs Hauptstadt mit ihren vielen brillanten Köpfen bleibt ein schwieriges Pflaster für einen ambitionierten jungen Intellektuellen. »Paris ist ein Ort, an dem es schwerfällt, sich zu unterscheiden: man findet die fähigsten Menschen unserer Zeit und alle Arten der Wissenschaften, man muss viel arbeiten und braucht ein wenig Robustheit, um sich Reputation zu verschaffen.«[5] An beidem – Arbeitseifer und Hartnäckigkeit – fehlt es ihm keineswegs.
Neben all seinen Forschungen bleibt ihm auch noch Zeit, um am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Bei Molières Bühnenstücken findet er ebenso Zerstreuung und Vergnügen wie im Théâtre du Marais. Zudem interessiert ihn die Salonkultur. Nicht sicher ist, ob er auch die legendäre Société de Samedi von Madeleine de Scudéry, mit der er später einen Briefwechsel führen wird, besucht hat. Leibniz ist kein Eigenbrötler, obwohl er nach eigenen Angaben Lektüre und einsames Nachdenken bevorzugt. Sich selbst beschreibt er zwar als wenig ansehnlich, mit meist blassem Gesicht und kalten Händen und Fingern, die im Vergleich zum übrigen hageren Körper viel zu lang seien. Trotzdem fühlt er sich in Gesellschaft wohl, ja weiß sie mitunter, wie er glaubt, »ziemlich angenehm zu unterhalten«. Dabei findet er mehr Spaß bei »scherzhaften und heiteren Gesprächen als bei Spiel oder Zeitvertreiben, welche mit körperlicher Bewegung verbunden sind«.[6] Alles, bloß nicht sich bewegen. Das am Hof beliebte Blindekuh-Spiel dürfte ihm ebenso wenig zugesagt haben wie die barocken Gesellschaftstänze Courante, Gigue oder Sarabande. Und als trinkfester Höfling, das weiß Leibniz nur zu genau, würde er keine gute Figur machen, deshalb mischt er bei längeren Festlichkeiten lieber viel Wasser in sein Weinglas.
Am Ufer der Seine
Was Leibniz ins Schwärmen geraten lässt, sind nicht rauschende Hoffeste, sondern die Fortschritte von Wissenschaft und Technik, die in Paris mit Händen zu greifen sind. Erst im letzten Monat, im September 1675, konnte er bei einem Spaziergang an der Seine beobachten, wie ein Mann versuchte, mit Hilfe einer Flugmaschine auf dem Wasser gehend den Fluss zu überqueren. Für Leibniz hat dieses öffentliche Schau-Experiment hohen Symbolwert. Es steht für das von den wissenschaftlichen Revolutionen des 17. Jahrhunderts genährte Versprechen, mit Hilfe von Forschung und Technologie bislang Unmögliches vollbringen zu können (nämlich halb hüpfend, halb fliegend einen Fluss zu überqueren). Zugleich schwingt hier auch ein religiöses Moment mit, nämlich die Verheißung, wie Jesus über das Wasser schreiten zu können. Die Flugaufführung lässt sich insofern lesen als Emblem für eine Zeit des Aufbruchs, in der Erfindungen, Maschinen und neue Konstruktionen die Aussicht eröffnen, die real gegebenen Beschränkungen hinter sich zu lassen und abzuheben in einen Raum ungeahnter Möglichkeiten.
Von dieser Fortschrittseuphorie ist auch Leibniz erfasst. Die spektakuläre Flugaufführung an der Seine beflügelt seine Phantasie und lässt ihn von einer Akademie öffentlicher Darbietungen träumen, mit Zirkusveranstaltungen, Turnieren, Schwertkämpfen und Feuerwerken, mit Bühnenstücken, die anatomische Demonstrationen, Experimente mit Maschinen, Laterna-magica-Aufführungen, Marionettenstücke, Rossballette, Seeschlachten oder Konzerte mit sprechenden Trompeten zum Besten geben. Es soll Lotterien und Glücksspiele geben, Ballspiele, Galerien, Kunst- und Naturalienkabinette, einen Heilkräutergarten und ein Registrierungsbüro für Erfindungen. Anschauungsmaterial für seine Akademieträume hat Leibniz genug, denn in der Nähe seiner Wohnung in der Rue Garancière befindet sich der bunte Jahrmarkt von Saint-Germain. Wohlhabende Männer aus dem Umfeld des französischen Königs sollen zur Finanzierung dieser Forschungs-, Bildungs- und Vergnügungseinrichtung animiert werden. Es gelte, die Neugier und die Leidenschaften der Menschen zu wecken und sie nicht (wie es die Kirche will) als Laster zu bekämpfen, sondern diese Schwächen für Fortschritt und Wohlstand zu nutzen. Leibniz leugnet das Schlechte im Menschen nicht, er will es nur positiv umwerten als Bedingung der Möglichkeit einer besser werdenden Welt.[1] Leibniz’ Optimismus, wie er für seine spätere Philosophie und die europäische Frühaufklärung charakteristisch werden wird, bricht sich hier bereits Bahn, während er im Spätsommer 1675 am Ufer der Seine sitzt und seinen Gedanken freien Lauf lässt.
Die weiße und schwarze Magie von Papier und Tinte
Doch das liegt schon wieder einige Wochen zurück. Wann Leibniz heute, an jenem Dienstag Ende Oktober, sein Bett verlassen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Sehr früh dürfte es wohl nicht gewesen sein, zumal ihn in diesen Tagen eine Erkältung plagt, die ihn am Ausgehen hindert.[1] Oft ist er zwar schon morgens wach, manchmal sogar gegen 6 Uhr. Doch zumeist denkt er noch gar nicht daran aufzustehen. Lieber gibt Leibniz sich ausgiebig seinen Gedanken hin. Den Kopf hat er bereits voller Ideen. Die Einfälle kommen zu ihm wie Waldtiere, die im Morgengrauen auf der Lichtung erscheinen. Kaum bleibt Zeit, bei einem Einfall zu verweilen, so schnell folgt schon der nächste. »Mir kommen manchmal morgens«, so notiert er sich, »während ich noch eine Stunde im Bett liege, so viele Gedanken, dass ich den ganzen Vormittag, ja mitunter den ganzen Tag und länger benötige, um sie mir durch Aufschreiben klar werden zu lassen.«[2] Zumeist sitzt Leibniz mit gekreuzten Beinen, also im Schneidersitz, im Bett und schreibt. Was zu Papier gebracht wird, sind keine fertigen Gedanken, vielmehr werden sie erst beim Aufschreiben gebildet. Während er formuliert, nehmen sie Gestalt an und gewinnen an Klarheit, worauf sich weitere Gedankenketten entfalten. Wie mit schwarzer Magie füllt Eisengallustinte in einem fort Papier um Papier. Blätter und Bögen werden beidseitig bis an den Rand beschrieben. Je näher die Papierkante kommt, desto winziger werden die Buchstaben, die der seit Kindesbeinen kurzsichtige Leibniz, mit dem Gesicht nah am Beschreibstoff, notiert.
An jenem späten Oktobertag geht es vor allem um mathematische Untersuchungen, mit angeregt durch die Diskussionen seines Landsmannes Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, der sich seit August in Paris aufhält. Mit Tschirnhaus diskutiert Leibniz manchmal von morgens bis abends. Wie im Rausch fertigen sie gemeinsam Rechnungen und geometrische Figuren auf einem Stück Papier an. Einmal treffen sie sich am Morgen um 9 Uhr. Als es dunkel wird, glaubt Leibniz, ein Gewitter sei aufgezogen, um dann anhand der Uhrzeit festzustellen, dass es bereits Nacht geworden ist.[3] Leibniz ist heute wohl allein, doch seine Schreibfeder steht ebenfalls den ganzen Tag kaum still. Unablässig fährt sie über das Papier, hastig schreibt er alles auf, was ihm einfällt, zeichnet und rechnet fast pausenlos. Glaubt er, einen Fehler gemacht oder sich verrechnet zu haben, wird das Geschriebene durchgestrichen, immer wieder setzt er neu an oder fügt Ergänzungen hinzu, die er am Rand notiert – häufig quer zur Schreiblinie oder in Form von Einschüben, die manchmal Sprechblasen ähneln. Französisch und Latein fließen ihm rasend schnell aus der Feder, Rechnungen werden durch Nebenrechnungen angereichert, Kurven und Flächen durch Tangenten ergänzt, Linien und Schnittpunkte mit Ziffern versehen. Ununterbrochen formt der Federkiel seine Gedanken. Abermals nutzt Leibniz jeden Millimeter des teuren und raren Papiers. Briefe, die er von Freunden und anderen Gelehrten erhalten hat, werden als Konzeptpapier wiederverwendet. Zu kostbar ist das Schreibmaterial, um es wegzuwerfen, und heutige Leibniz-Kenner behaupten etwas spöttisch, dass der vielschreibende und papierbegierige Gelehrte nie einen Papierkorb besessen habe. Leibniz traut seinem Gedächtnis nicht, schreibt alles nieder, um es nicht zu vergessen, und hebt alles auf. Lieber wolle er, so wird er mehrfach sagen, zweimal dasselbe erfinden als einmal nichts.
Beim Denken und Schreiben springt er nicht selten von einem Wissensgebiet zum nächsten. So finden sich oft auf ein und demselben Stück Papier neben- und untereinander Aufzeichnungen unterschiedlichster Inhalte und Fachrichtungen: beispielsweise eine mathematische Rechnung, daneben die Zeichnung zu einem physikalischen Experiment, darunter Exzerpte aus einer medizinischen Abhandlung, Konzeptzeilen für einen geplanten Brief und vielleicht auf der Blattrückseite noch philosophische Reflexionen zum Freiheitsproblem. Manchmal sind es inhaltliche Assoziationen, die Leibniz von einem Themenfeld zum nächsten leiten, manchmal gibt es scheinbar keinen Bezug zwischen den verschiedenen Notizen. Oft ist Leibniz so tief im Schreibprozess versunken, dass er alles um sich herum ausblendet, nur die lebensnotwendigen Grundbedürfnisse melden sich gelegentlich. Während er einmal Exzerpte aus einer Abhandlung über mechanische Stoß- und Aufprallkräfte anfertigt, macht er sich Notizen zu einer Lebensmittelrechnung: »zwei Würstchen, zwei Hühnchen, vier Brote und drei Mal Wein«.[4] Wer ohne Pause denkt und schreibt, darf dabei nicht vergessen, zu trinken und zu essen.
Dabei hat Leibniz nicht nur schreibend gedacht, sondern auch schneidend geordnet. Ist ein Papier ausreichend beschrieben, wird es oftmals mit der Schere zerlegt. Striche auf dem Papier zeigen die Linie, entlang deren geschnitten werden soll. Blätter werden zu Zetteln verarbeitet, viele von ihnen nicht größer als schmale Streifen. Auf diese Weise versucht Leibniz, die unterschiedlichen Gedanken thematisch voneinander zu trennen, um die Streifen und Papierstücke anschließend nach Sachgebieten systematisch zu ordnen. Meist jedoch kommt er gar nicht dazu. Zu rasch folgen neue Gedanken und neue Aufzeichnungen. Zettel um Zettel, Schnipsel um Schnipsel häufen sich zu einem immer größer werdenden Papierberg. Die Zeit in Paris ist erst der Anfang. Später wird diese Flut an befüllten Beschreibstoffen so sehr anschwellen, dass Leibniz in ihr zuweilen unterzugehen droht. Im buchstäblichen Sinne beginnt er, sich zu verzetteln, und bezeichnet seine Zettelwirtschaft selbst freimütig als »ein groß chaos«.[5] Schreib-, Schneide- und Schnipsel-Technik bringen schließlich bis zu seinem Tod mit Abertausenden Papieren und Papierstückchen einen der größten Gelehrtennachlässe der Weltgeschichte hervor. Was Leibniz einer ratlosen Nachwelt hinterlassen hat, so wurde es einmal treffend formuliert, »ist ein Heuschober voller Annalen, Gutachten, Aide-mémoires, Kataloge, Miszellaneen; ein Wirrwarr von Abstracts und Abstracts von Abstracts und Abstracts von Abstracts von Abstracts …«.[6]
Abb. 1. Schnipsel und Streifen aus dem Leibniz-Nachlass der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek/Niedersächsische Landesbibliothek
Leibniz was a Rolling Stone
An diesem Vormittag dürfte es mal wieder laut gewesen sein in der engen Rue Garancière, wie an den meisten Tagen. Am Ende der kurzen Straße wird zurzeit an der Kirche Saint-Sulpice, einer monumentalen Basilika, gebaut. Begonnen wurde der Neubau schon vor fast drei Jahrzehnten, doch ausbleibende Geldzahlungen haben die Bauarbeiten immer wieder verzögert, und auch in diesem Herbst sind sie immer noch nicht abgeschlossen. Der Lärm mag vielleicht noch auszuhalten gewesen sein, Leibniz’ ausgeprägter Heißhunger[1] hingegen dürfte ihn schließlich aus dem Bett getrieben haben. Das späte Frühstück ist wahrscheinlich karg ausgefallen, denn er hat wenig Geld und muss sich die Lebensmittel einteilen. Ganz anders dagegen im etwa fünfundzwanzig Kilometer entfernten Schloss in Saint-Germain-en-Laye, wo Ludwig XIV., ein notorischer Frühaufsteher, meist um 8 Uhr morgens schon ein opulentes Frühstück mit frischem Obst, Pasteten und erlesenem Schwarztee zu sich nimmt. Verglichen damit kann sich Leibniz nur eine bescheidene Unterkunft leisten. Wo genau er in der Rue Garancière wohnt, ist nicht überliefert, vermutlich in einem eher mittelmäßigen, vielleicht schon etwas heruntergekommenen Gästehaus, möglicherweise im ehemaligen Mädchenpensionat, das seit einem Jahr geschlossen ist. Dessen Besitzerin, eine gewisse Madame Saujon, wird die Einrichtung aber noch mindestens bis 1696 als privatwirtschaftliche Pension weiterbetreiben.[2]
Nur mit Mühe hält sich Leibniz über Wasser. Eine Zeitlang hatte er sich noch um die Erziehung eines jungen Adeligen aus Mainz, Philipp Wilhelm von Boineburg, gekümmert. Inzwischen aber sind die Kontakte zu seinen ehemaligen Auftraggebern aus dem rheinischen Erzbistum so gut wie abgebrochen. Trotz der schwierigen Lebenssituation ist er weiterhin fest entschlossen, an der Seine zu bleiben. Im Frühjahr 1673 hat er ein lukratives Angebot als Sekretär des leitenden Ministers am dänischen Hof ausgeschlagen. An seinen Freund Christian Habbaeus von Lichtenstern, der ihm die Stelle vermitteln wollte, schrieb er, dass er es nicht gewohnt sei, sich »den politischen Launen irgendwelcher großer Herren« zu unterwerfen. Von den Affären an Fürstenhöfen wolle er sich lieber fernhalten.[3]
Leibniz gibt sich selbstbewusst und mutig und fühlt sich als freier Geist. Allein einer sicheren Stelle wegen will er nicht in den Dienst irgendeines Fürsten treten und zum subalternen Höfling verkommen. Nicht einer einzigen Nation zu dienen, ist sein Ziel, sondern dem gesamten Menschengeschlecht. Es geht ihm um die Förderung des Gemeinwohls, des »bonum commune« aller Völker. Lieber bei den Russen viel Gutes ausrichten als bei den Deutschen oder anderen Europäern wenig, wird er später einmal sagen, denn er halte »den Himmel für das Vaterland und alle wohlgesinnte[n] Menschen für dessen Mitbürger«.[4] Entschlossen pocht Leibniz auf seine Unabhängigkeit als Gelehrter, letztlich nur der Wissenschaft und Philosophie verpflichtet. Und doch sucht er die Nähe politischer Herrscher. Denn er benötigt die Unterstützung zahlungskräftiger Potentaten, um seine Forschungen zu finanzieren und seine hochfliegenden Ideen und Pläne für den Fortschritt der Menschheit zu verwirklichen. Ideal wäre ein Herrscher, der ihn in Ruhe forschen lässt und gleichzeitig Macht, Geld und den Willen hat, seine ambitionierten Projekte zu fördern.
Einen solchen vielversprechenden Förderer scheint Leibniz an jenem Dienstag im Spätoktober 1675 bereits gefunden zu haben. Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, Herzog von Hannover, will ihn für ein jährliches Gehalt von immerhin 400 Talern als Bibliothekar und Hofrat an die Leine holen. Leibniz hat zugesagt, doch noch zögert er, wirklich nach Hannover zu reisen, um die Stelle anzutreten. Bis zum Sommer konnte er sich noch mit juristischen Gutachten durchschlagen, obwohl die Einmalzahlungen für solche Gelegenheitsjobs kaum für Miete und Essen reichen. Doch nun droht ihm das Geld ganz auszugehen. Erst vor einigen Tagen hat er in seine sächsische Heimat geschrieben und seinen Halbbruder Johann Friedrich sowie Christian Freiesleben, der sich um die juristischen Angelegenheiten der Familie kümmert, um finanzielle Unterstützung gebeten.[5] Noch während er auf Antwort wartet, scheint sich plötzlich doch eine Perspektive zu öffnen, in Paris eine Anstellung zu finden.
Vor zwei Tagen ist der Mathematiker Gilles Personne de Roberval gestorben. Auf dem frei gewordenen Platz in der Académie des sciences kann sich Joachim D’Alencé, Sekretär und Berater Ludwigs XIV., durchaus Leibniz vorstellen. Aufsehen hat in Paris vor allem dessen Modell einer Maschine zur Durchführung automatisierter Rechenoperationen gefunden. Noch immer aber ist Leibniz mit dem Resultat nicht zufrieden und arbeitet fieberhaft weiter an der Perfektionierung seiner »Machina arithmetica«. Und an ebenjenem Dienstag, dem 29. Oktober, verfasst D’Alencé um die Mittagszeit ein kleines Billett, in dem er Leibniz auffordert, die Arbeiten an seiner Rechenmaschine rasch zum Abschluss zu bringen, um sich damit für die Aufnahme als Mitglied der Akademie bewerben zu können.[6]
Allerdings wird die Initiative bald im Sande verlaufen. Für Leibniz jedoch ist das kein Weltuntergang, schließlich hat er noch die Stellenzusage des Hannoveraner Herzogs in der Tasche. Letztlich träumt er in diesen Wochen und Monaten davon, als freier Gelehrter zwischen Frankreich und dem deutschen Reich pendeln zu können, mal dem einen, mal dem anderen Herrscher dienend, oder besser noch: im Auftrag mehrerer Fürsten gleichzeitig. An Habbaeus von Lichtenstern schreibt er, dass er am liebsten so etwas wie ein »amphibisches Wesen« wäre, bald in Deutschland, bald in Frankreich lebend.[7] Was ihm vorschwebt, ist ein autonomes Leben mit guten Verbindungen zu Trägern der Macht, zwischen deren Höfen er permanent hin- und herfahren könnte. Ein dauerhaftes Unterwegssein im Dienste der Wissenschaft, ausgestattet mit Vollmachten und Empfehlungen eines Sonderbotschafters von höchsten Gnaden. Halb Landtier, halb Wassertier: Leibniz’ Amphibien-Metapher zeigt, dass er bereit ist, für eine solche Existenz auch den Preis nicht eindeutiger Zugehörigkeit zu bezahlen. Tatsächlich bekommt er als Wahlpariser von seinem Halbbruder immer wieder vorgeworfen, es mangle ihm an Patriotismus gegenüber seinem Vaterland und er stehe den katholischen Franzosen näher als seinen protestantischen Landsleuten.[8]
Hybride Existenzen mit hoher Mobilität sind in der frühen Neuzeit weit verbreitet: inoffizielle Diplomaten, Spione, fliegende Händler, Gaukler, wandernde Handwerker, reisende Gelehrte, Religionsflüchtlinge, arbeitslose Söldner, Gelegenheitsarbeiter – nicht selten mischen sich mehrere Zuordnungen in ein und derselben Person. Ihr Zuhause ist überall dort, wo sie sich abends zum Schlafen legen. Sie führen ein Leben, wie es etwa Anthony Standen, ein berüchtigter englischer Doppelagent des späten 16. Jahrhunderts, in Bezug auf sich selbst beschrieben hat: in »perpetual motion and so comfortable to our English proverbe of the Rowlinge stone«.[9] Auch Leibniz ist ein solcher »Rolling Stone«, er gehört zum Kreis jener prekären Personen, die von anderen zumeist als suspekt eingestuft werden, weil sie sich nirgends richtig verorten lassen. Und auch er wird später noch mehrfach der Spionage oder Doppelspionage beschuldigt werden.
Leibniz’ berufliche und finanzielle Situation war nie – weder vorher noch nachher – schlechter als im Oktober 1675. Ausgerechnet in jener Zeit gelingen ihm wichtige Durchbrüche in der Mathematik. Spitzenleistung in der Wissenschaft auf dem Tiefpunkt der beruflichen Karriere – ein Zufall? Für Leibniz nicht, im Gegenteil entspricht es exakt seiner Vorstellung davon, dass nicht der Überfluss, sondern der Mangel in der Welt das Gute hervorbringt. »Dann ich sehe und erfahre, daß die so viel haben offt soviel verzehren, als die so wenig haben gewinnen. Wer weniger hat, muß mehr arbeiten. Und ie mehr man arbeitet, ie mehr wird man geschickt. Und wer geschickt, dem ist nicht schwehr etwas zu gewinnen.«[10] So schreibt der wenig verdienende und hart arbeitende Leibniz am 21. Oktober, also acht Tage bevor er mit der Erfindung eines neuen mathematischen Symbols seine Geschicklichkeit in der höheren Wissenschaft mehr als unter Beweis stellt. Wieder wird das Negative umgewertet, diesmal sind es nicht die menschlichen Laster und Schwächen, die das Positive bewirken, sondern Not und Verzicht, die erfinderisch machen. Was zum Markenkern der leibnizschen Philosophie gehört und was er in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer stärker theoretisch ausformulieren wird, nämlich der Gedanke, dass das Schlechte in der Welt zur Verwirklichung des Guten notwendig ist, hat hier einen konkreten Lebensbezug: Inmitten eines Karriereknicks schwingt sich Leibniz zu den höchsten Höhen abstrakter Mathematik auf und vollbringt Außerordentliches.