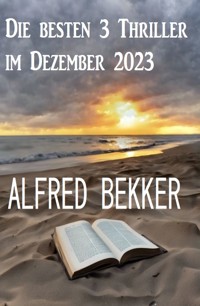Ein Harry Kubinke Krimi
Der Berliner Kommissar Harry Kubinke gerät ins Visier eines
kriminellen Clans aus dem Wedding. Gleichzeitig erschüttert eine
Reihe von Morden die Bundeshauptstadt, bei denen ein Spezialgewehr
für Scharfschützen eine Rolle spielt. Kubinke und sein Team müssen
alles daransetzen, die Hintermänner zu finden. Für den Kommissar
selbst wird dieser Fall eine Frage von Leben und Tod.
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen,
Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb
er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry
Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica
Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick,
Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und
BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Alfred Bekker: Kubinke im Fadenkreuz
Kommissar HARRY KUBINKE ermittelt in Berlin.
Kommissar RUDI MEIER ist sein Kollege.
*
Ein dummes Gefühl, wenn man weiß, dass man sich im Fadenkreuz
eines Killers befindet…
Das war in Kreuzberg vor einer urigen Kneipe, an deren
Außenwand noch ein großer roter Stern und ein Anarchisten-Zeichen
aufgemalt war. Man fühlte sich irgendwie in die Achtziger
zurückversetzt, als die die Stadt voller Punks und Hausbesetzer
gewesen war und alle möglichen Politsekten des linken Spektrums
hier das Straßenbild geprägt hatten. Alternative, Anarchisten,
Autonome…
Damals alles junge Leute, inzwischen aber in Jahre
gekommen.
So wie der Inhaber der Kneipe. Sein Outfit war originalgetreu.
Wer seine Figur über die Jahre behält, kann seine Sachen ewig
tragen.
Seine Klamotten waren dieselben geblieben. Etwas ausgebleicht
von unzähligen Wäschen, aber dieselben, so als wollte er ein
einsames Fanal gegen den Konsumterror setzen. Nur er selbst hatte
sich verändert. Er trug immer noch die Haare zu einem Zopf
zusammengefasst, nur waren es inzwischen sehr viel weniger Haare.
Und sie waren grau. Die kahle Stelle am Hinterkopf wirkte wie eine
Mönchstonsur.
„Willste ‘nen Kaffee?”, fragte er.
„Ja”, sagte ich. „Immer noch der Magenunfreundliche aus
Nicaragua?”
„Ist für die Solidarität.”
„Schon klar.”
„Sind gute Projekte.”
„Hoffe ich.”
„Ey, echt!”
„Echt.”
Der Sowjet-Stern und das Anarcho-Zeichen waren von dem
Kneipier in all den Jahren immer wieder sorgfältig nachgemalt
worden. Die einzigen Stellen an dieser Fassade, die einen
gepflegten Eindruck machten.
Für mich waren der Sowjet-Stern und das Anarcho-Zeichen
eigentlich Gegensätze. Aber den Kneipier schien das nicht weiter zu
jucken. Das war eben Hausbesetzer-Nostalgie. Inzwischen hatte der
Typ wahrscheinlich seit Jahrzehnten einen ganz spießigen
Mietvertrag.
Man schrieb 2018, aber ein Besuch hier war immer wie eine
Reise mit der Zeitmaschine in die 80er, die Zeit des Kalten
Krieges, der Mauer und die Zeit von Präsident Reagan, der von
Gorbatschow forderte, die Mauer niederzureißen.
Ich traf mich in diesem Lokal normalerweise mit einem
Informanten. Mein Kollege Kommissar Rudi Meier war auch
dabei.
Diesmal trafen wir uns genauer gesagt eigentlich nicht in dem
Lokal, sondern davor, denn der autonom-alternative Kneipier hatte
ein paar Stühle auf den Bürgersteig gestellt. Eine Genehmigung
hatte er dazu mit Sicherheit nicht. Aber ein bisschen Revoluzzertum
musste ja sein.
Wir saßen mit dem Informanten zusammen und der sagte mir: „Ich
wills heute kurz machen, Harry.”
„Wieso nicht?”
„Jemand mag dich nicht.”
„Das wäre nicht das erste Mal.”
„Tu nicht so, als würdest du nicht wissen, was ich meine,
Harry. Jemand sehr Mächtiges mag dich nicht und nach allem, was ich
gehört habe, hat er auch Grund dazu, dich zu hassen.”
„Es wird viel geredet.”
„Er will dich umlegen, Kriminalhauptkommissar Harry Kubinke.
Du sollst ausradiert werden. Es ist eine Frage der Ehre. Die Sache
mit seiner Schwester lässt ihm keine andere Wahl.”
Kopfgeld auf mich, Harry Kubinke. Das war im Prinzip nichts
Neues.
„Sag mal, wieso beschäftigen wir dich eigentlich als
Informanten, wenn du uns nur Dinge erzählst, die wir sowieso schon
wissen?”, fragte ich.
Wie ich schon erwähnte, ich hatte schon die ganze Zeit über
ein mulmiges Gefühl gehabt. Man entwickelt im Laufe der Zeit in
diesem Job einen sechsten Sinn für sowas.
Und ich war nun wirklich lange genug dabei, um diesen
besonderen Sinn für die Gefahr entwickelt zu haben. Ein Sinn, der
einem mitunter das Leben retten konnte.
Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung, warum ich gerade
in diesem Augenblick auf auf das dritte Obergeschoss im Haus schräg
gegenüber blickte. Tatsache ist, dass es geschah. Ich sah einen
Mann ein Gewehr in meine Richtung halten. Ein
Scharfschützengewehr.
Ich war im Fadenkreuz.
Der Informant hatte ganz Recht.
Der Typ, den ich geärgert hatte, würde die Sache mit seiner
Schwester nicht auf sich beruhen lassen.
Er sagte einfach einem seiner Leute bescheid und schickte
einen Typ, wie den dort oben im dritten Obergeschoss, um mich zu
erledigen.
„Runter, Rudi!”, rief ich.
Ich warf mich zu Boden und riss den Informanten mit mir.
Der Schuss ging dicht an mir vorbei und blieb in der Wand
stecken.
Genau im roten Sowjet-Stern.
Ich rappelte mich auf, rettete mich ein geparktes Fahrzeug.
Inzwischen hatte ich meine Dienstpistole in der Faust. Aber
ernsthaft daran denken, sie zu benutzen, konnte ich in dieser
Situation natürlich nicht; die Gefahr, Unbeteiligte zu treffen, war
viel zu groß.
Ein paar weitere Schüsse ließen die Scheiben des Fahrzeugs
zersplittern, hinter dem ich mich verschanzt hatte.
Spätestens jetzt war klar, dass ich gemeint war.
Rudi hatte unterdessen den Informanten gesichert und war mit
ihm in das Lokal geflohen.
Die ersten Passanten bemerkten jetzt, was geschehen war und
gerieten in Unruhe.
Panik war jetzt nur eine Frage der Zeit.
Ich sah, dass die Gestalt, die auf mich geschossen hatte,
jetzt nicht mehr am Fenster zu sehen war.
Also tauchte ich aus meiner Deckung hervor. Ich lief über die
Straße. Ein Lieferwagen musste bremsen. Dann erreichte ich das
Gebäude, aus dem geschossen worden war.
Einen kurzen Moment hielt ich inne.
Dann nahm ich einen schmalen Durchgang, der zu einem Hinterhof
führte.
Manchmal muss man sich einfach in sein Gegenüber
hineinversetzen.
Ich hätte jedenfalls anstelle des Killers versucht, hinten aus
dem Haus zu kommen - und nicht vorne.
Und genau da fand ich ihn dann auch.
Er hatte das Gewehr, mit dem er auf mich geschossen hatte,
noch in der Hand und rannte auf einen Wagen zu.
„Stehen bleiben, Kriminalpolizei!”, rief ich und hob die
Waffe.
Er drehte sich um und feuerte sofort.
Ich schoss ebenfalls.
Seine Kugel pfiff dicht an meinem Kopf vorbei.
Mein Schuss traf besser. Getroffen wankte er zurück. Er ließ
mir keine andere Wahl, als nochmal zu feuern, denn der Kerl legte
erneut auf mich an.
Wie ein gefällter Baum fiel der Killer zu Boden.
Ich senkte die Waffe.
Dass der Kerl tot war, daran konnte kein Zweifel
bestehen.
*
Es dauerte nicht lange, bis die Identität des Killers
festgestellt worden war. Es handelte sich um einen vorbestraften
alten Bekannten. Einen, der bekanntermaßen für Farid Abu-Jamal
arbeitete, den Anführer des Abu-Jamal-Clans aus dem Wedding.
Und Farid Abu-Jamal war der Mann, mit dem ich mich angelegt
hatte. Oder besser gesagt: Der sich mit mir angelegt hatte.
Es ging um seine Schwester.
Und so, wie die Sachlage sich nunmal darstellte, konnte ich
nicht damit rechnen, aus dieser fiesen Nummer so schnell
herauszukommen.
*
Vielleicht sollte ich jetzt mal erzählen, wie der ganze Ärger
anfing. Das war zwei Wochen vor diesem Schusswechsel, der mich um
ein Haar das Leben gekostet hätte und am Ende mit dem Tod des
Killers endete.
Ich war zusammen mit Rudi auf einer Polizeidienstelle,
irgendwo im Wedding. Wir mussten mit einem Kollegen sprechen, um
bestimmte Sachverhalte zu ermitteln. Worum es da gig, tut hier
nichts zur Sache.
Jedenfalls ging es auf diesem Polizeirevier ziemlich hoch
her.
Das ist manchmal so. Randalierende Betrunkene oder
Drogensüchtige - das kann schonmal eine explosive Mischung ergeben.
Festgenommene, die logischerweise nicht damit einverstanden sind,
das sie festgenommen wurden und so weiter.
In diesem Fall war es eine junge Frau, die randalierte.
Sie schrie, schlug um sich und hatte eine Spritze in der Hand.
Die Augen waren auf unnatürliche Weise geweitet. Sie stand ganz
sicher unter dem Einfluss irgendwelcher Drogen. Mochte der Teufel
wissen, was sie geschluckt hatte. Es machte sie jedenfalls zu einer
unberechenbaren Furie. „Ey, isch mach euch AIDS!”, schrie sie. „Ich
stech euch und mach euch alle AIDS! Ihr verdammten Wichser und
Nazis!”
Sie machte ausholene Handbewegungungen und ließ die Nadel
durch die Luft schnellen wie einen Dolch.
Dann stürmte sie auf einen Kollegen zu, der wie gelähmt am
Schreibtisch saß.
Ein Schrei kam aus ihrer Kehle.
Die Nadel war in ihrer Faust.
Ich schnellte vor und versetzte der Irren einen kräftigen
Tritt zwischen die Beine, um sie zu stoppen.
Ich gebe zu, der Tritt war sehr kräftig. Ich habe schließlich
mal Fußball gespielt, auch wenn ich es nie nicht gerade zu Real
Madrid geschafft habe.
Aber mit dem, was dann geschah, hatte wirklich niemand rechnen
können. Und ich werde es auch ganz bestimmt nie vergessen.
Die Frau explodierte nämlich.
Und zwar im wortwörtlichen Sinn.
Es gab einen dumpfen Knall und und im nächsten Moment gab es
in dem ganzen Großraumbüro der Dienststelle wirklich niemanden
mehr, dessen Kleidung nicht blutbesudelt gewesen wäre.
*
Am übernächsten Tag, als ich Kriminaldirektor Hoch
gegenübersaß, hatte ich den Schock noch nicht wirklich
überwunden.
„Was hätte ich tun sollen?”, fragte ich. „Zulassen, dass diese
Frau mit ihrer Spritze auf den Kollegen einsticht?”
„Natürlich nicht, Harry”, sagte Kriminaldirektor Hoch. „Sie
haben völlig richtig gehandelt. Und trotzdem…”
„Trotzdem was?”
„Trotzdem haben wir jetzt ein Problem.”
„Sie meinen: Ich habe jetzt ein Problem.”
„Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen,
Harry.”
„Umreißen Sie mir mal das Problem.”
„Zunächst einmal darf ich mich wiederholen: Man kann Ihnen
keinen Vorwurf machen. Sie haben völlig richtig gehandelt. Ich
hätte an Ihrer Stelle hoffentlich dasselbe getan.”
„Das klingt, als käme das dicke Ende noch!”
„Es gibt einen entscheidenden Umstand, den Sie nicht wissen
konnten.”
„Und der wäre?”
„Ich habe den gerichtsmedizinischen Bericht und diverse
Zeugenaussagen von dem betreffenden Revier. Und ein ballistisches
Gutachten. Die Frau hatte in ihrer Vagina eine Pistole.”
„Die sollte da nicht sein.”
„Nein, sollte sie nicht.”
„Und wie kam die Waffe dort hin?”
„Die spannendere Frage ist: Wieso war sie immer noch dort? Die
Frau ist offenbar sehr schlampig durchsucht worden. Jedenfalls
nicht so, wie das den Regeln entspricht.”
„Sieht so aus.”
„Als Sie zugetreten haben, ist die Waffe losgegangen. Den Rest
brauche Ihnen ja nicht zu schildern.”
„Von dem, was Sie den Rest nennen habe ich wahrscheinlich noch
Albträume, wenn ich schon pensioniert bin”, meinte ich.
„Sie können von Glück sagen, dass der Schuss nicht noch
jemanden verletzt hat”, sagte Kriminaldirektor Hoch. „Dem Bericht
der KTU nach ist er in die Decke gegangen.”
„Tja…”
„Ihr Problem ist jetzt ein anderes, Harry.”
„Wer war denn die Frau?”
„Genau damit hängt es zusammen. Die Frau war Yasemin
Abu-Jamal. Die kleine Schwester von Farid Abu-Jamal…”
„...dem Clan-Chef aus dem Wedding!”
„Genau.”
„Der muss jetzt seine Ehre wiederherstellen. Und das kann er
nur, indem er mich tötet.”
„Ja, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.”
„So?”
„Es ist noch schlimmer, Harry.”
„Was kann man Schlimmeres tun, als die Lieblingsschwester des
Abu-Jamal-Chefs explodieren zu lassen? Ich nehme an, alle
Argumente, die in Richtung Notwehr oder Nothilfe gehen, zählen da
nicht viel.”
„Wie ich schon sagte: Es ist noch schlimmer, Harry. Sie haben
nämlich durch Ihren beherzten Tritt Farid Abu-Jamal ein
Riesenproblem abgenommen.”
Ich runzelte die Stirn.
„Wie denn das?”
„Er braucht jetzt nur Sie zu töten, Harry - und nicht mehr
seine Schwester, was ihn in Gegnerschaft zu seinem Geschäftspartner
Victor Brilanow von der Russen-Mafia brächte, von dem er eigentlich
lieber gerne Drogen aus Usbekistan beziehen würde…”
„Das verstehe ich jetzt nicht”, gestand ich.”
Kriminaldirektor Hoch lächelte nachsichtig. „Yasemin war
keineswegs Farids Lieblingsschwester, sondern eher das Gegenteil.
Sie war das schwarze Schaf der Familie.”
„Ich nehme an, sie wollte sich nicht bevormunden
lassen.”
„Mit Drogen handeln ist in der Familie in Ordnung, Drogen
nehmen nicht. Und davon abgesehen hat sie ihrem Bruder das
Schlimmste angetan, was man man ihm nur antun konnte.”
„Ist sie mit einem Deutschen durchgebrannt?”
„Schlimmer.”
„Ist auf den Strich gegangen?”
„Schlimmer.”
„Ich glaube nicht, dass es was mit Religion zu tun
hatte.”
„Hatte es auch nicht. Sie ist auf den Strich gegangen, aber
nicht für irgendwen, sondern in einem Bordell, dass unter der
Kontrolle von Victor Brilanow steht. Und der hat das natürlich
überall verbreitet. Das war die maximale Demütigung. Farid hätte
seine Schwester und am besten auch Victor Brilanow töten müssen,
damit man ihn überhaupt noch Ernst nimmt. Aber das konnte er nicht,
weil er von dessen Stoff aus Usbekistan abhängig ist.”
„Sowas nennt man eine Zwickmühle.”
„Das ist noch nicht alles! Farid konnte bis jetzt auch nicht
seine Schwester umbringen, was seine Pflicht gewesen wäre! Denn
dann hätte er Victor Brilanow herausgefordert und der wäre wiederum
gezwungen gewesen, etwas gegen Farid zu unternehmen!”
„Schließlich kann der nicht einfach ein Mädchen aus seinem
Bordell umbringen lassen!”
„Genau! Aber jetzt haben Sie ihm seinen Job abgenommen und er
kann mit Victor Brilanow Frieden halten. Außerdem wird er sich
darauf konzentrieren, Sie zu töten, Harry. Und dabei wird sein
ganzer Clan hinter ihm stehen.”
Ich atmete tief durch.
„Wirklich schöne Aussichten”, sagte ich.
Zwei Wochen geschah nichts.
Ich dachte schon, die Sache würde sich vielleicht doch von
allein regeln.
Tat sie aber nicht.
Ich hatte es geahnt.
Zwei Wochen geschah nichts, dann geschah das Attentat vor dem
Anarcho-Lokal in Kreuzberg.
Der Killer war tot.
Aber der war ohnehin nur ein Werkzeug gewesen.
Ein Werkzeug für Farid Abu-Jamal.
*
Ein paar Tage später informierte mich mein Chef darüber, dass
der ballistische Bericht zu der Waffe vorlag, mit der auf mich vor
dem Anarcho-Lokal geschossen worden war.
„Das ist ein Scharfschützengewehr, wie es normalerweise nur
von SEK-Kommandos oder bei der Bundeswehr benutzt wird”, sagte
Kriminaldirektor Hoch. „Eine sehr gute Waffe. Heißt nach ihrem
Konstrukteur: Weitz.”
„Nie gehört.”
„Ist sehr selten. Und die Waffe, die wir sichergestellt haben,
ist so gut wie neu gewesen. Die wurde vorher wahrscheinlich noch
nie benutzt.”
Ich zuckte mit den Schultern.
„Der Killer ist tot”, gab ich zu bedenken.
„Und Tote können nicht mehr aussagen.”
„So ist es. Und einen Hinweis darauf, wen Farid Abu-Jamal als
nächstes anheuert, können wir uns durch dieses Gewehr auch nicht
erhoffen.”
Hoch sah mich an. „Ich frage mich nur, wer zurzeit so etwas
hier in Berlin verkauft…”
„Nun…”
„Es gibt da ein paar Gerüchte, Harry.”
„Dann vermute ich mal, dass wir sehr bald wieder auf eine
solche Waffe stoßen werden.”
„Ja, das ist zu befürchten”, war auch Kriminaldirektor Hoch
überzeugt. „Ach übrigens, wenn Sie angesichts der jüngsten
Ereignisse etwas Urlaub machen wollen…”
„Nein”, sagte ich.
„Wirklich nicht?”
„Wirklich nicht.”
Mein Chef hob die Augenbrauen.
Seine Hände steckten in den tiefen Taschen seiner
Flanellhose.
Die Hemdsärmel waren aufgekrempelt.
„Ich habe es Ihnen angeboten”, sagte er dann.
„Schon klar.”
„Und ich habe Sie auch auf die Möglichkeit hingewiesen,
psychologische Betreuung zu bekommen.”
„Ich bin schon eine Weile im Dienst und weiß, wie die Dinge
laufen”, sagte ich.
Kriminaldirektor Hoch nickte. „Gut, ich wollte nur
sichergehen.
„Was passiert jetzt mit Farid Abu-Jamal?”
„Nichts. Wir können ihm nichts nachweisen.”
Ich atmete tief durch. „Hatte ich mir fast gedacht. Das heißt
dann wohl, ich muss auf mich selbst aufpassen.”
Ich hatte für mich entschieden, einfach das zu tun, was ich am
besten konnte. Meinen Job. Am besten, man ließ sich nicht beirren
oder einschüchtern. Wenn man das nämlich erstmal zulässt, dann kann
man alles vergessen.
Hört sich alles allerdings leichter an, als es in Wahrheit
ist.
Tage vergingen.
Sammelten sich zu Wochen.
Aber mir war klar, dass es nicht vorbei war.
Ganz bestimmt nicht.
*
Der Mann mit dem dunklen Haarkranz und der Narbe am Kinn hatte
ein verkniffenes Gesicht. Entschlossenheit blitzte in seinen Augen.
Er sah durch das Zielfernrohr des Spezialgewehrs. Im Fadenkreuz sah
er das Gesicht der Bundeskanzlerin. Der Schütze hielt die Waffe so,
dass das Fadenkreuz genau über der Stirn war. Gut so, dachte er. Da
gehört es hin, dieses Kreuz.
Er drückte ab.
Die Kugel traf genau zwischen die Augen. Der Kopf zerplatzte.
Blutrot troff es herab.
Zufrieden senkte der Schütze die Waffe und juckte sich dann
auf eine recht auffällige Weise an der Narbe an seinem Kinn.
„Sie hat es nicht anders verdient“, murmelte er.
*
„Ein guter Schuss“, sagte der andere Mann – hochgewachsen,
dunkelhaarig und gut trainiert. Unter dem linken Auge war ein
dunkler Punkt, den man auf den ersten Blick für ein Muttermal
halten konnte. Wenn man genauer hinsah, erkannte man, dass es eine
Tätowierung war. Eine Träne.
Der Kahlköpfige grinste. „Gute Waffe“, meinte er. „Und darauf
kommt es, sage ich Ihnen. Auf die Waffe. Und es gibt keine zweite
wie diese hier. Das können Sie mir glauben.“
„Wenn Sie das sagen, Herr Weitz.“
Der Kahlköpfige grinste breit. „Ich habe sie konstruiert. Ich
kenne jede Schraube an dem Ding und ich sage Ihnen, es ist nie
wieder eine Handfeuerwaffe mit einer vergleichbaren Zuverlässigkeit
hergestellt worden.“ Er hob die Augenbrauen. „Sie können damit
jemandem auf anderthalb Kilometer das Auge ausschießen, wenn Ihre
Hand ruhig genug ist.“
„So anspruchsvoll bin ich gar nicht.“
„Das sollten Sie aber sein, Herr. Wer weiß, gegen wen man sich
noch alles verteidigen muss! Die Regierung ist wie eine Krake.
Eines Tages kriegt die jeden. Sie werden es auch noch sehen. Und am
Ende sind Sie auf sich allein gestellt, wenn diese Arschlöcher Sie
mit allen Tricks fertig zu machen versuchen.“
Zusammen gingen sie die fast fünfhundert Schritte, die
zwischen ihrem Standort und dem Ziel lagen.
Sie erreichten einen Baum mit stark überhängenden Ästen.
Ein Seilstück hing von einem dieser Äste herab.
Es baumelte.
Die Melone, die Weitz damit befestigt hatte, war durch den
Schuss auseinandergeplatzt. Irgendwo lag ein Computerausdruck, der
ein Foto vom Gesicht des Bundespräsidenten zeigte.
„Sie haben einen eigenartigen Humor, Herr Weitz.“
„Wie?”
„Ich meine es ernst!”
„Wieso Humor?“
„Naja, ich meine, dass Sie die Melonen, auf die Sie schießen,
mit Fotos bekannter Leute bekleben.”
„Ja, und?”
„Mit Politikern und so – Sie wissen schon, was ich meine. Tut
mir leid, das finde ich schräg.“
„Ich finde es schräg, wie diese Bande von Parasiten unser Land
ausbeutet und sich von all denen einlullen lässt, die das Recht auf
Waffenbesitz zurückzudrängen versuchen! Aber ich sage immer, wenn
ich meine Waffe nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen darf, wie
in Berlin, dann ist das der erste Schritt in die Diktatur.“
Weitz bückte sich, hob den Fetzen auf, der von dem Foto der
Kanzlerin übrig geblieben war. Sein Gesicht bekam für einen kurzen
Moment einen zufriedenen Ausdruck, als er sah, dass der Schuss mit
dem Spezialgewehr genau zwischen die Augen gegangen war.
So, wie es sein sollte, ging es Weitz durch den Kopf.
„Ich nehme die Waffe“, sagte der andere Mann. „Haben Sie auch
Munition dafür?“
„Ja, habe ich. Die Waffe ist übrigens so konstruiert, dass Sie
auch problemlos Standardmunition verwenden können. Und so, wie es
aussieht, werden Sie das auch bald müssen, denn ich kann Ihnen bei
den Spezialprojektilen nicht garantieren, dass Sie die noch lange
nachbestellen können. Mein Vorrat geht nämlich zur Neige – und ein
paar bewahre ich für meine eigenen Zwecke auf. Ich will schließlich
vorbereitet sein, wenn es soweit ist und alles
zusammenbricht.“
Der Mann mit der Träne unter dem Auge runzelte die Stirn. „Die
kleinen Modifikationen, die wir besprochen haben – bis wann können
Sie die durchführen?“
„Ist alles in ein paar Tagen fertig.“
„Dann komme ich am Dienstag zu Ihnen raus.“
„Nein, nicht Dienstag. Dienstag bin ich in Berlin. Kommen Sie
Sonntag Abend oder erst Donnerstag. Und bringen Sie den Betrag in
bar mit. Ich misstraue der Regierung und dem Bankensystem. Die
überwachen doch, wo jeder Cent bleibt und am Ende drehen sie einem
einen juristischen Strick daraus, wenn sie es brauchen und einen
aus dem Weg räumen wollen. Da kann ich Ihnen Stories erzählen... Da
fallen Sie vom Glauben ab, sag ich Ihnen.“
*
Ich traf mich mich mit einem Informanten aus dem Wedding. Aber
diesmal nicht auf der Straße.
Wir gingen in einen Schwulen-Club.
Eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dort nicht jemanden
anzutreffen, der dem Abu-Jamal-Clan angehörte.
Selbst wenn diese Typen mir auf Schritt und tritt gefolgt
wären - dorthin wäre mir keiner von ihnen gefolgt. Schon, damit sie
dort nicht gesehen wurden und jemand das weiter erzählte.
„Du kannst Farid eine Botschaft ausrichten?”, fragte
ich.
„Wie stellst du dir das vor?”, fragte der Informant.
„Ja, was ist? Kannst du oder kannst du nicht? Sonst hast du
doch immer so groß herumgetönt, dass du das könntest. Und jetzt, wo
ich diesen Kanal mal brauche ist bei dir Sendepause?”
„Das habe ich nicht gesagt.”
„Also, was ist nun?”
„Okay, was soll das für eine Botschaft an Farid sein?”
„Sag ihm, dass ich die Sache gerne aus der Welt schaffen
würde. Wir können uns treffen. Nur er und ich.”
„Keine Mikros und so?”
„Nein.”
„Keine Kameras und ein SEK-Kommando im Hintergrund?”
„Nur er und ich”, wiederholte ich. „Ich sage ihm Ort und
Zeit.”
„Hm…”
„Wenn er will. Und wenn er den Mut dazu hab.”
„Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert.”
„Ich auch nicht.”
Der Informant lachte. „Das stimmt natürlich…”
„Ich höre von dir, okay?”
„Du hörst von mir.”
*
„Keine Ahnung, ob das wirklich eine gute Idee war”, meinte
mein Kollege Rudi Meier, als wir später in unserem Dienstwagen
saßen.
„Das weiß ich auch nicht. Aber irgendetwas muss ich
tun.”
„Kann ich nachvollziehen.”
„Mal sehen, was aus der Sache wird.”
Erstmal schien es so, als würde nichts daraus.
Ich hörte jedenfalls in der Sache nichts mehr.
Naja, ich hatte eigentlich auch nicht wirklich viel
erwartet.
Erstmal…
*
Es war ein Dienstag.
Ein Dienstag, der schon schlecht begann, denn als ich meinen
Kollegen Rudi Meier morgens an der bekannten Ecke abholte, um mit
ihm zum Präsidium zu fahren, fuhr uns der unvorsichtige Fahrer
eines alten Ford hinten drauf. Der Schaden an meinem Dienstporsche
hielt sich zum Glück in Grenzen. Etwas eingedrücktes Blech, das war
alles. Es hätte schlimmer kommen können.
Da der Unfall erst abgewickelt werden musste und wir
anschließend in der Fahrbereitschaft sicherstellen mussten, dass
die Reparatur durchgeführt wurde, erreichten wir das Büro unseres
Chefs mit leichter Verspätung.
Kriminaldirektor Jonathan D. Hoch stand am Fenster und hatte
dabei die Hände in den tiefen Taschen einer Flanellhose vergraben.
Die Hemdsärmel waren hochgekrempelt, die Krawatte gelockert.
„Ich weiß, dass wir etwas spät dran sind“, begann ich.
Aber Kriminaldirektor Hoch ging darauf gar nicht weiter ein.
„Es hat eine Leiche im Park gegeben“, eröffnete er. „Maik Ozanali,
52 Jahre alt, Anwalt. Ozanali hat bis vor kurzem bei der
Staatsanwaltschaft gearbeitet und war dort Spezialist für Fälle,
die mit Geldwäsche und organisiertem Verbrechen zu tun hatten. Es
wäre also nicht unwahrscheinlich, wenn es da einen Zusammenhang
gibt.“ Kriminaldirektor Hoch sah auf die Uhr an seinem Handgelenk.
„Der Anruf von der Kollegen kam vor zehn Minuten. Die Untersuchung
am Tatort dürfte gerade angelaufen sein.“
„Dann werden wir uns am besten sofort auf den Weg machen“,
sagte ich.
„Lassen Sie keine Zweifel daran, dass wir vom BKA die
Ermittlungen übernehmen, Harry“, ermahnte mich Kriminaldirektor
Hoch. „Die Informationen sind zwar noch recht spärlich, aber
eigentlich besteht für mich kein Zweifel, dass die Sache in unseren
Zuständigkeitsbereich fällt.“
„In Ordnung.“
Es klopfte. Mandy, die Sekretärin unseres Chefs brachte ein
Tablett mit dampfenden Kaffeebechern herein.
„Sie gehen schon wieder?“, fragte sie, als Rudi und ich uns in
Richtung Tür bewegten.
Kriminaldirektor Hoch deutete auf die drei dampfenden Becher,
die Mandy inzwischen auf den Tisch des Besprechungszimmers gestellt
hatte. „Harry und Rudi haben dafür leider keine Zeit mehr, aber
lassen Sie sie ruhig hier. Ich trinke alle drei.“
„Wie Sie meinen, Herr Hoch“, sagte Mandy.
*
Da der Dienstporsche repariert werden musste, nahmen Rudi und
ich uns ein Fahrzeug aus den Beständen unserer Fahrbereitschaft. Es
handelte sich um einen unauffälligen Ford.
Leider verfügte der nicht über einen Bordrechner mit
TFT-Bildschirm, wie er in den Dienstporsche eingebaut war.
„Der Name Ozanali kommt mir bekannt vor“, sagte Rudi und ging
dabei mit seinem Smartphone ins Netz, um zumindest die wichtigsten,
öffentlich zugänglichen Informationen suchen zu können.
„Hat sich selbstständig gemacht, als der neue Oberstaatsanwalt
ihm erklärt hat, dass seine Karriere nicht weiter nach oben gehen
wird.“
„Woher weißt du das denn, Harry?“
„Habe ich von Manuel Schneyder gehört. Und der hat es von
Ozanali selbst.“
Manuel Schneyder war einer unserer Verhörspezialisten im
Innendienst. Und die hatten naturgemäß viel mit Anwälten und
Staatsanwälten zu tun, denn bei einer großen Zahl von Vernehmungen
bestand entweder eine oder beide Seiten auf eine Anwesenheit. Und
natürlich fiel da auch schon einmal das eine oder andere private
Wort.
„Ein Anwalt, der die Seiten wechselt“, meinte Rudi. „Erst jagt
er Geldwäscher und zuletzt verteidigte er wahrscheinlich genau
solche Typen, die er zuvor gejagt hat. Muss auch eigenartig
sein.“
„Anwalt und Staatsanwalt dienen beide dem Recht“, sagte
ich.
„Kann ja sein. Muss aber trotzdem eigenartig sein, plötzlich
auf der anderen Seite zu stehen. Wäre interessant zu erfahren,
wieso er sich mit seinem beiden Vorgesetzten überworfen hat.“
„Jedenfalls finanziell gesehen dürfte der Ausstieg kein
Nachteil für Ozanali gewesen sein“, vermutete ich. „Ich nehme an,
dass er mit seinem Spezialwissen bei allen Gangstern Berlins, die
ein paar schmutzige Koffer mit Euros weiß zu waschen hatten und
dabei erwischt wurden, gerne und zu lukrativen Honoraren engagiert
wurde.“
„Willst du ihm daraus einen Vorwurf machen?“, fragte Rudi.
„Das war nunmal sein Spezialgebiet! Als Anwalt konnte er ja wohl
schlecht als Verteidiger von Verkehrssündern anfangen!“
Wir erreichten schließlich den Tatort. An diesem Dienstag war
es zwar kalt, aber es schien die Sonne. Wir stellten den Ford aus
unserer Fahrbereitschaft auf einem der Parkplätze ab und wir
stiegen aus.
Einige Einsatzfahrzeuge der Schutzpolizei waren hier ebenfalls
bereits zu finden. Ein Kollege notierte die Nummernschilder der
anderen parkenden Fahrzeuge. Eine vorsorgliche Maßnahme. Jeder, der
hier seinen Wagen abgestellt hatte, war möglicherweise auch ein
wichtiger Zeuge.
Wir zeigten unsere Dienstausweise.
Der Polizeimeister sah auf.
„Icke bin beeindruckt”, sagte er ironisch.
„Na dann”, sagte ich.
„Kommissar Schaluppke erwartet Sie schon“, erklärte er.
„Christian Schaluppke?“, fragte ich. Ich kannte Schaluppke
nämlich von einem gemeinsamen Sicherheitstraining im Umgang mit
Handfeuerwaffen, zu dem nach und nach sämtliche Polizeieinheiten
Berlins geschickt worden waren, nachdem ein psychisch kranker
Mehrfachmörder auf dem Weg zum Gericht trotz Handschellen und
Fußfesseln einem Kollegen die Waffe abgenommen und damit ein
Blutbad angerichtet hatte. Christian und ich hatten uns gut
verstanden. Ich hatte nichts dagegen, mit ihm
zusammenzuarbeiten.
Der Kollege beschrieb uns knapp den Weg zum Tatort, und wir
machten uns auf den Weg. Aber die Beschreibung des Kollegen hätten
wir streng genommen gar nicht gebraucht.
Auch auf den Rasenflächen des angrenzenden Parks standen
mehrere Einsatzfahrzeuge – sowohl von der Schutzpolizei, als auch
vom Rettungsdienst sowie von der Abteilung Kriminaltechnische
Untersuchung, dem zentralen Erkennungsdienst, der von allen
Berliner Polizeieinheiten genutzt wird.
Der Bereich um den Tatort war mit Flatterband abgegrenzt.
Schaulustige standen außerhalb davon und sahen zu, wie ein halbes
Dutzend Kollegen und Kolleginnen die Grasfläche nach irgend etwas
absuchten.
Der Tote war bereits in einen Zinksarg gelegt worden.
Ich bemerkte Dr. Bernd Heinz, einen Gerichtsmediziner der
Abteilung Kriminaltechnische Untersuchung. Er winkte uns kurz zu.
Jetzt bemerkte uns auch Kollege Schaluppke, der uns bis dahin den
Rücken zugewandt hatte.
Wir stiegen über das Flatterband und gingen zu ihnen hin.
Unsere Ausweise trugen wir gut sichtbar, damit di Kollegen Bescheid
wussten, dass wir dazugehörten.
„Hallo Harry! Hallo Rudi!“, begrüßte uns Dr. Heinz. „Ich habe
das Wesentliche gerade schon mit Kollege Schaluppke besprochen.
Aber für euch auch nochmal das Wesentliche: Letale
Schussverletzung. Die Kugel drang fast genau dort, wo sich die
Nasenwurzel befindet, in den Schädel ein. Kaliber kann ich euch
erst sagen, wenn ich mit der Obduktion fertig bin.“
„Die Kugel ist nicht ausgetreten?“, fragte ich.
„Nein, sie ist noch im Schädel.“
„Spezialmunition“, meldete sich Christian Schaluppke zu Wort.
„Muss sowas Ähnliches sein, was wir auch benutzen.“
Ich wusste natürlich, was Christian meinte. Moderne Waffen
haben oft eine enorme Durchschlagskraft. Ein einziger Schuss kann
unter Umständen nacheinander mehrere Körper durchschlagen. Gerade
bei Polizeieinsätzen zur Geiselbefreiung und ähnlichem würde ein
Schusswaffeneinsatz zwangsläufig Unbeteiligte in Mitleidenschaft
ziehen, wenn man nicht die richtige Munition benutzt.
„Unser Täter scheint ja richtig rücksichtsvoll zu sein“, sagte
Rudi stirnrunzelnd.
Christian deutete in Richtung einer Baumgruppe, die sich
ungefähr zweihundert Meter entfernt befand. Links davon waren die
Piers und die Anlegestellen der Fähren zur Statue of Liberty zu
sehen.
„Aus Turguts Richtung wurde geschossen“, erklärte Christian
Schaluppke.
„Turgut?“, echote ich.
Tatsächlich entdeckte ich unseren Chefballistiker Turgut
Özdiler. Er kauerte in einiger Entfernung am Boden und führte
gerade eine Laserpeilung durch, um den Einschusswinkel näher zu
bestimmen und hatte uns noch nicht bemerkt. Er stand anschließend
auf und ging auf die Baumgruppe zu.
„Ihr Kollege meint, dass der Schuss ungefähr von der
Baumgruppe aus abgegeben worden sein muss“, berichtete
Christian.
„Auf zweihundert Meter?“, staunte ich.
„Ein guter Schütze“, kommentierte Rudi.
„Einem Scharfschützen mit einem sehr guten Gewehr und einer
hervorragenden Zieloptik“, stellte Kommissar Schaluppke klar. „Die
Bäume dort sind im übrigen auch die einzige Möglichkeit für den
Täter gewesen, Deckung zu finden. Ihr Kollege meinte allerdings,
dass er da noch etwas überprüfen will. Sie fragen ihn am Besten
gleich selbst danach.“
Das Gebiet um die Baumgruppe war ebenfalls mit Flatterband
abgegrenzt worden. Mehrere Kollegen des Erkennungsdienstes
stöberten dort herum, das Gesicht dabei stets aufmerksam auf den
Boden gerichtet.
Es war ja schließlich möglich, dass der Täter dort irgend
etwas hinterlassen hatte.
„Ihr braucht mich dann ja hier nicht mehr“, meinte Dr. Heinz.
Er wandte sich an mich. „Der Tote kommt jetzt zu uns ins Labor.
Wenn sich dabei nichts Außergewöhnliches ergibt, dann habt ihr das
vorläufige Ergebnis noch heute Mittag. Ich schlage vor, dass das
Projektil dann gleich in die KTU-Labors geht, oder besteht ihr
darauf, es bei euch zu untersuchen?“
„Nein, nein“, wehrte ich ab. „Wir wollen das Ergebnis so
schnell wie möglich.“
„Gut“, nickte Dr. Bernd Heinz. „Wir hören dann
voneinander.“
Bevor der Tote fortgebracht wurde, hatte ich noch kurz
Gelegenheit, einen Blick auf ihn zu werfen. Sein Blick war starr.
Das Einschussloch war ziemlich klein – aber das erstaunt nur
diejenigen, die zu viele Action-Filme gesehen haben. Das
Einschussloch ist meistens klein, die großen Wunden entstehen bei
Austritt des Projektils. Und das war in diesem Fall im Körper
geblieben und steckte jetzt vermutlich in der hinteren Schädelwand
oder vielleicht auch in den Halswirbeln. Er trug einen grauen
Dreiteiler, darüber einen ebenfalls grauen Mantel. Die Schusswunde
hatte offenbar nicht stark geblutet. Das weiße Hemd und die sehr
gediegen wirkende Krawatte mit dem Anker darauf, hatten kaum Blut
abbekommen. Nur ein paar Spritzer, die so klein waren, dass man
genau hinsehen musste.
Aber es gab einen roten Fleck in Bauchhöhe, der irgendwie gar
nicht dazu passte.
Ich fragte Kollege Schaluppke danach.
„Herr Ozanali aß ein Sandwich, als er erschossen wurde.“
„Verstehe“, murmelte ich.
„Aber ich verstehe nicht, wieso jemand so früh am Morgen sich
in den Park begibt und dort ein Sandwich isst!“
„Ditte ist nicht so schwer zu verstehen”, sagte
Schaluppke.”
Ich hob die Augenbrauen.
„Ach, nee?”
„Das mit dem Sandwich, meine ich. Oder Stulle, wie das richtig
heißt.”
„Aha. Und ich dachte, sowas nennt man Döner.”
„Die gibt es hier in der Nähe“, erklärte Schaluppke. „Was soll
es dafür eine Erklärung geben? Ich nehme an, Herr Ozanali hatte
einfach Hunger und zu Hause nichts gefrühstückt.“
„Trotzdem eigenartig“, meinte Rudi. „Zur Tatzeit dürften vor
allem Jogger hier im Park gewesen sein. Und Leute, die ihre Hunde
ausführen.“
„Vergessen Sie die Angler am See nicht“, meinte
Schaluppke.
„Meinetwegen. Und Ozanali kommt hier in Schlips und Anzug hin,
um ein Sandwich zu essen?“
„Die Kollegen haben einige Zeugenaussagen aufgenommen.
Vielleicht ist etwas dabei, was man verwerten kann, Harry.“
„Sag mal – noch was anderes, Christian….“
„Schieß los!“
„Hatte ich das falsch in Erinnerung oder seit wann bist du bei
der Mordkommission? Ich dachte, du wärst auf deiner Dienststelle
bei der Einheit, die sich mit organisiertem Verbrechen
beschäftigt?“
„Bin ich auch immer noch, Harry. Wenn jemand einen Mann mit
Ozanalis Vergangenheit erschießt, dann riecht das doch nach
organisiertem Verbrechen. Und ich denke, deswegen seid ihr auch
hier.“
„Stimmt“, musste ich zugeben, während der Tote weggetragen
wurde.
„So wie es aussieht, wir ja nun Ihr Team den Fall an sich
ziehen, aber wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir das
getan. Und ich gehe jede Wette ein, dass das kein gewöhnlicher
Mordfall mit persönlichem Hintergrund ist.“
„Ozanali hat sich hier mit jemandem getroffen“, vermutete
Rudi. „Und zwar unter quasi konspirativen Umständen. Dabei bekommt
er eine Kugel in den Kopf.“
„Noch ist das eine Vermutung“, gab Schaluppke zu bedenken.
„Aber genau so könnte es gewesen sein.“
Etwas später wurden wir zu der Baumgruppe gerufen, von der aus
offenbar geschossen worden war.
„Wir haben die exakte Position, von der aus geschossen wurde“,
erklärte Turgut Özdiler. „Um eine Patronenhülse zu hinterlassen war
der Täter zu clever, aber wir haben einen Fußabdruck, der ihm
vielleicht gehört. Größe 42.“ Turgut seufzte. „Ja, ich weiß, das
könnte nahezu jeder sein, aber es ist ein Anfang.“ Unser Kollege
zeigte uns dann die Stelle, von der seinen Messungen nach
geschossen worden war. Der Täter hatte einfach direkt neben einem
Baum gestanden. Ein paar Sträucher hatten ihn zusätzlich verborgen.
In aller Ruhe hatte er dort offenbar auf sein Opfer gewartet. „Der
Killer hat die perfekte Position gewählt“, stellte Turgut
klar.
„Sieht alles nach einem Profi aus“, war Rudi überzeugt.
„Womit es wohl immer eindeutiger wird, dass der Fall in unsere
Zuständigkeit fällt“, meinte ich und wandte mich an Schaluppke.
„Tut mir leid, Christian.“
„Kein Problem. Es ist nicht so, dass wir sonst nichts zu tun
hätten und etwas dagegen hätten.“
*
Später suchten wir die Kanzlei auf, die Ozanali nach seinem
Ausscheiden aus dem Dienst bei der Staatsanwaltschaft gegründet
hatte. Ozanali & Partner stand an der Tür. Das Wort Partner
konnte Einzahl oder Mehrzahl sein. Wer damit gemeint war, sollten
wir wenig später erfahren.
Eine Sekretärin brachte uns in das Büro von Linda Kalbitz.
Zumindest war das der Name, der an der Tür stand.
„Kommissar Harry Kubinke, BKA“, stellte ich mich vor und hielt
ihr meine Dienstmarke entgegen. Ich deutete auf Rudi. „Dies ist
mein Kollege Kommissar Meier. Sind Sie Linda Kalbitz, die Partnerin
von Herrn Ozanali?“
„Ja, das bin ich“, nickte sie. „Was kann ich für Sie
tun?“
Sie war schätzungsweise Anfang dreißig, hatte brünettes,
adrett frisiertes Haar und trug ein knapp sitzendes
Business-Kostüm. Um Partnerin einer Kanzlei zu sein, war sie
entschieden zu jung. Aber offenbar hatte sich für sie bei Ozanali
eine einmalige Karrierechance ergeben. Vielleicht war sie auch
einfach nur sehr gut in ihrem Job.
„Wir müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen“,
eröffnete ich. „Herr Maik Ozanali ist heute Morgen ermordet
worden.“
Ihr Gesicht veränderte sich. Sie schien ehrlich betroffen und
überrascht zu sein, ehe sie wieder ihren geschäftsmäßigen,
freundlichen und angesichts dieser Nachricht sehr gefassten
Gesichtsausdruck aufsetzte. „Lassen Sie uns bitte allein“, wandte
sie sich an die Sekretärin, der in diesem Moment sämtliche
Gesichtszüge entglitten und die fast fluchtartig den Raum
verließ.
Manchmal sprechen Gesichter Bände.
Linda Kalbitz bot uns einen Platz an.
Wir setzten uns.
„Was ist genau passiert?“, fragte Linda Kalbitz, nachdem sie
sich gefasst hatte.
„Das versuchen wir herauszufinden“, sagte ich.
„Herr Ozanali wurde heute früh in einem Park erschossen“,
erläuterte Rudi. „Wir nehmen an, dass der Täter ein professioneller
Killer war und es Zusammenhänge zum organisierten Verbrechen gibt
und der Mord entweder etwas mit seiner ehemaligen Tätigkeit bei der
Staatsanwaltschaft oder mit seinen gegenwärtigen Mandanten zu tun
hat. Offenbar hat er sich im Park mit jemandem getroffen, leider
wissen wir nicht mit wem.“
„Da werde ich Ihnen leider nicht weiterhelfen können“, sagte
Linda Kalbitz. „Erstens werde ich ganz sicher nicht ohne einen
richterlichen Beschluss dazu über Mandanten, Termine und Ähnliches
aussagen. Sie wissen, dass das Gesetz da auf meiner Seite ist und
wenn Sie nicht stichhaltig begründen können, wieso diese Auskünfte
für Ihre Ermittlungen unerlässlich sind, dann wird kein Richter in
Berlin...“
„Hören Sie, ich wollte eigentlich nicht von Ihnen juristisch
bekehrt werden, sondern ich brauche Ihre Hilfe, um einen Mord
aufzuklären“, unterbrach ich sie. „Und eigentlich hatte ich
gedacht, dass das auch Ihr Interesse ist.“
„Selbstverständlich, Herr Kubinke.“
„Dann schlage ich vor, dass Sie uns einfach alles mitteilen,
was irgendwie mit Herrn Ozanalis Tod in Zusammenhang stehen könnte.
Es geht uns nicht darum, Sie dazu zu bringen, das Vertrauen Ihrer
Mandanten aufs Spiel zu setzen.“
„Es freut mich, dass Sie diesen Punkt immerhin anerkennen,
Kommissar Kubinke“, sagte Linda Kalbitz kühl. „Genau darum geht es
nämlich.“
„Berührt Sie eigentlich der Tod von Herrn Ozanali?“
Sie hob die Augenbrauen.
Die Art und Weise, mit der sie mich ansah, ließ mich
stutzen.
Meine Frage schien sie ziemlich überrascht zu haben. Für einen
Moment gab sie die glatte, kontrollierte Fassade mit dem
geschäftsmäßigen Lächeln wieder auf.
Sie schluckte. „Hören Sie, diese Nachricht ist für mich ein
Schock. Um ganz ehrlich zu sein, mir ist noch nicht einmal klar,
wie es ohne Maik hier weitergehen soll. Es kann sein, dass Maiks
Tod auch das Ende dieser, wie Sie sehen, ziemlich kleinen Kanzlei
bedeutet und ich mir wieder einen Job als angestellte Anwältin
suchen muss. Und davon abgesehen, war er ein netter Kerl!
Aber...“
Sie sprach nicht weiter. Ihr Blick wirkte in sich gekehrt.
Erst jetzt zeigte sich in ihren sonst so kontrollierten Zügen jene
Traurigkeit, die man angesichts einer solchen Nachricht eigentlich
erwartet. Zumindest dann, wenn der Ermordete einem nicht völlig
gleichgültig gewesen ist.
„Sie wollten noch etwas sagen“, hakte ich schließlich nach,
als diese Pause des Schweigen sich etwas zu sehr in die Länge
zog.
„Wissen Sie, ich weiß nicht so recht, wie ich es ausdrücken
soll.“
„Sagen Sie einfach, was Sache ist“, schlug ich vor.
„Ich bin zwar Partnerin in der Kanzlei, aber in manche Dinge
hat Maik mich nie einbezogen. Er hatte noch aus seiner Zeit bei der
Staatsanwaltschaft viele Kontakte zu Informanten und reichlich
dubiosen Leuten, die ihn mit Informationen versorgten, die er bei
der Ausübung seiner Mandate nutzen konnte.“
„Und Sie meinen, mit so jemanden hat er sich heute Morgen
getroffen?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Es ist nur eine
Vermutung.“
„Haben Sie irgendeine Vermutung, wer es auf Herrn
Ozanali abgesehen haben könnte? Jemand, der ihn vielleicht so
hasst, dass er einen Killer auf ihn ansetzt? Schließlich hat sich
Herr Ozanali in seiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft ja wohl
sicherlich auch Feinde gemacht.“
„Davon können Sie ausgehen“, nickte Linda Kalbitz. „Aber das
war alles vor meiner Zeit und ich kann Ihnen wirklich nichts weiter
dazu sagen.“
„Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei Ozanali & Partner
angefangen haben?“, fragte ich.
Sie sah mich etwas überrascht an. „Ich weiß jetzt ehrlich
gesagt nicht, wieso Sie mich jetzt in den Fokus Ihrer
Aufmerksamkeit stellen“, sagte sie und hob dabei das Kinn.
„Und ich weiß nicht, weshalb es ein Problem sein sollte, diese
einfache Frage zu beantworten“, gab ich zurück. „Im Zweifelsfall
wird man mir diese Auskünfte auch bei der Anwaltskammer geben
können. Sie werden irgendwo studiert haben und Ihre bisherige
Tätigkeit als Anwältin wird wohl auch kaum unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattgefunden haben! Es wird ehemalige Mandanten
geben, die vielleicht etwas auskunftsfreudiger sind und abgesehen
davon...“
„Ich habe nach dem Studium bei verschiedenen Kanzleien in
München und Frankfurt gearbeitet, bevor es mich nach Berlin
verschlug“, erklärte sie. „Und außerdem bin ich in der glücklichen
Lage etwas Geld geerbt zu haben, was sicher ganz hilfreich dabei
war, die Chance zu bekommen, Partner eines so renommierten Anwalts
wie Herrn Ozanali zu werden. Reicht Ihnen das als vorläufige
Auskunft?“
„Als vorläufige Auskunft, ja“, gab ich zurück.
Ich fragte mich unwillkürlich, woher dieser feindselige
Tonfall bei ihr kam. Schließlich wollten wir doch nichts anderes,
als herauszufinden, wer den Mann getötet hatte, von dem doch
angeblich auch ihre eigene berufliche Zukunft ganz maßgeblich
abhing.
Aber offenbar schien sie zu glauben, dass wir ihr irgendwie
etwas am Zeug flicken wollten. Befürchtete sie, dass wir bei
unseren Ermittlungen auf Dinge stießen, die unter der Decke bleiben
sollten?
Ich reichte ihr meine Karte.
„Seien Sie so freundlich und stellen Sie uns eine Liste
sämtlicher Mandantschaften zusammen, die Ihre Kanzlei seit ihrer
Gründung übernommen hat. Und zwar möglichst schnell. Wir können
natürlich auch dafür sorgen, dass ein richterlicher Beschluss Sie
dazu zwingt. Für uns hätte das den Nachteil, dass es zu einer
Verzögerung kommt, die nur dem Täter nützt. Für Sie wiederum
bedeutet es, dass Sie den Umfang ihrer Auskünfte nicht mehr selbst
bestimmen können.“
„Ich lasse Ihnen die gewünschten Daten zukommen“, versprach
Linda Kalbitz.
Ihr Lächeln wirkte so säuerlich, wie es selten bei einer Frau
ihres Alters gesehen hatte.
Der PH-Wert musste auf jeden Fall im absolut toxischen Bereich
liegen.
„Es wäre nett, wenn Sie dafür sorgen, dass diese Angaben
sofort zusammengetragen werden“, sagte Rudi.
Linda Kalbitz rief daraufhin über die Sprechanlage die
Sekretärin herein und gab ihr eher widerwillig entsprechende
Anweisungen.
„Ich erledige das“, versprach sie. Die Sekretärin sah aus, als
hätte sie vor wenigen Minuten noch geweint und nur notdürftig ihr
Make-up gerichtet.
„Und ich werde Sie begleiten und kann Ihnen dabei auch noch
ein paar Fragen stellen“, kündigte Rudi an. „Wie war nochmal Ihr
Name?“
„Sybille Cromers“, gab die Sekretärin bereitwillig Auskunft.
Ich schätzte sie auf Mitte zwanzig. Das Haar war blond gelockt. Und
der wiederholte Seitenblick zu ihrer Chefin zeigte deutlich, wie
wichtig es war, sie allein zu befragen. Allerdings hatte ich meine
Zweifel, dass sie dabei auskunftsfreudiger sein würde als ihre
Chefin.
Linda Kalbitz schien der Gedanke, dass sich Rudi ohne ihre
Anwesenheit mit der Sekretärin unterhalten wollte, nicht zu
gefallen. Ihre Mimik war da vollkommen eindeutig.
Allerdings sah sie im Moment wohl auch keine Handhabe, um das
irgendwie verhindern zu können.
Ich wartete, bis Sybille Cromers und Rudi den Raum verlassen
hatten.
„Kommissar Kubinke, ich habe heute noch ein paar dringende
Mandantengespräche vor mir und werde zu einem Termin jetzt schon zu
spät kommen. Einen weiteren habe ich bereits absagen müssen. Falls
Sie also keine weiteren Fragen haben, möchte ich Sie bitten, mich
nicht länger aufzuhalten.“
„Schon erstaunlich, wie sie einfach zur Geschäftsordnung
übergehen“, fand ich. „Ich meine, die Kanzlei existiert noch nicht
allzu lange, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie doch in
dieser Zeit wirklich sehr eng zusammengearbeitet haben. Schließlich
sind Sie hier ja nun wirklich keine Großkanzlei, in deren Büro man
sich vielleicht gegenseitig tagelang aus dem Weg gehen kann, wenn
man an unterschiedlichen Fällen arbeitet.“
„Es wäre überaus liebenswürdig, wenn Sie auf den Punkt kämen,
Herr Kubinke“, sagte Linda Kalbitz. Der Klang ihrer Stimme
erinnerte an klirrendes Eis. Sie war gereizt. Und ich hatte das
Gefühl, dass sie mir ein paar Dinge über Maik Ozanali hartnäckig
verschwieg.
Ich sah sie an und sagte:
„Ich stelle mir vor, jemand hätte meinen Partner, Kommissar
Meier, plötzlich über den Haufen geschossen. Da würde ich anders
reagieren.”
„Ach, ja?”
„und ich komme ganz ehrlich immer noch nicht darüber hinweg,
wie kühl Sie über den Dingen zu stehen scheinen.“
„Emotionen können teuer werden, Herr Kubinke.”
„Wer sagt das?”
„Das ist eine der ersten Lektionen, die ich als Anfängerin in
meinem Job lernen musste.“
Ach je! Emotionen können teuer werden - wie das klang! Aber
sie war nicht so cool und abgeklärt, wie sie mir glauben machen
wollte. Das war alles Fassade. Ich frage mich immer wieder, wieso
sich Menschen so viel Mühe damit machen, einem etwas anderes
vorzumachen, wo doch die Wahrheit nur allzu offensichtlich ist.
Schauspielerei beherrscht nicht jeder. Nicht wirklich gut
jedenfalls.
Ich sagte:
„Dann scheinen Sie ja schnell gelernt zu haben!“
Ihr Lächeln war so dünn wie der Automatenkaffee auf mancher
Dienstelle.
„Vielleicht ist genau das der Grund, warum ich in relativ
jungen Jahren schon Partner einer Kanzlei bin.
„Wenn Sie das sagen…”
„Und so tragisch der Tod meines Partner ist, ich werde alles
tun um zu verhindern, dass sich diese Tragödie auch noch auf
weitere Personen ausweitet.“
„Anscheinend sind Sie rücksichtsvoll.”
„Ihren Sarkasmus können Sie sich sparen.”
„Wen meinen Sie genau damit?“
„Womit?”
„Andere Personen.”
„Damit meine ich zum Beispiel Sybille, die ihren Job verlieren
würde, wenn hier alles den Bach runtergeht. Und Mandanten, für die
wir verantwortlich sind...“ Sie schluckte. Erst jetzt schien ihr
aufzufallen, dass sie tatsächlich wir gesagt hatte. „Sie merken
vielleicht, dass ich noch nicht wirklich umgeswitcht habe, Herr
Kubinke.“
„Ja, das habe ich schon mitbekommen.“
„Sie tun alles, um den Täter zu finden, nicht wahr?”
„Natürlich.”
„Wirklich?”
„Das ist mein Job. Warum zweifeln Sie daran?”
Sie schluckte.
*
Wenig später saßen wir wieder in dem Ford aus dem
Fahrzeugbestand unserer Fahrbereitschaft. Die Sekretärin hatte Rudi
eine Liste der gegenwärtigen Mandaten der Kanzlei erstellt.
„Interessante Leute darunter“, fand mein Kollege. „Mir würden
allein bei einer oberflächlichen Durchsicht mehrere Namen
einfallen, denen ich zutraue, bei Bedarf einen Profi-Killer zu
engagieren.“
„Hast du noch irgend etwas aus der Sekretärin herausbekommen
können?“
„Leider nicht, Harry. Die war so eingeschüchtert, dass sie
nichts weiter rausgebracht hat. Allerdings hat sie der Tod ihres
Chefs anscheinend sehr getroffen.“
*
Unsere nächste Adresse war ein exquisites Juwelengeschäft in
Berlin Mitte. Klein aber fein, so lautete hier die Devise. Ozanali
stand in großen Buchstaben über der Tür. Es gehörte nämlich Maik
Ozanalis Ehefrau Joanna. Kollegen hatten sie bereits über den Tod
ihres Mannes informiert. Zumindest diese unangenehme Pflicht blieb
uns also erspart.
In der Gegend zu parken ist eine Wissenschaft für sich. Einen
Stellplatz zu bekommen ist schiere Glücksache und die Plätze in den
Tiefgaragen der Kaufhäuser sind meistens zu knapp bemessen. Wir
waren deswegen gezwungen, den Ford in einiger Entfernung
abzustellen und die letzten zehn Minuten zu unserer Zieladresse zu
Fuß zu laufen.
Aber so ein kleiner Marsch kann ganz erfrischend ein.
Zumindest blieb uns auf diese Weise Zeit, sich zu überlegen,
wie man einer Frau einfühlsam begegnen konnte, die soeben durch die
Kugel eines skrupellosen Killers zur Witwe geworden war.
Eine Angestellte des Juweliergeschäfts geleitete uns in einen
der hinteren Räume, wo sich unter anderem ein Büro befand. Dort
fanden wir Joanna Ozanali. Sie saß in sich zusammengesunken in dem
schweren Ledersessel hinter ihrem Schreibtisch. Auf diesem lagen
ein paar Schmuckstücke und eine Lupe. Offenbar war sie gerade damit
beschäftigt gewesen, diese Stücke zu begutachten und hatte dann
irgendwann damit aufgehört.
Ihr Blick war ins Nichts gerichtet. Sie schien uns zunächst
gar nicht zu bemerken. Die Angestellte sprach sie zweimal an, ehe
sie schließlich aus ihrem Tranceartigen Zustand erwachte.
„Frau Ozanali?“, fragte ich dann. „Ich bin Kommissar Harry
Kubinke vom BKA und dies ist mein Kollege Rudi Meier. Wir müssen
Ihnen ein paar Fragen stellen.“
„Natürlich“, murmelte sie.
„Ich weiß nicht, was die Kollegen Ihnen schon gesagt haben,
aber...“
„Ein Scharfschütze hat meinen Mann auf dem Gewissen und ihn
aus zweihundert Metern Entfernung erschossen“, fasste sie zusammen,
was man ihr gesagt hatte.
Mich wunderte es, dass sie bereits diese Einzelheiten
wusste.
Vermutlich hatte sie danach gefragt.
Im Allgemeinen ist es so, dass man mit Angehörigen, die
genauen Details und Tatumstände erst nach einer Weile einigermaßen
gefasst besprechen kann.
Schlimme Nachrichten brauchen einfach ihre Zeit, bis sie sich
durch die Windungen des Gehirns hindurchgearbeitet haben und
wirklich ins Bewusstsein gedrungen sind. Bei Frau Ozanali schien
das jedoch anders zu sein.
Sie nickte der Angestellten zu und wies sie damit an, den Raum
zu verlassen.
Sie zog sich daraufhin mehr oder minder geräuschlos
zurück.
Joanna Ozanali deutete auf die edelsteinbesetzten
Schmuckstücke auf ihrem Schreibtisch. „Das ist eine Arbeit, die
viel Konzentration verlangt. Ich habe versucht mich damit etwas
abzulenken, nachdem Ihre Kollegen von der City Police mir die
Nachricht von Maiks Tod überbracht haben.“ Sie sah auf. Ihr Blick
musterte mich einige Augenblicke auf seltsame Weise. „Es ist mir
nicht gelungen“, stellte sie fest und ihre Stimme war so leise,
dass ich sie kaum verstehen konnte.
Mir fiel auf, dass sie blonde Locken trug. Die Ähnlichkeit zu
Sybille Cromers, der Sekretärin in der Kanzlei Ozanali &
Partner war frappierend. Die beiden wirkten wie Schwestern – oder
eigentlich schon eher wie Mutter und Tochter.
„Es freut mich, dass das BKA offenbar den Fall übernimmt“,
sagte Joanna Ozanali schließlich. „Das bedeutet für mich, dass Sie
die Sache die Priorität einräumen, die angemessen ist.“
„Wenn die zuständige Polizeidienststelle den Fall übernehmen
würde, dann hieße das nicht, dass man dort diesen Fall für weniger
wichtig erachten würde“, stellte ich klar.
„Mag sein, Herr Kubinke. Aber auf Grund der früheren Tätigkeit
meines Mannes bei der Staatsanwaltschaft, gibt es da ja dann doch
ein paar besondere Umstände, wie Sie zugeben werden.“
„Wir gehen bisher davon aus, dass es sich um einen
professionellen Auftragsmord handelt“, sagte Rudi. „Haben Sie eine
Ahnung, wer ein Motiv gehabt hätte, Ihrem Mann einen Killer auf den
Hals zu hetzen?“
„Fahren Sie zur JVA Moabit. Oder wahlweise zum Knast in Tegel.
Da gibt es wahrscheinlich ganze Zellentrakte, in denen nur Personen
einsitzen, die Grund genug haben, meinem Mann irgend etwas übel zu
nehmen, Herr Kubinke. Und streng genommen müssen Sie mich auch auch
dazuzählen.“
Rudi hob die Augenbrauen. „In wie fern?“, fragte er.
„Maik hatte ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Ich habe mit
dem Geld, das ich durch mein sehr gut gehendes Geschäft
erwirtschaftet habe, ihm den Start seiner Kanzlei ermöglicht und
das war dann sozusagen der Dank dafür...“ Ein bitterer Zug breitete
sich jetzt für kurze Zeit in ihrem Gesicht aus. Maik Ozanali ist
also seinem Typ treu geblieben, dachte ich. Rudi und ich hatten
wohl beide das Gefühl, dass Joanna noch etwas sagen wollte und nur
nach den richtigen Worten suchte. Deswegen schwiegen wir und
warteten geduldig ab. „So ist nunmal das Leben“, fuhr sie
schließlich fort. „Ich sage Ihnen das deshalb, weil Sie ja doch von
der Affäre mit Sybille Cromers erfahren hätten und da dachte ich,
ist es besser, gleich reinen Wein einzuschenken.“
„Wir wissen Ihre Offenheit zu schätzen“, erklärte ich.
„Auch wenn Maik und ich unsere Probleme hatten, ändert das
nichts daran, dass sein Tod für mich ein schwerer Schlag ist und
ich Sie bei Ihrer Suche nach dem Täter in jeder Hinsicht
unterstützen werde.“
„Darauf werden wir sicher noch zurückkommen“, sagte
Rudi.
„Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dass wir trotz der
gerade angedeuteten Probleme wieder enger zusammenkommen und unsere
Schwierigkeiten überwinden würden. Und damit sie auch gleich die
volle Wahrheit wissen, möchte Ihnen auch noch mitteilen, dass eine
Lebensversicherung zu meinen Gunsten existiert, die im Fall von
Maiks Tod ausgezahlt wird.“
Ich war etwas verwundert darüber, dass sie uns ein mögliches
Mordmotiv nach dem anderen präsentierte. War das wirklich nur der
Wunsch, mit offenen Karten zu spielen und die Erkenntnis, dass all
die Fakten ohnehin im Laufe der Ermittlungen auf den Tisch kommen
würden? Was man nicht verbergen kann, muss man betonen. Das schien
Joanna Ozanalis Devise in diesem Punkt zu sein.
„Ja, Sie können davon ausgehen, dass all diese Dinge im Zuge
der Ermittlungen überprüft werden und sich daraus natürlich
entsprechende Fragen ergeben könnten“, nickte ich.
„Fragen?“ Sie lächelte matt. „Sie meinen, einen
Verdacht.“
Ich atmete tief durch.
Sehr tief.
„Meinetwegen, ein Verdacht.“
Sie hob die Augenbrauen.
„Ich nenne die Dinge gerne beim Namen, wissen Sie?“
„Das tun wir auch.”
„So?”
„Wie hoch ist denn die Auszahlungssumme?“
„Eine Million Euro.
„Eine Menge Holz.”
„Und sie ist nicht auf Gegenseitigkeit gewesen, Herr
Kubinke.“
„Eine Million Dollar ist wirklich eine hohe Summe.“
„Wissen Sie, das kommt noch aus unserer Anfangszeit. Damals
war ich eine kleine Angestellte und Maik war bei der
Staatsanwaltschaft und hat Jagd auf Gangster gemacht. Sein
Spezialgebiet war damals schon die Geldwäsche und da hat er
natürlich gewisse Leute dort gepackt, wo es ihnen am meisten
wehtut! Bei ihren Gewinnen nämlich.“
„Das heißt, Sie haben damals schon befürchtet, dass Ihr Mann
auf der Abschussliste dieser Leute stehen könnte.“
„Natürlich! Und Maik wollte, dass ich dann abgesichert bin.
Mit den Jahren hat sich die Situation allerdings verändert. Ich
habe mein Geschäft gegründet und verdiene schon lange mehr als mein
Mann. Aber wie das so ist: So eine Versicherung verliert man aus
den Augen und wir haben das aus irgendeinem Grund nie geändert. Ich
hoffe, dass man mir daraus jetzt keinen Strick dreht.“
„Es ist nicht strafbar, Begünstigte einer Lebensversicherung
zu sein“, wich ich aus.
„Nein, aber verdächtig. Und die Summe wäre auch hoch genug, um
davon noch einen Profi bezahlen zu können.“
Ich ging nicht weiter darauf ein. Wieso Joanna Ozanali sich so
hartnäckig selbst zu belasten versuchte, war mir noch nicht so ganz
klar. Aber mein Instinkt zweifelte daran, dass sie irgend etwas mit
dem Mord zu tun hatte. Trotz der mehr als stichhaltigen Gründe,
ihren Mann zu hassen und vielleicht sogar aus dem Weg räumen zu
wollen. Vielleicht war es einfach so, dass ihre Trauer über den Tod
von Maik Ozanali letztlich doch einfach zu ehrlich erschien, als
dass ich mir vorstellen konnte, dass sie die nur gespielt hatte.
Und dass sie ansonsten eher unterkühlt wirkte und ihre Gefühle
zurückhielt, ließ das für mich eher noch überzeugender erscheinen,
als dass es irgendwelche Zweifel genährt hatte.
Andererseits kann man sich, was solch eine Einschätzung
betrifft, sehr leicht vertun.
Ein guter Instinkt ist eine prima Sache – aber man sollte ihm
auch nur bis zu einem gewissen Grad trauen.
„Ich habe noch eine andere Frage, Frau Ozanali“, sagte ich.
„Was wissen Sie über die Gründe für das Ausscheiden Ihres Mannes
aus dem Dienst bei der Staatsanwaltschaft?“
„Die offizielle Version oder die Wahrheit?“, gab sie
zurück.
Ich hob die Augenbrauen.
„Ich nehme an, das war eine rhetorische Frage.“
„Wieso?”
„Nur so.”
„Die Arbeit meines Mannes wurde nicht richtig geschätzt. Wir
haben nicht nur einmal darüber geredet. Fast jeden Tag hat er
darüber geklagt.
„Wie meinen Sie das?”
„Er durfte die Arbeit machen, andere haben sich hinterher in
das Kameralicht gestellt und sich mit irgendwelchen
Ermittlungserfolgen gebrüstet.”
„Das klingt schlimm.”
„Und bei Beförderungen ist er geflissentlich übergangen
worden.“
„Er war zum Schluss immerhin stellvertretender Leiter seiner
Behörde.“
„Ja. Aber Friedhelm Dallhaus, der Mann, der sein Vorgesetzter
wurde, hat ihm von Anfang an klar gemacht, dass er bei ihm keine
Chance gehabt hätte. Maik drohte mit untergeordneten Aufgaben
abgespeist zu werden. Und das wollte er sich nicht antun und
dachte, es ist besser sich selbstständig zu machen.“
„Und hat ihn nicht irgendwie irritiert, jetzt solche Leute zu
verteidigen, die er noch vor kurzem versucht hätte, in Moabit
einzuquartieren?“
„Doch, das hat ihn irritiert, sehr sogar. Aber finanziell
scheint es sich gelohnt zu haben. Ich habe zwar für die
Anschubfinanzierung gesorgt. Schließlich mussten ja Büros
eingerichtet und eine Sekretärin eingestellt...“ Sie brach ab. „Ja,
das ist ein eigenes Thema, aber irgendwie komme ich immer wieder
darauf zurück, wie Sie vielleicht verstehen werden.“
„Das verstehe ich durchaus”, sagte ich.
„Sie sind sehr verständnisvoll.”
„Ich gebe mir Mühe.”
„Na, das ist doch wenigstens etwas…”
*
Etwas später saßen wir wieder im Wagen. Wir hatten uns in der
Nähe jeder ein vollkommen überteuertes Sandwich besorgt. Aber die
Gegend war nunmal teuer und irgendwohin zu fahren, wo es
preiswerter war, dazu hatten wir keine Zeit.
„Was hältst du von Joanna Ozanali?“, fragte Rudi.
„Da bin ich mir noch nicht sicher.“
„Traust du ihr zu, einen Profi engagiert zu haben, um ihren
Mann umzubringen?“
„Ehrlich gesagt: Nein.”
Rudi hob die Augenbrauen.
„Wieso nicht?”
Ich zuckte mit den Schultern.
„Das ist nur ein Gefühl, nichts was auf irgendwelchen
Tatsachen basiert. Davon abgesehen wissen wir nicht, ob es wirklich
ein Profi war.“
„Aber der Schluss liegt doch angesichts der Umstände nahe,
Harry!“
„Niemals zu früh festlegen, Rudi, das weißt du doch.“
„Es war ein sehr gezielter Schuss aus großer
Entfernung.“
„Das heißt streng genommen nur, dass der Täter ein wirklich
guter Schütze ist.“ Ich fädelte den Ford in den laufenden Verkehr
ein. „Vielleicht ein ehemaliger Scharfschütze, ein Jäger, jemand
der Teil eines SEK-Teams war – da gibt es viele
Möglichkeiten.“
„Bin gespannt darauf, was die Ballistik sagt, Harry.“
„Ich auch.“
„Das Obduktionsergebnis an sich dürfte ja weit weniger
spannend sein, denn es kann ja wohl niemand im Ernst daran
zweifeln, dass die Todesursache die Kugel im Kopf war.“
Wir fuhren zum Präsidium.
Unser gemeinsames Dienstzimmer hatten wir kaum betreten, als
unser Kollege Turgut Özdiler herein kam. „Harry! Rudi! Wir wissen
jetzt, was für eine Kugel in Maik Ozanalis Kopf steckt“, erklärte
er.
„Und?“
„Spezialmunition, wie ich mir schon dachte. Bei der Waffe
handelt es sich um eine Weitz MXW-234.“
Ich wechselte mit Rudi einen kurzen Blick. „Nie gehört“,
meinte mein Kollege und sprach mir damit aus der Seele. Ich bildete
mir schon ein, mich mit Waffen aller Art auszukennen. Das bringt
der Alltag in unserem Job nunmal so mit sich. Aber das Fabrikat,
das Turgut uns genannt hatte, war mir vollkommen unbekannt.
„Eine Weitz?”,fragte ich. „Dieselbe Waffe, mit der auf mich
vor der Anarcho-Kneipe geschossen wurde.”
„Das hatte ich nicht mehr gegenwärtig”, sagte Rudi.
„Die Weitz MXW-234 ist eine wahre Wunderwaffe”, sagte Kollege
Özdiler.
„Was soll das Besondere an der Waffe sein?“, fragte ich.
„Sie ist gut.”
„Davon mal abgesehen.”
„Besonders gut.”
„Das sind andere auch, Turgut.”
„Ein Spezialgewehr für Scharfschützen. Gilt in Fachkreisen als
eine der besten Waffen dieser Art, die jemals hergestellt wurden.
Für eine Weile bestand sogar die Chance, dass die Weitz – übrigens
benannt nach ihrem Konstrukteur – zur Standardwaffe für
Scharfschützen in der U.S.Army, bei der Bundeswehr und bei den
SEK-Teams verschiedener Polizeieinheiten wird. Aber daraus ist aus
unerfindlichen Gründen nichts geworden.“
Ich stutzte.
„Und was waren das für Gründe?“, fragte ich, denn so wie das
jetzt aus Turgut Özdilers Mund klang, war diese Waffe ein technisch
gesehen ziemlich unschlagbares Produkt.
Eine Superwaffe.
„Könnte sein, dass es mit dieser Waffe nicht möglich ist,
Standardmunition zu verschießen. Aber ehrlich gesagt glaube ich das
nicht.”
„Sondern?”,hakte ich nach.
„Ich würde eher vermuten, dass die Herstellerfirma nicht
imstande gewesen wäre, die entsprechende Stückzahl innerhalb einer
vertretbaren Zeit zu liefern.“
„Also eine seltene Waffe“, schloss ich.
Turgut Özdiler grinste. „Eine sehr seltene Waffe“, stellte er
klar. „Und das dürfte uns die Suche nach dem Täter erheblich
vereinfachen.“
„Wie viele von diesen Gewehren gibt es denn?“
„Nicht einmal hundert.”
„Weltweit?”
„Ja.”
„Das ist wirklich nicht viel”, sagte Rudi.
„Ich habe mich bereits im Netz informiert. Dieser Weitz ist
mit seiner Firma vor einigen Jahren pleite gegangen.“
„Obwohl die Waffe, die er konstruiert hat, doch so gut war?“,
wunderte ich mich.
Unser Kollege zuckte mit den Schultern.
„Vielleicht hat er sich einfach übernommen, Harry. Inzwischen
tummelt Norman Weitz sich auf radikalen Internet-Seiten, auf denen
die Auflösung der BRD und ein Steuerboykott propagiert wird, weil
der Staat seine Bürger sowieso nur ausbeutet und
bevormundet.“
„Ist Weitz ein sogenannte Reichsbürger?”, fragte ich.
Der Kollege nickte.
„Sowas in der Art.”
„Es müsste sich bei einer so kleinen Anzahl von Waffen doch
feststellen lassen, wo die einzelnen Exemplare geblieben sind“,
meinte Rudi.
Turgut nickte erneut. „Ist schon in die Wege geleitet.“
„Ist mit speziell dieser Waffe schon einmal ein Verbrechen
begangen worden?“, fragte ich.
„Mit der am Park eingesetzten Mordwaffe nicht – aber vor einem
halben Jahr hat es einen Fall gegeben. Jörn Mackelhoff, Mitglied
eines SEK-Teams der Polizei von München, hat einen Vorgesetzten mit
einem Weitz-Gewehr erschossen. Hintergrund ist wohl ein
Eifersuchtsdrama. Der Vorgesetzte hatte etwas mit Mackelhoffs Frau.
Und ein Zusammenhang mit unserem Fall kann ich da, abgesehen vom
Waffentyp, auch nicht erkennen.“
„Hm.”
„Und dann natürlich der tote Killer, der vor dem Anarcho-Lokal
auf dich geschossen hat und von dem wir denken, dass der
Abu-Jamal-Clan ihn geschickt hat.”
Rudi sagte: Für eine sop seltene Waffe ist sie in letzter Zeit
aber ziemlich beliebt bei den Mördern.”
*
Am Spätnachmittag besuchten wir noch einige der Zeugen, deren
Aussagen und Personalien am Tatort von den Kollegen der aufgenommen
worden waren.
Darunter war auch Josephine Bringemeyer.
Sie nannte sich Objektkünstlerin und wohnte zur Untermiete in
einem ehemaligen Lagerhaus.
Als Atelier eigneten sich die hohen Räume sicherlich
hervorragend.
Vorausgesetzt, man hatte das nötige Geld, um sich die hohen
Heizkosten leisten zu können und hatte nichts dagegen, in einer
Umgebung zu wohnen, die in etwa so wohnlich wie eine Autowerkstatt
war.
Josephine Bringemeyer bat uns herein.
Das erste, was mir auffiel, war eine lebensgroße Gestalt aus
Pappmaché, die Josephine Bringemeyer bemalt hatte. Es roch nach
Farbe. „Ich kann Ihnen leider nicht die Hand geben“, sagte sie. „Es
sei denn, Sie haben nichts dagegen, wenn sie Farbe
abbekommen!“
„Muss nicht unbedingt sein“, gab ich zurück.
„Und es wäre nett, wenn Sie die Tür schließen würden.“
„Sicher.“
Rudi übernahm das. Die Tür war eine relativ schwer zu
bewegende Schiebetür. Rudi musste sich ganz schön anstrengen. Die
Tür hatte offen gestanden, als wir die Wohnung betraten. Vermutlich
um zu lüften.
Josephine Bringemeyer wischte sich die Hände mit einem Lappen
ab und betrachtete dabei ihren Pappmaché-Kameraden. Es befanden
sich noch einige weitere, schwer zu definierende Objekte im Raum.
Darunter eine Vogelscheuche, deren Kopf eine Maske von Donald Trump
trug und ein Mobile, das aus kleinen Engeln mit Totenschädeln
bestand. Der Luftzug, den schon unser Auftreten verursachte,
reichte aus, um sie durcheinander fliegen zu lassen.
In einer Ecke stand ein Bett, daneben ein Tapeziertisch mit
Computer und mehreren Papierstapeln. An der Wand hing eine Collage
aus den Schnipseln von Zeitschriften.
„Was kann ich für Sie tun?“, fragte sie.
Wir zeigten ihr unsere Ausweise, die sie mit einem
Stirnrunzeln zur Kenntnis nahm. „Wir kommen wegen des
Mordanschlags, der sich im Park ereignet hat“, sagte ich. „Mein
Name ist Kommissar Kubinke und das ist mein Partner Kommissar
Meier. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.“
Sie sah mich an.
„Schade“, sagte sie.
„Was meinen Sie damit?“
„Ich hatte schon gehofft, dass Sie vielleicht ein finanziell
gut ausgestatteter Galerist wären, oder wenigstens ein
Privatkäufer, dem es etwas wert ist, ein echtes
Josephine-Bringemeyer-Unikat in der Wohnung zu haben.“
„Tut mir leid, aber damit können wir leider nicht dienen“,
sagte Rudi.
Josephine Bringemeyer sah Rudi einige Augenblicke lang an.
Dann kehrte ihr Blick wieder zu mir zurück. „Eigentlich habe ich
Ihren Kollegen schon alles gesagt. Viel zu sehen war da ja auch
nicht... Ich habe nicht einmal den Schuss gehört. Dieser Mann ist
einfach tot umgefallen und hatte eine Schusswunde im Kopf.“
Josephine Bringemeyer schluckte. „Schrecklich!“
Sie rieb noch etwas an ihren Händen herum. Dabei stiegen
offenbar nochmal die Erinnerungen an das schreckliche Geschehen im
Park in ihr hoch. Eine leichte Röte überzog ihr Gesicht. Sie wirkte
plötzlich sehr angespannt, auch wenn sie versuchte, dies mit einem
ziemlich verkrampften Lächeln zu überspielen.
„Jeder Hinweis, jede Beobachtung kann uns eventuell
weiterbringen“, sagte ich. „Auch wenn es Kleinigkeiten sind, die
Ihnen vielleicht gar nicht wichtig vorkommen.“
„Ich verstehe“, murmelte sie.
„Wir möchten Sie deswegen bitten, dass wir alles nochmal genau
durchgehen.“
„Wissen Sie, ich bin morgens im Park, um die Hunde auszuführen
und...“
„Sie haben Hunde?“, unterbrach ich sie.