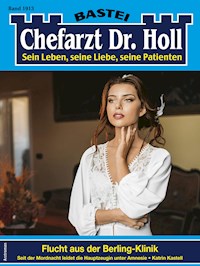5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die besten Ärzte
- Sprache: Deutsch
Willkommen zur privaten Sprechstunde in Sachen Liebe!
Sie sind ständig in Bereitschaft, um Leben zu retten. Das macht sie für ihre Patienten zu Helden.
Im Sammelband "Die besten Ärzte" erleben Sie hautnah die aufregende Welt in Weiß zwischen Krankenhausalltag und romantischen Liebesabenteuern. Da ist Herzklopfen garantiert!
Der Sammelband "Die besten Ärzte" ist ein perfektes Angebot für alle, die Geschichten um Ärzte und Ärztinnen, Schwestern und Patienten lieben. Dr. Stefan Frank, Chefarzt Dr. Holl, Notärztin Andrea Bergen - hier bekommen Sie alle! Und das zum günstigen Angebotspreis!
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Chefarzt Dr. Holl 1786: Da beging sie Fahrerflucht ...
Notärztin Andrea Bergen 1265: Liebst du mich nicht mehr?
Dr. Stefan Frank 2219: Glaub nicht seinen schönen Worten!
Dr. Karsten Fabian 162: Für alle Fälle Dr. Fabian
Der Notarzt 268: Die Operation, die alles veränderte
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
BASTEI LÜBBE AG Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Für die Originalausgaben: Copyright © 2013/2015/2016 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln Covermotiv: © romeovip_md/Shutterstock ISBN 978-3-7325-9190-9 ww.bastei.de www.luebbe.de www.lesejury.deKatrin Kastell, Isabelle Winter, Stefan Frank, Ulrike Larsen, Karin Graf
Die besten Ärzte 21 - Sammelband
Inhalt
Inhalt
Cover
Impressum
Da beging sie Fahrerflucht …
Vorschau
Da beging sie Fahrerflucht …
Doch die Schuld verfolgt sie Tag und Nacht
Von Katrin Kastell
Als Lea Meisenhälter an diesem frühen Morgen vor dem Heim, in dem ihre an Alzheimer erkrankte Mutter lebt, aus ihrem Wagen aussteigt, ist sie mit den Nerven vollkommen am Ende. Immer wieder gehen ihr die schrecklichen Geschehnisse der Nacht durch den Kopf. Während der Fahrt über die Autobahn fiel vor ihr aus einer großen dunklen Limousine ein Mann auf die Straße. Jetzt quälen die junge Frau tausend Fragen: Hat sie den Mann trotz ihrer Vollbremsung überfahren? Oder war er bereits tot, als man ihn aus dem Auto schubste?
Wie auch immer – eines steht unumstößlich fest: Ihre Entscheidung, die Polizei zwar anonym zu verständigen, aber nicht auf das Eintreffen der Beamten zu warten, war falsch. Das war eindeutig Fahrerflucht!
Von nun an wird sie für immer mit der Angst vor Entdeckung leben müssen …
Wenn ihr Vater einen Familienrat einberief und dafür sogar ihren Bruder aus Hamburg herbeorderte, dann war das eine ernste Angelegenheit. Lea Meisenhälter drehte sich noch einmal im Bett um und wünschte, sie hätte einen ganz normalen Sonntagmorgen vor sich gehabt.
Sie wollte noch ein wenig dösen und dann in aller Ruhe mit der Zeitung frühstücken und schauen, was der Tag so brachte. Sicher wäre sie für ein paar Stunden bei ihren Eltern vorbeigegangen wie eigentlich fast an jedem Sonntag, aber um nach ihrer Mutter zu sehen, und nicht zu einem hochoffiziellen Familienrat.
Aber es half alles nichts! Sie zwang sich, aufzustehen und ins Bad zu gehen. Um neun Uhr erwartete ihr Vater sie zum Frühstück.
Als Bibliothekarin in der Münchner Stadtbibliothek war Lea Teambesprechungen und gemeinsames Planen gewohnt. Normalerweise hätte ihr der Familienrat keine Angst eingejagt, aber es war eine besondere Situation, und ihr Vater war kein Mensch, der den Rat anderer suchte. Er war ein Mensch, der entschied und anderen seine Entscheidungen mitteilte.
Walter Meisenhälter war ein anerkannter Dirigent und hatte die Münchner Kammermusiker über Jahrzehnte geleitet. Er war es in jeder Hinsicht gewohnt, den Ton anzugeben. Eine Kindheit mit diesem dominanten Vater war nicht immer ganz leicht gewesen und hatte geprägt.
Lea verdankte ihrem Vater, dass sie als ausgesprochen stur und konfliktfähig galt. Im Gegensatz zu ihrem Bruder Tobias hatte sie sich dem väterlichen Willen nie widerspruchslos gebeugt, und dementsprechend angespannt war auch ihr Verhältnis zum Vater, so sehr sie ihn auch für sein musikalisches Lebenswerk bewunderte und ihn auf eine etwas distanzierte Weise liebte.
Es war immer ihre Mutter gewesen, die für Lea die Familie zusammengehalten hatte mit ihrer Wärme und Liebe. Leas Augen wurden feucht. Sie hätte alles dafür gegeben, sich einmal wieder mit ihrer Mutter unterhalten zu können wie früher. Über alles hatten die Frauen sich ausgetauscht und waren die besten Freundinnen gewesen. Das fehlte ihr so sehr!
Ihre Mutter hätte ihr sagen können, was in dieser Lage richtig war. Sie hatte so etwas immer gewusst. Mit ihrer tiefen Menschlichkeit und ihrem Einfühlungsvermögen hatte sie nie jemanden verurteilt und immer einen weisen und gütigen Weg gefunden, Konflikte zu lösen. Sie hätte spielend herausgefunden, was das Beste für alle Beteiligten war.
Vor zwei Jahren hatte Leas Vater seinen Beruf aufgegeben, um ganz für ihre Mutter da zu sein. Es war ein großes Opfer gewesen, denn er war erst siebenundfünfzig und hätte noch einige Jahre seinen Posten innehaben können. Ohne den täglichen Umgang mit Musik und ohne sein Orchester fühlte er sich wurzellos und verloren. Für seine Frau, die er über alles liebte, opferte er klaglos seine musikalische Karriere.
„Ohne deine Mutter hätte ich das nicht erreicht. Sie stand immer voll hinter mir, hat mir Mut gemacht, mir den Rücken freigehalten und mich bedingungslos unterstützt. Nun ist es an mir, etwas für sie zu tun“, hatte er erklärt und keine Einwände zugelassen.
Lea zweifelte schon damals daran, ob seine Entscheidung langfristig gut war. Sie wusste, wie sehr er unter dem Verfall ihrer Mutter litt, und ohne den Ausgleich, den er durch die Musik gehabt hatte, war er dem Schmerz wehrlos ausgeliefert. Inzwischen erkannte ihre Mutter ihn manchmal nicht mehr und hielt ihn für einen Fremden. Sie irrte verloren durch die gemeinsame Wohnung und bat darum, dass man sie nach Hause brachte, obwohl sie zuhause war.
Lea tat es unendlich weh, sie so zu sehen, und doch war es ihr wichtig, viel Zeit mit ihr zu verbringen. Sie besuchte ihre Eltern mehrmals in der Woche und entlastete ihren Vater, so gut sie konnte. Die Stunden, die sie mit ihrer Mutter verbrachte, waren auf eine eigene Weise schön und bedeutsam, denn die Verschlechterung ihres Zustandes schritt unerbittlich und sehr schnell voran.
Die Krisensitzung hatte mit ihrer Mutter zu tun, daran konnte kein Zweifel bestehen. Wurde ihrem Vater die immer aufwendigere Pflege zu viel? Lea hätte es ihm nicht verdenken können. Es war wirklich nicht Walter Meisenhälters Art, seine Kinder in seine Entscheidungen einzubeziehen. Das hatte er noch nie getan. Warum tat er es jetzt?
Lea ahnte, dass es sich um eine äußerst schwerwiegende Entscheidung handeln musste, wenn ihr Vater sie nicht alleine treffen wollte. Was konnte schwerwiegender sein als die Frage, ob der Zeitpunkt gekommen war, an dem ihre Mutter in einem Heim besser aufgehoben wäre?
Allein der Gedanke daran jagte Lea einen Schauder durch den ganzen Körper. Sie wollte, dass sich ihre Mutter noch wohl und geborgen fühlte, so weit die Krankheit es ihr erlaubte. In der vollkommen fremden Umgebung eines Heimes würde es für sie endgültig keine Berührungspunkte mehr geben, die sie daran erinnerten, wer sie war.
Das war schrecklich, aber hatte Lea überhaupt das Recht, sich in irgendeiner Weise dazu zu äußern? Was ihr Vater in den vergangenen fünf Jahren getan hatte, war großartig. Er hatte sich aufopferungsvoll und liebevoll um ihre Mutter gekümmert und sein ganzes Leben auf sie eingestellt. Niemand konnte ihm vorwerfen, sich die Entscheidung leicht gemacht zu haben.
Lea war da und unterstützte ihre Eltern, aber sie wusste, was für ein Luxus es war, nach drei oder vier Stunden wieder nach Hause in ihre eigene Wohnung fahren zu können. Wollte sie diesen Luxus aufgeben und die Pflege übernehmen, um ihrer Mutter das Heim zu ersparen?
Konnte sie das schaffen? Was war, wenn sie ihre Arbeitsstelle verlor? Im Gegensatz zu ihrem Vater war sie auf ihren Verdienst angewiesen.
All diese Gedanken gingen ihr durch den Kopf, und sie waren mit unbestimmten Existenzängsten verknüpft. Ganz tief in ihr wusste sie, dass diese Ängste nicht das Schlimmste waren. Konnte sie es ertragen, die nächsten Stufen des Verfalls ihrer Mutter hautnah mitzuerleben?
Nachts träumte sie oft, dass sie zu ihren Eltern kam und alles wie immer war. Auf wundersame Weise war ihre Mutter geheilt und begrüßte sie an der Tür mit einer langen Umarmung.
„Warum habt ihr mich denn so lange schlafen lassen?“ Das sagte sie jedes Mal lachend, und Lea wachte nach diesem Traum jedes Mal glücklich auf.
Sie wusste, dass es nur ein Traum war. Ihre Mutter würde nie wieder aus dem großen Vergessen erwachen, das sie immer weiter weg zog von ihrer eigenen Identität, ihrer Familie und ihrem früheren Leben. Es waren kostbare Geschenke, wenn sie hin und wieder etwas klarer war, aber diese Phasen waren von kurzer Dauer, und die Abstände zwischen ihnen wurden länger – zumindest kam es Lea so vor.
Tobias kam einmal im Jahr und floh dann wieder in den hohen Norden. Die Krankheit der Mutter machte ihm Angst. Direkt nach der Diagnose hatte er die Stelle in Hamburg angenommen und München fluchtartig verlassen. Auch wenn er es nie deutlich aussprach, wusste Lea, dass es kein Zufall gewesen war.
„Wenn Mama es hat, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir es auch bekommen?“, hatte er Lea einmal bange gefragt. „Ich möchte nicht die Kontrolle verlieren und …“
Lea hatte ihn in den Arm genommen, ohne ihm zu antworten. Für ihn war es besser, weit weg in Hamburg zu sein und kaum etwas mitzubekommen. Allerdings konnte sie nicht mit seiner Hilfe rechnen, falls ihr Vater ausfiel, stand sie alleine da.
Lea blieb lange unter der kalten Dusche stehen, aber das half auch nichts. Sie wusste nicht, was richtig war, und sie kam nicht gegen die Ängste an, die sie quälten. Der einzige Mensch, der wissen konnte, was gut und richtig für ihn war, war ihre Mutter. Was hätte Lea darum gegeben, wenn ihre Mutter in der Lage gewesen wäre, für sich selbst zu sprechen!
Niedergeschlagen und ratlos nahm sie schließlich die U-Bahn, die fast neben der eleganten Vierzimmerwohnung ihrer Eltern hielt, die im vierten Stock eines Hochhauses in einem exklusiven Stadtviertel lag. Es war sinnlos, weiter zu grübeln. Vielleicht lag ihrem Vater etwas ganz anderes am Herzen.
Sie hoffte es, wenn sie es auch nicht glaubte. Er war in den vergangenen zwei Jahren extrem gealtert und selbst gesundheitlich angeschlagen. Mit neunundfünfzig Jahren hätte man ihn für siebzig halten können. Er konnte nicht mehr, und es war sein gutes Recht, an sich selbst zu denken.
***
„Du bist fünf Minuten zu spät“, tadelte ihr Vater streng, als er Lea die Tür öffnete. „Tobias sitzt schon am Tisch.“
Sie nahm den Tadel schweigend hin und lächelte nur entschuldigend. Tobias hatte immer alles richtig gemacht und war das Vorzeigekind gewesen. Kaum war er einmal aus Hamburg zu Besuch, musste er schon wieder dafür herhalten. Sie beneidete ihn nicht darum.
„Hat Mama heute einen guten Tag?“, fragte sie wie immer, wenn sie kam, denn die Unterschiede zwischen den einzelnen Tagen konnten enorm sein.
„Sie hat Tobias erkannt und freut sich wie ein kleines Kind, dass er da ist. Die ganze Zeit redet sie auf ihn ein. Vorhin wollte sie ihn in den Kindergarten bringen, und etwas später hat sie sich Gedanken darüber gemacht, was wir ihm zum Abitur schenken sollen“, erwiderte ihr Vater.
Lea betrat das große Wohn- und Esszimmer ihrer Eltern und empfand Mitgefühl für ihren Bruder. Sein Blick war gepeinigt, und nur sein Anstand hielt ihn zurück, ansonsten wäre er aus der Wohnung gerannt. Ihre Mutter stand hinter ihm und bürstete sein Haar, wie sie es immer getan hatte, als er ein kleiner Junge gewesen war.
„Du musst doch ordentlich aussehen, wenn du in die Schule gehst!“, tröstete sie ihn und sagte es wieder und wieder, als ob etwas in ihr an diesem Satz der Vergangenheit hängen geblieben wäre und sie ihn auskostete wie einen Schatz.
„Guten Morgen, Mama!“, rief Lea heiter, ging zu ihr und umarmte sie liebevoll.
Magdalena Meisenhälter legte die Bürste achtlos beiseite und damit auch die Grundschultage ihres Sohnes. Dafür sprang sie wie immer übergangslos in Leas Pubertät.
„Da bist du ja endlich! Ich habe gesagt, du musst um zweiundzwanzig Uhr zuhause sein, bevor die Probe deines Vaters aus ist. Es ist nach dreiundzwanzig Uhr, und er ist schon zuhause und ziemlich sauer. Tut mir leid, diesmal kann ich dir nicht helfen. Das Donnerwetter hast du dir selbst zuzuschreiben“, antwortete ihre Mutter und schüttelte genervt den Kopf über den Unverstand der Jugend.
Lea konnte sich gut daran erinnern, wie oft ihre Mutter sie mit diesen Worten begrüßt hatte, und musste schmunzeln.
„Lea, Lea, warum kannst du dich nicht ein kleines bisschen an die Regeln halten?“, fuhr ihre Mutter fort. „Du weißt doch, wie er ist! Ich war auch wild in deinem Alter und musste meine Grenzen austesten, aber du übertreibst es.“
„Mama, nächstes Mal komme ich pünktlich!“, versprach sie und reagierte zahmer, als sie es früher je getan hatte.
„Wenn ich das nur glauben könnte!“ Ihre Mutter lächelte ironisch. „Dann hol dir schon deinen Rüffel ab! Ich hab dich lieb.“
Als Magdalena sich wieder zu ihrem Sohn umdrehte, saß er nicht mehr am Tisch. Tobias war aus ihrer Nähe geflohen, bevor sie wieder zur Bürste greifen konnte. Sichtlich verloren stand er in dem luxuriösen Wohnzimmer und wusste nicht, wohin mit sich. Die Wohnung war nie sein Zuhause gewesen, und es gab keinen Fluchtort für ihn.
Die Meisenhälters hatten ihre Kinder in einem hübschen Vorstadtreihenhaus großgezogen – mit Garten, Schaukel und netten Nachbarn, die auch alle Kinder gehabt hatten. Als Lea und der drei Jahre ältere Tobias aus dem Haus gewesen waren, hatten sie es verkauft und sich den Traum erfüllt, in der Stadt zu wohnen.
Als kulturell interessierte Menschen konnten sie Theater, Kino, Museen und Ausstellungen leichter erreichen und waren ungeheuer aktiv. Zwei Jahre blieben ihnen, um dieses Wunschleben zu genießen, dann veränderte sich alles grundlegend.
Magdalena Meisenhälter stellte beunruhigt fest, dass ihr Gedächtnis stark nachließ und dass es ihr immer schwerer fiel, sich in München zu orientieren, obwohl sie in der Stadt geboren und aufgewachsen war. Sie verlor kein Wort darüber, aber es beunruhigte sie, weil ihre Großmutter im hohen Alter an Demenz gelitten hatte.
Immer öfter verirrte sie sich, wenn sie nur rasch etwas einkaufen gehen wollte, und fand nicht mehr nach Hause zurück. Irgendwann wagte sie dann nicht mehr, die Wohnung ohne ihren Mann zu verlassen, und das schuf eine Abhängigkeit von ihm, die sie nicht mochte, weil sie sie nicht gewohnt war. Das war der Moment, an dem sie zum Arzt ging.
Weder ihrem Mann noch ihren Kindern vertraute sie vorher ihre Beobachtungen und Sorgen an. Stattdessen entschuldigte sie sich mit einem Scherz oder überspielte es, wenn sie wieder einmal etwas vergessen oder verlegt hatte. Lächelnd ließ sie den gutmütigen Spott ihrer Familie über sich ergehen. Sie wollte unter allen Umständen vermeiden, dass ihr Mann und ihre Kinder etwas von ihrer Not bemerkten.
Natürlich war Lea damals nicht entgangen, dass ihre Mutter plötzlich sehr zerstreut und konfus war, aber sie hatte es sich genau wie ihr Vater und ihr Bruder schöngeredet und die Warnsignale nicht als solche erkennen wollen. Wer rechnete auch damit, dass eine ansonsten gesunde Frau von dreiundfünfzig Jahren aus heiterem Himmel geistig derart abbaute?
Nach dem Arztbesuch hatte Magdalena Meisenhälter erst einmal erleichtert aufgeatmet, und nach der vermeintlichen Entwarnung fand sie auch den Mut, mit ihrer Familie über ihre Ängste zu reden.
„Stellt euch vor, ich habe mich testen lassen, ob mit meinem Oberstübchen noch alles in Ordnung ist. Dr. Kramer hat mich ausgelacht, und ich musste auf den Test bestehen.“
Das erzählte sie ihrer Familie nebenbei bei einem gemeinsamen sonntäglichen Essen, als sie alle am Tisch saßen.
„Test bestanden! Gott sei Dank! Aber der Arzt hat mir den Rat gegeben, auf mich zu achten. Weniger Stress, mehr Schlaf und Glücksgefühle – mit der Therapie kann ich leben.“
Die Symptome wurden rasch schlimmer, und als sie den Test sechs Monate später noch einmal wiederholte, waren ihre Ergebnisse grenzwertig. Der Hausarzt überwies sie an einen Neurologen, der in der Diagnosefindung von Alzheimer und Demenz erfahren war. Weitere Untersuchungen wurden gemacht und eine beginnende degenerative Veränderung des Gehirns festgestellt. Magdalena litt an Alzheimer. Seit der Diagnose herrschte in der Familie der Ausnahmezustand.
„Der Befund muss nicht unbedingt etwas bedeuten, auch wenn wir selbstverständlich medikamentös eingreifen, um den Prozess zu verlangsamen“, erklärte ihr der Spezialist.
Magdalena hatte ihn hoffnungsvoll angeschaut.
„Um Ihnen etwas die Angst zu nehmen, möchte ich Ihnen von einer Langzeitstudie in einem Kloster erzählen. Nonnen erklärten sich bereit, dass ihre Gehirne nach ihrem Tod untersucht wurden. Bei einigen von ihnen zeigten sich bis ins hohe Alter keine Krankheitsmerkmale, aber ihre Gehirne wiesen typische Degenerationen auf. Wir wissen noch viel zu wenig über die Fähigkeit des Gehirns, sich zu regenerieren. Es ist in der Lage, Funktionen geschädigter Areale an andere Gehirnareale zu übertragen.“
Die Worte des Arztes machten Magdalena Mut. Sie war eine Kämpferin und setzte sich tapfer zur Wehr. Sie nahm Medikamente, um den geistigen Verfall zu verlangsamen, auch wenn sie ihr erst einmal Schwindel und Übelkeit bescherten. Sie trieb noch mehr Sport als zuvor, ging mit ihrem Mann viel an die Luft und trainierte unermüdlich ihr Gedächtnis.
Was bei sehr vielen Menschen half und einen schweren Verlauf der Krankheit ausbremsen konnte, erwies sich bei ihr leider als wirkungslos. Ihr geistiger Verfall ging mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit voran. Unaufhaltsam schaltete ihr Gehirn immer weiter ab.
Hilflos musste ihre Familie mit ansehen, wie sie sich mehr und mehr verlor und in eine Welt abdriftete, die nur sie wahrnehmen konnte. Die Anknüpfungspunkte an die gemeinsame Realität wurden immer weniger, aber die Liebe und Fürsorge für ihre Familie blieben.
Magdalena kochte Mittagessen nach Mitternacht und richtete das Frühstück am Abend. Sie verlor jeden Zeitbezug und lebte in ihrer eigenen Welt, aber auf ihre Weise umsorgte sie ihren Mann wie eh und je. Er lernte, ihre Zeit zu respektieren, und wenn sie kochte, dann aß er mit ihr und bedankte sich. Alles andere verstörte sie nur noch mehr und tat ihr nicht gut.
„Es ist spät, und du musst morgen früh raus. Ab ins Bett!“, wollte Magdalena Lea ins Bett schicken. Lea handhabte es wie ihr Vater und ging auf ihre Mutter ein, ohne zu versuchen, sie zu korrigieren.
„Mama, ich bin noch gar nicht müde, und Papa hat mir erlaubt, noch etwas aufzubleiben“, antwortete sie. In solchen Fragen hatte immer ihr Vater die letzte Entscheidung gehabt.
„Warum redest du so mit ihr?“ Tobias verdrehte genervt die Augen. „Sie ist kein Kind, und wir helfen ihr nicht, wenn wir so tun, als ob alles in Ordnung wäre“, griff er Lea aggressiv an. Er konnte und wollte seine Mutter nicht loslassen, und dafür musste er erreichen, dass sie in seiner Zeit lebte.
„Mama, es ist halb zehn und heller Vormittag“, versuchte er, die Zeit seiner Mutter auf die allgemeine Zeit umzustellen. „Hier, schau auf die Uhr!“
Magdalena sah ihn und dann die Uhr verständnislos an.
„Aber …“ Dann verstummte sie, und Tränen traten ihr in die Augen. Sie war verunsichert, und der hauchdünne Boden, auf dem sie sich noch vorsichtig bewegen konnte, wurde brüchig und warf Wellen.
„Lea ist sechsundzwanzig Jahre alt und hat ihre eigene Wohnung in der Stadt. Sie ist Bibliothekarin und schon lange erwachsen. Ich bin neunundzwanzig und lebe inzwischen in Hamburg“, fuhr Tobias gnadenlos fort.
Magdalena sah verstört von ihm zu Lea und dann wieder zu ihm.
„Walter!“, rief sie dann kläglich. „Walter!“ Es war ein Hilferuf.
„Ich bin da, Liebling!“ Walter Meisenhälter legte den Arm um sie, und sie schmiegte sich dankbar an ihn. Lange hielt sie das Stillstehen aber nicht aus. Ihr Bewegungsdrang war hoch, und so machte sie sich bald wieder von ihm los. Der Augenblick der Verunsicherung war überwunden.
„Ich muss das Abendessen kochen, bevor die Kinder aus der Schule kommen“, überlegte sie und ging auf die Küche zu. Die Küchentür war abgeschlossen. Zu oft hatte sie vergessen, die Herdplatten auszuschalten, und ein paar Mal hatte es fast gebrannt, weil ihr Mann nachts nicht gleich bemerkt hatte, dass sie aufgestanden war. Die verschlossene Tür war eine unvermeidliche Sicherheitsmaßnahme, obwohl sie jeden Tag mehrmals zu Protest und Tränen führte.
„Magdalena, wir haben doch noch von dem leckeren Auflauf von gestern, den sich die Kinder schnell in der Mikrowelle warm machen können. Heute bleibt die Küche kalt!“, lenkte ihr Mann sie ab. „Komm, setz dich zu uns! Möchtest du einen Saft trinken?“
Kaum eine Minute blieb sie sitzen, dann geisterte sie wieder unruhig durch die Wohnung, während ihr Mann sich mit Tobias und Lea zum Frühstücken an den Tisch setzte. Ganz ließ er seine Frau dabei nie aus den Augen, und auch Lea hatte ihre Mutter gewohnheitsmäßig immer im Blick.
Es war einer der besseren Tage, an denen sie sich recht gut zurechtfand und wusste, wer sie war und wo sie sich befand, aber das konnte jederzeit kippen. Man konnte nie wissen, was in fünf Minuten war.
„Mein Gott, geht es ihr immer so schlecht?“, wollte Tobias erschüttert wissen.
Vater und Tochter warfen sich einen kurzen Blick zu. Beide schwiegen. Es wäre ihnen wie Verrat an Magdalena und gemein gegenüber Tobias erschienen, ihn auf den wahren Stand der Dinge zu bringen. Wenn er es wissen wollte, musste er nur genauer hinsehen.
***
„Ich habe euch hergebeten, weil ich innerlich begonnen habe, mich von eurer Mutter und unserem gemeinsamen Leben zu verabschieden. Vor einem Monat hat sie mich das erste Mal einen ganzen Tag über nicht erkannt. Sie hatte große Angst vor mir, fühlte sich von mir bedroht und rief zugleich meinen Namen, damit ich ihr zu Hilfe komme“, begann Walter Meisenhälter, als sie das Frühstück beendet hatten.
Tobias und Lea hörten ihm erschüttert zu.
„Aber ich konnte ihr nicht helfen. Seitdem hat sich das mehrmals wiederholt. Das hat mir die Augen geöffnet. Ich liebe eure Mutter, und daran wird sich nie etwas ändern, aber es ist kaum noch etwas von ihr hier. Ihr Körper ist noch bei uns, aber ihr wunderschöner Geist, ihre Feinsinnigkeit, ihre Sensibilität und Schönheit sind längt gegangen“, fuhr er fort.
Seine Kinder fragten sich ängstlich, was der Vater ihnen wohl noch zu sagen hatte.
„Ich war immer um sie, als sie mich noch brauchte und ich für sie da sein konnte. Jetzt ist sie meist so weit weg, dass sie mich kaum noch bemerkt. Nennt mich grausam oder egoistisch, aber ich kann und will so nicht mehr leben. Daher habe ich einen Platz in einem guten Heim für eure Mutter gesucht und werde …“
Empört sprang Tobias vom Tisch auf.
„Das kannst du nicht machen! Du kannst sie nicht in ein Heim abschieben! Das lasse ich nicht zu!“, polterte er los.
„Tobias!“, wandte sich Lea mahnend an ihren Bruder. „Du bist nicht hier und weißt nicht, wie es ist.“
„Willst du mir vorwerfen, dass ich jetzt in Hamburg arbeite? Das ist nicht meine Schuld, und ich verwahre mich dagegen, mir vorzuwerfen, ich hätte Mama im Stich gelassen“, ereiferte sich Tobias und verriet damit unbewusst, dass er ein schlechtes Gewissen hatte.
„Du musst dir keine Vorwürfe machen!“, versuchte Lea, ihn zu beruhigen.
„Ich habe mir nichts vorzuwerfen! Aber wenn ihr glaubt, ihr könnt meine Mutter einfach hinter meinem Rücken in ein Heim abschieden, dann habt ihr euch geirrt!“, tobte er weiter.
Walter Meisenhälter betrachtete seinen Sohn eigentümlich gelassen.
„Ich freue mich über deine Reaktion. Du liebst deine Mutter, und das hat sie auch verdient. Ich habe Lea und dich an diesem Tisch zusammengebracht, damit nichts hinter eurem Rücken geschieht“, stellte er ganz ruhig klar. „Nimm Mama mit nach Hamburg! Sie freut sich immer, wenn du da bist, und hat dann meist einen ihrer guten Tage. Vielleicht hält das etwas an. Es wäre schön. Nimm sie mit und pflege sie!“, bot er an.
Tobias Mund öffnete und schloss sich, aber es kamen keine Worte heraus. Das Angebot seines Vaters raubte ihm die Luft. So hatte er es nicht gemeint. Das konnte doch keiner von ihm erwarten, oder?
„Du weißt, dass ich das nicht kann“, lehnte er trotzig ab, als er sich etwas gefasst hatte. „Ich bin gerade erst befördert worden, und wenn ich jetzt aussteige, dann fange ich irgendwann wieder ganz unten an. Mama gehört hierher nach München und in diese Wohnung! Du kannst sie nicht einfach abschieben, nur weil du keine Lust mehr auf sie hast!“
„Und du? Möchtest du Mama übernehmen?“, wandte sich Walter Meisenhälter nun doch etwas höhnisch an seine Tochter, weil die groben und unangemessenen Vorwürfe seines Sohnes ihn verletzten und er von Lea Ähnliches erwartete. „Du weißt immerhin, was es im Alltag bedeutet. Wenn du interessiert bist, dann ziehe ich aus und überlasse dir die Wohnung. Das ist kein Problem! Ich werde die Wohnung anderenfalls ohnehin verkaufen und mir etwas Kleineres suchen. Willst du?“
Lea schluckte. Ihr Vater hatte keinen Grund, ausgerechnet auf sie wütend zu sein, aber vermutlich galten sein Hohn und seine Wut der ganzen Welt. So hatte er sich seinen Lebensabend nicht vorgestellt. Ihre Mutter und er hatten von Reisen geträumt und davon, das Alter rundum zu genießen.
„Mama wollte nie in ein Heim, aber als sie noch in der Lage war, ihre Situation zu erfassen, haben wir ihr sogar versprechen müssen, dass wir sie in ein Heim geben, wenn es für uns zu viel wird. Sie wollte uns beschützen und hat uns ihren Segen gegeben, obwohl es ihr davor graute, in einem Heim zu sterben. Ich wünschte, alles wäre anders, aber …“, setzte Lea schweren Herzens an, um ihrem Vater zu sagen, dass sie seine Entscheidung verstand und keine Alternative sah.
Auf ihren rastlosen Wanderungen durch die ganze Wohnung war Magdalena wieder bei ihnen angekommen. Sie stand hinter Lea, die es nicht bemerkte, und hörte schon eine geraume Weile aufmerksam zu. Ihr Mann ging davon aus, dass sie wie meist in ihrer eigenen Welt war und zu weit weg, um tatsächlich zu verstehen, worum sich das Gespräch drehte, doch da täuschte er sich.
„Nein! Nein, bitte nicht! Ich will zuhause bleiben!“, flehte sie und hatte offensichtlich jedes Wort verstanden. „Bitte, ich will nicht weg! Bitte!“
Lea trieb es bei dem Flehen ihrer Mutter die Tränen in die Augen.
„Ich hab dich lieb, Mama! Wir sind doch alle da! Sieh doch, Tobias ist auch da!“, versuchte sie, die Verzweifelte abzulenken, aber das gelang ihr nicht. Die Angst vor einem Leben im Heim saß zu tief.
„Nicht in ein Heim! Bitte!“, bettelte Magdalena völlig außer sich.
Walter Meisenhälter stand vom Tisch auf, wandte der unerträglichen Szene den Rücken zu und sah hinaus auf die Kastanienallee vor dem Haus. Als seine Frau sich von hinten an ihn presste, drehte er sich um und schob sie fast grob weg. Er ertrug es nicht mehr. Wortlos verschwand er für über zehn Minuten im Badezimmer und schloss es von innen ab, damit sie ihm nicht folgen konnte.
„Was ist das für ein Mensch!“, schimpfte Tobias. „Wie kann er Mama so etwas antun und …“
„Sei still!“, fiel ihm Lea hart ins Wort.
Es war ihr gelungen, ihre Mutter auf dem Sofa mit Kissen und Decken etwas zur Ruhe zu bringen. Sie saß neben ihr und streichelte ihre Hände und Arme, wenn sie aufspringen wollte.
„Du hast keine Ahnung, wie es ist. Du weißt nicht, wie man sich dabei fühlt, wenn man Tag für Tag damit umgehen muss“, warf sie ihrem Bruder vor.
„Das ist nicht meine Schuld, ich …“
„Tobias, erspar mir deine unnötigen Schuldgefühle! Darum geht es nicht. Papa kann nicht mehr, und ich sehe, was er geleistet hat. Er kann einfach nicht mehr, und ich glaube nicht, dass es ihm leichtfällt, das zuzugeben. Er hat sich im Badezimmer eingeschlossen, weil er nicht will, dass wir seine Tränen sehen.“
„Unser Vater weint nie!“, widersprach Tobias.
Lea sah ihn stumm an. In ihrem Kopf tobte ein Orkan. Sie hatte sich gewünscht, dass ihre Mutter für sich sprach, und im Grunde hatte sich ihr Wunsch erfüllt. Ihre Mutter wollte unter keinen Umständen in ein Heim und hatte panische Angst davor. Lea rang mit sich. Der Vorschlag ihres Vaters war ernst gemeint, und er hatte etwas für sich.
Wenn Lea mit ihrer Mutter in der Wohnung blieb, dann änderte sich nur die erste Bezugsperson für die Kranke, und ansonsten blieb alles gleich für sie. Sicher würde ihr Vater manchmal vorbeikommen. Lea und er tauschten quasi nur die Rollen. Konnte das gut gehen? Die Verantwortung war gewaltig.
Magdalena beruhigte sich durch die Berührung ihrer Tochter, kuschelte sich auf dem Sofa zusammen, sodass sie wie ein kleines Mädchen aussah, und schlief mit dem Kopf auf Leas Schoß vertrauensvoll ein. Lea strich zärtlich durch ihr Haar und begriff, dass sie es wagen musste.
Die Augen ihres Vaters waren gerötet, als er aus dem Bad kam und sich wieder zu ihnen gesellte. Auch er hatte mit sich gerungen. Alles wäre um so vieles einfacher gewesen, wenn Magdalena nicht in weiten Abständen immer wieder solche klaren Momente wie eben gehabt hätte. Dann glaubte er zu spüren, dass vielleicht doch noch mehr von ihr da war, als er erkennen konnte.
Ließ er sie allein? Stieß er seine kranke Frau von sich, weil er nur an sein eigenes Wohl dachte? Genau das würden die Leute sagen. Tobias Reaktion hatte ihm noch einmal verdeutlicht, wie sein Verhalten auf andere wirken musste.
„Jeder Mensch hat die erste Verpflichtung sich selbst gegenüber. Er ist dafür verantwortlich, dass es ihm gut geht, und muss für sich sorgen!“ Das hatte Magdalena immer gesagt, und daran erinnerte Walter sich in letzter Zeit oft.
Er hätte alles dafür gegeben, seine Frau zurückzubekommen, aber er hielt es nicht mehr aus, neben dieser leeren Hülle zu leben. Er hatte nicht mehr die Kraft, die er brauchte, um gut für Magdalena zu sorgen, und es war verantwortlich sich selbst und ihr gegenüber, dass er sein Unvermögen und sein Scheitern akzeptierte. Etwas anderes blieb ihm nicht übrig, obwohl ihr Flehen ihm das Herz brach. Er konnte nicht mehr.
„Gut, dass sie eingeschlafen ist!“, freute er sich und breitete fürsorglich eine Decke über Magdalena aus. „Das bekomme ich den Tag über fast nie hin, Lea. Bei dir ist sie entspannter.“
„Ich mache es, Papa“, sagte Lea. „Wenn Mama und ich in der Wohnung bleiben können, dann haben wir ein Zimmer übrig, und ich hole eine Pflegerin ins Boot, die sich um Mama kümmert, solange ich in der Bibliothek bin. Es wird ein, zwei Monate dauern, bis ich umstellen kann, aber eigentlich steht dem nichts im Weg, dass ich nur noch fünfzig Prozent arbeite“, begann sie bereits, das weitere Vorgehen zu planen.
„Bist du dir ganz sicher, Kind?“, fragte ihr Vater.
„Ja. Du warst die ganze Zeit über für sie da. Jetzt bin ich an der Reihe. Finanziell wird es allerdings eng werden“, gestand Lea.
„Geld soll kein Problem sein. Ich übernehme selbstverständlich alle Kosten, die durch deine Mutter anfallen, und unterstütze euch“, versprach ihr Vater.
„Ich möchte auch gerne etwas beitragen“, warf Tobias ein, der froh war, etwas tun zu können.
„Das ist lieb von dir. Danke!“
Erst als Lea wieder zuhause in ihren eigenen vier Wänden war, erfasste sie den vollen Umfang dessen, was da vor ihr lag. Ihr Leben würde sich grundlegend ändern, und sie würde die volle Verantwortung für ihre Mutter tragen.
„Ich habe Angst“, gestand sie sich kleinlaut ein. „Das ist auch gut so! Du wärst eine Idiotin, wenn du keine Angst hättest. Aber was auch kommen mag, es ist richtig, dass du es versuchst“, baute sie sich auf. „Du tust das Richtige!“
***
Sechs Monate waren verstrichen, seitdem Lea zu ihrer Mutter gezogen war. Ihr Leben hatte sich vollkommen verändert und drehte sich im Prinzip ausschließlich um die Kranke. Es war nicht leicht, den gemeinsamen Alltag zu organisieren.
Lea kämpfte verbissen um ihre Berufstätigkeit. Sie wollte nicht absolut abhängig von den finanziellen Zuwendungen ihres Vaters und ihres Bruders sein, aber es zeichnete sich ab, dass ihr mittelfristig keine andere Wahl blieb, als in der Bibliothek zu kündigen.
In den ersten Wochen war ihr Vater jeden Tag gekommen, um nach ihrer Mutter zu sehen, solange Lea in der Bibliothek war. Sie hatte in aller Ruhe nach einer Pflegerin suchen können, die ihn aus der Pflicht nahm. Von da an kam er nur noch ein paar Mal in der Woche und zog sich mehr und mehr zurück.
Inzwischen sah er unregelmäßig vorbei und blieb selten lange. Magdalena erkannte ihn in der Regel nicht und benahm sich, als ob er nicht anwesend wäre. Für ihren Mann war das ein Zeichen, dass sie ihn in der Tat vergessen hatte und nicht mehr brauchte. Ganz langsam baute er sich wieder ein eigenes Leben auf.
Eigentlich hatte es eine Übergangslösung sein sollen, als er in Leas kleine Zweizimmerwohnung zog, aber er fühlte sich wohl dort. Nach drei Monaten ließ er den Mietvertrag auf sich umschreiben und erklärte die Wohnung zu seinem Zuhause.
Er nahm die früheren kulturellen Aktivitäten wieder auf, schuf sich einen netten, neuen Freundeskreis, in dem keiner Magdalena kannte oder auch nur von ihr wusste, und blühte auf. Aus dem matten, grauen, alternden Mann wurde ein aktiver und lebensoffener Herr, der auf die sechzig zuging und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war.
Lea tat ihm leid, aber er verdrängte sein Mitgefühl und das schlechte Gewissen, sie alleine mit der Verantwortung zu lassen. Es war ganz allein ihre Entscheidung gewesen, und sie war erwachsen. Walter Meisenhälter ging weiter. Er ließ das Elend und die Trauer der vergangenen Jahre hinter sich zurück.
Leas berufliches Zurückschrauben auf fünfzig Prozent funktionierte anstandslos, auch wenn ihre direkte Vorgesetzte es sehr bedauerte.
„Die Pflege Ihrer Mutter geht selbstverständlich vor, aber für uns bedeutet es einige Unannehmlichkeiten. Wir werden keinen Ersatz für die Ausfallzeit bewilligt bekommen. Jeder von uns wird etwas von der Arbeitslast auffangen müssen, die zusätzlich anfällt.“
Lea tat es leid, dass sie ihren Kollegen so große Umstände machte, und sie versuchte, in der Hälfte der Zeit auf die Reihe zu bekommen, wofür sie zuvor doppelt so lange gebraucht hatte. Es war anstrengend, und wenn sie nach Hause kam, konnte sie sich keine fünf Minuten entspannen. Ihre Mutter brauchte rund um die Uhr jemanden, der für sie da war.
Die erste Pflegerin warf nach einem Monat frustriert das Handtuch. Magdalena Meisenhälter akzeptierte sie nicht und weinte, wann immer sie sich ihr näherte. Sie wehrte sich und schlug um sich, wenn die Pflegerin ihr helfen wollte.
„Ihre Mutter nimmt nur Ihre Hilfe an. Ich komme nicht weiter, und es wird nicht besser. Jeder Vormittag ist die Hölle für Ihre Mutter und mich. Das tue ich ihr und mir nicht länger an. Tut mir leid!“
Leas Suche begann von Neuem. Die nächste Pflegerin blieb keine fünf Tage. Inzwischen kümmerte sich morgens eine Frau um Magdalena, die mit liebevoller Geduld durchhielt, aber auch ihr machte es die Kranke schwer.
„Bitte, Rosalie, bleiben Sie bei uns! Ich bin so froh, dass es Sie gibt!“, bedankte sich Lea bei ihr und wusste nicht, wie sie es ohne die freundliche, mütterliche Frau, die etwa im Alter ihrer Mutter war, hätte schaffen sollen.
„Schon gut, aber für Ihre Mutter sind die Vormittage ohne Sie wirklich hart. Das kann ich kaum auffangen, sosehr ich mich auch bemühe. Sie ist absolut auf Sie fixiert, und nur Sie können Sie zur Ruhe bringen, wenn sie sich über etwas aufregt.“
Lea wusste das und dachte immer wieder einmal darüber nach, ihren Beruf ganz aufzugeben, aber das war ein sehr großer Schritt für sie, der viel Mut erforderte. Sie war alleinstehend, und daran konnte sich schon deshalb nichts ändern, weil sie nur noch zwischen der Bibliothek und der Wohnung pendelte.
Wann und wo hätte sie einem männlichen Wesen überhaupt begegnen sollen? Und woher sollte die erforderliche Zeit kommen, um sich auch noch zu verlieben? Nein, den Traum von einem Gefährten hatte sie erst einmal gestrichen. Sie war zu eingespannt, um die Liebe und Zärtlichkeit eines Mannes zu vermissen.
Wenn ihre Mutter einmal nicht mehr war, würde sie in der Arbeitswelt wieder einen Platz finden müssen. Das machte ihr schon deutlich mehr Sorgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach einigen Jahren Pause wieder eine Stelle in einer Bibliothek bekam, war eher gering.
Sie mochte ihren Beruf, und das war nicht der einzige Grund für ihr Zögern. Die Vormittage – umgeben von gesunden Menschen und mit ihrer gewohnten Arbeit beschäftigt – gaben ihr die Kraft, die sie für den Rest des Tages brauchte.
Allerdings kam es mit der Zeit immer öfter zu Notfällen, die sie zwangen, die Arbeit liegen zu lassen und nach Hause zu ihrer Mutter zu eilen. Ihre Kollegen waren verständnisvoll, aber jeder von ihnen war an seiner Leistungsgrenze. Lea war zur Last geworden, und hinter ihrem Rücken köchelte es.
„Nicht schon wieder! Du bist doch erst vor vier Tagen ausgefallen!“, stöhnte Marina, mit der Lea sich ansonsten gut verstand, als sie einmal mehr nach ihrer Handtasche griff.
„Ich mache es wieder gut und hole es morgen nach, Marina! Meine Mutter ist gestürzt und kann nicht mehr aufstehen. Ich muss sehen, was los ist, und sie in die Notaufnahme bringen. Es tut mir so leid!“, entschuldigte sich Lea.
„Hau schon ab! Hoffentlich ist es nicht gar zu schlimm. Noch etwas, Lea. Wenn du die Stelle hier nicht mehr ausfüllen kannst, dann wäre es für uns alle besser, wenn du gehst. Ich meine es nicht böse, aber du weißt, wie es ist. Wenn du kündigst, dann wird jemand auf Vollzeit eingestellt und …“
„Ich weiß.“ Lea war schon an der Bürotür und eilte davon. Tränen schimmerten in ihren Augen. Marina hatte recht, so weh es ihr auch tat, sich das einzugestehen. Selbst mit Rosalies Hilfe war es ihr inzwischen nicht mehr möglich, den Anforderungen ihres Jobs vormittags gerecht zu werden. Es war an der Zeit, ihren Beruf aufzugeben.
Normalerweise dauerte es mit dem Auto fünfzehn Minuten von der Bibliothek bis zur Wohnung, Lea schaffte es in acht Minuten und war nur dankbar, dass sie in keine Geschwindigkeitskontrolle geraten war und dass kein Polizist sie bei den verbotenen Abkürzungen überrascht hatte.
Gehetzt und voller Sorge stieg sie in den Fahrstuhl und fuhr in den vierten Stock. Schon als sie ausstieg, konnte sie die Hilferufe ihrer Mutter hören.
„Lea! Ich will zu Lea! Lea! Weg! Gehen Sie weg von mir!“
„Gott sei Dank sind Sie da!“, stöhnte Rosalie und atmete erleichtert auf, als Lea hereingeeilt kam. Die Pflegerin war mit den Nerven am Ende.
„Was ist passiert?“, fragte Lea. Ihre Mutter lag auf dem Wohnzimmerboden, und ihr rechter Fuß und der Knöchel waren geschwollen. Sie beugte sich zu ihr und nahm sie beruhigend in den Arm.
„Ich bin da, Mama. Alles wird gut!“, tröstete sie sie liebevoll.
Magdalena schlang die Arme fest um sie. Die Rufe hörten auf, und das Weinen verstummte.
„Sie ist gestolpert und gefallen. Ich wollte ihr aufhelfen, aber das hat sie nicht zugelassen. Es könnte sein, dass der Knöchel gebrochen ist, das muss untersucht werden. Ich wollte das Gelenk zumindest kühlen, aber Sie sehen ja, wie es ihr heute geht. Der ganze Morgen war schlimm, und so leid es mir tut, aber …“
„Bitte nicht!“, flehte Lea, die ahnte, was jetzt kam.
Rosalie schüttelte bedauernd den Kopf.
„Es geht mir an die Substanz, und mein Mann droht, wenn ich nicht endlich kündige, dann lässt er sich scheiden. Ich mag Sie und Ihre Mutter, aber ich fürchte, ich kann keine wirkliche Hilfe sein. Wenn Sie wollen, bleibe ich, bis Sie einen Ersatz für mich gefunden haben …“
„Es ist schon gut. Ich verstehe Sie“, sagte Lea müde. „Ich werde keinen Ersatz für Sie suchen. Es hat keinen Sinn. Morgen kündige ich meine Stelle. Könnten Sie bleiben, bis ich nicht mehr zur Arbeit muss? Unter Umständen handelt es sich nur um ein paar Tage. Ich nehme nicht an, dass man in meinem Fall auf der Kündigungsfrist besteht. Meine Kollegen werden drei Kreuze hinter meinem Rücken machen. Ich falle zu oft aus und bin zur Last für alle geworden.“
„Sie sind noch so jung und haben solch ein Päckchen auf den Schultern! Natürlich bleibe ich, bis Sie sich selbst um Ihre Mama kümmern können!“, willigte Rosalie gutmütig ein. Die junge Frau tat ihr unendlich leid. „Soll ich Sie zum Arzt begleiten?“, bot sie an.
„Ich wähle den Notruf, dann kann sich das zuerst einmal ein Sanitäter oder ein Notarzt ansehen. Falls Mama ins Krankenhaus muss, habe ich Hilfe. Rosalie, ich rufe Sie später an und sage Ihnen, was sich ergeben hat und ob ich Sie morgen brauche oder nicht.“
Als die Pflegerin gegangen war, wählte Lea die Notrufnummer, und zehn Minuten später sah sich ein Notarzt das Gelenk ihrer Mutter an. Magdalena sträubte sich zuerst und wollte die Fremden aus der Wohnung werfen, doch dann hielt sie sich an Lea fest, vertraute ihr und ließ die Untersuchung über sich ergehen.
„Es könnte sich um eine starke Verstauchung handeln. Ohne ein Röntgenbild lässt sich das nicht sagen. Wir müssen Ihre Mutter mit in die Notaufnahme der Berling-Klinik nehmen, damit das Gelenk geröntgt werden kann. Eine Verletzung der Gelenkkapsel oder ein Sehnen- oder Bänderriss müssen definitiv ausgeschlossen werden“, erklärte der junge Arzt.
„Dann starten wir ins große Abenteuer!“, meinte Lea mit Galgenhumor.
Sie konnte die Reaktion ihrer Mutter auf diesen Bruch mit der gewohnten Routine nicht vorhersagen. Liebevoll begann sie, Magdalena zu erklären, warum sie mit den Männern mitgehen mussten.
„Bestimmt sind wir bald wieder zu Hause, Mama! Du hattest einen kleinen Unfall, aber …“
„Geht es deinem Vater gut? Es ist ihm doch nichts passiert? Tobias und er sind in Sicherheit, oder?“
„Papa ist gesund und munter!“, beteuerte Lea.
„Dann ist es gut! Bei einem Erdbeben muss man Wohnung und Haus verlassen. Draußen sind wir sicherer.“
„Im Krankenhaus sind wir absolut sicher“, beteuerte Lea, die sich fragte, wo das Erdbeben plötzlich herkam. Ihre Mutter hatte, soweit sie wusste, nie ein Erdbeben miterlebt.
„Bei so einer Naturkatastrophe muss man zusammenhalten“, meinte Magdalena und nickte ernst. „Lea, vergiss die Pässe nicht, und nimm die wichtigsten Unterlagen mit! Pack alles, was wir unbedingt brauchen, in einen Koffer. Man muss immer auf alles vorbereitet sein! Hast du deinen Bruder informiert?“, fragte Magdalena geschäftig und gab Anweisungen.
Sie erfasste die Situation auf ihre Weise. Ausgestattet mit zwei kleinen Koffern und den Dokumenten ließ sie sich friedlich in den Krankenwagen tragen.
***
Lea sah das Unheil kommen. Sie musste in der Aufnahme noch einige Angaben machen, während die Sanitäter ihre Mutter weiterschoben, um sie in eine der Notfallkabinen der Notaufnahme der Berling-Klinik zu bringen.
„Warten Sie lieber, bis ich hier fertig bin und mitkommen kann!“, riet Lea.
Da bereits der nächste Notruf eingegangen war, konnten die Sanitäter jedoch keine Rücksicht darauf nehmen. Sie mussten mit dem Rettungswagen wieder raus.
„Meine Mutter leidet an Alzheimer in einem fortgeschrittenen Stadium. Sie wird nervös und bekommt Angst, wenn ich nicht bei ihr bin“, erklärte Lea der Krankenschwester, die gerade die Krankenkassenkarte ihrer Mutter einlas. Die indirekte Bitte, sich etwas zu beeilen, kam nicht bei der Schwester an, weil in einer Notaufnahme fast jeder Patient unter Druck stand und es eilig hatte.
Als Lea schließlich im Stechschritt zu der Notfallkabine strebte, in die Magdalena gebracht worden war, sah sie, wie eine Krankenschwester und ein Arzt kurz vor ihr in die Kabine rannten, um einer Kollegin zu Hilfe zu eilen. Lea kam zu spät.
Magdalena hatte die Abwesenheit ihrer Bezugsperson bemerkt und war verstört und verängstigt, als sie sich allein mit einer Fremden in der Notfallkabine wiederfand. Sie wusste nicht, wo sie war, wie sie an diesen Ort gelangt war, und auch nicht, warum.
Den Unfall hatte sie längst vergessen, und das schwere Erdbeben, vor dem sie zusammen mit der kleinen Lea aus dem Haus geflüchtet war, um das Kind in Sicherheit zu bringen, war auch in Vergessenheit geraten. Sie hatte keine Ahnung, was mit ihr geschah.
Wie immer, wenn sie total verloren war, wechselten in ihrer inneren Welt die Bilder in einer chaotischen Folge und warfen sie noch mehr aus der Bahn. Gefühle und Gedanken bildeten einen Strudel der Machtlosigkeit und Angst, in dem sie versank. Alles und jeder geriet zur Bedrohung und wollte ihr Übles.
„Was wollen Sie von mir? Gehen Sie weg von mir!“, verlangte sie panisch von der jungen Krankenschwester, die bisher wenig Erfahrungen mit dementen Patienten gesammelt hatte und völlig überfordert war.
„Frau Meisenhälter, ich möchte Ihnen nur helfen. Sie sind gestürzt und …“
„Gehen Sie weg!“
Irgendwann erlebte Magdalena in solchen Stresssituationen etwas, das anderen verborgen blieb – eine Szene aus der Vergangenheit oder eine alte Angst, die sie noch einmal durchleiden musste, als ob das längst vergangene Unglück sich genau in diesem Moment ereignete. Das Chaos der absoluten Verlorenheit in Raum und Zeit war damit besiegt, aber Angst und Gefahr wurden konkret und greifbar.
„Ich muss nach Hause! Meine Kinder kommen gleich aus der Schule, und wenn ich nicht da bin, dann stehen sie vor der verschlossenen Tür. Sie können mich hier nicht festhalten!“, forderte die Mutter resolut. In ihrer Welt besuchten Lea und Tobias noch die Grundschule.
„Frau Meisenhälter, es ist alles in Ordnung! Sie sind im Krankenhaus, weil Sie zu Hause gestürzt sind, und gleich kommt ein Arzt, der sich Ihren Knöchel ansehen wird“, erklärte die Krankenschwester nervös, weil sie merkte, wie ihr die Patientin entglitt und sie jegliche Kontrolle über die Situation einbüßte.
„Ich muss zu meinen Kindern! Sie brauchen mich. Mein Mann ist nicht da. Er ist nicht mehr da. Wo ist mein Mann? Ich will auf der Stelle gehen! Lassen Sie mich gehen!“, forderte Magdalena zwischen Empörung und Verwirrung schwankend, weil etwas in ihr registrierte, dass nichts stimmte. Sie setzte sich auf.
„Bleiben Sie liegen! Der Arzt kommt gleich, und wenn mit Ihrem Knöchel alles gut ist, dann wird er Sie entlassen, aber solange müssen Sie bei uns bleiben!“
„Das ist Freiheitsberaubung! Und was ist, wenn meinen Kindern etwas passiert? Ich lasse nicht zu, dass sie in Gefahr geraten! Ich gehe jetzt!“ Magdalena wollte aufstehen.
Die Krankenschwester tat alles, um sie daran zu hindern, damit sie nicht noch einmal stürzte.
„Ich brauche hier Hilfe! Schnell!“, rief sie auf den Flur hinaus, denn sie war eher zierlich, und in der Angst um ihre Kinder entwickelte Magdalena Kräfte, über die sie eigentlich nicht verfügte.
Als Lea dazukam, hielten Arzt und Krankenschwester ihre Mutter an den Armen fest, und eine zweite Krankenschwester stand hilflos dabei.
„Sie müssen liegen bleiben, Frau Meisenhälter! Sie können nicht auf Ihrem rechten Bein stehen und fallen, wenn Sie es versuchen“, erklärte der Arzt.
„Meine Kinder brauchen mich!“ Magdalena kämpfte mit den Kräften einer Furie um ihre Freiheit. Für sie waren Lea und Tobias inzwischen in akuter Gefahr, und als Mutter hätte sie einfach alles dafür getan, ihre Kinder zu schützen.
„Mama, Tobi und mir geht es gut.“ Lea schob sich ganz dicht an ihre Mutter heran, die sich sofort etwas entspannte, als sie den vertrauten Körperkontakt spürte.
„Wirklich? Seid ihr in Sicherheit? Ist euch nichts passiert? Ihr kommt doch sonst immer pünktlich. Wo ward ihr denn nur so lange?“, fragte sie unsicher.
„Tobi wollte unbedingt bei den Aquarien vorbei, und dann konnte er sich nicht losreißen. Du weißt doch, wie sehr er Fische mag. Dass du dir immer solche Sorgen machst! Papa hat uns vor dem Laden aufgelesen und nach Hause gebracht“, ging Lea auf die Fantasie ihrer Mutter ein und vermengte sie mit Erinnerungen.
„Ihr müsst Hunger haben, Kind! Ich …“
„Nein, Mama! Papa hat uns seine speziellen Rühreier gemacht. Schmecken die schrecklich! Igitt! Aber das sagen wir ihm natürlich nicht, Mama. Es ist so lieb, dass er für uns kocht, auch wenn er es nicht kann.“
Magdalena lachte leise auf. Die Rühreier waren eine alte Familienanekdote, über die sie früher oft zusammen gelacht hatten.
„Seine Rühreier sind ein wahrer Albtraum!“, stimmte sie Lea zu. „Mir hat er sie immer gemacht, als wir noch studiert haben und ich Prüfungen hatte. Er meinte es lieb. Wo ist er denn? Walter?“ Suchend sah sie sich um. „Ständig kommt er zu spät zu seinen Vorlesungen! So wird nie etwas aus ihm werden. Außer der Musik hat er nichts im Kopf!“
„Das schafft er. Mach dir keine Sorgen, Mama! Du bist vorhin gestolpert und hingefallen. Das ist Dr. Gruber. Er arbeitet in der Notaufnahme der Klinik von Dr. Holl – der Berling-Klinik.“
„Die Holls sind nette Leute und so interessiert am kulturellen Leben der Stadt, wirklich nette Leute“, warf Magdalena ein, und jede Angst war verflogen.
„Das finde ich auch“, stimmte Lea ihr zu, die den Klinikleiter und seine Frau nur aus den Erzählungen ihrer Eltern kannte. „Dr. Gruber wird jetzt deinen Knöchel untersuchen. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Alles ist gut!“
Ohne weitere Störungen konnte Dr. Gruber den Knöchel abtasten.
„Das muss geröntgt werden. Normalerweise dürfen Angehörige da nicht mit rein, aber ich schreibe Ihnen eine Notiz für den Kollegen, damit er Ihnen eine Bleiweste gibt und Ihnen erlaubt, bei Ihrer Mutter zu bleiben.“
Das Röntgen klappte problemlos, und die Bilder bestätigten den Verdacht des Notarztes.
„Die Gelenkkapsel Ihrer Mutter ist gesprungen. Mit einer Operation richten wir da nichts aus. Die Therapie ist leider langwierig. Wir werden Ihrer Mutter einen speziellen Stiefel anpassen, den sie in den kommenden sechs Wochen anbehalten muss“, erklärte Dr. Gruber.
Lea schluckte. „Meine Mutter braucht viel Bewegung. Der Bewegungsdrang ist krankheitsbedingt und lässt sich schwer eindämmen.“
„Anfangs wird sie sich daran gewöhnen müssen, weil der Stiefel ein gewisses Gewicht hat, aber Knöchel und Fuß sind in ihm geschützt und stabilisiert. Sie kann heute schon damit herumgehen, so viel sie will. Einmal am Tag müssen Sie ihr allerdings Heparin spritzen, um einer Thrombose vorzubeugen. Können Sie das? Es ist ganz einfach. Die Nadel ist hauchdünn, und Ihre Mutter wird den Einstich kaum bemerken.“
„Das ist kein Problem“, erwiderte Lea, die damit schon Erfahrung hatte.
„Gut, dann hätten wir das geklärt. Kommen Sie für die Kontrolluntersuchungen am besten wieder zu uns. Ihre Mutter muss nicht in der Berling-Klinik bleiben. Soll ich Ihnen für den Rücktransport eine Bescheinigung ausstellen?“, fragte Dr. Gruber, nachdem er den Stiefel angepasst hatte.
Lea überlegte, dann lehnte sie ab. Ihre Mutter musste sich an das Gehen mit dem Stiefel gewöhnen, und ein paar Schritte in der warmen Augustsonne würden ihr guttun und sie beruhigen. Bis zum Taxistand waren es keine hundert Meter. Nach einem derart aufregenden Tag war es ansonsten unwahrscheinlich, dass Magdalena nachts in den Schlaf fand. Bewegung und frische Luft waren gut für sie.
„Komm, Mama, wir machen einen kleinen Spaziergang!“, sagte sie fröhlich, als sie sich von dem Arzt verabschiedet hatten.
„Ich möchte Ihnen noch sagen, wie tief Sie mich beeindruckt haben. Sie machen das sehr gut. Die Art, wie Sie mit Ihrer Mutter umgehen, ist großartig. Ich habe heute viel von Ihnen gelernt und werde in Zukunft anders auf Patienten eingehen, die ähnliche Probleme wie Ihre Mutter haben“, sagte Dr. Gruber, bevor Lea und Magdalena gingen.
„Danke!“ Lea freute sich über das Lob. „Keine Situation und keine Krise ist wie die andere. Es gibt nur ein Gesetz: Die Welt meiner Mutter hat Vorrang und ist als real zu betrachten! Man muss flexibel sein, gut hinhören und ständig dazulernen.“
***
Es war kurz nach fünfzehn Uhr, als sie aus dem Hauptportal der Klinik in die Sonne traten. Magdalena war unzufrieden und unleidig, weil der Stiefel, dessen Grund sie vergessen hatte, sie störte. Sie wollte ihn ausziehen, aber zum Glück war er auf eine Weise an ihrem Fuß angelegt, dass sie das alleine unmöglich schaffen konnte. Lea hatte extra darum gebeten, weil sie das Problem vorausgesehen hatte.
Vom nahen Park her duftete es nach Rosen und frisch gemähtem Gras. Lea atmete den köstlichen Duft tief ein und genoss den Augenblick.
„Das tut gut!“, sagte da die Stimme ihrer Mutter neben ihr. „Ich habe das Gefühl, seit Jahren nicht mehr das Gesicht in die Sonne gehalten zu haben!“
Lea wandte sich ihr zu. Magdalena hatte die Augen geschlossen und stand mit schräg gelegtem Kopf verzückt in der Sonne. Etwas war anders an ihr. Ihre Tochter spürte es sofort und sah sie nur voller Sehnsucht an. Das Bild erinnerte Lea an glückliche Zeiten vor der Krankheit. Ihre Mutter war immer eine Sonnenanbeterin gewesen.
Magdalena lächelte, als sie die Augen öffnete, aber dann wurde sie plötzlich ernst.
„Lea, warum waren wir in der Berling-Klinik? Ich glaube, ich habe so etwas wie einen Filmriss. Ich habe keine Ahnung, wie wir hergekommen sind und warum. Ist alles in Ordnung?“
Lea versuchte, ganz ruhig zu bleiben, aber ihr Herzschlag beschleunigte sich, und sie flehte zu Gott, dass es wahr sein möge. Theoretisch wusste sie, dass Alzheimer-Patienten wie ihre Mutter für ein paar Minuten oder Stunden völlig bei sich sein konnten und bei klarem Bewusstsein ihrer selbst. Niemand konnte dieses Erwachen medizinisch erklären, aber es ereignete sich immer einmal wieder.
„Du bist heute Morgen gestürzt, Mama, und deine Gelenkkapsel im rechten Knöchel ist gerissen. Den Stiefel da wirst du sechs Wochen mit dir herumtragen müssen“, erklärte Lea.
Magdalena sah den Stiefel und dann Lea an. Sie wurde bleich.
„Du bist älter geworden“, stellte sie mit gepresster Stimme fest, und ihr dämmerte, was geschehen sein musste. Ihr Kampf gegen das Vergessen fiel ihr wieder ein, und sie ahnte, dass sie ihn am Ende verloren haben musste.
„Wie lange war ich …“ Sie zögerte und wusste nicht, wie sie das nennen sollte, was unaussprechlich und unvorstellbar war. „Wie lange war ich auf Reisen?“, vollendete sie dann ihren Satz.
„Es ist ungefähr vier Jahre her, dass wir uns das letzte Mal so unterhalten konnten“, antwortete Lea.
Magdalena nickte erschüttert. „Vier gestohlene Jahre. Wie müsst ihr gelitten haben! Geht es deinem Vater gut?“
Lea wollte antworten und keine Sekunde der kostbaren Zeit verschenken, aber sie konnte nicht. Tränen stürzten aus ihren Augen.
„Komm her, Kleines!“ Ihre Mutter umarmte sie tröstend. „Es tut mir so leid! Ich wünschte, ihr müsstet mich nicht so sehen!“
„Ich hab dich lieb, Mama!“
„Und ich dich erst, Lea!“
Lange hielten sie sich im Arm, dann gingen sie langsam zu einer nahen Parkbank, die von blühenden Rosenbüschen umgeben war, und setzten sich in die Sonne. Die Zeit war viel zu kostbar, um sie in der Wohnung zu verbringen. Keine von ihnen wollte nach Hause.
Lea versuchte, ihren Vater zu erreichen. Er sollte dieses Geschenk unbedingt mit ihnen teilen, aber wie so oft in letzter Zeit schaltete sich nur seine Mailbox ein. Sie hinterließ ihm eine Nachricht und bat ihn dringend um Rückruf. Damit ließ er sich gewöhnlich viel Zeit, und so machte sie es dringlich.
„Papa, Mama ist plötzlich ganz klar. Wir sind in der Stadt. Ruf an und komm! Gleich! Es ist so schön!“, jubelte sie.
Magdalena hörte ihr zu und musterte sie nachdenklich.
„Ihr leidet – meinetwegen“, stellte sie traurig fest. „So darf es nicht sein, Kind!“
„Mach dir darüber keine Gedanken!“ Lea war glücklich, und nur dieses Glück zählte jetzt.
„Wie geht dein Vater damit um, dass er mich verloren hat? Leitet er noch die Kammermusiker?“
Lea fasste sehr grob zusammen, was in der verlorenen Zeit geschehen war.
„Papa war immer bei dir und hat sich gekümmert. Er liebt dich. Vor sechs Monaten konnte er nicht mehr, und ich habe übernommen“, endete sie.
Magdalena hörte aufmerksam zu und versuchte, das Gehörte irgendwie zu verarbeiten. Sie hatte zahllose Fragen, und natürlich musste sie wissen, wie es ihrem Sohn ging.
„Sollen wir ihn anrufen? Dann kannst du dich ein wenig mit ihm unterhalten“, schlug Lea vor und hatte ihr Handy schon in der Hand, um Tobias Nummer zu wählen.
Magdalena zögerte. Es waren einfach zu viele Informationen und Eindrücke, die auf sie einströmten. Sie wusste nicht, ob ihr die Zeit blieb, all das zu sortieren und die richtigen Schlussfolgerungen und Konsequenzen zu ziehen.
„Frau Meisenhälter?“ Dr. Stefan Holl kam auf sie zu und reichte Magdalena und Lea die Hand. Da er von der Erkrankung wusste, rechnete er nicht damit, dass Magdalena ihn erkennen würde. Umso überraschter und erfreuter war er, als sie ihn heiter begrüßte.
„Guten Tag, Dr. Holl! Wie geht es Ihrer Frau?“
„Sehr gut, aber Sie tragen da einen Stiefel, der mir weniger gefällt“, antwortete der Arzt und fragte nach den Umständen des Unfalls.
Lea wollte für ihre Mutter antworten, aber Magdalena ließ es nicht zu.
„Ich habe über vier Jahre auf einem anderen Planeten verbracht, und was immer heute Morgen passiert ist, ist genauso vollständig aus meinem Gedächtnis gelöscht wie die letzten vier Jahre“, sagte sie und sah dem Arzt fest in die Augen. „Ich muss wieder auf den anderen Planeten zurück, oder?“, fragte sie ihn.
Stefan Holl blieb einen Moment still. Er hätte ihr so gerne eine andere Auskunft gegeben, aber zu solchen klaren Phasen kam es extrem selten bei Alzheimer, und sie hielten nie lange an.
„Leider ja“, antwortete er schließlich.
„Das dachte ich mir. Wie viel Zeit bleibt mir?“
„Das ist unterschiedlich. Es können Stunden sein, manchmal sind es auch ein oder zwei Tage.“
„Danke! Es gibt einiges, was ich dringend regeln muss, bevor ich wieder … dorthin muss.“