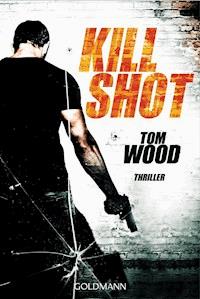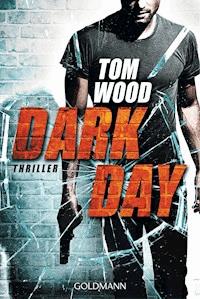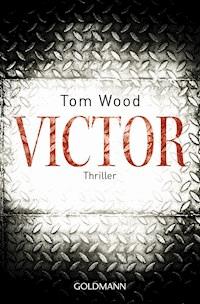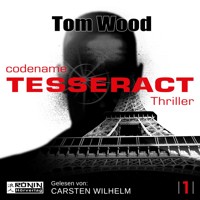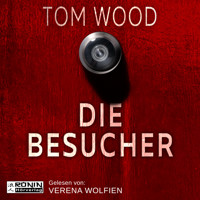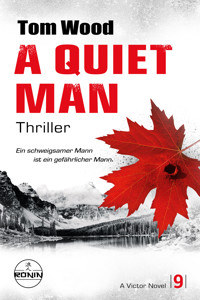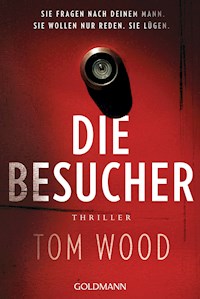
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie fragen nach deinem Mann. Sie wollen nur mit ihm reden. Sie lügen ... Brillante Spannung voller Action und spektakulärer Wendungen!
»Ihr Mann ist nicht der, der er zu sein vorgibt«. Das behaupten die zwei FBI-Ermittler, die vor der Tür von Jemima Talhoffer stehen. Sie bitten die junge Frau, sie zu begleiten, um ihr ein paar Fragen zu Leo zu stellen. Angeblich ist er in dunkle Geschäfte verwickelt. Da klingelt plötzlich das Telefon. »Vertrau den beiden Besuchern nicht«, sagt die Stimme. »Flieh, so schnell du kannst.« Wem soll Jem glauben? Und wie kann sie diesem Albtraum entkommen? Eine tödliche Jagd nimmt ihren Anfang ...
Ein packender Stand-alone-Thriller vom Autor der Serie um Profikiller Victor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Auf Jemima Talhoffer wartet der schlimmste Tag ihres Lebens. Es könnte ihr letzter sein …
Alles beginnt damit, dass zwei Fremde an Jems Tür klopfen, kurz nachdem ihr Mann zu einer Geschäftsreise aufgebrochen ist. Die beiden behaupten, vom FBI zu sein und Hinweise zu haben, dass Jems Mann Leo von einem Drogenkartell unter Druck gesetzt wird. Angeblich ist er seit geraumer Zeit in Geldwäsche-Aktivitäten verwickelt. Jem fällt aus allen Wolken. Während sie noch versucht, diese Informationen zu verarbeiten, erhält sie den Anruf eines FBI-Agenten, der sie ebenfalls zu Leo befragen will. Wie während des Telefonats deutlich wird, gehört das vermeintliche Ermittlergespann, das sich noch immer im Haus befindet, keineswegs zu seinen Kollegen. Jem vermutet, dass diese beiden Eindringlinge in Wahrheit dem Drogenkartell angehören und dass sie selbst und Leo in Todesgefahr sind. Sie versucht zu fliehen, doch so einfach ist es nicht, die zwei Besucher abzuschütteln …
Weitere Informationen zu Tom Wood sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Tom Wood
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »A Knock at the Door« bei Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group, London Der Titel erschien in zahlreichen Ländern unter dem Pseudonym T. W. Ellis Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2020 Copyright © der Originalausgabe 2020 by Tom Hinshelwood Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München Coverfoto: Composing (Schrabbel): FinePic®, München; ganze U1 (Tür): Getty Images/Ralf Pollack/EyeEm Redaktion: Gerhard Seidl AB · Herstellung: ik Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-26821-3V001 www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Ein Klopfen an der Tür kann alles verändern. Vielleicht nicht, wenn du darauf eingestellt bist. Aber wenn du nicht damit rechnest, was dann? Da ist dieser Moment der Verblüffung, vielleicht sogar des Erschreckens, der deine gesamte Aufmerksamkeit in Beschlag nimmt. Wer taucht denn heutzutage noch unangemeldet irgendwo auf? Es ist eine Aufforderung, die sich nicht ignorieren lässt. Eine Frage, die nach einer Antwort schreit. Wer immer das sein mag, bringt er gute oder schlechte Nachrichten? Gibt er dir etwas, oder will er etwas von dir?
Ist er Freund oder Feind?
FRÜHER
Im Sommer, auf dem Höhepunkt der Reisesaison, ist Rom eine sehr lebhafte Stadt, und zwar bis in die kleinsten Winkel. Diese Espressobar bildete da keine Ausnahme. Klein und eng, mit nackten Steinmauern und einer Gewölbedecke, lag sie versteckt in der Altstadt, und im Inneren war es nur unwesentlich kühler als draußen. Dafür sorgte schon die riesige Kaffeemaschine, die alle paar Sekunden ihren dampfenden, heißen Drachenatem ausstieß. Die Ventilatoren an der Decke brachten lediglich ein wenig Bewegung in den feuchten Dunst, mehr nicht. Aber das machte mir nichts aus. Der schimmernde Glanz auf meiner Haut gefiel mir. Ich war schon seit ein paar Wochen in Italien und hatte mich bis zu einem gewissen Grad akklimatisiert. Es gefiel mir, dass ich jeden Tag in Shorts und Sandalen losziehen konnte. Es gefiel mir, die übergroße Sonnenbrille und den Hut mit der Schlabberkrempe zu tragen. Ich kam mir vor wie verkleidet, ja, fast wie ein anderer Mensch. Nicht mehr länger eine ahnungslose New Yorkerin, sondern eine Pseudo-Europäerin. Ich war jetzt schon so lange unterwegs, dass die meisten Menschen, denen ich begegnete, nicht einmal errieten, wo ich aufgewachsen war. Aber jetzt musste ich wieder zurück, denn ich war pleite. Auf dem Weg dahin war ich kultiviert, braun gebrannt und weltgewandt geworden, aber vor allem langweilte ich mich inzwischen zu Tode.
Im Verlauf meiner Reise war ich den Kinderschuhen endgültig entwachsen, war ich eine ruhelose Erwachsene geworden.
Und leichtsinnig. Aber ich hatte einen Plan.
Ich hatte schon so viele schlechte Entscheidungen getroffen, dass ich nicht einmal mehr erkennen konnte, wenn schon die nächste im Entstehen war.
Er betrat die Bar.
Sein Gang wirkte so mühelos, seine Schritte federnd und leicht. Die italienische Sonne hatte seine Haut gebräunt und sein blondes Haar noch heller gemacht. Nach einem Blick auf seine Schuhe wusste ich, dass er kein Einheimischer war. Kein Italiener würde bei dieser Hitze solche festen Schnürschuhe tragen.
Ich beobachtete ihn von meinem kleinen, runden Tisch in der Ecke aus. Die Entfernung war kaum der Rede wert, weil die Espressobar so winzig war. Es gab überhaupt nur einige wenige Tische, weil die meisten Gäste nur einen Espresso bestellten, ihn im Stehen an der Bar hinunterkippten und für gewöhnlich nach einer Minute wieder draußen waren. Der Edelstahltresen wurde von den Baristas alle paar Minuten sauber gewischt, sodass er immer glänzte.
Zu Anfang hatten solche Bars mich eher eingeschüchtert, weil sie so anders waren als die entspannten Cafés, die ich aus meiner Heimat kannte. Aber jetzt konnte ich mir keinen besseren Ort denken, um zu sitzen und Menschen zu beobachten. Auf meinem Tisch lagen meine Handtasche, mein Reiseführer, das Buch, das ich versuchte zu lesen, mein Reisetagebuch, mein Hut und meine Sonnenbrille. Nur mit Mühe hatten das Wasserglas und die Espressotasse noch ein Plätzchen gefunden.
Mir gefällt die Vorstellung, dass dieses Chaos auch etwas Liebenswertes hatte.
Sein Italienisch war holperig oder lächerlich, je nachdem, ob ich großzügig oder eher grausam darüber urteilen wollte. Aber er versuchte es wenigstens und nahm nur deshalb wieder zu seinem Englisch Zuflucht, weil der Barista Mitleid mit ihm hatte und dem unwürdigen Schauspiel ein Ende bereitete.
Das war der Moment, als ich zum ersten Mal sein Lächeln sah.
Es wirkte so süß und unsicher, dass es mich unmittelbar anrührte. Es war, als hätte er keine Ahnung, wie attraktiv er war, wie schön er aussah, wenn er lächelte.
Natürlich wusste er das, anderenfalls wäre er ein Narr gewesen, doch die Macht seines Lächelns bestand gerade darin, diese Illusion der Unwissenheit hervorzurufen.
Vielleicht hatte er es geübt.
Ja, ich war zynisch.
Aber es war mir ohnehin gleichgültig. Ich fühlte mich bereits jetzt zu ihm hingezogen, und weil der einzige freie Tisch direkt neben mir stand, hatte ich meinen Stuhl möglichst dicht an den einen geschoben, den er unweigerlich nehmen würde, und zwar noch bevor er sich überhaupt nach einem Sitzplatz umgesehen hatte.
Als es so weit war, hatte ich mich natürlich bereits in mein Buch vertieft.
Es war eine dieser fast schmerzhaft tiefgründigen Schilderungen einer Reise zum Selbst, zu persönlichem Wachstum und Frausein.
Nach genau solch einer Reise sehnte ich mich auch, aber bis jetzt ohne Erfolg.
Er ließ sich Zeit für die kurze Strecke zwischen der Bar und dem Tisch. Vielleicht war ihm nicht ganz wohl dabei, dass er mir so nahe kommen musste. Vielleicht befürchtete er, dass ich das als Belästigung empfinden könnte.
Ich hatte schon Angst, dass er umkehren und seinen Kaffee wie ein Einheimischer an der Bar zu sich nehmen könnte. Darum hob ich den Blick und schenkte ihm ein scheues, freundliches Lächeln.
Er entspannte sich und stellte seine Tasse auf den Nachbartisch, nur um beim Hinsetzen mit dem Knie dagegenzustoßen. Der Kaffee schwappte aus seiner Tasse und bildete auf der Tischplatte eine kleine, dampfende Pfütze.
Er schnaufte. »Sehr elegant.«
»Machen Sie sich keine allzu großen Vorwürfe«, erwiderte ich. »Ihre Beine sind viel zu lang für diese winzigen Tische.«
»Aus der Entfernung haben sie größer ausgesehen.«
Er wollte aufstehen, um ein paar Servietten zu holen, doch ich gab ihm eine Packung Papiertaschentücher aus meiner Handtasche.
»Hier«, sagte ich.
Er bedankte sich und wischte die verschüttete Flüssigkeit auf, so gut es eben ging. Dabei schüttelte er ununterbrochen den Kopf, als hätte er einen unverzeihlichen Fehler begangen.
»Das war Rettung in höchster Not.«
»Sie wissen ja noch nicht, wie viel ich für die Taschentücher verlange.«
Er lächelte und reichte mir die Hand. »Ich heiße Leo.«
Ich schlug ein. »Jem.«
Er wusste bereits, dass ich aus den Vereinigten Staaten stammte, darum sagte er:»Was führt Sie nach Rom?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Eine interessante Geschichte?«
»Das kann ich selbst nicht beurteilen, aber vielleicht verraten Sie es mir, wenn ich fertig bin.«
Er sagte: »Sie wollen diese Geschichte also tatsächlich einem Wildfremden erzählen?«
»Sind wir denn wirklich Fremde?«
Er lächelte erneut. »Jetzt nicht mehr.«
8.01 Uhr
Meine erste Erinnerung an diesen Tag besteht darin, dass Leo durch die Küche schwebt und einen Hauch von Duschgel und Shampoo hinter sich herzieht. Saubere, kräftige Düfte. Das Parfüm kommt erst kurz vor der Abreise. Er sucht etwas und summt dabei vor sich hin, sodass meine Vorbereitungen von einer liebenswerten, wenn auch ziemlich schrägen musikalischen Untermalung begleitet werden.
Er findet, was er gesucht hat – Manschettenknöpfe, die er neben das Waschbecken gelegt hat, um mit nassen Haaren und ungekämmt eine hastige Tasse Kaffee zu schlürfen –, und geht auf dem Rückweg hinter mir vorbei.
»Das ist doch völliger Quatsch«, sagt er nach einem Blick über meine Schulter.
Ich weiß genau, was er vorhat, und ignoriere den Köder.
»Wenn du das sagst, dann muss es ja stimmen«, gebe ich zurück. Mein Tonfall ist genauso unschuldig wie ein dicker, kleiner Rauschgoldengel.
Er stößt ein unzufriedenes Murren aus, heiser und kehlig. Er hätte sich gerne noch ein bisschen mit mir gekabbelt, aber er ist zu spät dran, um noch länger zu verweilen und einen aussichtslosen Kampf zu kämpfen.
Genauso schnell, wie er gekommen ist, ist er auch wieder verschwunden, aber ich weiß, dass er sich jetzt, während er letzte Vorbereitungen trifft, überlegt, wie er sich revanchieren kann. Wir spielen ein endloses Spiel, einzig und allein mit dem Ziel, den anderen auszustechen, und das mit sehr viel Begeisterung und Ausdauer. Im Grunde genommen ist es ein Duell, wenn auch ein sehr sanftes – wir spielen ja und kämpfen nicht –, und eines ohne Verlierer, weil das Spiel an sich einfach viel zu viel Spaß macht.
Ich muss lächeln, bin zugleich erfreut über meinen kleinen Sieg und gespannt auf seinen unausweichlichen Konter nach seiner Rückkehr. Ich ermahne mich innerlich, nicht allzu überheblich zu werden, weil ich eines unserer guten Samuraimesser in der Hand halte und mir auf keinen Fall versehentlich einen Finger abtrennen will. Ich muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren, und die lautet: eine dicke Avocado zu halbieren, sie in meiner Hand zu drehen und den Stein zu umkreisen. Ich trenne die beiden Hälften und empfinde dabei eine unverhältnismäßig große Befriedigung, weil es wenig Befriedigenderes gibt, als eine Avocado zu teilen und festzustellen, dass sie nicht nur reif, sondern perfekt ist. Es gibt Menschen, die behaupten, so etwas nur durch Druck auf die Schale feststellen zu können, aber falls diese Gabe überhaupt existiert, besitze ich sie nicht. Ich kann lediglich einen ungefähren Reifegrad bestimmen, und selbst dann ist es immer noch denkbar, dass die Frucht eine Druckstelle hat oder irgendwo oxidiert ist. Daher ist der erste Schnitt immer eine Lotterie. Man muss bereit sein zu spielen, um zu wissen, ob man gewonnen oder verloren hat.
In diesem Fall habe ich den Jackpot geknackt.
Nicht ein einziger dunkler Fleck ist zu sehen. Nicht einmal ein Hauch von Oxidation. Das Fruchtfleisch ist weich, aber nirgendwo schwammig. Ich spieße den Stein mit der Messerspitze auf, drehe ihn und ziehe daran. Mühelos löst er sich aus dem Fleisch. Mein Magen zollt mir mit ermutigendem Knurren Beifall.
Ich beeile mich, so gut ich kann, versichere ich ihm.
Leo muss einen siebten Sinn haben, oder er hat heimlich vor der Küchentür genau auf diesen Moment gewartet, jedenfalls taucht er jetzt plötzlich wieder auf.
»Ganz ehrlich, das ist vollkommener Blödsinn«, wiederholt er seinen Satz, aber dieses Mal schwebt er nicht an mir vorbei, sondern bleibt stehen, während er seine Krawatte zu einem oft geübten Windsorknoten bindet. Seine Stimme klingt jetzt kräftiger, entschiedener, weil er, im Gegensatz zu vorhin, keine beiläufige Beobachtung mehr äußert, sondern eine konkrete Absicht verfolgt.
Ich gönne ihm einen schnellen Blick. »Suchst du etwas Bestimmtes, oder willst du bloß ein bisschen flirten?«
»Wenn ich mit dir flirten wollte, würde ich mir nicht die Krawatte binden«, entgegnet er mit einem schiefen Lächeln. »Dann würde ich sie mir vom Hals reißen.«
Ich lege das Messer weg und drehe mich um die eigene Achse, lehne mich mit dem Rücken an die Arbeitsplatte und halte mich mit beiden Händen daran fest.
»Und warum machst du es nicht?«, hauche ich und blicke ihm tief und bedeutungsschwanger in die Augen. »Ich gehöre ganz dir.«
Seine Wangen laufen rot an, während er ein paar unverständliche Worte nuschelt, bevor er einen frustrierten Schrei ausstößt.
»Was ist denn los mit dir?«, frage ich ihn.
Er zeigt mit dem ausgestreckten Finger auf mich. »Du«, stößt er hervor und lächelt dabei. »Du bist los.«
Ich klimpere mit den Augenlidern. »Was willst du denn damit sagen?«
Mit offenem Mund steht er da, still und stumm. Dann tippt er mit demselben Finger auf seine Armbanduhr und weicht zurück, erneut geschlagen.
Kühle Morgenluft weht mir entgegen, als ich auf die Terrasse trete und meine Tomatenpflanzen inspiziere. Es sind mehr als ein Dutzend, alle groß und kräftig, weil der Sommer sie mit Wärme umhüllt und ich sie gewissenhaft gegossen habe. Doch jetzt zeigen sich bereits die ersten Vorboten des Herbstes, und sie werden allmählich gelb, erleben die Tragödie der einjährigen Pflanzen. Bald werden sie abgestorben sein. Es sind alles Setzlinge, die ich aus Samenkörnern gezogen und zu Beginn des Frühjahrs eingepflanzt habe. Die Samen stammen aus der letztjährigen Ernte, und ich habe jeden einzelnen im Haus liebevoll so lange keimen lassen, bis die Triebe stark genug waren, um im Freien zu überleben. Keine Pestizide. Keinerlei Chemikalien. Auch wenn die Tomaten dadurch vielleicht nicht die größten geworden sind, sie sind doch zu einhundert Prozent biologisch und unfassbar köstlich. Wer noch nie eine selbst gezüchtete Tomate gegessen hat, weiß nicht, wie Tomaten wirklich schmecken.
Es dauert ein paar Minuten, bis ich zwischen den dichten Blättern die reifsten Früchte entdeckt und eine Handvoll davon gepflückt habe. Ich gehe zurück in die Küche und spüle sie schnell ab. Nur ein paar Sekunden unter dem laufenden Wasserhahn, mehr ist nicht nötig. Wie gesagt: bio.
In einer Edelstahlpfanne erhitze ich ein paar Tropfen kalt gepresstes Kokosnussöl – selbstverständlich auch bio – und gebe die Avocadostücke, die immer noch auf dem Schneidbrett liegen, dazu. Ein paar Minuten später folgen die halbierten Tomaten, gefolgt von etwas Himalajasalz, Chiliflocken und frisch geriebenem Pfeffer. Es duftet himmlisch.
Ich versuche, mich gesund zu ernähren, aber welchen Sinn hätte ein ewiges Leben ohne Brot? Ich schneide ein paar dicke Scheiben von dem krustigen Laib ab, den ich gestern auf dem Bauernmarkt gekauft habe – Sauerteig, Vollkorn und mit allen möglichen Körnern gespickt. Es ist weich und knusprig zugleich.
Leo kommt noch einmal in die Küche und unternimmt einen letzten Versuch, wenigstens ein Unentschieden zu erreichen. Allerdings weiß ich, dass er in wenigen Minuten das Haus verlassen muss, sodass ich ihn praktisch mühelos besiegen kann. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen deswegen … aber nur fast.
Er tut jetzt auch gar nicht mehr so, als würde er etwas suchen, sondern steuert ohne Umschweife das Ziel an, das er schon zweimal verfehlt hat.
Er zeigt auf mein Frühstück. »Genau das meine ich. Avocado und Tomaten. Beides ist ja eigentlich Obst, stimmt’s? Und du willst das auf dein getoastetes Brot legen. Das heißt, du isst Obst-Toast zum Frühstück. Das ist doch Unfug.«
»Es schmeckt köstlich, und das weißt du auch.«
»Ein Hamburger-Eis wäre vermutlich auch eine Geschmackssensation, aber trotzdem würde ich es niemals probieren.«
Ich seufze. Es ist ein übertrieben mitleidiges Seufzen, in dem ein großer Anteil Enttäuschung mitschwingt.
»Das ist alles? Mehr kriegst du nicht zustande?«
Er knurrt: »Na ja, du hast mich ja gleich beim ersten Mal abgewürgt. Und beim zweiten Mal auch.«
»Zu einfach will ich es dir auch nicht machen, sonst würde sich doch die Mühe gar nicht lohnen.«
Er beugt sich vor und küsst mich auf den Hals. »Ich tue alles, was nötig ist, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen.«
»Wenn du meine Aufmerksamkeit haben möchtest«, flüstere ich ihm ins Ohr, »dann weißt du genau, was du tun musst.«
»Jemima Talhoffer«, erwidert er in perfektem Schuldirektorentonfall. »Das kommt nicht infrage.«
»Seit wann bist du eigentlich so langweilig?«
»Nur, falls du es vergessen haben solltest, aber dein dich liebender Ehemann muss sehr bald schon ein Flugzeug besteigen.« Sein Lächeln könnte Gletscher zum Schmelzen bringen. »Und außerdem, weil du das offensichtlich schon vergessen hast: Ich war schon immer langweilig. Es hat dir bisher nur nichts ausgemacht.«
»Ja, genau«, erwidere ich. »Weil du nämlich das gemacht hast, wenn ich dich darum gebeten habe.«
»Damals hatte ich eben noch mehr Zeit. Hast du vielleicht meine Manschettenknöpfe gesehen?«
»Du trägst sie schon.«
Er richtet den Blick auf seine Handgelenke und schüttelt den Kopf. »Pfff.«
Ich scheuche ihn zur Küche hinaus. »Wage es ja nicht, deinen Flug zu verpassen.« Dann rufe ich ihm nach: »Ich erwarte, dass du mir auch weiterhin das Leben bietest, an das ich mich inzwischen gewöhnt habe.«
Er ruft irgendetwas zurück, aber ich habe bereits das Radio eingeschaltet, weil ich ein wenig musikalische Unterhaltung haben möchte, während ich meine Frühstücksvorbereitungen zu Ende bringe und mich an den Küchentisch setze, um meine Kreation zu verspeisen.
Der Tisch ist zu groß für uns beide, aber das gilt auch für das ganze Haus. Es hat mehr Zimmer, als Leo und ich je brauchen werden, und genau das ist der Sinn der Sache. Wir haben es mit der Vorstellung, ja, mit dem festen Vorhaben gekauft, die Leere zu füllen. Wir haben monatelang nach dem perfekten Ort, der perfekten Schule, dem perfekten Viertel, der perfekten Straße und dem perfekten Heim gesucht. Wir haben so viel Zeit damit verbracht, jeden einzelnen Aspekt zu bedenken, dass wir nicht eine Sekunde lang darüber nachgedacht haben, dass das alles schiefgehen könnte, bevor es überhaupt begonnen hat.
Mein Obstbrot schmeckt köstlich, aber aus irgendeinem Grund lässt es mich vollkommen kalt, und ich kann nicht weiteressen. Ich will diesen einen, kleinen Teller auf einem Tisch, der Platz für so viele Teller bietet, nicht leeren.
Leo sagt: »Ich bin fast fertig, und jetzt habe ich noch eine ganze Minute, um dich mit meiner Zuneigung zu überschütten.«
Zuerst nehme ich seine Worte gar nicht wahr, weil meine Gedanken beinahe automatisch an diesen dunklen Ort abgedriftet sind, der mir so vertraut ist. Es dauert einen Moment, bis sie zu mir durchdringen und mich aus dieser Leere ziehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dort verweilt habe. Es kommt mir vor wie wenige Sekunden, aber es könnte auch sehr viel länger gewesen sein.
Ich stehe auf und sehe ihn an, sodass er mich in seine Arme schließen kann. Er fühlt sich nach den morgendlichen Aktivitäten warm an, sicher und stark.
Er wirft einen Blick auf mein angefangenes Frühstück. »Hast du keinen Hunger?«
Ich schüttele den Kopf. »Weniger, als ich dachte.«
Er sieht mich an, und ich kenne diesen Blick nur zu genau. »Hast du gut geschlafen?«
Eine unschuldige Frage in unschuldigem Tonfall, und doch schwingen in diesem einen, kleinen Satz so viele Fragen mit, dass die Antworten den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen würden. Es geht nicht nur darum, ob ich gut geschlafen habe, sondern auch darum, ob ich genug geschlafen habe. Hatte ich Albträume? Bin ich müde? Geht es mir gut? Wird mein Schlaf Einfluss auf meinen Tag haben? Meine Stimmung? Bin ich deswegen womöglich niedergeschlagen? Bin ich so deprimiert, dass ich mich wieder ins Bett legen werde? Werde ich den ganzen Nachmittag über weinen? Werde ich ihn anrufen und ihn anflehen, nach Hause zu kommen, weil ich ohne ihn nicht zurechtkomme? Wird er dann so schnell wie möglich zurückkommen, nur um festzustellen, dass ich bester Laune bin, weil meine Stimmung einmal mehr gekippt ist? Bekomme ich aus heiterem Himmel einen Wutanfall, nur weil ich all diese negativen Gedanken irgendwie loswerden muss? Gibt es eine Rettung für mich? Werde ich ihn mit dieser grausamen, schrecklichen Krankheit irgendwann endgültig vertreiben?
All diese Fragen und noch mehr lassen sich zu einer einzigen zusammenfassen, und das ist die, die er mir in Wirklichkeit stellt: Kann er mich immer noch lieben?
Ich lächele. Das Lächeln beherrsche ich so gut, dass ich manchmal sogar vergesse, dass es gar nicht echt ist. »Wie ein Baby.«
Erleichtert erwidert er mein Lächeln. Er kann mich also noch ein bisschen länger lieben.
Ich verfüge über ein ganzes Arsenal an Metaphern, um die Wahrheit zu verschleiern: geschlafen wie ein Baby, wie ein Murmeltier, wie eine Tote, wie eine ägyptische Mumie, wie schwer betrunken, wie ein normaler Mensch …
Er streckt die Hand aus und schnappt sich meine halb gegessene Toastscheibe. »Dann hast du bestimmt nichts dagegen …« Er nimmt einen großen Bissen und kaut laut, weil er, ganz egal, was er vorhin noch behauptet hat, seinen Flug auf keinen Fall verpassen will. »Du hast recht«, sagt er. »Schmeckt wirklich köstlich.«
Ich nicke nur, ohne jede spitze Bemerkung. Ein Hab-ich-doch-gleich-gesagt würde mich nicht zufriedenstellen.
»Ich rufe dich an, sobald ich gelandet bin«, sagt Leo und will mir einen Abschiedskuss geben, etwas Leidenschaftliches, etwas, woran ich mich noch eine Weile erinnern werde.
Wir stoßen mit den Zähnen aneinander.
Wir lachen.
Ich sage: »Also, wenn das kein Zeichen ist, dass du dich auf den Weg machen sollst, dann weiß ich auch nicht.«
Er reibt sich mit dem Finger über die Schneidezähne. »Komm, wir probieren es noch mal.«
Wir küssen uns, dieses Mal mit mehr Erfolg. Seine Hände liegen auf meinen Hüften und meine auf seinen Schultern. Er war schon immer ein guter Küsser und gibt sich auch jetzt noch, nach all den Jahren, viel Mühe. Trotzdem fällt mir auf, dass ich die Augen schon aufschlage, bevor wir fertig sind.
Er merkt es nicht.
Er tritt einen Schritt zurück und fragt: »Wie sehe ich aus?«
Dann dreht er sich einmal um die eigene Achse wie eine Ballerina, allerdings eine sehr plumpe.
»Absolut, voll und ganz, unübersehbar … passabel.«
Er runzelt die Stirn, aber er weiß, dass das ein Scherz war. Er braucht mich nicht, um zu wissen, dass er im Anzug attraktiv aussieht – viel zu attraktiv –, und bei der Vorstellung, dass er unweigerlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, spüre ich, wie die Eifersucht in mir aufflackert. In unserer Anfangszeit habe ich mich regelmäßig darüber amüsiert, dass er die interessierten Blicke anderer Frauen überhaupt nicht bemerkt hat. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, in Bezug auf mich selbst und in Bezug auf uns. Aber jetzt kommt es mir vor, als sei das alles schon sehr lange her. Jetzt habe ich Angst, dass er die Blicke vielleicht doch bemerkt und anfängt, auch diese jungen, fruchtbaren Wesen mit Interesse zu mustern.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr. »Du musst los, Kumpel.«
»Oha, du hast recht.«
Er greift nach seinem Koffer, und ich begleite ihn bis zur Tür. Es ist kalt, und ich schlinge die Arme um den Oberkörper, während ich ihn in sein Auto steigen sehe.
»Tschüs«, ruft er mir zu, als er hinter dem Lenkrad sitzt.
Ich winke ihm zu, während er die Einfahrt entlangfährt, und er sieht mich durch den Seitenspiegel an. Ich kann seinen Blick nicht recht deuten.
Ist das Traurigkeit?
Bedauern?
Ich nehme die Hand erst herunter, als er nicht mehr zu sehen ist.
Fünf Minuten später klopft es an der Haustür.
Nichts wird wieder so sein wie zuvor.
8.18 Uhr
In diesen wenigen Minuten zwischen Leos Abfahrt und dem Klopfen an der Tür gehe ich in die Küche, um ein wenig aufzuräumen, doch dann sitze ich mit einem Mal wieder am Tisch, fühle mich schwer und erschöpft. Milchige Sonnenstrahlen strömen zum Fenster über der Spüle herein und umhüllen mein Gesicht. Das gebrochene Licht fühlt sich hell und warm an. In diesem Augenblick kann ich mich beinahe davon überzeugen, dass ich nichts sonst brauche. Nichts als diesen Mann, dieses Leben, dieses Haus.
Ich müsste eigentlich dankbar sein für alles, was ich habe, und nicht zornig über das, was ich nicht habe.
Die Schönheit des Hauses ist atemberaubend, beziehungsweise wird es sein, sobald alles fertig ist. Das stattliche, alte Ding ist ziemlich heruntergekommen, und ich bin seit dem Tag unseres Einzugs mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Zu Anfang war es ein Hobby, ein leidenschaftliches Projekt, aber irgendwann ist es dann zu einer Art Medizin geworden. Wobei – Medikamente verlieren mit der Zeit ihre Wirkung, nicht wahr? Wir brauchen immer mehr, entwickeln Resistenzen, und irgendwann verlieren sie jegliche Wirkung.
Jetzt ist das Haus zu einem Alibi für meine Abschottung geworden, zu einem Anlass, mich von der Welt zurückzuziehen. Ich habe eigentlich nie Zeit, mich mit einer Bekannten auf einen Kaffee zu verabreden, weil immer irgendwo eine Fußleiste ausgetauscht werden muss. Nie kann ich ein Wochenende für einen Kurzurlaub frei machen, weil ich im Baumarkt die Wandfarbe für das Arbeitszimmer abholen muss. Aber nichts wird fertig. Jedes Zimmer ist und bleibt unvollendet.
Wir wissen beide, was da wirklich vor sich geht, aber es war ein langer und sehr zäher Lernprozess. In seiner allumfassenden Vollkommenheit hat Leo niemals gedacht, dass er sich mit meinen Problemen würde befassen müssen. Er weiß gar nicht, wie er das anstellen sollte, und da ich inzwischen eine so hervorragende Schauspielerin geworden bin, gibt es auch in aller Regel gar keinen Anlass dafür. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, meine Angst zu verbergen, dass er keine Ahnung hat, wie sehr mich allein ein Gang zum Gemüseladen unter Stress setzt. Er hat keine Ahnung, dass ich manchmal, noch bevor ich zu Hause ankomme, am Straßenrand anhalte und laut schreie oder weine, um mich anschließend wieder so im Griff zu haben, dass ich mit einem strahlenden Lächeln vorfahren kann. Ich habe immer Augentropfen, Feuchttücher und Schminke im Handschuhfach. Und ich weiß nicht, ob ihm klar ist, dass ich das Haus wahrscheinlich nie mehr verlassen würde, müsste ich nicht regelmäßig meinen Kurs unterrichten.
So, wie ich es sehe, haben wir nur eine begrenzte Kapazität, um mit Stress fertigzuwerden. Und es spielt keine Rolle, ob diese Kapazität durch ein einziges, riesiges Trauma oder viele kleine in Beschlag genommen wird.
Sobald das Fass überläuft, gibt es Probleme.
Dann kommen wir nicht mehr klar.
Leo ist ein guter Mensch, und diese Jem ist nicht die Jem, für die er sich entschieden hat, nicht die Jem, die er geheiratet hat, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wollte. Wir leiden beide, und es ist ihm gegenüber nicht fair, dass ich mehr leide, dass ich so viel mehr brauche als er. Er ist immer noch Leo. Er ist immer noch genau derselbe Leo, in den ich mich verliebt habe, der ohne eine Sekunde zu zögern »Ja« gesagt hat. Er hat sich kein bisschen verändert. Meine größte Angst ist die, dass ihm eines Tages klar wird, dass er mich nicht mehr erkennt. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um die Maske des Ichs, das er will, am Leben zu erhalten, um ihm nicht mein wahres Ich zu offenbaren.
Unser Haus steht einsam und allein am Ende einer einspurigen Asphaltstraße. Die Vorbesitzer haben uns gesagt, dass hier ursprünglich noch mehr Häuser geplant gewesen seien, dass eigentlich ein kleiner Vorort hätte entstehen sollen. Doch dann hatte sich das Ganze anscheinend als komplizierter Steuerbetrug vonseiten des Bauträgers herausgestellt. Ich habe mich nie gründlich damit beschäftigt, daher kann ich auch nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob das wirklich stimmt. Es ist mir auch egal. Das Haus steht jedenfalls allein auf weiter Flur, und genau das habe ich damals gewollt. Ich wollte Ruhe und Frieden und genügend Platz zum Spielen für die Kinder. Die Jem von heute ist der Jem von damals sehr, sehr dankbar dafür, weil die Jem von heute mit Nachbarn nämlich absolut nicht zurechtkäme, weil sie unmöglich ständig lächeln, ständig belanglose Gespräche führen könnte.
Wie geht es dir heute?
Grässlich, und dir?
Ähh, ich, ähh…
Nein, danke. Das bin ich nicht.
Wenn man an der Kreuzung nach links abbiegt, dann kommt man auf eine Landstraße, die irgendwann auf den Interstate Highway führt. In den fünf Jahren, seit wir hier wohnen, bin ich die Strecke vielleicht ein halbes dutzend Mal gefahren. In der Zeit, in der ich eine Fläche von fünfzig Quadratkilometern abgegrast habe, ist Leo zweimal um den Globus gereist. Ich bin die ultimative Stubenhockerin geworden, nie um eine Ausrede verlegen. Dann sage ich Sachen wie: »Ich habe hier doch alles, was ich brauche«, und es ist schon etliche Jahre her, seitdem er das letzte Mal versucht hat, mich zu einer Auslandsreise zu bewegen. Er bittet mich schon lange nicht mehr, ihn auf einer seiner vielen Geschäftsreisen zu begleiten.
Leo weiß natürlich, was ich mit dem Haus mache … beziehungsweise nicht mache. Er sagt nichts dazu, und das wäre auch sinnlos. Was soll er denn sagen? Ich würde es schlicht und einfach abstreiten, würde alles so rational begründen, dass er am Schluss meinen Lügen Glauben schenken würde.
Er will, dass das Haus fertig wird, weil er sich so sehr wünscht, dass ich endlich etwas Neues ausprobiere. Aber nach meiner Erfahrung ist das Neue gar nicht unbedingt so großartig, wie alle immer behaupten. Vertrautheit bedeutet Sicherheit. Routine bedeutet geistige Gesundheit. Und ich brauche beides.
Das ist auch der einzige Grund, weshalb ich noch arbeite. Zum Glück bin ich selbstständig, sodass ich mich nicht gegenüber irgendeinem Chef verantworten muss. Es gibt niemanden, der mich feuern kann, nur weil ich meinen Verpflichtungen nicht nachgekommen bin.
Jetzt, wo ich an die Arbeit gedacht habe, fällt mir ein, dass ich noch duschen muss. Ich bin immer noch verschwitzt und zerzaust nach dem Frühkurs, aber ich stinke nicht – hoffe ich zumindest! Nach einer Stunde mit intensiven Dehnübungen habe ich immer einen Bärenhunger. Die Ahnungslosen glauben ja, dass Yoga ganz leicht ist, aber wenn man es richtig macht, ist es anstrengender als jedes andere Fitnesstraining. Man spürt es noch Tage danach, und nicht bloß in den Armen oder Beinen oder was man sonst gerade trainiert hat, sondern überall. Jeden einzelnen Muskel. Jede Sehne. Ich kenne kein Erbarmen mit meinen Teilnehmerinnen. Ich bin ein Monster. Ich genieße diese Rolle, und sie kommen in meinen Kurs, weil sie genau so jemanden brauchen. Auch wenn es nur eine Rolle ist. Dieses Monster, das bin nicht ich. Das bin ich mit einer furchterregenden Maske. Ich habe Mitleid mit denen, die meinen Kurs besuchen und dann in aller Hast ins Büro oder nach Hause müssen, um für ihre kreischende Brut das Frühstück zuzubereiten.
Als Leo weg ist, legt sich eine drückende Stille über unser Haus.
Dann durchbricht das Klopfen an der Tür diese Stille.
Es ist das kräftige Klopfen einer starken Hand.
Ich beeile mich, weil ich davon ausgehe, dass es Leo ist. Nicht eine Sekunde komme ich auf die Idee, es könnte jemand anderes sein. Hätte ich das geglaubt, ich wäre mit angehaltenem Atem am Küchentisch sitzen geblieben und hätte mich nicht von der Stelle gerührt. Ich kann keinem Fremden die Haustür öffnen. Ich weiß nicht einmal mehr, wann ich dies das letzte Mal versucht habe.
Während ich also den Flur entlangeile, stelle ich mir vor, wie Leo mit pochendem Herzen und leicht geröteten Wangen zurückgekommen ist, weil er seinen Reisepass oder die Auslandswährung oder irgendeinen Brief, ein Dokument, eine Bestellung vergessen hat. Er klopft deshalb so laut, weil er denkt, dass ich unter der Dusche stehe und ihn sonst nicht hören kann. Deshalb hat er auch gar nicht erst angerufen. Er hat den Motor laufen lassen, darum hat er den Hausschlüssel nicht dabei. Der baumelt nämlich an seinem Schlüsselbund neben der Lenksäule.
Kopfschüttelnd gelange ich bis ins Foyer und muss ein bisschen grinsen. Wie kann es sein, dass Leo einerseits so scharfsinnig, so schlau ist, aber gleichzeitig so vergesslich und unorganisiert. Er ist ein wandelnder Widerspruch, und deswegen liebe ich ihn noch ein bisschen mehr.
Jetzt klopft er noch einmal, lauter als zuvor. Er bearbeitet die Haustür mit der Faust.
»Ist ja gut, Mr. Sommelier«, rufe ich. »Ich komm ja schon, ich komme …«
Ich stoße ein paar orgasmische Seufzer aus, einen lauter als den anderen, je näher ich der Tür komme. Ich möchte albern sein, möchte ihn zum Lächeln bringen, trotz des Stresses, den er empfinden muss, weil er irgendetwas vergessen hat.
»Ich komme«, stöhne ich ein letztes Mal, während ich die Tür aufmache. Doch da steht nicht Leo. Da stehen zwei ernst dreinblickende Gestalten in dunklen Anzügen. Ein Mann. Eine Frau.
Die frischen Biotomaten, die ich vorhin gepflückt habe, waren weniger rot als mein Gesicht in diesem Augenblick.
Mein Mund ist wie ausgedörrt. Meine Kehle ist rau wie Sandpapier.
»Ich, also … ähh …«
»Komme?«, ergänzt der ernste Mann.
»Tut mir leid«, stammele ich mühsam und presse mit aller Kraft ein wenig Luft durch meine eng gewordene Luftröhre. »Das … also, das tut mir leid. Ich dachte, Sie wären jemand anderes.«
Die ernste Frau greift in die Innentasche ihrer Jacke und holt eine lederne Brieftasche heraus. Sie klappt sie mit einer beiläufigen Bewegung auf, einer Bewegung, die sie schon mindestens tausend Mal gemacht hat, daran kann es keinen Zweifel geben.
»Ich bin Agentin Wilks«, verkündet sie mit kräftiger, selbstsicherer Stimme. »Und das ist Special Agent Messer. Wir müssen mit Ihnen über Ihren Ehemann sprechen, Mrs. Talhoffer. Dürfen wir reinkommen?«
8.19 Uhr
Ich starre die glänzende FBI-Dienstmarke mit dem kleinen Foto von Agentin Wilks daneben an.
Sie sieht aus wie Ende vierzig und hat einen gebieterischen Gesichtsausdruck. Akkurat geschnittene, kurze blonde Haare. Grüne Augen. Messer ist ziemlich massig, zehn Jahre jünger als sie und besitzt ein quadratisches Gesicht sowie kurze schwarze Haare. Er ist auch ein wenig blasser als sie, ein bisschen gestutzter und gepflegter. Gerade jung genug, um Feuchtigkeitscreme zu benutzen, ohne das als Angriff auf seine Männlichkeit zu begreifen.
Ich bin eine gute, gesetzestreue Bürgerin, die nichts zu verbergen hat, und trotzdem ist mir dieser Besuch unangenehm. Ich fühle mich gedemütigt. Ich möchte diese beiden Menschen nicht in mein Haus lassen, aber es sind FBI-Agenten. Da kann ich doch nicht nein sagen, oder? Ich komme nicht einmal auf den Gedanken, sie zuerst um eine Erklärung zu bitten. Ich ordne mich sofort unter, lasse mich von ihren Dienstausweisen und ihrer Autorität augenblicklich einschüchtern.
Ohne ihnen in die Augen zu sehen, nicke ich und sage: »Okay.«
Ich halte ihnen die Tür auf, und sie treten ein, beide mit demselben roboterhaften Gang. Wahrscheinlich gibt es beim FBI für alles einen Kurs, auch für das Gehen.
»Bitte, gehen Sie durch«, sage ich.
Ich bin in erster Linie verwirrt.
Warum um alles in der Welt will das FBI mit mir über Leo sprechen?
Das Gute an der Peinlichkeit, die ich empfinde, ist, dass sie meine Angst überlagert. Schlagartig bin ich geheilt, wenn auch nur vorübergehend.
Ich folge ihnen durch den Flur bis ins Wohnzimmer. Dort drehen sie sich um und starren mich an. Meine Verlegenheit legt sich allmählich, weil ich mit jeder Sekunde ein bisschen neugieriger werde. Warum sind sie hier?
Sie stehen mit strengen Mienen und strengen Anzügen dicht nebeneinander. Messer ist groß und breit und wirkt allein dadurch schon einschüchternd, aber Wilks besitzt eine unglaubliche Selbstsicherheit, die mir genauso sehr den Wind aus den Segeln nimmt. Ich nehme an, sie ist die Ranghöhere, da sie auch die Ältere ist. Aber ich kenne mich beim FBI nicht so gut aus, dass ich sagen könnte, ob die beiden gleichberechtigte Partner sind oder in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Ausnahmsweise bedaure ich jetzt, dass ich nicht mehr Zeit vor dem Fernseher verbringe.
»Sie haben ihn gerade verpasst«, sage ich. »Er ist vor wenigen Minuten weggefahren.«
Wilks erwidert: »Können wir uns vielleicht setzen?«
Ich zucke mit den Schultern. »Sicher.«
Ich setze mich auf die Lehne des nächstbesten Sessels, während Wilks und Messer sich für das Sofa entscheiden, das neben ihnen steht. Es ist ein Dreisitzer, sodass sie bequem darauf Platz finden. Sie lehnen sich nicht an. Sie entspannen sich nicht. Hier geht es um etwas Ernstes.
»Mrs. Talhoffer …«
»Nennen Sie mich Jem, bitte. Ich weiß gar nicht, wieso ich Leos Nachnamen angenommen habe, obwohl ich ihn so hasse. Na ja, hassen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber …«
Wilks signalisiert mit einem höflichen Nicken, dass sie meine Vorbehalte zur Kenntnis genommen hat. »Jem, ich hoffe, Sie können uns bei unseren Ermittlungen behilflich sein. Es geht um einen Geldwäscher-Ring, dem wir schon seit einiger Zeit auf den Fersen sind.«
Noch nie haben meine Augenbrauen so perfekte Bogen gebildet. »Ein Geldwäscher-Ring? Ich weiß ja nicht einmal, wie Geldwäsche überhaupt funktioniert, ganz zu schweigen in einem ganzen Ring.« Da fällt mir etwas ein. Ich habe keine Ahnung, woher der Gedanke kommt, aber ich sage: »Fällt das nicht in die Zuständigkeit des Finanzamts? Müsste dann nicht eigentlich der Secret Service die Ermittlungen führen?«
Messer übernimmt. »Der Secret Service ist für Falschgeld zuständig. Geldwäsche fällt in den Zuständigkeitsbereich des FBI. Sonst wären wir nicht hier.«
Sein Tonfall wird gegen Ende ein wenig herablassend, was allem Anschein nach nicht abgesprochen war, jedenfalls wirft Wilks ihm einen tadelnden Blick zu.
»Aber was hat Leo mit Geldwäsche zu tun?«
Wilks erwidert: »Mrs. Talhoffer – Entschuldigung, Jem –, wir glauben, dass eine kriminelle Organisation den Weinhandel Ihres Mannes benutzt, um Drogengeld zu waschen. Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass das eine sehr ernst zu nehmende Angelegenheit ist. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Sie unsere Fragen so präzise und ausführlich wie nur möglich beantworten. Haben Sie das alles verstanden?«
Ich verstehe die Wörter, aber ich kann nicht glauben, was ich da gerade gehört habe. »Drogengeld …?«
Wilks nickt.
»Leos Geschäft?«
Wilks nickt.
»Eine kriminelle Organisation benützt Leo, um Drogengeld zu waschen? Also, ein Drogenkartell? Das kann ich nicht glauben. Das glaube ich nicht. Das würde er niemals machen, niemals, glauben Sie mir.«
Meine Stimme wird mit jedem Wort lauter.
Wilks beugt sich etwas dichter zu mir. »Wir glauben nicht, dass Ihr Mann aus freien Stücken in diese Sache verwickelt ist. Darum wollten wir zunächst mit Ihnen sprechen, bevor wir uns an Ihren Mann wenden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er zur Mitarbeit in dieser Organisation gezwungen wird.«
»Die erpressen ihn? Aber wie? Warum?« Ich schüttele den Kopf. »Wie sollen sie denn Leo dazu zwingen, für sie zu arbeiten?«
Wilks und Messer sehen mich an, als wäre das doch offensichtlich.
»Ich?«
»Leo tut, was er tun muss, um Sie zu beschützen«, erläutert Wilks.
Messer äußert sich ein bisschen weniger feinfühlig. »Wenn er sich nicht genau an das hält, was diese Leute von ihm verlangen, dann beauftragen die irgendwelche anderen Leute damit, Sie zu töten. Und wir reden hier nicht über einen sauberen, schmerzlosen Kopfschuss. Das sind skrupellose Männer. Grässliche Menschen. Der Abschaum des Abschaums.«
Die Stille legt sich so schwer und drückend über den ganzen Raum, dass ich das Gefühl habe, er könnte jeden Moment zusammenbrechen und mich unter sich begraben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, darum sage ich: »Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
Wilks gibt sich alle Mühe, eine mitfühlende Miene aufzusetzen. »Wir wissen natürlich, dass das sehr schwer zu verkraften ist.«
»Nehmen Sie’s mir nicht übel, aber das können Sie unmöglich wissen.« Ich senke den Blick und ringe die Hände im Schoß. »Mein Tag hat gerade erst angefangen, und da tauchen Sie hier auf und lassen diese Bombe platzen. Ich hab ja noch nicht mal geduscht.«
Wilks und Messer schweigen, während ich versuche, mit dem Schock fertigzuwerden. Da fällt mir etwas ein.
»Haben Sie extra gewartet, bis Leo weggefahren ist?«
Für einen kurzen Moment sehen sie aus wie zwei Schulkinder, die dabei erwischt worden sind, wie sie Steine geschmissen oder Süßigkeiten geklaut haben.
Ich frage: »Wie lange spionieren Sie uns schon nach?«
»Wir haben an der Kreuzung gestanden und gewartet«, erwidert Wilks. »Wir haben Leo vorbeifahren lassen, und eine Minute später haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben Sie nicht ausspioniert, Jem.« Sie lächelt. »Dafür haben wir gar nicht genügend Leute.«
Ich nehme an, das Lächeln ist Teil einer taktvoll-behutsamen Strategie, aber das, was sie mir gerade eröffnet haben, war weder taktvoll noch behutsam, darum lächele ich nicht.
»Ist Leo in Gefahr?«
»Nein, nein«, stößt Wilks hastig hervor. »Er hat einen unersetzlichen Wert für diese kriminelle Organisation …«
»Warum sagen Sie nicht einfach Kartell?«
»Aufgrund seines Geschäfts ist Leo ein essenzieller Bestandteil dieser Organisation. Ihm droht keinerlei Gefahr, und genau dabei wollen wir es auch belassen. Darum sind wir ja zuerst zu Ihnen gekommen.«
Messer fügt hinzu: »Wir wollen Leo nicht ansprechen, für den Fall, dass er beobachtet wird.«
»Soll das heißen, dass das Kartell ihn beschatten lässt?«
»Das soll heißen, dass wir das für möglich halten.«
»Aber dann würden sie doch bestimmt das Haus hier bewachen, oder nicht?«
Noch bevor ich meine Frage zu Ende gebracht habe, schüttelt Wilks den Kopf. »Das haben sie gar nicht nötig. Sie wissen, wo er wohnt, wo Sie wohnen, und das reicht ihnen. Aber wenn er nicht hier ist, wenn er für diese Leute arbeitet, dann steht er ständig unter Beobachtung.«
»Wie können Sie das alles wissen?«
»Das ist unser Job«, erwidert Wilks mit einer unerschütterlichen Selbstgewissheit, wie ich sie noch nie empfunden habe, nicht einmal ansatzweise. »Wir wissen, wie diese kriminellen Organisationen – diese Kartelle – funktionieren. Bitte, glauben Sie uns.«
Ich stelle fest, dass ich irgendwann im Verlauf des Gesprächs von der Sessellehne auf den Sitz gerutscht sein muss. Wobei, gerutscht klingt vielleicht zu elegant. Ich bin geplumpst, bin zusammengebrochen.
»Sie versprechen mir, dass Leo nichts zustoßen wird?«
»Ich schwöre«, versichert Wilks mir im Brustton der Überzeugung.
»Also gut.« Ich atme tief ein und nicke. »Also gut. Was wollen Sie wissen? Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich Ihnen überhaupt behilflich sein kann. Schließlich habe ich gerade erst von alledem erfahren.«
Messer übernimmt. »Wir glauben, dass Leo auf seiner letzten Europareise in Rom war, um sich dort mit dem für Europa zuständigen Kartellvertreter zu treffen. Wir glauben, dass Leo von diesem Mann bestimmte Informationen bekommen hat: Kontonummern, Passwörter, Unternehmen auf der ganzen Welt. Scheinfirmen, Jem, hinter denen sich das Kartell verbirgt. Wir glauben, dass Leo Zugang zu ihrer globalen Finanzinfrastruktur erhalten hat. Diese Informationen könnten für unsere Ermittlungen einen gewaltigen Fortschritt bedeuten. Ohne Übertreibung kann ich sagen, dass wir mit diesen Beweisen unter Umständen das gesamte Kartell auf einen Schlag erledigen können.«
»Aber warum sollten sie ihm so wichtige Informationen überhaupt anvertrauen?«
»Weil er sich bereits als vertrauenswürdig erwiesen hat«, erklärt mir Wilks. »Er ist schon lange als Geldwäscher tätig. Ein paar Tausend hier, Hunderttausend da. Er ist zuverlässig. Er ist berechenbar. Und er ist noch mehr als das: Überall dort, wo sie schmutzig sind, ist seine Weste vollkommen unbefleckt.«
»Außerdem«, fügt Messer hinzu, »sind Sie das perfekte Druckmittel. Leo kann diese Leute nicht hintergehen. Er kann sich nicht weigern.«
»Ich habe wirklich keine Ahnung von alledem«, sage ich. »Auch wenn ich wünschte, es wäre anders.«
»Das erwarten wir auch gar nicht. Aber vielleicht wissen Sie ja, wo Leo diese Informationen aufbewahrt. Er hat vielleicht eine externe Festplatte oder einen USB-Stick bekommen. Irgendetwas, was einen Kopierschutz besitzt und keine Verbindung zum Internet hat. Leo würde selbstverständlich sehr sorgfältig darauf achtgeben. Haben Sie vielleicht mitbekommen, dass er versucht hat, etwas zu verstecken?«
Ich zucke mit den Schultern und schüttele den Kopf. »Ich interessiere mich eigentlich nicht für Leos Geschäfte. Ich weiß wirklich nicht, ob er ein paar USB-Sticks aus Rom mitgebracht hat oder nicht. Wie auch?«
Wilks und Messer wechseln einen Blick, den ich nicht deuten kann. Wilks macht den Mund auf und will etwas sagen, aber in diesem Augenblick klingelt ein Telefon in der Küche. Für einen kurzen Moment glaube ich, dass es mein Handy ist, das immer noch neben meinem Teller auf dem Küchentisch liegt. Aber es ist das Festnetztelefon. Das Klingeln kommt mir fremd vor, weil kaum jemand diese Nummer anruft.
»Ich gehe lieber mal ran«, sage ich und bin dankbar für die Möglichkeit, den Raum verlassen und ein bisschen verschnaufen zu können.
Wilks ist sich unsicher, doch dann nickt sie und steht auf. »Falls das Leo sein sollte«, sagt sie, »dann erzählen Sie ihm bitte nichts von unserem Gespräch.«
Ich runzele die Stirn.
»Bis wir fertig sind«, fügt sie hinzu. »Bitte, um seinetwillen.«
Ich schenke ihr ein lahmes Nicken und gehe in die Küche. Es ist garantiert nicht Leo, der würde mich auf meinem Handy anrufen. Wer ruft heutzutage überhaupt noch auf dem Festnetzanschluss an? Niemand, oder?
Als hätte ich nicht schon genug zu verarbeiten, frage ich mich jetzt auch noch, wer um alles in der Welt so früh am Morgen hier anrufen könnte.
Die Antwort auf diese Frage wird alles verändern.
8.26 Uhr
Immer noch benommen von all dem, was Wilks und Messer mir gerade eröffnet haben, erreiche ich das Wandtelefon in der Küche. Genau wie das Öffnen der Tür gehört auch das Annehmen eines Telefonanrufs nicht unbedingt zu meinen Stärken. Für gewöhnlich kann ich die Nummer des Anrufers auf meinem Handydisplay sehen, und wenn ich sie nicht kenne, gehe ich nicht ran. Aber Wilks und Messer haben meine Gedanken auf eine wilde Achterbahnfahrt geschickt, sodass mein Gehirn gerade mit völlig anderen Dingen beschäftigt ist. Meine persönlichen Probleme haben sich in den Hintergrund zurückgezogen.
Eine Angststörung ist ein lähmendes Leiden ohne äußere Symptome. Ich sehe normal aus. Ich benehme mich sogar normal. Ich kann meine Ängste so gut verstecken, dass die wenigsten etwas davon mitbekommen. Selbstvertrauen lässt sich vortäuschen. Innere Ruhe lässt sich vortäuschen. Ein Lächeln ist eine Maske, die jedem Menschen zur Verfügung steht, und ich konnte schon immer sehr gut lächeln.
Leo möchte verstehen. Er hat es weiß Gott versucht, aber wenn selbst ich meine Gefühle nicht verstehen kann, ganz zu schweigen von den Ursachen, wie soll er das dann können?
Ich verstehe es nicht.
Früher war ich nicht so. Und wenn ich eines Tages mit dieser Erkrankung aufgewacht wäre, hätte ich sie bestimmt beheben können. Ich hätte gewusst, dass es da irgendwo ein Problem geben muss. Aber so entstehen Angststörungen nun mal nicht. Man sieht sie nicht kommen. Man weiß nicht, dass man darunter leidet, und zwar so lange, bis der Schaden bereits entstanden ist und man sich in einem Teufelskreis aus negativen Gedanken und Gefühlen befindet, die sich ununterbrochen gegenseitig bestärken, einem endlosen Strudel der Trübsal.
Wenn es gut läuft, dann halten einen die Mitmenschen für launisch, abweisend, nervtötend, unkommunikativ oder unhöflich. Sie wissen nicht, dass im Inneren etwas nicht stimmt, weil äußerlich ja alles in Ordnung ist.
Es fällt mir schon ohne all das wirre Zeug über Leo und irgendwelche Drogenkartelle schwer, den Vormittag zu überstehen, aber aus einem unerfindlichen Grund scheint genau das meine eigentlichen Probleme in den Hintergrund zu drängen. Jedenfalls fühle ich mich wie benommen, ja, fast wie ein anderer Mensch.
Und so ist auch der Anruf eines Unbekannten ausnahmsweise nichts, was mich aus der Bahn wirft.
Mein anderes Ich greift also zum Hörer und sagt: »Hallo?«
Nach einer kurzen Stille ertönt eine Männerstimme. »Mrs. Talhoffer?«
Eine tiefe Stimme. Ein ernster Tonfall.
»Ja«, sage ich, während ich mit den Gedanken weit weg bin.
»Mrs. Jemima Talhoffer?«
»Hier gibt es nur eine Mrs. Talhoffer, das kann ich Ihnen versichern. Wer ist da?«
Die tiefe Stimme erwidert: »Mrs. Talhoffer, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie so aus heiterem Himmel anrufe. Ich bin Agent Carlson. Ich arbeite für das Federal Bureau of Investigation und möchte Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und mir einige Fragen über Ihren Ehemann Leo zu beantworten. Es ist sehr wichtig.«
Ich bin nicht in der Stimmung, meine Zeit zu vergeuden, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. »Stimmen Sie sich denn gar nicht mit Ihren Kollegen ab?«
Carlson sagt: »Wie bitte, was? Das verstehe ich nicht.«
»Ich bin heute schon von mehr als genug FBI-Agenten zu meinem Mann befragt worden, und dabei ist es noch nicht einmal 9 Uhr.«
»Wie bitte, was?«, wiederholt Carlson.
»Ich bitte Sie, tun Sie meiner geistigen Gesundheit und dem US-amerikanischen Steuerzahler einen Gefallen und koordinieren Sie Ihre Ermittlungen. Ich setze voraus, dass Sie meine Gereiztheit nachvollziehen können. Dieser Vormittag ist eine Katastrophe, und ich bin auch nur ein Mensch.«
»Mrs. Talhoffer, ich fürchte, ich …«
»Und warum sind Sie eigentlich alle immer so förmlich? Nennen Sie mich Jem, um alles in der Welt. Schreiben Sie’s auf einen Zettel. Legen Sie ihn in die Akte. Sagen Sie allen anderen Agenten Bescheid. Und wenn Sie schon dabei sind, dann sagen Sie ihnen auch gleich, dass ich nicht einmal Jemima genannt werden möchte. Kurz gesagt: Ich. Heiße. Jem.«
»Jem«, erwidert Carlson. »Ich weiß nicht, was Sie mir sagen wollen.«
»Holen Sie sich noch einen Kaffee, Carlson, weil Sie den nämlich brauchen werden. Ich will Ihnen sagen, dass zwei Ihrer Kollegen gerade in meinem Wohnzimmer sitzen und mir Fragen über Leo stellen, über sein Geschäft, über kriminelle Organisationen und Informationen auf irgendwelchen USB-Sticks. Also alles das, was Sie mich gleich fragen wollen. Aber ich bin nicht bereit, meine kostbare Zeit zu verschwenden, indem ich das alles jetzt noch einmal wiederhole. Warten Sie den Bericht ab oder rufen Sie nachher Ihre Kollegen an oder machen Sie das, was Sie normalerweise in so einer Situation tun würden.«
Schweigen. Und dann: »Sie haben zwei FBI-Agenten bei sich zu Hause? Jetzt in diesem Moment?«
»Genau das habe ich gerade gesagt. Einen Mann und eine Frau. Wilks und Messer.«
Erneutes Schweigen folgt, und meine Worte klingen mir noch in den Ohren. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn so schroff angefahren habe. Das bin nicht ich.
»Es tut mir leid«, sage ich zu Carlson. »Ich bin im Moment etwas überreizt, und was ich gerade über Leo erfahren habe, ist nur schwer zu verkraften. Trotzdem hätte ich nicht so kurz angebunden sein dürfen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid.«
Gibt es eigentlich einen Satz, den Frauen öfter sagen als: »Es tut mir leid«?
Carlsons Tonfall wird sehr feierlich. »Hören Sie mir jetzt sehr genau zu, Jem. Außer mir gibt es keinen einzigen FBI-Agenten, der sich für die Geschäfte Ihres Mannes interessiert.«
Ich wiederhole Carlsons Worte von vorhin: »Wie bitte, was?«
»Das ist mein Fall, Jem. In diesem Stadium der Vorermittlungen ist niemand anderes beteiligt. Ich stehe ganz am Anfang. Und zwar alleine.«
Es gibt so viele Fragen, die ich ihm stellen möchte, aber ich bekomme nicht mehr heraus als: »Aber Wilks und Messer …«
»Wer immer dieser Mann und diese Frau zu sein behaupten, sie arbeiten nicht für das Bureau.«
Mein Herz rast so schnell, dass mein ganzer Körper anfängt zu zittern.
Carlson fährt fort: »Die Einzigen, die wissen können, was Sie mir gerade erzählt haben, sind ich selbst, Ihr Mann und seine Geschäftspartner.«
Mir wird kalt. Eiskalt.
»Sie haben mir ihre Dienstausweise gezeigt.«
»Jem«, fängt Carlson an. »Die Ausweise sind eine Fälschung. Wie gesagt: Es gibt beim FBI außer mir niemanden, der darüber Bescheid weiß. Jem, wer immer diese Leute zu sein vorgeben, sie haben Sie angelogen.«
8.29 Uhr
Wilks und Messer sind keine FBI-Agenten.
Aber was sind sie dann?
Schon bevor ich meine Frage zu Ende gedacht habe, habe ich sie bereits beantwortet. Carlson hat es ja gesagt: Es gibt nicht viele Menschen, die über Leos Aktivitäten Bescheid wissen.
Wilks und Messer sind Leos Geschäftspartner.
Das Kartell.
Wenn er sich nicht genau an das hält, was diese Leute von ihm verlangen, dann beauftragen die irgendwelche anderen Leute damit, mich zu töten.
»Ich will Ihnen wirklich keine Angst machen«, sagt Carlson, »aber Sie müssen sofort aus dem Haus verschwinden.«
Zu spät, möchte ich sagen.
Ich habe bereits Todesangst, höre aber nur mit halbem Ohr hin, weil mir klar wird, dass Wilks zu mir in die Küche gekommen ist.
Ich war so auf Carlsons Worte fixiert, dass ich sie überhaupt nicht gehört habe.
»Sie schweben in größter Gefahr, Jem«, höre ich Carlson sagen, während ich den Blick starr auf die näher kommende Wilks gerichtet habe. »Legen Sie auf und verlassen Sie das Haus. Rufen Sie das Bureau an, sobald Sie in Sicherheit sind, dann hole ich Sie ab. Ganz egal, wo Sie stecken, ich komme zu Ihnen. Ich bringe Sie in Sicherheit, das schwöre ich. Aber jetzt, Jem, jetzt müssen Sie flüchten. Sie müssen verschwinden, und zwar auf der Stelle, Sie müssen …«
»Ist schon gut, Mom«, sage ich und versuche, die Angst aus meinem Gesicht zu verbannen. »Ich rufe dich später zurück. Muss los.«
Irgendwie schaffe ich es, den Hörer auf die Gabel zu legen, ohne dass er mir aus den zitternden Fingern rutscht.
»Ist alles in Ordnung?«, erkundigt sich Wilks mit ihrer strengen, emotionslosen Stimme.
Ich habe keine Ahnung, wie lange sie schon in der Küche ist. Ich habe keine Ahnung, was sie alles gehört hat.
Sie steht dicht vor mir, und hinter mir befindet sich die Wand. Ich kann nirgendwo hin.
Ich sitze in der Falle.
Ich muss an das Pistolenhalfter unter ihrer Jacke denken. Die Waffe ist immer noch dort. Ihre Hände, die schlaff an ihren Seiten baumeln, sind leer.
Wie lange noch?
Doch trotz der unterschwelligen Drohung, die in ihrer Anwesenheit mitschwingt, ist sie kein bisschen aggressiv. Sie hat also nichts Konkretes gehört. Sie hat nur das gehört, was ich gesagt habe. Sie weiß nicht, wer am Telefon war. Sie kann nicht wissen, was Carlson zu mir gesagt hat.
Messers Worte gehen mir durch den Kopf: Genügend Beweise, um das gesamte Kartell auf einen Schlag erledigen zu können.
Deshalb sind sie hier. Deshalb stellen sie mir all diese Fragen, das wird mir jetzt schlagartig klar. Sie wollen die Informationen sichern, die Leo über sie gesammelt hat. Sie brauchen diese Informationen. Ich verstehe zwar nicht, warum, aber irgendetwas muss sich geändert haben.
Carlson, natürlich. Sie haben gemerkt, dass ihnen jemand auf den Fersen ist. Und Leo. Sie wollen sich die Informationen wiederbeschaffen, bevor sie gegen sie verwendet werden können. Ich verstehe zwar nicht, wieso sie dann zu mir kommen und nicht gleich zu Leo, aber das spielt im Moment keine Rolle, nicht wahr? Ich muss von hier verschwinden, genau wie Carlson gesagt hat. Die Antworten können warten.
Ich zwinge mich, ganz normal auszusehen. Zum Glück ist das eines der Dinge, die ich wirklich gut kann. Das weiß ich. Wie gesagt, ein Lächeln ist eine Maske, die jedem Menschen zur Verfügung steht. Anderen Menschen ist vielleicht nicht klar, wie ermüdend es ist zu lächeln, wenn man es nicht spürt, wenn man eigentlich das genaue Gegenteil empfindet. Ja, es ist sehr anstrengend, aber ich habe so viel Übung darin, dass ich es auf der Stelle anknipsen kann und weiß, dass es funktioniert.
Ich lächele und rolle kopfschüttelnd mit den Augen, verlegen, als würde ich mich in einer Zwickmühle befinden.
»Meine Mutter …«, sage ich.
Bei diesen Worten scheint Wilks sich ein wenig zu entspannen. Sie wirkt beruhigt, überzeugt. Sie hat keinen Grund, an meinen Worten zu zweifeln. Soweit es sie betrifft, bin ich immer noch brauchbar. Immer noch unwissend. Immer noch keine Gefahr.
»Wir haben eine komplizierte Beziehung«, fahre ich fort. Irgendwie purzeln die Wörter aus meinem Mund, und ich bin erstaunt, wie stimmig es klingt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich zu so etwas in der Lage bin. »Sie … also, wollen Sie wirklich, dass ich Ihnen unsere Mutter-Tochter-Beziehung schildere?«
Wilks erwidert: »Ich fürchte, wir haben drängendere Probleme zu lösen.«
Ich drehe die geöffneten Handflächen nach oben. »Ich verstehe. Ehrlich gesagt würde ich auch lieber über Leo und Geldwäsche sprechen als über meine geliebte Mama.«
Wilks verzieht die Lippen, was vermutlich so etwas wie ein Lächeln darstellen soll. Sie hat nichts Liebenswürdiges an sich, und als mir das klar wird, erkenne ich, dass das Kartell zwei ganz bestimmte Persönlichkeiten geschickt hat, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Zwei Persönlichkeiten, die es nicht gewohnt sind, freundlich zu sein. Zwei Persönlichkeiten, die nicht einmal in der Lage sind, Freundlichkeit zu heucheln.
Der Abschaum des Abschaums, wie Messer selbst gesagt hat.
Ich schlucke. Meine Kehle ist schon wieder staubtrocken. Ich zeige auf die Türöffnung, in das Wohnzimmer, zu Messer. »Sollen wir weitermachen?«
Wilks nickt. »Wir werden Sie nach Möglichkeit nicht mehr allzu lange belästigen.«
»Kein Druck«, sage ich. »Ich bin froh, wenn ich Ihnen helfen kann.«
Es ist verblüffend, wie leicht einem die Lügen über die Lippen kommen, wenn man Angst um sein Leben hat.
Sie geht mit müden Schritten voraus. Im Flur angekommen sehe ich, dass Messer im Wohnzimmer steht und in unsere Richtung blickt. Er sieht besorgt aus, hat eine fragende Miene aufgesetzt. Ich kann Wilks’ Gesicht nicht sehen, aber Messer entspannt sich und setzt sich wieder hin.
Als Wilks fast schon durch die Tür ist, sage ich: »Ich muss noch mal schnell auf die Toilette«, und gehe die Treppe hinauf.
Wilks bleibt stehen. Dreht sich um. »Gibt es denn hier unten keine?«
»Der Wasserkasten ist kaputt«, sagte ich beiläufig und ohne mich umzublicken, weil ich befürchte, dass meine Lüge den direkten Augenkontakt nicht überstehen würde. Doch genau dieses Ausweichmanöver scheint eine willkommene Nebenwirkung zu entfalten und meiner Aussage noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Warum sollte ich versuchen, jemanden von der Wahrheit zu überzeugen?
Am oberen Treppenende angelangt riskiere ich einen kurzen Blick nach unten und sehe Wilks von hinten, als sie ins Wohnzimmer geht. Sie hat es mir abgekauft.
Mein Herz hämmert wie wild. Eine Treppe ist für mich wirklich keine körperliche Herausforderung, aber das Adrenalin, das durch meine Adern tobt, bewirkt, dass ich ziemlich außer Atem oben ankomme. Ich muss mich so sehr zusammenreißen, um die Angst, die sich in meinem Inneren aufstaut, nicht nach draußen zu lassen, dass mein Körper sich anfühlt wie kurz vor der Explosion.
Trotzdem habe ich jetzt ein bisschen Zeit, ein wenig Spielraum gewonnen.
Aber was soll ich damit anfangen?
8.32 Uhr
Es war ein Fehler, dass ich nach oben gegangen bin. Ich habe zwar etwas Abstand zu Wilks und Messer gewonnen, aber dafür muss ich mich jetzt gegen das verzweifelte Gefühl wehren, in eine Falle getappt zu sein und dadurch alles noch schwieriger und noch gefährlicher gemacht zu haben. Ich hatte keine Wahl. Wie hätte ich denn Wilks und Messer erklären sollen, dass ich das Haus verlassen will, so wie Carlson es mir nahegelegt hat? Sie hätten jedes Wort sofort als billige Ausrede durchschaut. Nur ein bisschen frische Luft schnappen zu wollen und mir gleichzeitig die Autoschlüssel aus der Schale neben der Tür zu schnappen, das hätte niemals funktioniert.
Ich habe keinen Plan, aber ich muss mir einen zurechtlegen.
Und zwar schnell.
Ein paar Minuten habe ich wohl. Falls Wilks nicht sowieso schon misstrauisch geworden ist – aber wenn das so wäre, hätte sie mich gar nicht erst nach oben gehen lassen –, dann hat sie keinen Grund zu der Annahme, dass ich hier oben etwas anderes vorhabe, als zu pinkeln. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass ich tatsächlich pinkeln muss. Aber das muss warten. Ich kann es mir nicht erlauben, wertvolle Zeit zu vergeuden.
Ich trage immer noch meine Yogasachen. Soll ich schnell in etwas Praktischeres schlüpfen? Aber was? Ich weiß es nicht. Meine Gedanken überschlagen sich. Keine Zeit, mich umzuziehen. Wozu auch? Das Einzige, was jetzt zählt, ist, von hier zu verschwinden.
Aber wie?
Das Haus hat zwei Stockwerke. Ich bin zwar einigermaßen fit und kräftig, aber alles andere als eine Bergziege. Wenn ich jetzt versuche, die Regenrinne hinabzuklettern, dann stürze ich garantiert ab und breche mir das Genick, im besten Fall verstauche ich mir den Knöchel. Was womöglich auf dasselbe hinausläuft, sobald Wilks und Messer mitbekommen, was ich vorhabe. Mit nur einem gesunden Fuß kann ich ihnen unmöglich entkommen, und einer Kugel schon gar nicht.
Die Garage! Die hat nur ein Geschoss. Ich könnte auf das Garagendach klettern und von dort auf die Erde. Das ist nicht einfach, aber möglich. Machbar.
Aber zuerst öffne ich behutsam und so leise wie nur möglich die Badezimmertür, dann haste ich zum Waschbecken und drehe einen Wasserhahn auf. Als ich wieder nach draußen gehe, knalle ich die Tür bewusst ins Schloss. Ich glaube zwar nicht, dass der laufende Wasserhahn Wilks oder Messer lange hinhalten wird, wenn sie sich entschließen nachzusehen, aber vielleicht kostet es sie ein paar wenige Sekunden, und ich habe das schreckliche Gefühl, dass jede Sekunde zählt.