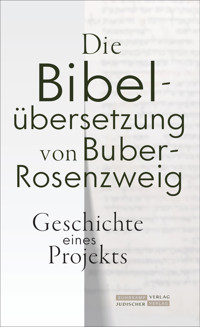
Die Bibelübersetzung von Buber-Rosenzweig E-Book
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jüdischer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1926 versetzte eine Bibelübersetzung die deutsch-jüdischen und besonders die Frankfurter Intellektuellen in Aufruhr: Martin Buber arbeitete seit Mai 1925 gemeinsam mit Franz Rosenzweig daran, den Tanach zu übertragen. Ihr Unterfangen bezeichneten sie als Verdeutschung der Schrift. Ende Dezember erschien als erster Band Das Buch Im Anfang. Öffentliches Echo und persönliche Rückmeldungen ließen nicht lange auf sich warten: Erste Rezensionen kritisierten die Sprache der Übersetzung, vor allem aber schlug die äußerst polemische Besprechung von Siegfried Kracauer hohe Wellen, die Ende April 1926 in der Frankfurter Zeitung erschien. Es gab freilich auch Zuspruch, Lob und Verteidigung. Margarete Susman setzte sich immer wieder für die Bedeutung der neuen Schriftübertragung ein. Direkt oder indirekt beteiligten sich auch Ernst Simon, Walter Benjamin, Gershom Scholem, Leo Löwenthal und viele andere an der Diskussion. Es entfaltete sich eine deutsch-jüdische Debatte, in der die großen Fragen der Moderne – von Tradition, Politik und Zugehörigkeit – verhandelt wurden.
Diese Edition versammelt zum ersten Mal die zentralen Quellen einer historischen Kontroverse, deren Strahlkraft weit über das Jahr 1926 und den Ort Frankfurt hinausreichte.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Die Bibelübersetzung von Buber-Rosenzweig
Geschichte eines Projekts
Herausgegeben von Inka Sauter, Christoph Kasten und Ansgar Martins
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Jüdischer Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.
© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildungen: Vjom/Shutterstock (umgeblätterte Seite); Auszug aus dem Leningrader Kodex, 1008, Farbfotografie des Bibeltextes aufgenommen von Bruce E. Zuckerman für das Westsemitische Forschungsprojekt, Russische Nationalbibliothek, St. Petersburg, MS Evr. I B19a, CC PDM 1.0
eISBN 978-3-633-78427-1
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Einleitung
Begegnungen
Konfrontationen
Deutungen
Zu dieser Edition
Anmerkungen
Einleitung
Begegnungen
Konfrontationen
Deutungen
Im Anfang
Fehler mit Folgen
Die Koch-Kontroverse
1.
2.
3.
4.
Die Bibel auf Deutsch
Erste Sondierungen
Wider die Widrigkeiten
Martin Buber | Franz Rosenzweig
:
Die Bibel auf Deutsch. Zur Erwiderung
Kreisende Briefe
Zwischenbilanzen
Luther
als Stellvertreter
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Abgegrenzte Sprache
Martin Buber
:
Der Mensch von heute und die jüdische Bibel. Aus einer Vortragsfolge (November 1926)
Gedenken an Rosenzweig
Im Rückblick
Richard Koch
. Einzelne Erinnerungen an Franz Rosenzweig. 40
Anhang
Dank
Quellenübersicht
Im Anfang
Fehler mit Folgen
Die Koch-Kontroverse
Die Bibel auf Deutsch
Erste Sondierungen
Wider die Widrigkeiten
Kreisende Briefe
Zwischenbilanzen
Luther als Stellvertreter
Abgegrenzte Sprache
Gedenken an Rosenzweig
Im Rückblick
Bildnachweis
Personenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Einleitung
Am 27. April 1926 hielt die Frankfurter Zeitung nicht für alle gute Nachrichten bereit, zumindest nicht für die Religionsphilosophen Franz Rosenzweig und Martin Buber. Sie sahen sich in aller Öffentlichkeit mit dem Verriss einer gemeinsamen Arbeit konfrontiert, der sie sich seit einem Jahr mit ganzer Anstrengung widmeten. Auf der Titelseite unter dem Strich – also im Feuilleton – erschien im ersten Morgenblatt der Text Die Bibel auf Deutsch. Zur Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig.1 Es handelte sich dabei um den Hauptteil einer äußerst polemischen Besprechung von Siegfried Kracauer, die in einem der meistgelesenen Periodika der Zeit abgedruckt wurde und insbesondere in der deutsch-jüdischen Öffentlichkeit hohe Wellen schlug. Immerhin wurden mit Buber und Rosenzweig gleich zwei zentrale Figuren jüdischer Selbstvergewisserung in der intellektuellen Konstellation der Weimarer Republik angegangen, und das ausgerechnet von jemandem, der gelegentlich noch in denselben Kreisen verkehrte wie sie selbst. Der Schluss der Kritik folgte am nächsten Tag, ebenfalls an exponierter Stelle.2
Sie richtete sich gegen Bubers und Rosenzweigs Übertragung der hebräischen Bibel ins Deutsche, deren erster Band Ende Dezember 1925 unter dem Titel Das Buch Im Anfang veröffentlicht worden war. Das Werk selbst war insgesamt auf 20 Bände angelegt, zehn bearbeiteten sie gemeinsam. Mit diesem Unterfangen wollten Buber und Rosenzweig das Wort der Bibel buchstäblich in ihrer Gegenwart wieder hörbar machen. Sie reagierten auf die zunehmende religiöse Bindungslosigkeit in der Moderne und suchten in Reaktion darauf die jüdische Bibel in der deutschen Sprache zum Klingen zu bringen. Ihr Anspruch ging weit über eine bloße Neuübersetzung des Tanach hinaus: einerseits inhaltlich, da ihnen keine der vorliegenden Übersetzungen den rechten Ton zu treffen schien. Andererseits auch in ihrer Arbeit mit der Sprache – sie bezogen Wortwurzeln, -morphologien und klangliche Entsprechungen in ihre Überlegungen mit ein und veröffentlichten den Text ohne Kommentar – er sollte für sich, ja aus sich heraus sprechen. Durch die Bewahrung der hebräischen Rhythmik, Betonung und Bedeutung in der Bibelübertragung suchten sie in rastlosen Bemühungen deutsch-jüdischer Zugehörigkeit einen eigenen Ausdruck zu geben. Dafür gruben sie sich tief in die deutsche Sprachgeschichte ein und arbeiteten ausgiebig mit einschlägigen deutschen Wörterbüchern, vor allem mit jenem von Jacob und Wilhelm Grimm. Vor diesem Hintergrund bezeichneten sie ihr Unterfangen als »Verdeutschung«, Rosenzweig sprach gar vom »Rebbe Grimm«.3 (S. 131)
Buber und Rosenzweig taten ihr Bestmögliches, um die Übersetzung zügig fertigzustellen. Gerade für Rosenzweig bedeutete das eine kaum vorstellbare Kraftanstrengung. Er litt schon seit einigen Jahren an amyotropher Lateralsklerose, einer unheilbaren progressiven Lähmungserkrankung, und konnte sich bereits zu Beginn des Unterfangens nur noch mit Lidschlägen verständigen, die zumeist von seiner Ehefrau Edith Rosenzweig in Worte übersetzt wurden. Trotzdem schafften sie es, binnen acht Monaten den ersten Band von der Idee bis zur Drucklegung zu bringen, und nahmen unverzüglich die Arbeit am nächsten auf. Im Dezember 1925 wurde das Werk annonciert und bald die ersten Exemplare von Das Buch Im Anfang verschickt. Unter den direkten Reaktionen, die oft zunächst in privater Form als Dankesbriefe übermittelt wurden, war viel Lob; allerdings gab es auch solche, die sich in aller Deutlichkeit irritiert zeigten, und auch ein öffentliches Echo ließ nicht lange auf sich warten. So veröffentlichte Kracauer bereits im Januar 1926 eine Notiz in der Frankfurter Zeitung,4 in der er sich über die Werbeanzeigen mokierte. Unabhängig davon publizierte Richard Koch, der Arzt und auch mit Rosenzweig befreundet war, eine Rezension im Februarheft von Der Morgen. Eine Zweimonatsschrift,5 in der er seine Zweifel an dem Unterfangen offenlegte und die Buber und Rosenzweig als Affront begriffen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Die Bibel auf Deutsch in der Frankfurter Zeitung waren sie zwar schon auf Kritik gefasst – auch vonseiten Kracauers –, hatten sich aber nicht vorstellen können, wie heftig diese ausfallen würde.
Dabei hatte sich Kracauer auch vorher schon wiederholt durch polemische Stellungnahmen hervorgetan; nach dem Ersten Weltkrieg machte er sich zunächst mit kritischen Texten über geistige und religiöse Gegenwartsentwicklungen einen Namen, ab Mitte der 1920er zunehmend mit soziologischen und ideologiekritischen Arbeiten. Seine Essays über Photographie, Kinofilme oder die Berliner Mittelschichten wurden später zu Klassikern der Kritischen Theorie. Sie erschienen zumeist in der Frankfurter Zeitung, für die Kracauer bis zu seiner fluchtartigen Emigration nach Paris im Jahr 1933 als Redakteur arbeitete. Ende April 1926 legte er in seinem Hausmedium dar, dass er den Anspruch, »die Wirklichkeit der Schrift rein zu erneuen«, als fehlgeleitete Hybris ansah. (S. 188) Er schrieb von einem »sprachlichen Hinterland« (S. 189), das Buber und Rosenzweig zu kultivieren suchten, und von der in den verwendeten »urdeutschen Ausdrücken« (S. 190) repräsentierten »altertümelnden Neuromantik des ausgehenden 19. Jahrhunderts«. (S. 189) Zu Luthers Zeit, so Kracauer, sei die Bibelübersetzung noch politischer und religiöser Akt in einem gewesen. In der Moderne sei dieser Zusammenhang auseinandergetreten und »der Zugang zur Wahrheit […] im Profanen« zu suchen. (S. 198) Noch während der Lektüre des Textes begannen Buber und Rosenzweig Strategien zu entwickeln, wie auf diesen Angriff aus nächster Nähe zu reagieren sei. Ihr Umfeld brachte sich unmittelbar in den zutage tretenden Konflikt mit ein und auch Kracauer suchte den Austausch in seinen Kreisen – wobei es zunächst noch die eine oder andere Überschneidung gab. Denn einige der Protagonistinnen und Protagonisten kannten sich schon länger, als Kracauer seinen Text gegen die Bibelübersetzung von Buber und Rosenzweig schrieb; so mancher Kontaktabbruch folgte darauf. Andere begegneten sich erst viele Jahre später und kamen doch wieder auf die Debatte vom Frühjahr 1926 zurück. Neben Buber, Rosenzweig, Koch und Kracauer partizipierten unter anderem Margarete Susman, Ernst Simon, Gershom Scholem, Julius und Margarete Goldstein, Ernst Bloch, Walter Benjamin und Leo Löwenthal direkt oder indirekt an dem sukzessive eskalierenden Konfliktgeschehen.
Für die Beteiligten stand alles auf dem Spiel, für das sie jeweils eintraten: Es ging um nichts Geringeres als den legitimen Ort des Judentums (und seiner Offenbarung) in der Moderne. Buber und Rosenzweig beabsichtigten, eine neue deutsche Stimme für das göttliche Wort zu formen, ihre Kritiker stießen sich bereits an diesem Anspruch, der ihnen als Blindheit gegenüber den tatsächlichen Erfordernissen der Zeit erschien. In der sich anschließenden Kontroverse kristallisierten sich die großen Themen der deutsch-jüdischen Debatte jener Jahre, die Fragen eines immer wieder von außen wie von innen herausgeforderten Selbstverständnisses und das Problem, dass beides kaum voneinander zu trennen war: Sakrales und Profanes, Tradition und Transformation, Zionismus und Akkulturation, Antisemitismus und Emanzipation, Zugehörigkeit und Individualismus. Die Positionen der Beteiligten zu diesen Themen waren zutiefst verschieden und zugleich geradezu existenziell. Die Ansprüche der jeweiligen Gegenseite empfanden sie entsprechend schnell als persönlich verletzend. Zwar trafen hier renommierte Intellektuelle aufeinander, denen Wortgefechte und große Debatten im Prinzip genauso am Herzen lagen wie Dialogphilosophie und Austausch. Und dennoch spitzte sich die Verdeutschungsdebatte nach und nach auf eine Weise zu, die an ein Kammerspiel erinnert – eine mit zunehmender Wut ausgetragene Konfrontation, in der kaum jemand aus der eigenen Rolle auszubrechen vermochte. Der Streit hallte noch lange nach; in bestimmter Weise begleitete er die Bibelübersetzung über die vielen Jahre, die sie dauerte. Nachdem Rosenzweig am 10. Dezember 1929 im Alter von 42Jahren starb, veröffentlichte Buber bis zu seiner Emigration im Frühjahr 1938 fünf weitere Bände der Übersetzung. Erst in den 1950er Jahren wandte er sich wieder der Bibelübertragung zu und revidierte dabei auch die bereits erschienenen Teile. 1961 feierte er in seinem Haus in Jerusalem die Fertigstellung von Die Schrift. Bei dieser Gelegenheit hielt Gershom Scholem seine berühmte Rede mit dem Titel An einem denkwürdigen Tage.
Dass das Unterfangen »mehr als ein Menschenalter« dauern würde,6 (S. 446) war nicht zu erahnen, als sich gleich zu Beginn, im Frühjahr 1926, kritische Stimmen erhoben. Über die Jahre und Jahrzehnte wurde es zwar breit rezipiert, auch in christlichen, jugendbewegten und in antisemitischen Kreisen gab es viele öffentliche Äußerungen. Die entscheidende Frage nach dem Status der Bibel in ihrer Zeit blieb aber an die ersten Wahrnehmungen gebunden, die auch die Beteiligten selbst immer wieder aufriefen. Die epochale Konfrontation von Buber, Rosenzweig und jenen, die sie unterstützten, mit denen, die sich gegen sie positionierten, hatte eine signifikante Vorgeschichte, die insbesondere auf die Krisenzeit und die religiöse Suche nach dem Ersten Weltkrieg zurückging, und eine bedeutungsvolle Nachgeschichte, die bis in die frühen 1960er Jahre, bis zu einem Dankesbrief Susmans an Scholem reichte. Der Verlauf der Ereignisse mit ihren Verzweigungen ist der Gegenstand des vorliegenden Buches. Die in vielerlei Form – in Briefen, Notizen und Aufsätzen, in Ankündigungen, Besprechungen und Repliken – artikulierten divergierenden Wahrnehmungsweisen der Verdeutschung von Buber und Rosenzweig werden hier zum ersten Mal dokumentiert.
Begegnungen
Die Intellektuellen, die in der Kontroverse um die Bibel-Verdeutschung aufeinandertrafen, waren sich in unterschiedlichen Konstellationen bereits zuvor begegnet. Dabei teilten sie nicht nur Netzwerke und Kontakte, sondern vor allem auch historische Erfahrungen: Sie alle hatten die ökonomische, kulturell-soziale und religiöse Erschütterung des Ersten Weltkriegs und die frühen Krisenjahre der Weimarer Republik erlebt; sie alle hofften auf »Erneuerung« oder wenigstens auf eine Antwort, mit deren Hilfe die Krisenerfahrung ihrer Zeit sich neu und anders darstellen würde. Damit standen sie nicht allein. Die frühen 1920er Jahre waren, und zwar über Religionsgrenzen hinweg, die Zeit der »transzendentalen Obdachlosigkeit«,1 der »Wartenden«, der religiösen Wanderer und »barfüßigen Propheten«.2
Während sich manche dieser Heilssucher und -bringer ins Landleben zurückzogen, entfalteten andere ihre Wirkung gerade in den urbanen Zentren der Weimarer Republik. Eines davon war Frankfurt – nicht zufällig auch der Ort der Kontroverse um die Bibelübersetzung. Hier war 1914 eine progressive Stiftungsuniversität entstanden, hier saß die weithin anerkannte Frankfurter Zeitung, hier wurden in den 1920er Jahren nicht nur avantgardistische Bau- und Gesellschaftsprojekte wie das Neue Frankfurt angegangen, sondern auch intellektuelle Unternehmen vom Institut für Sozialforschung bis zu Rosenzweigs Freiem Jüdischen Lehrhaus ins Leben gerufen.3 Spätere Angehörige dieser beiden bis heute berühmten Institutionen begegneten sich um 1920 bei einem ebenso religiösen wie gesellschaftlichen Ereignis: Nehemia Anton Nobel, dem orthodoxen Rabbiner der Synagoge am Börneplatz in Frankfurt. In der Literatur wird er zumeist mit dem (von Max Weber stammenden) Attribut »charismatisch« belegt.4 Die Namensliste des Kreises, der sich um Nobel formierte, umfasst zahlreiche spätere Berühmtheiten und wichtige Teilnehmer der noch bevorstehenden Verdeutschungsdebatte: Leo Löwenthal, Siegfried Kracauer und Erich Fromm begegneten hier Franz Rosenzweig und Martin Buber, selbst der prominente Hermann Cohen reiste gelegentlich aus Marburg an, aber der »Lieblingsschüler« war Ernst Simon.5Löwenthal behauptete rückblickend, im Nobel-Kreis habe eine »merkwürdige Mischung von mystischer Religiosität, philosophischer Eindringlichkeit und wohl auch einer mehr oder minder verdrängten homosexuellen Liebe zu jungen Menschen« geherrscht; die Versammlung sei »schon eine Art kultischer Gemeinschaft« gewesen.6
Der Nobel-Kreis war somit nicht nur religiöse Gemeinschaft, sondern vor allem eben auch Gemeinschaft: Sie hatte eine utopisch-politische Komponente; der Kreis und der verehrte Rabbiner gaben den Einzelnen Halt. Seine Anhänger dachten aber weniger über die politisch-soziale Dimension nach und betrachteten Nobel vor allem als spirituelles Genie. Er schien einen zeitgemäßen Zugang zu den Tiefen der jüdischen Tradition anzubieten. Seine Persönlichkeit verband Orthodoxie und Kosmopolitismus, Halacha und Goethe, Großstadtleben und Chassidismus, Zionismus, deutschen Patriotismus »und – gütiger Himmel – den Sohar!«7 Die Vermittlung eines rationalen Judentums ging also mit deutschem Bildungsgut und Offenheit für mystisch-irrationale Dimensionen einher. Am berühmtesten waren Nobels ergriffene und ergreifende Predigten, denen »sich die Frankfurter Bürger […] wie Opernereignissen« hingegeben haben sollen, während der jüdische Nachwuchs Nobel als mystischen »Ersatzvater« gegen liberale Elternhäuser in Stellung bringen konnte.8
Als Nobel im Januar 1922 plötzlich verstarb, hielt Erich Fromm in einem Nachruf fest, er sei der »Führer der Jugend« gewesen, denn er habe »unsere Not« verstanden und nicht nur Tora und Talmud, sondern auch deren innere Schönheit zugänglich gemacht. Noch wichtiger sei nur sein Charakter gewesen: »[E]r lebte, was er sagte, und […] sagte, was er lebte.«9 Ähnlich äußerte sich Kracauer. Der promovierte Architekt, der lieber Philosoph geworden wäre und sich in den frühen 1920er Jahren als schreibender Intellektueller zu etablieren suchte, stimmte inbrünstig in das Loblied auf Nobel mit ein: »[E]r war ja ganz Geist – was die anderen lehren, das war er«, schrieb Kracauer am Todestag Nobels an Löwenthal und gründete seine Verehrung dabei ganz explizit auf die Krisenerfahrung: »In einer Zeit äußerster Skepsis und Ungläubigkeit war er mir die Offenbarung der echten religiösen Persönlichkeit.«10Kracauer reflektierte damit die spezifische religiöse Suchbewegung, die seine Generation auszeichnete: »Ich habe sein Wesen geliebt […] nicht eigentlich seine Gedanken suchte ich, sondern das Sein, das er verkörperte.«11 So suchte und fand er Halt, ganz allgemeinen Halt in dieser »religiösen Persönlichkeit«. Im vertrauten Zusammenhang fragte er ebenso wie Ernst Simon, ob Nobel »zu den 30 [sic] Zaddikim gehörte, die in jeder Generation leben?«.12
Während einige der Genannten wie Fromm und KracauerNobel relativ zu Anfang ihres philosophischen Weges trafen, betrachtete Rosenzweig die Versammlung distanzierter. Er schätzte an Nobel nach eigenem Bekunden nur die Talmudlektüre und betrachtete sich als »Hasser und Verächter aller Predigten«.13 Selbst er jedoch musste seine Faszination für diejenigen Nobels eingestehen: »Man könnte nur das Allergrößte daneben nennen.« In den Predigten Nobels meinte er den »ganzen Menschen« zu entdecken und ging dabei so weit, dem Verehrten – wenige Monate bevor dieser unerwartet dahinschied – etwas zuzugestehen, das ihm selbst (noch) fehle: »Die Gedanken könnte schließlich ich auch haben, den Sprachstrom hat vielleicht mancher, aber es ist noch etwas dabei, etwas Allerletztes, eine Hingerissenheit des ganzen Menschen.« Und wie Kracauer ihn als »ganz Geist« bezeichnete, so zeigte Rosenzweig seine Bewunderung in verwandter Bildsprache: »[M]an würde sich nicht wundern, wenn er plötzlich aufflöge und nicht mehr da wäre, es gibt keine Kühnheit, die er in solchen Augenblicken nicht wagen könnte, und kein Wort, das in diesem Munde dann nicht wahr wäre.«
Wenige Monate bevor Rosenzweig seine »Hingerissenheit« gegenüber Nobel bekundete, hatte er selbst eines der zentralen religionsphilosophischen Werke der 1920er Jahre mit dem Titel Der Stern der Erlösung vorgelegt. Rosenzweigs eigener suchender Denkweg war alles andere als geradlinig und geprägt von Krisen und Ambivalenzen, die typisch für seine Generation waren. Im Jahr 1913 führten diese dazu, dass er unter dem Einfluss seines Freundes Eugen Rosenstock fast zum protestantischen Christentum konvertiert wäre. In einem wohlhabenden bürgerlichen Milieu seiner Geburtsstadt Kassel aufgewachsen, verfolgte Rosenzweig zunächst eine akademische Karriere, die ihn 1906 zum Studium der Medizin nach Freiburg brachte. Er wechselte dort aber in die Fächer Geschichte und Philosophie und promovierte mit einer ideengeschichtlichen Arbeit über Hegels politische Philosophie bei dem bekannten Historiker Friedrich Meinecke. Der Entstehungsgeschichte des daraus hervorgegangenen Buches Hegel und der Staat ist der Zeitindex selbst eingeschrieben, sie ist Ausdruck der durch die Krise des Ersten Weltkrieges verursachten Standortbestimmung Rosenzweigs. In der nach dem Krieg verfassten Einleitung zu seinem Buch, das zwar bereits vor Kriegsausbruch weitgehend fertiggestellt war, aber erst nach dem Krieg erschien, hielt Rosenzweig fest: »Ein Trümmerfeld bezeichnet den Ort, wo vormals das Reich stand.«14 Über diesem Trümmerfeld wollte Rosenzweig mit seinem Stern der Erlösung einen religiösen Neubau errichten, um Orientierung in die empfundene politische und geistige Desorientierung zu bringen. Im Frühjahr 1922 hob eine Rezension von Margarete Susman die Bedeutung dieses Buches hervor: »An einer großen Zeitwende steht dies Buch und ist es sich bewußt zu stehen: an der Zeitwende des Zerfalls.«15
Rosenzweig wandte sich am Ausgang des Ersten Weltkrieges einem, wie er es 1925 mit Blick auf den Stern der Erlösung bezeichnete, »neuen Denken« zu. Er verstand darunter ein »Sprachdenken«, das im Miteinander und im Gespräch gründe.16 Die Konzentration auf die lebendige Sprache schlug sich auch in seinen Überlegungen zu einer jüdischen Bildungsreform nieder, die in der von ihm diagnostizierten geistigen wie lebensweltlichen Krise innerhalb des modernen Judentums eine Perspektive in perspektivloser Zeit eröffnen sollte. Eine der zentralen Institutionen, in der diese religiöse Suchbewegung manifest wurde, ist das 1920 in Frankfurt gegründete Freie Jüdische Lehrhaus, das bis 1927 bestand. Rosenzweig blieb bis zu seinem der Krankheit geschuldeten Ausscheiden 1922 Leiter des Lehrhauses. Die Idee, diese Institution zu schaffen, geht auf einen Text zurück, den Rosenzweig 1917 von der mazedonischen Front an den seinerzeit berühmten Philosophen und jüdischen Denker Hermann Cohen richtete, den er als »geistigen Führer« innerhalb des deutschen Judentums bezeichnete.17 Der Text trägt den Titel Zeit ists. Rosenzweig schrieb darin pathetisch über das jüdische Bildungsproblem: »Denn wahrhaftig: die Zeit zum Handeln ist gekommen.«18 In seinem Text entwickelte er erste Ideen zu einem neuen jüdischen Bildungsprogramm; seine Gedanken kreisten um Lehrpläne, darum, dass »Lehrer und Gelehrte« die »gleiche Person sein müssten«.19
Nach dem Krieg konkretisierte Rosenzweig seine Gedanken zum Bildungsproblem nun im Rahmen der Idee der Volkshochschule. Zu Beginn des Jahres 1920 veröffentlichte er dann die für das Lehrhaus programmatische Schrift Bildung und kein Ende, mit der er zwar an seine Überlegungen aus Zeit ists anknüpfte, aber von seinem einstigen Bildungsplan abrückte. Es ging ihm nun nicht mehr um Fachwissen, sondern um, wie er es nannte, »Sprechraum und Sprechzeit«.20 Rosenzweig suchte dem Verlust von Tradition die Begegnung derjenigen entgegenzustellen, die nurmehr das »noch so keimhafte, noch so verborgene Bewußtsein [hatten], jüdischer Mensch zu sein«.21 Seinen Programmtext legte Rosenzweig im Januar 1920 Nobel vor, der sich, so schrieb er es seiner Mutter, »begeistert« zeigte.22
Im Sommer 1920 öffnete das Frankfurter Lehrhaus seine Pforten – im übertragenen Sinne, denn es wurden insbesondere die Räumlichkeiten einer Schule genutzt. Zu seinen Hochzeiten verzeichnete es über tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Rosenzweig versammelte hier neben Gelehrten explizit auch Laien als Lehrende. Diese sollten, so seine Ansicht, gleichermaßen in der Lage sein, ein lebendiges Judentum im gleichberechtigten Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu vermitteln. Neben etablierten gelehrten Rabbinern und jüdischen Persönlichkeiten wie beispielsweise Nobel und Benno Jacob holte Rosenzweig daher auch solche ans Lehrhaus, die sich selbst als unwissend in Fragen des Judentums verstanden, darunter der spätere Bildungspädagoge Ernst Simon und der Arzt Richard Koch.
Insbesondere Simon, der Lieblingsschüler Nobels, wurde eine der tragenden Säulen des Lehrhauses. Wie viele andere der jüngeren Generation am Lehrhaus, war auch er um die Jahrhundertwende geboren worden und war, wie er es rückblickend selbst beschrieb, in einem »wohlhabenden, gebildeten, religionslosen jüdischen Bürgerhaus in Berlin« aufgewachsen.23 Er war Kriegsfreiwilliger und wandte sich nach dem Krieg der zionistischen Jugendbewegung zu, später war er Redakteur bei Bubers Zeitschrift Der Jude. Er sollte 1928 ins Mandatsgebiet Palästina emigrieren und an der Hebräischen Universität Philosophie und Pädagogik lehren.
Der deutlich ältere Koch – Jahrgang 1882 – wiederum war Internist und unterrichtete als außerordentlicher Professor Geschichte der Medizin in Frankfurt. Er war vom Vitalismus und von der Lebensphilosophie Henri Bergsons beeinflusst, was sich in seinen philosophischen und theoretischen Arbeiten zur Medizin widerspiegelte. In der Frankfurter Zeitung veröffentlichte er regelmäßig medizinische, naturwissenschaftliche und kulturelle Beiträge und schrieb unter anderem auch für Zeitschriften wie Der Morgen, die sich an ein jüdisches Publikum richteten. Koch war früh am Lehrhaus aktiv und für einige Zeit, zusammen mit Buber und Eduard Strauß, einer der Leiter. 1922 wurde er zudem Rosenzweigs Arzt – Rosenzweig schrieb über diese Beziehung im selben Jahr an seine Mutter, »daß Kranksein mit Koch schöner ist als Gesundsein ohne Koch«.24Koch diagnostizierte kurze Zeit später erstmals Rosenzweigs schwere Erkrankung. 1923 erschien in Der Jude ein in weihevollem Ton gehaltener, programmatisch-leidenschaftlicher Text über das Lehrhaus, in dem Koch ein erstes Resümee der bisherigen Arbeit zog, Rosenzweig als eigentliches Genie des Lehrhauses zeichnete und die Frage »Was will und soll das Lehrhaus?« damit beantwortete, dass es darum gehe, »unser eigenes wahres Leben zu leben«.25
Im Lehrhaus begegneten sich auch andere frühere Angehörige des Nobel-Kreises wie Erich Fromm und Leo Löwenthal wieder, nun allerdings in der Rolle der Lehrenden. Zeitweise unterrichteten Samuel Joseph Agnon, Gershom Scholem, Leo Strauss und Bertha Pappenheim am Lehrhaus. Neben Vorlesungen zur Geschichte, Religion und Kultur des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart wurden unter der Rubrik Arbeitsgemeinschaften auch Quellenstudien und Hebräischunterricht angeboten. Diese Sprache lehrte Rosenzweig in den ersten Trimestern selbst und richtete sich damit explizit auch an ein Publikum ohne Vorkenntnisse. Kracauer und Simon, die später zu Kontrahenten in der Übersetzungsdebatte wurden, waren 1921 noch gemeinsam mit dem Mediziner und Soziologen Fritz Edinger zu einer Vorlesung mit dem Titel »Unsere Zeit« eingeladen. Dass Rosenzweig seinen späteren Gegner Kracauer an sein geliebtes Lehrhaus holte, um über »die religiösen Strömungen der Gegenwart zu reden«, war aber schon damals kein Ausdruck von geistigem Einklang. Vielmehr hoffte er, durch die Einladung »vielleicht die Kreise der Frankfurter Zeitung«, bei der Kracauer angestellt war, »ins Lehrhaus [zu] locken«.26Kracauer jedoch stotterte stark, brachte bei seinem Vortrag kein Wort heraus, Rosenzweig musste das Manuskript schließlich selbst verlesen – die Episode ließ beide verstört zurück und dürfte mit zu den Emotionen beigetragen haben, die wenige Jahre später eskalierten.
Während es mit Kracauer und dem Lehrhaus so ganz und gar nicht passen wollte, kam eine andere Verbindung noch indirekt vermittelt über Nobel zustande, die sich als äußerst produktiv erweisen sollte. Martin Buber, zweifellos selbst eine prägende Gestalt für die Jugend (und für die Junggebliebenen), kam im Herbst 1922 an das Lehrhaus und sprach über »Die Urformen des religiösen Lebens«.27 Schon vor dem Ersten Weltkrieg war er weithin für ein breitgefächertes Werk bekannt. 1878 in Wien geboren, verbrachte er Kindheit und Jugend in gehobenen Verhältnissen bei seinen Großeltern in Lemberg. Sein Großvater war in Galizien ein angesehener Gelehrter der Haskala, der jüdischen Aufklärung. Zu seiner Studienzeit besuchte Buber die Vorlesungen Wilhelm Diltheys und die Privatseminare Georg Simmels in Berlin. Er wurde über deutsche Mystik promoviert und erforschte interreligiöse »ekstatische Konfessionen«, studierte Nietzsche ebenso wie Laotse. Es war aber seine schließlich erfolgte dezidierte Hinwendung zum Judentum, mit der er den Höhepunkt seiner philosophischen und literarischen Anziehungskraft erreichte. Bereits früh brachte er sich in die zionistische Bewegung ein; wandte sich jedoch 1902, im Kontext der sogenannten »Altneulanddebatte« (rund um den gleichnamigen utopischen Roman von Theodor Herzl) von dessen politischer Fassung ab und einem Kulturzionismus zu, der auf jüdische Erneuerung, ja auf »Renaissance« gerichtet war. Seine ab 1905 veröffentlichten chassidischen Erzählungen und seine um 1910 vor dem Prager Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochba gehaltenen Reden übten großen Einfluss auf diejenigen aus, die nach Gemeinschaft suchten. Viele von ihnen lasen unter diesen Vorzeichen die 1923 erschienene Schrift Ich und Du, mit der Buber seine allgemeinmenschliche Dialogphilosophie in Text fasste.
In der Frage des Dialogs fanden auch Buber und Rosenzweig zueinander; es dauerte jedoch einige Jahre, bis sie ins Gespräch kamen. Bereits 1914 hatte Rosenzweig Buber persönlich getroffen, aber ohne dass sich gleich eine Verbindung eingestellt hätte. Nach ersten gescheiterten Begegnungsversuchen,28 kam Ende des Jahres 1921 ein Austausch zwischen ihnen zustande – allerdings nicht ohne Umweg. Anlass war die Gabe, eine Aufsatzsammlung für Nobel zum 50. Geburtstag. Im Auftrag Rosenzweigs schickte Ernst Simon am 18. Oktober 1921 eine Anfrage zur Mitwirkung an Buber.29 Rosenzweig selbst reagierte erst auf Bubers Beitragssendung. Ende November lud Buber Rosenzweig zu sich nach Heppenheim ein, wo er seit 1916 wohnte, und es folgten ab Dezember 1921 Briefe in dichter Folge; zunächst ging es um eine Vorlesung am Lehrhaus und bald darauf um Ich und Du. Der rege Austausch wurde unversehens zu einer Freundschaft, die sich rasch vertiefte. Neben den Lehrhausaktivitäten spielten in den folgenden Jahren die Auseinandersetzung über Offenbarung und Gesetz rund um Rosenzweigs Die Bauleute sowie die Gründung der Zeitschrift Die Kreatur eine wichtige Rolle.30 Vor allem aber beschäftigten sie sich ab Mitte der 1920er Jahre intensiv mit der Verdeutschung der Schrift.
Lange bevor sich die beiden Denker des Dialogs kennenlernten, war Margarete Susman schon freundschaftlich mit Buber verbunden. Als Essayistin schrieb sie über die Rolle der Frau, die Revolution und die Krise ihrer Zeit. Ihre Artikel und Besprechungen veröffentlichte sie insbesondere in der Frankfurter Zeitung. Auch sie hatte (wie Buber, Kracauer oder Ernst Bloch) bei Simmel in Berlin studiert, Gedichte und Übersetzungen publiziert, vor allem aber wurde sie als Religionsphilosophin eine lange verkannte, wichtige Stimme für eine »jüdische Renaissance«. In ihrer Autobiografie erinnerte sie sich, wie sie Buber – bevor er berühmt wurde – in Simmels Privatseminaren begegnet war, und hielt ihren ersten Eindruck fest: »das ist kein Mensch, das ist reiner Geist«.31 Dem setzte sie hinzu: »Und was alles hat Martin Buber uns seit jener frühen Zeit erschlossen: ganze Welten sind durch ihn unser eigen geworden.«32 Der Kontakt blieb mit Unterbrechungen über die Jahre bestehen. Zunächst noch ganz unabhängig von Buber erhielt Susman, die seit 1907 für die Frankfurter Zeitung schrieb, wohl im Februar 1921 einen Brief von Rosenzweig. Er fragte, ob sie nicht sein soeben erschienenes Buch Der Stern der Erlösung in ihrem üblichen Forum rezensieren wolle.33 Die beiden kannten sich zu diesem Zeitpunkt nicht; Susman war zwar gelegentlich in Frankfurt, lebte aber seit Herbst 1918 in Säckingen an der Schweizer Grenze. Rosenzweig hatte sie zunächst – und das teilte er ihr tatsächlich auch mit – nur angefragt, weil der Verlag es wünschte. Als er aber von »Eugen Rosenstock und seiner Frau«, die ebenfalls in Säckingen wohnten, etwas von ihr persönlich »gehört habe« und von der Frankfurter Zeitung keine unmittelbare Rückmeldung hinsichtlich einer Besprechung kam, war es ihm doch auch selbst wichtig, dass sie etwas schriebe.34 Daher bat er sie, sich an Buber zu wenden (ein halbes Jahr bevor er durch Simons Vermittlung mit diesem in Kontakt trat). Und so teilte sie Buber ihre Einschätzung von Der Stern der Erlösung mit, schrieb ihm von einem »große[n] seelige[n] Traumland« der »letzte[n] Dinge«, das sich im wissenschaftlichen Gewand darstellte, und fragte, ob er nicht eine Rezension in die Monatsschrift Der Jude aufnehmen wolle.35 Ihr ging es dabei darum, dass das Werk über die Zeit hinausweise und ihr zugleich angehöre – und es war diese Deutung, die sie nicht nur zum epochalen Bild der »Zeitwende« in Bubers Zeitschrift führte, sondern auch ihr Interesse an Rosenzweigs Übersetzungsdenken beförderte. Nicht zuletzt weil sich Rosenzweig in Susmans Besprechung zu Der Stern der Erlösung zutiefst verstanden fühlte, prägte sich zwischen ihnen eine geistige Verbundenheit aus. Im Herbst 1924 besprach sie dann ein Buch Rosenzweigs in der Frankfurter Zeitung; es handelte sich um Sechzig Hymnen und Gedichte des Jehuda Halevi.36 Durch die Übertragung der Gedichte sah sie eine fremdgewordene Welt hindurchscheinen, die für sie in ihrem eigenen, bis ins Fundament erschütterten jüdischen Selbstverständnis geradezu zum Sehnsuchtsort wurde. Und so nimmt es nicht wunder, dass Susman die Verdeutschung der hebräischen Bibel von Buber und Rosenzweig mit eigenem existenziellen Interesse begleitete.
Seit Oktober 1918 war Susman auch mit Siegfried Kracauer bekannt, der ebenfalls bei Nobel verkehrte, Vorlesungen Simmels besucht hatte und kurzzeitig Buber bewunderte. Zwischen den beiden entwickelte sich eine intensive, aber kurze Freundschaft, die dennoch beiden geholfen haben dürfte, die Krisenjahre um 1920 zu überstehen.37Susman zog wegen ihres Ehemanns in die Provinz nach Säckingen, wo sie sich sowohl geistig als auch sozial isoliert sah, Kracauer suchte nach Gott oder wenigstens einem Propheten und versuchte, sich als Schriftsteller zu etablieren. Aus der Korrespondenz sind nur Kracauers Briefe erhalten, die Aufschluss geben über das, was ihn damals beschäftigte. Die beiden diskutierten alles: die Krisenjahre in Deutschland, die junge Sowjetunion, Buddhismus, Katholizismus, Phänomenologie, die großen Philosophien und die frühe Soziologie, die Hoffnung auf eine spirituelle Erlöserfigur und nicht zuletzt die eigenen theoretischen Entwürfe. Susman fand in Kracauer einen Bewunderer, der ihr ewige geistige Treue versprach, Kracauer lernte bei ihr außerdem noch interessante Zeitgenossen kennen, so beispielsweise den »dämonischen« Ernst Bloch, Autor des 1918 veröffentlichten messianischen Buches Geist der Utopie. Es dürften Kracauers rigorose kritische Texte über so manche dieser mit Susman befreundeten Zeitgenossen gewesen sein, die immer wieder zu Entfremdungen führten: Blochs Buch Thomas Münzer als Theologe der Revolution widmete er bald nach dem Treffen einen äußerst kritischen Text, ebenso der katholisch-phänomenologischen Philosophie Max Schelers. Nicht zuletzt empörte sich Kracauer über den Patmos-Kreis, eine weitere Versammlung von Charismatikern für Charismatiker, in dessen Umfeld sich auch Buber und Rosenzweig bewegten und aus dem später die Zeitschrift Die Kreatur hervorging. Vermutlich aufgrund dessen ebbte der Kontakt zwischen Susman und Kracauer im Verlauf des Jahres 1922 ab, 1925 kündigte sie ihm die Freundschaft, in der 1926 folgenden Debatte über die Bibelübersetzung versuchte sie nur noch erfolglos, ihn von der Publikation eines weiteren Verrisses abzuhalten.
Andere Begegnungen wurden durch die harsche Besprechung erst möglich: Ausgerechnet Ernst Bloch suchte die Aussöhnung mit Kracauer, nachdem ihm Walter Benjamin die kritische Rezension über Die Bibel auf Deutsch zu lesen gegeben hatte. Kracauer, inzwischen vom religiös Suchenden zu einem bekannten und respektierten Journalisten der Frankfurter Zeitung geworden, veröffentlichte und rezensierte in den folgenden Jahren auch die Texte dieser beiden neuen Freunde. Alle drei waren an einer akademischen Karriere letztlich gescheitert, sie schrieben eher wissenschaftskritische als wissenschaftliche Texte. So entwickelten sie ihren Marxismus zu einem literarischen Verfahren weiter: große Themen in kleinen Texten behandeln, partikulare Alltagserfahrungen und historische Sammlerstücke auf das Allgemeine hin transparent machen, Kunst und Philosophie zu neuen Erkenntnisformen engführen. Gekannt hatten sie sich schon länger. Die Fronten des anfänglichen Konflikts zwischen Kracauer und Bloch verliefen durch das Feld der Theopolitik: Wie ließ sich theologischer Gehalt mit politischer Neugestaltung verbinden? Jedenfalls nicht durch das angemaßte »Prophetentum« Blochs, meinte Kracauer 1922, aber 1926 wurden sie sich untereinander und mit Walter Benjamin einig, dass eine neu versprachlichte Bibel – zumindest »jetzt und ins Deutsche«38 (S. 304) übersetzt – da auch nicht weiterhelfe, sondern ein Primat der Politik und »des Profanen« bestehe. Kracauer beurteilte auch Benjamins religionsphilosophische Versuche anfangs skeptisch. Die beiden lernten sich 1923 kennen, als Benjamin mit Habilitationsplänen nach Frankfurt kam. Gershom Scholem berichtete, Benjamin habe ihm 1923 in Frankfurt »besonders« den »sehr begabte[n] Kritiker« Kracauer vorgestellt. Der sei »der erste Mensch« gewesen, »der mit mir heftig über die metaphysischen Tendenzen Benjamins diskutierte, die er völlig ablehnte – bevor er sich mit ihm in den kommenden Jahren mehr und mehr anfreundete«.39 Als Kracauer ihm 1926 seine Kritik der Buber-Rosenzweig-Bibel vorlegte, empfahl BenjaminScholem, sie zu lesen, da sie ihm, »soweit ohne Kenntnis des Hebräischen eine gegeben zu werden vermag, schlechthin zutreffend vorkam, zudem [wie Benjamin seinen Zeitgenossen öfter unterstellte] mancherlei übernimmt, was ich mündlich ihm zu dem Thema gesagt«.40 (S. 283)
Scholem tauschte sich schon ein paar Jahre früher mit Rosenzweig über Fragen des Übersetzens aus. Rosenzweig war 1917 auf den jungen Scholem aufmerksam geworden, als dieser in der Wochenzeitung Jüdische Rundschau eine Kritik von Jiddisch-Übertragungen Alexander Eliasbergs veröffentlichte, die Rosenzweig gut gefiel. 1921 schickte er Scholem eine seiner ersten eigenen Übersetzungen – Der Tischdank –, worauf eine briefliche Kontroverse zwischen den beiden Übersetzern folgte. Scholem war in dieser Zeit in der zionistischen Jugendbewegung aktiv. Hier lernte er Ernst Simon kennen, der ihn, wie Scholem später berichtete, davon überzeugte, am Lehrhaus zu unterrichten. Zu dieser Zeit arbeitete Scholem bereits intensiv mit kabbalistischen Originaltexten. 1923 zog er nach Frankfurt, wo er in der Stadtbibliothek kabbalistische Handschriften studierte und kurz vor seiner Auswanderung in das britische Mandatsgebiet Palästina stand. Später wurde Scholem Professor für jüdische Mystik an der Hebräischen Universität Jerusalem. Im Zuge seines Aufenthaltes am Lehrhaus bot Scholem Lektürekurse zum Buch Daniel und dem Sohar an. Scholem war von den Übersetzungsfähigkeiten Rosenzweigs alles andere als überzeugt. Als er in der Jüdischen Rundschau vom 23. Dezember 1925 eine Leseprobe zum ersten Band der Bibelübersetzung sah, die er als »höllischen Waschzettel« bezeichnete, schrieb er an seinen Freund Simon: »Ich fürchte für diese Übersetzung das Schlimmste.«41 (S. 114) Denn er vermutete, dass Rosenzweig dabei federführend sei, und da er dessen Halevi-Übersetzung als »sehr schlecht« (S. 114) empfand, hatte er wenig Hoffnung, dass es bei der Bibel besser werde.
Die Übersetzung der hebräischen Bibel von Buber und Rosenzweig wurde also mit (durchwachsener) Spannung erwartet. Deren Umsetzung selbst ging nicht auf lange Planungen zurück, sondern auf einen Brief Lambert Schneiders vom 6. Mai 1925. Im Zuge seiner Verlagsgründung fragte der damals gerade einmal 25-Jährige bei Buber an, ob er nicht bei ihm eine Bibel für den Alltagsgebrauch herausgeben wolle. Buber, der bereits seit seinen Kindertagen über das Übersetzen nachdachte und kurz vor dem Krieg anvisiert hatte, sich der hebräischen Bibel anzunehmen, erweiterte das Vorhaben direkt zu einer ganz neuen Übertragung. Schnell konnte er auch Rosenzweig für das Vorhaben gewinnen. Zwar hatte dieser wenige Jahre zuvor noch die These vertreten, dass eine Übersetzung des hebräischen Urtextes ins Deutsche zweckwidrig sei, weil – so schrieb Rosenzweig in Zeit ists – eine Vermittlung jüdischer Inhalte »in deutscher Sprache ohne fremdgläubigen Beiklang« schlicht nicht möglich sei. »Christentum und deutsche Sprache« hätten sich, meinte er 1917, »seit Luther und länger schon vermählt«.42 Diese Position vertrat er nach seinen Übersetzungen des Tischdank und der Gedichte Halevis so nicht mehr. Dennoch war ihm Martin Luther erst als Vorbild, dann als »Konkurrenz« präsent.43 Rosenzweig ließ in der Zusammenarbeit mit Buber seine einstige Skepsis (um nicht zu sagen Ablehnung) gegenüber einer Neuübersetzung der Bibel ins Deutsche hinter sich. Im Januar 1926 charakterisierte er in einem Brief an den Frankfurter Rabbiner Jakob Horovitz diesen Prozess als Umlernen. Dieses Umlernen habe ihn, führte Rosenzweig aus, in der Bibel-Übersetzungsarbeit zu einer Revision derjenigen Grundsätze geführt, die für ihn noch in seinen Halevi-Übersetzungen bestimmend gewesen seien. Entscheidend war dabei der Einfluss Bubers, der, wie Rosenzweig schrieb, »mir zu grundsätzlich neuen methodischen Einsichten den Weg aufgeschlossen hat; er hatte eben über das Problem einer Bibelübersetzung schon jahrelang nachgedacht, ich kaum«.44
Buber und Rosenzweig waren sich unmittelbar darüber einig, ihre Schriftverdeutschung eng an das Original anzulehnen, sodass der hebräische Gehalt im Deutschen erhalten bliebe; dafür folgten sie gewissen Übersetzungsprinzipien. Den Text gliederten sie im Sinne der Kolometrie nach Atemeinheiten als »Sinnzeilen«45 (S. 109), die Kolen oder Kola und im Singular Kolon genannt werden, sodass das schließlich gedruckte Schriftbild äußerlich an ein Gedicht erinnern konnte. Sie suchten Alliterationen und lautliche Nähen beizubehalten, fanden Leitworte, durch die verschiedene Bibelstellen in Verbindung gesetzt wurden, und grübelten lange über Namen wie Wortgefüge. Um passende Wendungen zu finden, bedienten sie sich der Sprachgeschichte und dies geradezu programmatisch. So beschrieb Rosenzweig ihr Vorgehen 1927, in einem Gespräch mit Rudolf Stahl, den es – zusammen mit Ernst Heinrich Seligsohn und anderen – aus der liberalen Jugendbewegung an das Frankfurter Lehrhaus verschlagen hatte: »Wir haben ein Wort gefunden und dann als Beleg so lange im ›Grimm‹ oder sonstwo nachgeschlagen, bis wir die Wortbildungen gefunden haben. Damit haben wir nichts Neues in die deutsche Sprache eingeführt, sondern nur das Alte aufgenommen.«46 Diese Vorgabe erinnerte nicht nur an den deutschen Sprachpurismus des 19. Jahrhunderts, ganz buchstäblich arbeiteten sie auch mit den entsprechenden Wörterbüchern und anderen literarischen Quellen, um in den sprachgeschichtlichen Schranken einen hebräischen Klang zu ermöglichen. Sie strebten eine neue, eigene »Vermählung« der »Sprachgeister« – wie sie sich ausdrückten – an, der sie sich durch eine Erweiterung der deutschen Sprache aus sich heraus widmeten. Damit gab es gewisse Motive, die auf die deutsche Romantik zurückgingen, als Vor- und Vergleichsbilder nannten sie etwa Ludwig Tieck und Wilhelm Schlegel. Ihre wichtigste Quelle der deutschen Sprache jenseits von Martin Luther war aber zweifellos – wie sollte es anders sein – Johann Wolfgang von Goethe.
Gleichzeitig konsultierten sie in akribischer Detailarbeit die alten wie die modernen Kommentare des Judentums und bezogen frühere Tora- und Tanach-Übersetzungen mit ein. Insbesondere die Übertragungen von Samson Raphael Hirsch, dem Begründer einer neoorthodoxen Strömung im Judentum, wurden verschiedentlich als (oft ungenannte) Vorlage genommen, beispielsweise bei dem Ausdruck »Mondneuung«,47 aber auch Moses Mendelssohns Tora sowie Benno Jacobs und Arnold Ehrlichs Kommentare wurden unter anderem herangezogen. Neben der Lutherbibel spielten neuere Arbeiten der protestantischen Bibelkunde und -kritik in ihren Übersetzungsprozess hinein, wie jene des Alttestamentlers Emil Kautzsch. Buber und Rosenzweig verbanden die verschiedenen Quellenbestände durch eigene (interne) Kommentierung, Diskussionen, versuchsweises Vorlesen und auch Sprachgefühl. Mehr als eine Dekade später reflektierte Buber erneut auf ihren grundsätzlichen Anspruch: »[W]ir […] wussten uns in keine andre Pflicht genommen als das wirkliche, gesprochene und sprechbare Wort, das in der Schrift gefangen liegt, zu befreien und wieder in die Welt ertönen zu lassen: sage es was es sagen mag, die Welt dieser Stunde solls hören.«48 In dieser allgemeinen religiösen Aktualisierung reformulierten sie nichts Geringeres als jüdische Zugehörigkeit – in und mit der deutschen Sprache. Entsprechend breit war die Resonanz auf ihr Unterfangen. Nahezu alle einschlägigen deutsch-jüdischen Periodika berichteten in der folgenden Zeit darüber, der Anfang war indessen von ganz praktischen Herausforderungen in der Umsetzung geprägt.
Im gemeinsamen Prozess des Übersetzens etablierten sich bald mehr oder weniger feste Abläufe, die Buber folgendermaßen beschrieb: Zu Beginn legte er einen ersten Übersetzungsvorschlag vor, den sie als »Quartmanuskript« bezeichneten. Mitunter fügte er Marginalien hinzu, wenn er ein Wort zwar passend fand, aber doch unsicher war, was die traditionellen oder auch die modernen Kommentatoren dazu sagten, manchmal gab er auch Sprachgeschichtliches zu bedenken. Die erste Übersetzung kommentierte Rosenzweig meist relativ ausführlich in schriftlicher Form. Buber arbeitete wiederum die Anmerkungen ein und erstellte ein »Foliomanuskript«, das Rosenzweig erneut durchging.49 Auf die Manuskripte und Anmerkungen folgten Umbruch- und Fahnenkorrekturen. Mittwochs, wenn er in Frankfurt Vorlesungen hielt, besuchte Buber Rosenzweig und sie klärten offene Fragen. Auch im Schriftverkehr waren sie sich mal schnell einig, mal kam es vor, dass sie lang und breit über ein einzelnes Wort diskutierten. Zwar nicht die Gespräche, aber die anderen Schritte sind in ihren nicht zur Veröffentlichung vorgesehenen Arbeitspapieren festgehalten, in denen sie sich auch über Werbung und Wirkung austauschten – und dann über die Wahrnehmung. Zusammen mit den Briefen von Schneider an Buber zeichnen sie ein Bild von strebsamer Arbeit, Zeitdruck und intensiver Wortrecherche, vor allem aber zeugen sie von der geradezu aus dem Text herausspringenden Hingabe der Beteiligten.
Schneider, der für seinen in Gründung befindlichen Verlag den neuromantisch-religiösen von Eugen Diederichs zum Vorbild nahm, schoss immer wieder über das Ziel hinaus. Bei der Werbung etwa wollte er einen zu den Übersetzern passenden Text vorlegen und traf zwar einen Ton, der den beiden zusagte, aber nicht dem gesamten angedachten Publikum. Der Text variierte leicht von Anzeige zu Anzeige, in der Frankfurter Zeitung vom 13. Dezember 1925 lautete er: »Die Bibel / in der kosmischen Tiefe ihres Sinngehalts / Die Bibel / in der rhythmischen Gestalt des Urtextes / Die Bibel / in elementarer Treue gegen den Wortlaut / Die Bibel / im edelsten Deutsch unserer Tage«.50 (S. 105) Gut zehn Tage zuvor war die allererste Reklame des Werks im Börsenblatt gedruckt worden – mit falsch wiedergegebenem Titel: Statt Das Buch Im Anfang hieß es Das Buch im Anfang.51 (S. 99) Selbstredend war es nicht Schneiders Fehler, die Setzerei des Börsenblatts hatte einfach angenommen, dass sich hier jemand verschrieben hatte.52 In den folgenden Monaten schlich sich immer wieder das kleine »i« in Besprechungen ein, obwohl im Börsenblatt zeitnah zwei weitere Anzeigen veröffentlicht wurden, die den Titel in korrekter Form enthielten.53 Die Reklame erschien Mitte Dezember dann nicht nur in der Frankfurter Zeitung, sondern unter anderem auch in der Weltbühne, der Neuen Freien Presse und der Vossischen Zeitung.54 Der Titel wurde mitunter in Majuskeln wiedergegeben, schließlich ließ sich so das Problem mit der Schreibweise dezent umgehen.
Noch bevor die erste Anzeige erschienen war, hatte ausgerechnet Kracauer im Auftrag der Frankfurter Zeitung bei Buber einen Auszug zum Vorabdruck angefragt, der am 12. Dezember 1925 unter dem Titel Joßef der Traumdeuter gedruckt wurde.55 Nach der Lektüre dieses Textes bat Robert Weltsch, der Buber seit der Prager Zeit kannte, als Redakteur der Jüdischen Rundschau um eine Probe, die am 23. Dezember veröffentlicht wurde und die Scholem gegenüber Simon kommentierte – es handelte sich um Die Schöpfung.56 Keine zwei Wochen vor dem Erscheinen des Buches bereiteten dem Verleger wie den Übersetzern die nur sehr zögerlich eingehenden Vorbestellungen Sorgen, sodass sie vielleicht auch deswegen verstärkt versuchten, die Werbetrommel zu rühren.57
Wie ein roter Faden zieht sich indessen die Wahl des Papiers durch Schneiders Briefe (und später auch durch die Debatte). So nutzte er »Alfapapier«, das aus England importiert werden musste, was in der Reklame explizit Erwähnung fand. Neben logistischen Problemen, etwa bei Lieferung und Nachbestellung, zeigte sich im Druck zu allem Überfluss auch noch, dass das Papier »faserte«. (S. 100) Doch trotz aller Widrigkeiten konnte Das Buch Im Anfang Ende Dezember 1925 versendet werden. Zum Jahreswechsel trafen dann auch die ersten persönlichen Reaktionen bei Buber und Rosenzweig ein. Darunter waren gleich zwei Briefe von Susman, einer für Buber und einer für Rosenzweig, in beiden bedankte sie sich »von ganzem Herzen« für ihr »Geschenk«.58 (S. 119f.) Die Freude über Lob und Verbundenheit währte allerdings nicht lange.
Was auf jene, die sich um 1920 auf ihrer Suche nach Erlösergestalten begegnet waren, kurz nach der Veröffentlichung des ersten Bandes von Die Schrift zukam, ahnte wohl keiner von ihnen. Auch beteiligten sich bei weitem nicht alle, die sich direkt oder indirekt über Nobel kennengelernt hatten, an den bald aufbrechenden Konflikten. Erich Fromm etwa gab zu Pessach 1926 seine orthodoxe Lebensführung auf und scherte sich allem Anschein nach nicht mehr um die von den ehemaligen Weggefährten heiß diskutierten Fragen. Bereits am Lehrhaus hatten sich erste Sollbruchstellen religiöser Selbstvergewisserung nach dem Krieg gezeigt. Als ein Zeichen dafür liest sich eine Äußerung Simons, dessen Verehrung für Buber und Rosenzweig außer Frage steht, vom November 1923. Als ihm angetragen wurde, Vorstandsmitglied des Lehrhauses zu werden, lehnte er dies ab und begründete seine Entscheidung mit einer zunehmend wahrgenommenen »religiöse[n] Sensationslust« an der ehedem so vielversprechenden Institution.59 Dies ist nur eine kurze, aus ihrem Zusammenhang gerissene Einschätzung, aber sie steht doch emblematisch für tiefgreifende Probleme, die letztlich in dem Lehrhausgedanken selbst angelegt waren; in ihrer eigenen Weise wirken sie auch noch in der Debatte um die Schriftverdeutschung nach. Dies galt für die verschiedenen Seiten: Buber und Rosenzweig wandten sich in ihrer religiösen Perspektive auffälligerweise dem Urtext und seiner Zugänglichkeit zu – nicht nur, aber vielleicht auch, um der »Sensationslust« entgegenzuwirken –, und ihre Gegner kritisierten die politischen Implikationen des sprachlichen Ausdrucks in gewissem Sinne vor demselben Hintergrund.
Konfrontationen
Im Jüdischen Wochenblatt erschien am 15. Januar 1926 eine der Werbeanzeigen für Das Buch Im Anfang. Erneut hatte sich ein Fehler eingeschlichen; wenn auch diesmal keiner im Titel. Der Lapsus in der Anzeige vom 15. Januar befindet sich stattdessen ganz am Ende, fast schon im Kleingedruckten: »Das Werk erscheint […] auf echtem englischem Altpapier durch Jakob Hegner in Hellerau.« (S. 122) Aus dem teuren »Alfapapier« war »Altpapier« geworden. Als verantwortlicher Redakteur wird im Impressum Ernst Simon genannt. Auch wenn der Fehler kaum jemandem aufgefallen sein dürfte, gab es doch mindestens einen aufmerksamen Leser. Zehn Tage später wurde in der Frankfurter Zeitung eine Glosse gedruckt, die den Anzeigentext inklusive der Nennung des »englischen Altpapiers« wiedergibt und ihn wie folgt kommentiert: »Es schauert einem vor der kosmischen Rhythmik dieses edelsten Deutsches unserer Tage, dessen Treue gewiß der Echtheit des englischen Altpapiers entspricht.« (S. 123) Das »Altpapier« ist damit gleich doppelt exponiert. Die Notiz schließt mit der von Sarkasmus triefenden Einschätzung: »[E]in modernes Verdeutschungs-Unternehmen mit den tiefen Sinngehalten im Einbandentwurf. Sie hat uns lang schon gefehlt.« (S. 123) Dies war die erste öffentliche Reaktion. Die von Kracauer verfasste, aber nicht unter seinem Namen veröffentlichte Notiz stieß durchaus auf positive Resonanz: Die linksprotestantische Reformzeitschrift Neuwerk druckte sie in ihrer Aprilausgabe nach.1
Rosenzweig, dem der Fehler in Simons Anzeige ebenfalls nicht entgangen war, sandte am Folgetag Buber einen Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise zu. Schneider solle einen Brief aufsetzen, führte er aus, in dem die Feuilletonredaktion der Frankfurter Zeitung zur Berichtigung aufzufordern sei.2 Auch wollte Rosenzweig, dass der Urheber der polemischen Notiz ein Exemplar erhalte, »damit er sich vielleicht überzeugt, daß die vier Punkte des Prospekts, aus dem leider heut nötigen Posaunenjargon der Reklame in den auch mir lieberen Kammermusikstil des Privatabends transponiert, – der Wahrheit entsprechen«. (S. 124) Rosenzweig gestand also ein, dass sie (oder Schneider) einen »Posaunenjargon« gewählt hatten, bekräftigte aber zugleich den Gehalt ihres Anzeigentextes.
Noch wusste Rosenzweig nicht, wer für die Glosse verantwortlich war. Buber war anscheinend schnell informiert worden, vielleicht durch Schneider, der ihn am 29. Januar darüber in Kenntnis setzte, dass sich deren Verfasser das Buch zur Rezension vorgemerkt habe. Der Verleger fügte mit etwas Stolz hinzu: »das Begleitschreiben […] war ein wenig spöttisch«.3 (S. 124) Nach Abdruck der polemischen Notiz trafen mehrere kritische Zuschriften bei der Frankfurter Zeitung ein, woraufhin die Redaktion sich in aller Deutlichkeit hinter ihren Autor stellte: »Wir bitten die Einsender, sich bis zur Besprechung des Werkes gedulden zu wollen.«4 (S. 125f.) Margarete Susman bemühte bald ihre langjährigen Kontakte bei der Frankfurter Zeitung und sprach direkt mit Heinrich Simon, dem Vorsitzenden der Redaktionskonferenz, über Kracauers Notiz und die angekündigte, ja angedrohte Besprechung. Simon habe ihr gesagt, berichtete sie Buber am 9. Februar 1926, dass er Kracauer die »Gelegenheit« geben wolle, den »begangenen Fehler […] wieder gut zu machen«, »Kr. habe die Absicht, einen ›sehr schönen‹ Artikel über die Übersetzung zu schreiben«.5 (S. 129) Auch habe Simon ihr »fest [versprochen] noch einmal sehr ernsthaft mit Kracauer über die ganze Sache zu sprechen um ihn nicht im Zweifel darüber zu lassen, daß er etwas sehr Schlimmes und Törichtes begangen habe«. Buber zeigte sich daraufhin gegenüber Rosenzweig skeptisch und fragte: »Was soll denn das nun heissen, er wolle einen ›schönen Artikel‹ schreiben?«6 (S. 130)
Während sich die Lage hinsichtlich der Frankfurter Zeitung – vorerst – beruhigte, kam aus einer anderen, unerwarteten Richtung Kritik. Ausgerechnet Rosenzweigs Arzt und enger Mitarbeiter am Lehrhaus, Richard Koch, veröffentlichte in Der Morgen, im Februarheft 1926, unter dem Titel Bemerkungen zur neuen Verdeutschung der Heiligen Schrift eine scharfe Kritik. In Kochs Besprechung ist vor allem ein Punkt entscheidend, der auch die spätere Auseinandersetzung mit Kracauer bestimmt: die ästhetisierte Sprache der Verdeutschung.
Die Rezension wird mit einer allgemeinen Reflexion über die deutsche Sprache eröffnet. Diese, so Koch, sei »Ausdrucksform für die ewigen Dinge«. (S. 135) Er warnte daher: »Eine Übersetzung des Alten Testamentes in die deutsche Sprache greift tief in das Leben der Juden, in das deutsche Leben und in das Leben aller Menschen ein.« Die Bibel auf Deutsch, führte Koch aus, sei mit der Sprache und Bilderwelt Luthers eng verbunden, also ein Produkt aus dessen Zeit. Der Text Luthers aber habe sich im Laufe der Jahrhunderte von dieser Bilderwelt gelöst. Kochs Kritik setzte nun genau an diesem Punkt an: »Diese unserer natürlichen Sprache verlorengegangene Bildhaftigkeit haben Buber und Rosenzweig wieder hergestellt und ihre Übersetzung den Werken der Kunst damit nahe gerückt.« (S. 138) Dem Text werde so künstlich ein neuer Bilderkatalog hinzugefügt. Damit fielen sie aber, so sein Hauptvorwurf, der Gefahr anheim, »zeitlos Gewordenes aufs neue der Zeit auszusetzen« (S. 139) und dadurch – ob absichtlich oder nicht – eine »Lebendigkeit mit Kunstgriffen« zu erzeugen. (S. 138) Für ihn war das ganze Übersetzungsvorhaben damit letztlich zum Scheitern verurteilt. In Erinnerungen, die er im Februar 1948 festhielt, rekapitulierte er seine erste Einschätzung und schrieb nun, dass Bubers und Rosenzweigs Bibelübertragung »eine unschöne ästhetisierende schwülstige Verzerrung«, ja »statt einer Verdeutschung eine Entdeutschung« gewesen sei.7 (S. 442) Koch »witterte« bei dieser Art der »gekünstelten« Sprache den »Einfluß Stefan Georges«. (S. 442) Damit aber nicht genug: In seiner Besprechung in Der Morgen schlug Koch 1926 auch noch in die alte Papier-Kerbe, die das Unterfangen von Anfang an begleitete. Die »Schwäche der Arbeit« (S. 139), die Verkünstelung der Sprache, fand für ihn eine Bestätigung in der Wahl des Papiers, dieses sei derart empfindlich, dass es sich für mehrfachen Gebrauch schlicht nicht eigne. Mit dieser doppelten Kritik der Unbrauchbarkeit traf er ins Mark der Grundintention von Buber und Rosenzweig.
Kochs Kritik saß tief. Er hatte wohl selbst nicht damit gerechnet, ein so »großes Malheur« anzurichten. (S. 442) Rosenzweig ging die Angelegenheit, die er in einem Brief an Buber als Gift bezeichnete, »in den Magen« und brachte ihn dazu, sich sprichwörtlich zu übergeben.8 (S. 192) Bubers und Rosenzweigs Entgegnung stellte geradezu einen Selbstentgiftungsversuch dar. Die Replik verfasste federführend Buber. Rosenzweig fand sie »prachtvoll« und wünschte nur eine durch Susman inspirierte Verbesserung, die darauf zielte, denjenigen, die kein Hebräisch könnten, nicht automatisch die Berechtigung zur Kritik abzusprechen, solange sie sich nicht, wie Koch, erdreisteten, die Übersetzungsrichtigkeit an sich infrage zu stellen.9 (S. 141) Ihre »Abkochung«10 (S. 143) schickten sie an die temporäre Herausgeberin der Zeitschrift, Margarete Goldstein, die wegen krankheitsbedingter Abwesenheit ihres Mannes Julius die Geschäfte führte.
In ihrer Erwiderung wehrten sich Buber und Rosenzweig gegen Kochs Vorwurf, mit der Bibel – wie sie es ausdrückten – »Inzucht der Kunst zu treiben«.11 (S. 166) Sie erkannten darin dessen Verdacht, die Übersetzung sei nicht etwa nur das Produkt der Texttreue, die sie sich auf die Fahne geschrieben hatten. Mit diesem Vorwurf gingen Buber und Rosenzweig scharf ins Gericht, indem sie darauf hinwiesen, dass Koch, der kein Hebräisch konnte, überhaupt nicht in der Lage sei, dies zu beurteilen. Rosenzweigs ursprüngliche Idee war, insbesondere auch Laien als Dozenten ans Lehrhaus zu holen, und dafür hatte er unter anderem Koch zu gewinnen versucht. In der Auseinandersetzung verkehrte sich das nun ins Gegenteil. Auf ironische Weise schlugen Buber und Rosenzweig vor, Koch solle seine Vorwürfe am Text der Verdeutschung selbst aufzeigen, die vermeintliche Verkünstelung anhand des hebräischen Originals nachweisen. In der »leidenschaftliche[n] Zurückweisung« seiner Rezension meinte Koch, einen übertriebenen Angriff Bubers gegen ihn zu erkennen. (S. 146) Das »Wir«, mit dem die Autoren gemeinsam ihm gegenüber auftraten, ignorierte er schlicht. Rosenzweig nahm er als Mitverfasser und damit als Gegenspieler nicht wahr.
Koch sprach sich in einem Brief an den Herausgeber von Der Morgen dafür aus, von der Publikation der Replik Bubers und Rosenzweigs abzusehen, um eine drohende Eskalation zu vermeiden. Er habe nur über die »Wirkung der Übersetzung« geurteilt, nicht über die »Übersetzungstechnik«, von der er als »Nichtsachverständiger« nichts verstünde.12 (S. 146) Er empfand sich als Opfer von unbegründeten, persönlichen Angriffen und Unterstellungen vonseiten Bubers, die das Ziel verfolgten, ihn öffentlich vorzuführen. Er ließ es sich aber nicht nehmen, seinem Brief an Goldstein bereits eine Schlussbemerkung beizufügen, falls Der Morgen die Erwiderung doch druckte. Wie aus diesem Brief an Goldstein deutlich wird, hatte Koch große Sorge, dass die ganze Angelegenheit seine Beziehung zu Rosenzweig gefährden könnte. Rosenzweig hingegen nahm sich in der Abfassung der Replik bewusst zurück, nicht aber, um Koch zu schonen, sondern – im Gegenteil – weil er nicht, wie er es Buber gegenüber formulierte, »ohne persönliche Schärfe« gegen ihn hätte schreiben können, was aber der Sache nicht dienlich gewesen wäre.13 (S. 150) Dass Rosenzweig so über Koch dachte, war Letzterem wohl nicht bewusst.
Die Replik erschien gleich im nächsten Heft von Der Morgen im April; Kochs kurzer Text direkt dahinter.14 Im Ton deutlich defensiver, versuchte Koch darin noch einmal seine vormals gemachten Punkte gegen die Verdeutschung zu behaupten; letztlich aber streckte er die Waffen, um einer weiteren Konfrontation aus dem Weg zu gehen. In seinen Erinnerungen an diese Auseinandersetzung gab er Buber – Rosenzweig blieb als Kontrahent auch hier unerwähnt – sogar recht.15 Seinen Vorwurf, die Sprache sei verkünstelt und verleihe der Übersetzung »die Schwächen eines künstlichen Zeitstils«,16 (S. 438) hatte er schon 1931, in einem Brief an Buber, ein Stück weit revidiert. Der Ästhetizismusvorwurf war aber mit seiner Kritik der Verdeutschung vom Februar 1926 erst einmal in der Welt.
Unterdessen liefen die Vorbereitungen für Siegfried Kracauers Rezension – nicht nur bei Kracauer selbst. Margarete Susman, die nach der polemischen Glosse gewiss ahnte, was sich da zusammenbraute, versuchte das Schlimmste zu verhindern. Dazu hatte sie ja bereits im Februar mit Heinrich Simon gesprochen und sich irgendwann brieflich an Kracauer gewandt. Es ist jedoch nur ein zweiter Brief vom 22. März erhalten, mit dem sie auf Kracauers (gleichfalls nicht überlieferte) Antwort reagierte: Er werde sowohl einen Todkranken angreifen als auch ein Werk, dessen Sprache aus religiöser Tiefe geschöpft sei. Zu dieser schöpferischen Leistung stehe eine bloß »negative Kritik […] immer in einem Mißverhältnis« (S. 156). »Sie allein müssten wissen«, appellierte sie an Kracauers Gewissen, »ob der Wert Ihrer Überzeugungen den Wert dieses Daseins und seiner Äußerung aufwiegt«.17 (S. 157) Und ja: Für Kracauer selbst bestanden da überhaupt keine Zweifel. Schon vor der Publikation hatte er den Text an Walter Benjamin geschickt. Benjamin hatte ihn mit »äußerst intensivem Anteil gelesen« (S. 175) und kam zu dem Schluss, das sei »alles im höchsten Maße stichhaltig«.18 (S. 175)
Die schon vor Drucklegung so umstrittene Besprechung erschien in zwei Teilen am 27. und 28. April. Kracauer würdigte die beiden Übersetzer im ersten Absatz mit der marxistischen Formulierung, in ihrer zionistischen Jugendarbeit (Buber) respektive am Freien Jüdischen Lehrhaus (Rosenzweig) zeige sich der Versuch einer »Wendung von der Theorie zur Praxis« (S. 181) – der Rest des Textes diente allerdings dem Nachweis, dass sie daran gescheitert seien, die »Wirklichkeit« verfehlten, sich »von der Öffentlichkeit unseres gesellschaftlichen Daseins« (S. 194) abgewandt und in eine neuromantische Privatsprache abgekapselt hätten. Ihre Alliterationen erinnerten nicht an die Bibel, sondern an die völkisch-religiösen Runen Richard Wagners. In dieser Ähnlichkeit zeige sich symptomatisch das (Un-)Wesen des ganzen Projekts. Luthers Bibelübersetzung habe noch die ganze Wirklichkeit getroffen – weil sie religiöse und politische Bedeutung hatte, konnte sie die Welt verändern und die deutsche Sprache prägen, so Kracauer. Aber politische und religiöse Sphäre seien in der Geschichte der Moderne auseinandergetreten, die »profane« Sphäre müsse in ihrer Eigenlogik adressiert werden, und deren Nichtbeachtung führe mit zwingender Konsequenz zum Jargon der Buber-Rosenzweig’schen Übersetzung. Die Schriftverdeutschung, so Kracauers Urteil, »rührt die Gegenwart nicht auf. Sie ist ohne Aktualität«. (S. 194)
Kracauers Text plädiert für einen marxistischen Materialismus. Das entsprach der Philosophie, die er in den folgenden Jahren in der Frankfurter Zeitung entfaltete: »Der Prozeß führt durch das Ornament der Masse«, das heißt die gegenwärtige Gestalt der kapitalistischen Massenkultur, »mitten hindurch, nicht vor es zurück«,19 nur durch die bestimmte Kritik an der aktuellen Misere komme man weiter. Die Fähigkeit, das Profane zu adressieren, war das Kriterium, an dem Kracauer die Legitimität religiöser Rede maß. Hier zeigt sich die Überschneidung zweier Themen, die in der folgenden Debatte und ihrer Rezeption selten zusammen gedacht wurden. Der einen Seite ging es maßgeblich um Religion, der anderen vor allem um Politik – der Konflikt entstand daraus, dass hier zwei unterschiedliche Positionen darüber aufeinandertrafen, wie diese beiden Bereiche zueinander im Verhältnis standen. Zu solchen Metareflexionen waren aber alle Beteiligten nicht bereit. Rosenzweig schrieb Buber schon nach der Lektüre des ersten Teils von Kracauers Rezension: Falls sie eine Entgegnung verfassen sollten, dann nur unter »›schauderhaft höfliche[m]‹ Verzicht darauf, dem Rezensenten in seine metaphysisch-sozialwissenschaftlichen Gedankengänge zu folgen« (S. 193); umgekehrt war Kracauer weder des Hebräischen kundig noch willens, sich in die sprachliche Substanz der Übersetzung hineinzuarbeiten. Er versuchte dieses Problem zu umgehen, indem er den Übersetzern die von ihnen beanspruchte Treue gegenüber dem Original zugestand und argumentierte, diese Treue sei nutzlos, weil sie für die Gegenwart blind bleibe und sie entsprechend nicht zu erreichen vermöge. Ein Beispiel für gelungene Profanisierung benannte Kracauer vier Jahre später – Charlie Chaplins kurze, durchaus komische Reinszenierung des Kampfs von David und Goliath in The Pilgrim: »So klein ist David; so groß ist Goliath; so wird die Schleuder gewirbelt; so elend liegt der böse Riese zu Boden. Jedes weitere Wort wäre überflüssig.«20 In Kracauers Augen gelang Chaplins Neuinterpretation durch Verbildlichung im (Stumm-)Film, was eine Neu-Versprachlichung der »in Stummheit eingesenkten Schrift« (S. 197)21 gerade aufgrund der beabsichtigten Treue zum Text nie erreichen konnte – erst der Sprung ins Profane vermochte diese Wahrheit zu treffen.
Die von Kracauer beabsichtigte Profanisierung bedeutet Universalisierung – wo der Sieg Davids aus dem biblischen Kontext gelöst und zur frohen Botschaft darüber wird, dass auch der Kleinste die Welt verändern kann, droht David als Figur der jüdischen Geschichte zu verblassen. Die Forderung, das »Profane«, »unsere Zeit« als alleinigen Maßstab anzuerkennen, ließ sich auch als unbewusst »assimilatorisch-judäophobe« Tendenz verstehen.22 (S. 282) Auch in den Augen von Rosenzweigs Bewunderer Ernst Heinrich Seligsohn, der sich von liberal-jüdischer Seite für die Verdeutschung einsetzte, stand fest, die von Kracauer geforderte Verwandlung ins »Profane« komme einer Übersetzung »in den Sport- oder Kinojargon unserer großstädtischen Civilisation« gleich.23 (S. 291) Ihm zufolge war das genaue Gegenteil vonnöten, »das Wort der Schrift« müsse »sich selbst die Zeit erobern und darum gerade auch den Grund des Fremden haben«. (S. 291) Dagegen schloss Ernst Bloch sich Kracauers Profanisierungspostulat an, erkannte aber noch in Kracauers Absicht, die Religion revolutionär auszurauben,24 die Fortsetzung und Einlösung des biblischen Motivs, »die goldenen Gefäße der Ägypter zu stehlen und dem Dienst des wahren Gottes zu weihen; sonst bedürfte es ja überhaupt keiner Geschichtsphilosophie«.25 Diesem Ansatz nach steht selbst noch der marxistische Auszug aus der Religion in der Tradition der Exodus-Geschichte.
Kracauer selbst zählte die Bibel-Verdeutschung nicht im engeren Sinne zu den jüdischen Fragen, sondern vielmehr zum Diskurs über »religiöse Erneuerung überhaupt« (S. 197), also zu den neoreligiösen Aufbrüchen der 1920er Jahre. Passend dazu steht Die Bibel auf Deutsch im Kontext von Kracauers Werk in einer Reihe mit anderen Polemiken, die er zeitnah oder zeitgleich veröffentlichte: Am 27. April war auch eine sehr kurze Glosse über die völkische Wandervogel-Zeitschrift Der Zwiespruch erschienen,26 einen Tag zuvor ein Verriss der »religiösen Propagandawochen« des »Weltanschauungs«-Verlegers Eugen Diederichs, den Kracauer ebenfalls seiner Sprache – »stolze[r] Wortballungen« und »gellende[r] Interpunktionen« – wegen sezierte.27Diederichs prägte den Begriff »Neuromantik«, ein Attribut, das Kracauer auch auf den Stil der Buber-Rosenzweig-Bibel übertrug. Buber stand mit Diederichs in Austausch, und Lambert Schneider wollte sein Verlagsprogramm an dessen Verlag orientieren; insofern stand die Bibel-Verdeutschung wenigstens näher an Diederichs als an Wagner.
Durch die Verdeutschungsdebatte ziehen sich Probleme des Stils und der Ästhetik. Zwar wären sich alle Beteiligten darüber einig geworden, dass ästhetische Kriterien für eine Bibelübersetzung nicht maßgeblich seien. Doch waren Rosenzweig und Buber der Auffassung, ebendem Rechnung zu tragen, während Koch und Kracauer kritisieren, die religiöse Wirkung des Textes sei bloß ästhetische Suggestion. Susman wies bereits in ihrem Brief an Kracauer vom März 1926 darauf hin, dass Koch, ihrer Ansicht nach, die religiöse Sprache mit einer ästhetischen verwechselte.28 Als Rosenzweig dann nach dem Erscheinen von Kracauers Kritik von einem »Koch-Kracauerschen Ressentimentkrieg« gegen ihre Übersetzung sprach,29 machte er eine Verbindung zwischen den beiden im Vorwurf der Ästhetisierung aus. In verschiedenen Wahrnehmungen war insbesondere die akustische Dimension zentral. Die Übersetzung sollte das Wort, ja die Stimme Gottes in der Gegenwart, neu zum Klingen bringen; Kracauer hing sich an der »poetisierende[n] Weise« und dem »völkischen Tonfall« auf. (S. 195) In diese Kerbe schlug auch die Kritik Gershom Scholems, der ja schon Rosenzweigs Halevi-Übersetzung abgelehnt und Ende 1925 an Ernst Simon geschrieben hatte, er »fürchte für diese Übersetzung das Schlimmste« (S. 114). Am 27. April – also dem Erscheinungstag der Kracauer-Rezension – richtete er einen Brief an Buber, der ihm ein Exemplar von Das Buch Im Anfang





























