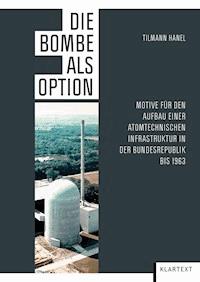
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Klartext
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Welche Akteure forcierten in der Bundesrepublik zur Adenauerzeit den Einstieg in die Atomkraftnutzung? Welche Motive standen hinter ihren Bemühungen? Und inwiefern zeitigen die damaligen Vorgänge auch heute noch Auswirkungen? Der Technikhistoriker Tilmann Hanel geht diesen Fragen gestützt auf eine breite Quellenbasis nach und zeigt auf, dass der von einzelnen Regierungsmitgliedern getragene Wunsch nach westdeutschen Atomwaffen nicht folgenlos blieb, sondern sich in der Errichtung von Anlagen manifestierte, die speziell auf die Herstellung von waffenfähigem Plutonium ausgerichtet waren. Zwar verfolgten Politik, Wissenschaft und Industrie unterschiedliche Interessen; gemeinsam bewirkten sie dennoch die Durchsetzung einer für den zivilen Gebrauch zu gefahrenträchtigen Technik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tilmann Hanel:
Die Bombe als Option
Tilmann Hanel
Die Bombe als Option
Motive für den Aufbaueiner atomtechnischen Infrastrukturin der Bundesrepublik bis 1963
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
1. Auflage Januar 2015
Satz und Gestaltung: Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, Hamm
Umschlaggestaltung: Volker Pecher, Essen
Umschlagabbildung: Viola Sonans
ISBN 978-3-8375-1283-0
eISBN 978-3-8375-1420-9
© Klartext Verlag, Essen 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.klartext-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.Einleitung
1.1Einführung in die Themen- und Fragestellung
1.2Stand der Forschung
1.3Thesen und Herangehensweise
1.4Quellenlage
2.Die Vorgeschichte der bundesdeutschen Reaktorentwicklung
2.1Atomforschung im Nationalsozialismus
2.2Atomtechnik und Atombomben
2.3Außenpolitische Entwicklungen 1945-54
3.Exkurs: Reaktorforschung im Ausland
3.1Motive für den Aufbau atomtechnischer Infrastrukturen
3.2Fallbeispiel: Schweden
3.3Fallbeispiel: Schweiz
4.Protagonisten und Motive
4.1Politik
4.2Wissenschaft
4.3Wirtschaft
4.4Militär
5.Der Aufbau einer atomtechnischen Infrastruktur
5.1Die Anfänge bis zum „Eltviller Programm“ 1957
5.2Umsetzung und Erweiterung des Programms: 1957-61
5.3Wandel der Prioritäten: 1961-63
5.4Die Abkehr vom Schwerwasserreaktor: 1963-1974
6.Ergebnisse und Folgen der bundesdeutschen Atompolitik bis 1963
6.1Die frühe bundesdeutsche Atomtechnik im internationalen Vergleich
6.2Außenpolitische Ergebnisse
6.3Tarnung der Motive und die Grenzen der Tarnung
6.4Spätfolgen der anfänglichen Typfestlegung
7.Fazit
8.Verzeichnisse
8.1Abkürzungen
8.2Quellen
8.3Literatur
8.4Medien
Vorwort
Das vorliegende Buch ist eine geringfügig überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die ich im Wintersemester 2013/14 am Fachbereich 2 der Technischen Universität Darmstadt eingereicht und verteidigt habe. Erstmals widmete ich mich der Thematik in einem enger gefassten Rahmen mit meiner 2009 ebenfalls dem Fachbereich 2 der TU Darmstadt vorgelegten Masterarbeit, deren Ergebnisse zum Teil in die Doktorarbeit einflossen.
Danken möchte ich ganz besonders meinem Erstgutachter Prof. Dr. Mikael Hård, der mich mit großem Einsatz unterstützte und mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Auch Prof. Dr. Helmuth Trischler bin ich für wertvolle Tipps und die Übernahme der Gutachterrolle sehr dankbar.
Für eine über zweijährige finanzielle Förderung des Projekts „Die Bombe als Option. Politische und wirtschaftliche Interessen am Aufbau einer kerntechnischen Infrastruktur in der Bundesrepublik 1954-63“ (DFG HA 3015/5) zu großem Dank verpflichtet bin ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Zuvor hatte die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS) der TU Darmstadt das Vorhaben angeregt, meine Forschungen ein Jahr lang finanziert und mir die Möglichkeit des fächerübergreifenden Austauschs geboten. Dafür danke ich Prof. Dr. Franz Fujara, Prof. Dr. Wolfgang Liebert und den übrigen Mitgliedern der Arbeitsgruppe.
Prof. Dr. Dieter Schott, der einstmals so freundlich war, meine Masterarbeit zu betreuen, unterstützte das Gelingen der Dissertationsschrift und deren Überarbeitung mit hilfreichen Anmerkungen; Prof. Dr. Mark Walker steuerte Kommentare bei, die eine geschätzte Anregung waren. Vielen Dank!
Ebenfalls zu Dank verpflichtet bin ich Dr. Roland Kollert; er half mir mit seinem überragenden Fachwissen dabei, meine Gedanken in einem frühen Stadium der Beschäftigung mit der bundesdeutschen Atomwirtschaft zu sortieren und gab mir wichtige Anregungen mit auf den Weg.
Dr. Dirk Reitz danke ich für die Vermittlung des Kontakts zu IANUS sowie für seinen freundschaftlichen Rat und manch fruchtbare Diskussion.
Bedanken möchte ich mich außerdem bei Nadja Schmitt, die das Projekt mit viel Engagement als studentische Hilfskraft unterstützte, sowie bei den Mitarbeitern der von mir besuchten Archive.
Der Dank an mein privates Umfeld soll nicht hier übermittelt, sondern persönlich vorgetragen werden; als Korrekturleserinnen der Dissertationsschrift sei aber meiner Schwiegermutter Rosemarie Horn und ihrer entzückenden Tochter Dr. Melanie Hanel schon an dieser Stelle sehr herzlich gedankt.
1.Einleitung
1.1Einführung in die Themen- und Fragestellung
Bei allen derzeit in Deutschland noch zur Stromerzeugung genutzten Atomreaktoren1 handelt es sich – ebenso wie beim überwiegenden Anteil der Anlagen weltweit, darunter auch der jüngste Unglücksreaktor in Fukushima – um sogenannte Leichtwasserreaktoren. Die Hauptlinie dieses Typs2 stellt dabei die direkte Weiterentwicklung eines atomaren U-Boot-Antriebs der US-amerikanischen Marine dar, der erstmals in dem mit seiner Polarunterquerung bekannt gewordenen Unterseeboot USS Nautilus eingesetzt wurde. Als Prototyp der heutigen Kernkraftwerke kann die 1957 in Betrieb genommene Anlage in Shippingport, Pennsylvania, gelten. Sie basierte in wesentlichen Teilen ihrer Technik auf vergrößerten Varianten von Komponenten des Reaktors auf der Nautilus.3
Dass die Nutzbarmachung der bei der Atomkernspaltung entstehenden Energie schon früh vor allem unter militärischen Aspekten erforscht wurde, ist allgemein bekannt. Weniger im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert hingegen ist die Tatsache, dass auch die zur Stromerzeugung verwendeten Atomanlagen technisch nie eine wirkliche Abgrenzung zum militärischen Verwendungsbereich erfuhren. Welche Konsequenzen sind aus der Kenntnis um diese Nähe abzuleiten für eine Beurteilung der bundesdeutschen Kerntechnik? Deren Entwicklung stand, nachdem die deutsche Atomforschung im Zweiten Weltkrieg an der Bereitstellung einer kriegsentscheidenden Waffe gescheitert war, von Anfang an unter der Prämisse, militärischen Interessen nicht dienen zu dürfen. Dies zumindest war der Eindruck, den überzeugender noch als die Protagonisten der Anfangszeit die späteren Wortführer der Atomtechniknutzung in der Öffentlichkeit zu verbreiten suchten.
Die vorliegende Arbeit widmet sich den Aufbaujahren der kerntechnischen Infrastruktur in der Bundesrepublik. Der zeitliche Rahmen reicht dabei von 1954, als die verschiedenen Akteursgruppen in Erwartung der bevorstehenden bundesdeutschen Souveränität ihre Vorbereitungen konkretisierten und seitens der Wirtschaft erste organisatorische Strukturen geschaffen wurden, bis 1963, als nicht nur Konrad Adenauers Kanzlerschaft endete, sondern auch das Beharren auf einem eigenen und von den USA unabhängigen Reaktortyp aufgegeben wurde. Dieser Typ, der sogenannte Schwerwasserreaktor, war anders als der US-amerikanische Leichtwasserreaktor kein ehemaliger U-Boot-Antrieb, sondern stand in der Tradition der deutschen Forschungen während des Krieges und war in den 1950er Jahren weitgehend von denselben Forschern weiterentwickelt worden. Er fand Verwendung in drei Anlagen: zweifach im Kernforschungszentrum Karlsruhe und einmal im Kernkraftwerk Niederaichbach.
Die Analyse der Entstehungsgeschichte dieser Anlagen macht einen wichtigen Teil der vorliegenden Arbeit aus. Sie soll dazu dienen, die Ungereimtheiten aufzuzeigen, die sich aus der Deklaration der bundesdeutschen Kerntechniknutzung als per se „friedlich“ einerseits und der in höchstem Maße subventionierten Forschung an potenziell militärisch verwendbaren Großanlagen andererseits ergeben. Dass die der Atomkraft von ihren Befürwortern stets zugeschriebene Eigenschaft als zumindest potenziell billigste Energiequelle dabei niemals Realität war, offenbarte sich nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Im Gefolge des Schocks über die Anfälligkeit auch westlicher Anlagen wurde selbst im atomkraftnahen Lager manche Aussage getätigt, die nicht mehr der früher geltenden Diktion entsprach. „Wenn man die Kernenergie allein an den Geboten der Marktwirtschaft messen wollte“, so der damalige FDP-Generalsekretär Christian Lindner im April 2011, „hätte es sie nie geben können.“4
Doch welche Motive standen dann hinter der Atomkraftnutzung in der Bundesrepublik? Die hier vorgenommene Untersuchung widmet sich den Interessen maßgeblicher Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Militär. Vorrangig wird erörtert, inwiefern der öffentlich von allen Beteiligten gelobte und schließlich auch geübte Verzicht auf die Herstellung bundesdeutscher Kernwaffen tatsächlich beabsichtigt war. Dienten die Verzichtserklärungen möglicherweise dazu, die Ziele der Protagonisten zu verhüllen, um in Ruhe eine Option auf die Produktion nationaler Kernwaffen schaffen zu können? Im Zentrum der Arbeit stehen dabei Vorgänge rund um die Errichtung der ersten beiden Schwerwasserreaktoren im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Es soll im Folgenden gezeigt werden, dass die Wahl der zu verwendenden Reaktortechnologie deutlich stärker als bisher angenommen von der Frage beeinflusst wurde, welcher Typ die größere Menge an waffenfähigem Plutonium zu produzieren in der Lage sei. Tatsächlich legt insbesondere die Analyse der technologischen Entscheidungen den Schluss nahe, dass der in Tradition zu den deutschen Kriegsforschungen stehende Schwerwasser-Natururanreaktor von der Regierungspolitik vorrangig gefördert wurde, um die Voraussetzungen für eine bundesdeutsche Atombombenproduktion zu schaffen.
In diesem Zusammenhang ebenso wie in Verbindung mit den Forschungen im Zweiten Weltkrieg ist die Rolle der beteiligten bundesdeutschen Kernforscher zu betrachten. Inwieweit konnten diese – die nach außen hin schon vor der „Göttinger Erklärung“ einen rein an zivilen Verwendungszwecken der Kerntechnik interessierten Kurs zu verfolgen vorgaben – um die militärisch-diplomatischen Ambitionen der Bundesregierung wissen? Falls ja, wie gingen sie mit ihrem Wissen um? Welche Motive bewegten die Kernforscher dazu, trotz ihrer öffentlichkeitswirksam bekundeten Ablehnung militärischer Atomforschung die Öffentlichkeit nicht über die aus der von ihnen gleichzeitig zur Nutzung empfohlenen zivilen Kerntechnik automatisch entstehenden militärischen Möglichkeiten aufzuklären? Glaubten sie aufrichtig daran, dass die Atomkraft bei ziviler Nutzung segensreich sein könnte, dass aber eine Verwirklichung dieser Vision ohne die staatliche Unterstützung für fraglich erachtet werden musste? Zugleich ist zu fragen, ob in einer solchen Haltung nicht auch partielle Kontinuitäten im Verhalten der beteiligten Wissenschaftler zu erkennen sind, die vom „Dritten Reich“ über die „Stunde Null“ hinaus bis weit in die Geschichte der Bundesrepublik hineinreichen in Form einer bereitwilligen Anpassung an von Politik und Militär vorgegebene Anforderungen bei gleichzeitiger Legitimierung der eigenen Forschungen als unpolitisch.
Zu überprüfen ist darüber hinaus, inwieweit das Zusammenwirken der relevanten Akteursgruppen generell in der Tradition deutscher Großforschung steht. Wie zu zeigen ist, bildeten die am Aufbau der bundesdeutschen Kerntechnikinfrastruktur Beteiligten eine nach außen weitgehend abgeschlossene Gruppe. Dieser Kreis Eingeweihter war beschränkt auf relativ wenige, jedoch an entscheidenden Stellen wirkende Mitglieder. Neben Vertretern der Politik gehörten ihm auch Wissenschaftler, Militärs und Führungskräfte der für die Kerntechnikentwicklung relevanten Großfirmen an, die das von der Politik vorgegebene Ziel einer unter strikter Geheimhaltung zu verwirklichenden atomaren Rüstung der Bundesrepublik aus teils unterschiedlichen Eigeninteressen heraus stützten. Der strukturelle Rahmen der bundesdeutschen Atomforschung im Betrachtungszeitraum kann aufgrund der engen Zusammenarbeit der partizipierenden Akteursgruppen als militärisch-industriell-wissenschaftlicher Komplex5 bezeichnet werden.
Helmuth Trischler skizziert, dass im Zentrum des von Franz Josef Strauß entwickelten und der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards entgegenstehenden Konzepts einer „staatsinterventionistischen, nicht-marktwirtschaftlichen Technologie- und Industriepolitik“ militärisch relevante Schlüsseltechnologien standen.6 Ich glaube zeigen zu können, dass die frühe bundesdeutsche Kerntechnikentwicklung – trotz allseitiger Tarnung der mit ihr verbundenen militärischen Ambitionen – ein geradezu idealtypisches Ergebnis dieser Politik darstellt und ihre Geschichte einen weiteren Beleg dafür liefert, „wie eng nationales Sicherheits- und nationales Innovationssystem in Deutschland auch nach 1945 miteinander verflochten waren.“7 Gleichwohl verkehrt sich der von Trischler für die übrige Militärforschung festgestellte, vergleichsweise „hohe Grad an Internationalität“8 hier ins Gegenteil. Dass dabei gerade auf dem politisch wie moralisch besonders brisanten Gebiet der Kerntechnik etliche Protagonisten eine politisch wie moralisch fragwürdige Vergangenheit aufwiesen, ist mehr als nur eine Randnotiz. Denn sie waren es, die auf Grundlage von manch struktureller Kontinuität mit ihrer Betätigung dazu beitrugen, in der Bundesrepublik die Grundlage zu schaffen für den Durchbruch der Kernkraftnutzung, wie wir sie heute kennen. War dieser Durchbruch unausweichlich? Mit der Antwort darauf wird die vorliegende Arbeit enden; den Weg dorthin konkretisieren die folgenden Teilkapitel.
1.2Stand der Forschung
Die bisherige Forschung zur Schnittmenge der Themenfelder „Bundesrepublik der Ära Adenauer“ und „Atomkraft“ besteht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aus Werken zu den politischen Bemühungen der Bundesregierung um größeren Einfluss auf die Nuklearpolitik der westlichen Verbündeten. Wegweisend für eine ganze Anzahl Studien dieser Art waren dabei Dieter Mahnckes „Nukleare Mitwirkung“9 und Catherine Kellehers „Germany and the Politics of Nuclear Weapons“.10 Diese wie auch neuere Arbeiten weiterer Autoren11 und zuletzt der anlässlich des Jubiläums der Spiegel-Affäre verfasste Beitrag Eckart Conzes12 folgen dabei im Wesentlichen der in Westdeutschland wie von dessen NATO-Verbündeten offiziell stets vertretenen Ansicht, die Bundesrepublik habe nach ihrem Verzicht in den Pariser Verträgen keine ernsthaften Ambitionen auf eine unabhängige Produktion eigener Atomwaffen gehegt. Eine solche Herangehensweise erklärt auch, warum sich die meisten geschichtswissenschaftlichen Studien zur Atom- und auf Atomwaffen bezogenen Außenpolitik der Bundesregierungen in den 1950er und 60er Jahren beinahe ausschließlich mit den bundesdeutschen Wünschen nach Partizipation am Atomwaffenarsenal der Verbündeten oder allenfalls mit angepassten Verteidigungsplänen als Reaktion auf veränderte Nuklearstrategien der Verbündeten beschäftigen, nicht jedoch mit dem Aufbau einer kerntechnischen Infrastruktur in der Bundesrepublik.
Wolfgang Müller wiederum beschäftigt sich in seiner zweibändigen „Geschichte der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland“ zu Planung und Bau der bundesdeutschen Atomanlagen sehr detailliert mit den finanziellen sowie forschungs-, energie- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, ohne dabei jedoch eine Verbindung zu den der Technik unweigerlich innewohnenden machtpolitischen Aspekten zu ziehen.13 Der Grund hierfür ist vermutlich nicht zuletzt im Lebenslauf Müllers, dem langjährigen Chefredakteur des Branchenblattes „Atomwirtschaft – Atomtechnik“, zu suchen. Sein umfangreiches Werk kann insofern auch als Quelle für den Umgang eines ehemaligen Protagonisten mit der bundesdeutschen Atomgeschichte angesehen werden. Aufgrund des akkuraten wissenschaftlichen Apparates, der durchgehenden Verwendung auch archivalischer Quellen und der Bezugnahme auf geschichtswissenschaftliche Forschungsliteratur wird es hier dennoch selbst der Letzteren zugeordnet.
Als Ausnahmeerscheinung sind angesichts der überwiegenden Beschäftigung der Literatur mit bündnispolitischen Aspekten und von Müllers unkritisch-deskriptivem Werk bislang die verschiedenen Arbeiten Joachim Radkaus zu bezeichnen, allen voran sein entsprechendes Hauptwerk zu „Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft 1945-1975“.14 Obwohl dieses sich vorwiegend mit den übrigen die Errichtung der bundesdeutschen Kerntechnik-Infrastruktur beeinflussenden Rahmenbedingungen auseinandersetzt, thematisiert Radkau auch die Problematik des untrennbaren Nebeneinanders von militärischer und ziviler Kernenergienutzung. Ein kurzer Abschnitt behandelt gar die möglichen Gründe für den von der Bundesregierung und führenden Industriellen forcierten Aufbau einer inländischen Plutoniumproduktion.15 Radkaus Fazit bezüglich der Zielstrebigkeit der staatlichen Aktivitäten indes fällt hier, auch gegenüber späteren Ausführungen, in denen er offener auf mögliche machtpolitische Ambitionen der politischen Akteure verweist,16 eher zurückhaltend aus.17 Im Gefolge von Radkaus Ausführungen finden sich vermehrt Einschätzungen, die den Bau eigener westdeutscher Kernwaffen zumindest als vorübergehende „distant option“18 betrachten oder, wie Marc Trachtenberg,19 gar offensiv die These von durch die Politik gefassten Plänen einer bundesdeutschen Atomrüstung vertreten.
Radkau selbst wiederum unterließ es in der aktualisierten Neufassung seiner Geschichte der bundesdeutschen Atomwirtschaft,20 die von ihm zwischenzeitlich offener thematisierten militärisch-diplomatischen Interessen an der Kerntechnik detaillierter zu betrachten und so mit seinem atomgeschichtlichen Hauptwerk zu verbinden. Vielmehr wurde „Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft“ zwar um die Co-Autorenschaft Lothar Hahns und eine chronologische Fortschreibung bis in die Gegenwart erweitert, auch begradigte Radkau die in „Aufstieg und Krise“ aufgrund von Breite und Tiefe der Untersuchung unübersichtliche Gliederung durch Kürzungen und strich zugleich den Anmerkungsapparat; bezüglich des hier behandelten Sujets der Verbindung von Atomwirtschaft und Außenpolitik in der Bundesrepublik unterblieb jedoch jegliche Neubewertung. Radkaus diesbezügliche Kernaussage lautet nahezu wortgleich hier wie dort: „Eine zielstrebige Steuerung der deutschen Atomentwicklung im militärischen Interesse ist nicht zu erkennen und [ist]21 auch wenig wahrscheinlich.“22
Angesichts der nur geringen textlichen Veränderungen bezüglich der Geschehnisse der 1950er und 60er Jahre und der Ausrichtung auf eine breitere Leserschaft liegt der Wert der Neuausgabe im Sinne vorliegender Arbeit vor allem in der Einleitung. Dort thematisiert Radkau Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Originals ebenso wie seine Verbindungen zu manchen Angehörigen der nuklearen „Community“: Er berichtet von seinem Glück, Zugang zu den ehedem noch ungereinigten Akten von Atomministerium, Atomkommission und Reaktorsicherheitskommission erlangt zu haben,23 dem sogar „großen Glück“, für sein ursprüngliches Werk „nicht juristisch belangt worden zu sein“24 und der Empfindung, mehr mit der Forscherbegeisterung seiner Bekannten aus der „Community“ sympathisiert zu haben als mit der Wut ihrer Gegner.25 All dies lässt besser verstehen, weshalb Radkau sich, trotz seiner andernorts deutlich geäußerten Kenntnis der Zusammenhänge von Atomtechnik und atomdiplomatischen Ambitionen in der Bundesrepublik, zu einer detaillierteren Erörterung der Schnittstellen nicht durchringen mochte.
Trotz Radkaus neuerlicher atomgeschichtlicher Betätigung gilt weiterhin, dass eine umfassende Auseinandersetzung mit dem gesamten Themenkomplex von außen- und wirtschaftspolitischen Überlegungen bis zu den tatsächlich gebauten Atomanlagen bislang erstaunlicherweise unterblieben ist. Obwohl die „Dual-Use“-Ausrichtung der frühen staatlichen Atompolitik in der Göttinger Erklärung der 18 Atomwissenschaftler keine Erwähnung fand und eine mögliche machtpolitische Ausnutzung der bundesdeutschen Kerntechnik-Infrastrukturen danach nur noch selten öffentlichkeitswirksam thematisiert wurde, verwundert es dennoch, dass kein geschichtswissenschaftliches Werk die im Folgenden untersuchten bundesdeutschen Bestrebungen zur Schaffung einer nationalen Produktionsmöglichkeit für Kernwaffen zentral behandelt. Auf der Seite der Politikwissenschaft hat sich Roland Kollert der Thematik zwar unter dem hier beschriebenen Ansatz genähert, seine Forschungen blieben jedoch unvollendet und ergaben statt der ursprünglich beabsichtigen ausführlichen Auseinandersetzung ein zwar aussagekräftiges, jedoch knapp gehaltenes Arbeitspapier über mögliche Verbindungen der bundesdeutschen Verteidigungs- und Außenpolitik zu einzelnen Kerntechnikprojekten.26
Ebenso existiert zwar vom Adenauer-Biografen Hans-Peter Schwarz ein Aufsatz über „Adenauer und die Kernwaffen“,27 dessen Hauptaussagen sich auch im später erschienenen zweiten Band der Adenauer-Biografie des Autors finden.28 Schwarz konzentriert sich allerdings ganz auf die persönliche Rolle des Kanzlers und den Umstand, dass dieser mehr über die Möglichkeiten „moderner“ Waffen gewusst habe, als gemeinhin angenommen werde. Eine umfassendere Analyse des Geflechts von ziviler und militärischer Kerntechnik unterbleibt dabei. Lediglich Peter Fischers Arbeit über „Atomenergie und staatliches Interesse“29 weist in diese Richtung; der gewählte Untersuchungszeitraum endet allerdings 1955 und damit schon kurz nach den ersten Weichenstellungen. Die Arbeit Fischers wurde als Teil des Nuclear History Program (NHP) der Stiftung Wissenschaft und Politik veröffentlicht. Die übrigen Werke dieses Programms beschäftigen sich indes vornehmlich mit der Rolle von Atomwaffen im Rahmen der internationalen Bündnispolitik und tasten die zeitgenössische bundesdeutsche Außendarstellung eines grundsätzlich nicht nach eigenproduzierten Atomwaffen strebenden Landes nicht an.30 Ihnen zur Seite gesellt sich der 2013 erschienene Beitrag Stephan Geiers,31 der sich ebenfalls nicht näher mit der Rolle der bundesdeutschen Kerntechnik auseinandersetzt.
Auch Michael Eckert beschäftigte sich auf bündnispolitischer Ebene mit den westdeutschen Nuklearambitionen.32 Er stellte dabei explizit die Problematik des weitgehenden Nebeneinanders ziviler und militärischer Technik fest; seine recht knappen Beiträge zum Thema bieten allerdings noch keine umfassende Analyse des gesamten Themenkomplexes zwischen Wirtschafts- und Außenpolitik sowie ziviler und potenziell militärisch nutzbarer Kerntechnik. Erwähnt werden muss zudem die politikwissenschaftliche Arbeit Matthias Küntzels, die bereits in den frühen 1990er Jahren unter dem Titel „Bonn und die Bombe“ publiziert wurde und den hier thematisierten Zeitraum nur kurz berührt.33 Obgleich Küntzel sich ebenso kenntnisreich wie tabubrechend mit den atomdiplomatischen Ambitionen der verschiedenen Bundesregierungen befasste, unterließ er es, die Verbindung zwischen Atomwaffenstreben und Atomtechnik näher zu untersuchen. Michael Knoll wiederum wirft in seiner Dissertationsschrift34 zwar die Frage nach möglichen Zusammenhängen auf; mit der irrigen Annahme, die – unter militärischen Gesichtspunkten entscheidende – „Konstruktion von Reaktortypen, die die Plutoniumentnahme während des laufenden Prozesses ermöglichen“, sei „nicht realisierbar“ gewesen,35 beraubt er sein Werk in diesem Punkt aber der Urteilskraft und kommt hier folgerichtig nicht zu neuen Ergebnissen.
Noch weniger thematisiert als die regierungsseitigen Ambitionen – die zumindest verschiedentlich Erwähnung finden – wurde in der geschichtswissenschaftlichen Literatur bislang die Rolle der chemischen Industrie. Das vehemente Engagement einiger ihrer Vertreter beim Aufbau der bundesdeutschen Kerntechnikinfrastruktur erscheint schwer erklärlich. Anhand der Biografien leitender Persönlichkeiten wie der des Vorstandsvorsitzenden der Farbwerke Hoechst, Karl Winnacker, denen aufgrund der Exklusivität des Kreises der eingeweihten Entscheidungsträger rund um die „Physikalische Studiengesellschaft“ besondere Bedeutung zugemessen werden muss, soll erörtert werden, inwieweit auch nicht kommerziell orientierte Motive eine Rolle für die Partizipation am ersten deutschen Atomprogramm spielten.
Die Rolle der Atomforscher ist schon häufig thematisiert worden, stellvertretend sei Elisabeth Kraus’ „Von der Uranspaltung zur Göttinger Erklärung“ angeführt.36 Die Betrachtung richtet sich hierbei zwar auf die Verantwortung der Wissenschaftler, beantwortet jedoch nicht die sich aufdrängende Frage, weshalb Wissen um die „Dual-Use“-Möglichkeit der Atomtechnik nicht an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Eine Beschäftigung mit der Motivation der Initiatoren der Göttinger Erklärung unter diesem Blickwinkel verspricht daher immer noch ertragreich zu sein. Um überhaupt in der Lage zu sein, etwaige Kontinuitäten im Verhalten der Atomforscher feststellen zu können, ist das Wissen um die Tätigkeit der betreffenden Personen zur Zeit des „Uranvereins“ während des Krieges unabdingbar. Dieser Bereich ist indes durch Mark Walker glänzend erforscht,37 der zudem in jüngeren Veröffentlichungen38 plausible Erklärungsmuster für die Rechtfertigungsversuche der Forscher in der Nachkriegszeit liefert. So enttarnt Walker die gerne geglaubte39 Schutzbehauptung der Wissenschaftler, man habe Hitler keine Atomwaffen zur Verfügung stellen wollen, als doppelten Versuch, das eigene Renommee zu wahren: In Wahrheit sei man im Krieg an der Bombe gescheitert – obwohl man durchaus, wenn auch angesichts fehlender Ressourcen weitgehend chancenlos – in diese Richtung gearbeitet habe. Vor diesem Hintergrund muss wiederum die in der Göttinger Erklärung erfolgte Distanzierung vom Bau atomarer Waffen bei gleichzeitiger Befürwortung ziviler Atomkraftnutzung deutlich kritischer hinterfragt werden, als dies, trotz in diese Richtung gehender jüngster Ansätze Cathryn Carsons,40 bislang geschehen ist.
Dass sich am Konzentrationspunkt der hier analysierten Geschehnisse, dem Kernforschungszentrum Karlsruhe, eine überraschend große Anzahl ehemals hochrangiger Nationalsozialisten versammelte, ist keine neue Erkenntnis. Schon Robert Jungk stellte in seinem populären Werk „Der Atomstaat“ fest, dass die Stimmung an dem für die nuklearen Ambitionen der Adenauer-Regierungen so bedeutsamen und angesichts der Ambivalenz des Forschungsgegenstandes heiklen Zentrum von Personen geprägt werde, „die einer früher in Deutschland vorherrschenden Geisteshaltung immer noch eng verbunden“ seien.41 Teil der im Folgenden vorgenommenen Analyse des mit den frühen bundesdeutschen Atomplänen verbundenen Interessengeflechts soll es sein, diesen Befund zu überprüfen.
Die Beziehungen zwischen Politik und Militär in der Bundesrepublik der 1960er Jahre wurden unter anderem bereits von Detlef Bald in seinem Werk „Politik der Verantwortung“42 beschrieben; Bald geht dabei davon aus, dass sich das Militär – als „Lehre“ aus der Zeit der Weimarer Republik – gegenüber der Politik die im Kontakt mit den NATO-Verbündeten auszuübende Entscheidungsgewalt bezüglich des Einsatzes der in der Bundesrepublik stationierten US-Atomwaffen nach dem Zwei-Schlüssel-Prinzip gesichert habe. Dazu beigetragen habe nicht zuletzt das Engagement von Franz Josef Strauß in dessen Zeit als Verteidigungsminister. Im Folgenden sollen angesichts von Strauß’ Rolle bei der Etablierung der Nukleartechnik in der Bundesrepublik auch die Entwicklungen des Verhältnisses zwischen Militär und Politik in Bezug auf die mutmaßlich angestrebte Schaffung eines eigenen Atomwaffenarsenals untersucht werden.
Für andere Länder sind zum hier thematisierten Problemkomplex bereits einige umfassende Arbeiten erschienen. Beispielhaft zu nennen sind dabei für Frankreich Gabrielle Hechts „The Radiance of France“43 und für Schweden die Veröffentlichungen Thomas Jonters.44 Mit diesen beiden Ländern sowie der Schweiz und Großbritannien beschäftigt sich auch Roland Kollert in seiner „Politik der latenten Proliferation“.45 Angesichts der anhaltenden Wirkungsmacht des von Eisenhower apostrophierten Begriffes vom „friedlichen Atom“ sind dabei insbesondere die Fälle Schwedens und der Schweiz von Interesse, da hier wie in der Bundesrepublik zum Start des als friedlich deklarierten Atomprogramms für die unauffällige Plutoniumproduktion besonders geeignete Schwerwasser-Natururanreaktoren gebaut wurden. Die Thematik behandelte für die Bundesrepublik bislang nur Kollerts knappes Arbeitspapier;46 Anliegen der vorliegenden Studie ist es, die bestehende Forschungslücke auf die im folgenden Teilkapitel dargelegte Weise zu schließen.
1.3Thesen und Herangehensweise
Der hier vorzunehmenden Analyse liegt die Eingangsthese zugrunde, dass in der Bundesrepublik zur Regierungszeit Adenauers die hinter dem Einstieg in die als „friedlich“ deklarierte Kernkraftnutzung stehenden Motive überwiegend außenpolitischer Natur waren. Dies zu belegen bedeutet im Umkehrschluss auch, den Nachweis zu erbringen, dass aus den bislang vorwiegend als lediglich politische Ambitionen verstandenen Kernrüstungsplänen der Regierungspolitik konkrete Maßnahmen in Gestalt des Baus speziell konzipierter Kernreaktoren erwuchsen. Mit den folgenden Ausführungen soll überprüft werden, ob dieser für andere Staaten bereits festgestellte Befund auch für die Bundesrepublik zu konstatieren ist; die seit dem westdeutschen Einstieg in die Kernkraftnutzung übliche weitgehende Tabuisierung der mit der zivilen Technik einhergehenden machtpolitischen Möglichkeiten würde damit als innen- wie außenpolitische Tarnung erkennbar.47
Die Untersuchung erfolgt entlang zweier Hauptfragen: Welche bundesdeutschen Akteursgruppen forcierten aus welchen Gründen die Entwicklung der Kerntechnik in der Bundesrepublik – und welche Folgen hatten ihre Bemühungen? Die im Folgenden zu verifizierende Hauptthese ist es dabei, dass der von der bundesdeutschen Regierungspolitik getragene Wunsch, eine Option auf den Bau von Atomwaffen zur erlangen, wenigstens bis zum Ende von Adenauers Kanzlerschaft die treibende Kraft hinter dem Aufbau einer nationalen Kerntechnikinfrastruktur darstellte. Vermutet wird dabei, dass mit Ausnahme der Energiewirtschaft die übrigen Akteursgruppen dieses Leitmotiv stützten, da es mit ihren eigenen Interessen korrelierte.
So legten die Umstände des bundesdeutschen Einstiegs in die Kerntechniknutzung eine Verwendung von Schwerwasserreaktoren zur Plutoniumproduktion nahe; eine Vorgehensweise, die vor allem der Chemieindustrie mit der Produktion von Schwerwasser und der Abtrennung von Plutonium zwei lukrativ erscheinende neue Geschäftsfelder bot. Die deutschen Atomforscher wiederum hatten schon während des Krieges versucht, einen Schwerwasserreaktor zur Produktion von Plutonium in Gang zu setzen; diese auf den Bau von Atomwaffen gerichteten Bemühungen waren jedoch nicht an einer bewussten Gewissensentscheidung gescheitert.48 Entsprechend musste ihr Streben in der Bundesrepublik darauf gerichtet sein, den entstandenen Ansehensverlust wettzumachen: Zum einen wollten sie unterstreichen, dass alle ihre Bemühung schon seit jeher rein friedlich orientiert gewesen seien, sie also – entgegen der Vorwürfe des Auslands – nicht für den Bau der Atombombe durch ihre Kollegen in den USA verantwortlich gemachten werden konnten; zum anderen, dass sie in der Lage waren, die im Krieg begonnenen Arbeiten zufriedenstellend zu beenden und einen funktionierenden Schwerwasserreaktor zu erstellen.
Der Umstand, dass die bundesdeutsche Politik überhaupt an einer militärischen Option interessiert war, ist Teil der Hauptthese; auch er ist bislang weder im Bewusstsein der Öffentlichkeit noch der Geschichtswissenschaft nachhaltig verankert. Gleichwohl wurde in der im vorangehenden Teilkapitel vorgestellten Literatur die Erkenntnis, dass der bundesdeutsche Verzicht auf Atombewaffnung weder freiwillig noch aufrichtig geäußert wurde, an manchen Stellen bereits geäußert. Abseits von Radkau49 und Kollert50 allerdings wird dies lediglich auf einer Ebene der politischen Ideen- und Bündnisgeschichte konstatiert; dass, wie im Folgenden zu belegen sein wird, tatsächlich Anlagen direkt auf die diplomatische Verwendung hin konzipiert wurden, die teilweise noch bis zu Beginn der 1990er Jahre in Betrieb waren, ist bislang noch nicht ausführlich untersucht worden. Radkau befasste sich zwar intensiv mit der Entstehungsgeschichte aller relevanten Anlagen, geht aber, wie beschrieben, in seinem atomgeschichtlichen Hauptwerk51 nicht von einer eindeutigen Ausrichtung auf die militärische Verwendung hin aus.
Bei Annahme eines dem Bau der fraglichen Atomanlagen zugrundeliegenden diplomatischen Hauptzwecks jedoch verändert sich auch der Blickwinkel auf die bereits von einigen anderen Autoren festgestellten Bestrebungen der bundesdeutschen Regierungspolitik zur Beendigung der atomaren Enthaltsamkeit. Überdies könnten im Falle einer Bestätigung der hier aufgestellten These einer – soweit im Rahmen der Tarnung möglich – zielstrebigen Verfolgung der militärischen Option auch zur Entstehungsgeschichte der gesamten bundesdeutschen Kerntechniklandschaft neue Schlüsse gezogen werden. Zwar reicht der gewählte Betrachtungszeitraum im engeren Sinn nur bis 1963, die Auswirkungen der hier getroffenen Weichenstellungen jedoch sind auch über fünfzig Jahre später noch bedeutungsvoll. Denn das Ringen zweier primär nach außenpolitischer Zweckmäßigkeit ausgestalteter Reaktorkonzepte, dem bundesdeutschen Schwerwasserreaktor und dem US-amerikanischen Leichtwasserreaktor, bestimmte die Geschicke der bundesdeutschen Kerntechnik deutlich stärker als bislang angenommen. Dabei schuf, wie hier zu zeigen ist, die von den bundesdeutschen Akteuren nach außen hin stets gepflegte Darstellung der Entwicklungen als rein zivil motiviert überhaupt erst die Grundlage für die spätere großmaßstäbliche Atomkraftnutzung. In Erweiterung der eingangs des Teilkapitels eingeführten Fragestellung wird daher untersucht, welche Auswirkungen das vermutete Streben nach der Bombe auf die Entwicklung der Kerntechnik in der Bundesrepublik hatte.
Wo liegt nun der Mehrwert der vorliegenden Arbeit im Vergleich mit der bisherigen Literatur im Einzelnen? Gegenüber Müller52 soll er in der Analyse von allen mit der möglichen militärischen Nutzung zusammenhängenden Aspekten bestehen. Letztere finden in Radkaus atomgeschichtlichem Hauptwerk bereits Beachtung in einem kurzen Teilkapitel.53 Der Unterschied liegt hier vor allem im Fazit: Während Radkau davon ausgeht, dass die Technik lediglich militärisch vorstrukturiert war und der Leichtwasserreaktor ungeplant zum Durchbruch kam, soll im Folgenden demonstriert werden, dass die zivile Nutzung der Kernenergie auch in Bezug auf Schwer- und Leichtwasserreaktor ohne die mit ihr aufs Engste verwobenen militärisch-diplomatischen Interessen nicht denkbar gewesen wäre. Zur Analyse wurden dabei einerseits Quellen – darunter Akten des Auswärtigen Amts, des Kernforschungszentrums Karlsruhe, des Verteidigungsministeriums und der beteiligten Unternehmen – herangezogen, die Radkau noch nicht zugänglich waren; andererseits wurden die von Radkau bereits in großem Umfang verwendeten – und inzwischen durchgängig mit anderen, den Abgleich erschwerenden Signaturen versehenen – Bestände des ehemaligen Bundesministeriums für Atomfragen unter stärkerer Berücksichtigung der militärischen Aspekte vermeintlich zivil orientierter Kerntechnik neu ausgewertet.54 Gerade auch im Vergleich zu Radkaus späterer Beschäftigung mit der Thematik55 befasst sich die vorliegende Arbeit daher weitaus umfassender mit den eine mögliche außenpolitische Verwendbarkeit der Technik betreffenden Fragen.
Die Unterschiede zu Kollert, der diesen Ansatz ebenfalls gewählt hat,56 bestehen einerseits in einer ausführlicheren Auseinandersetzung mit dem Aufbau der bundesdeutschen Kerntechnikinfrastruktur – ganz im Sinne von Kollerts Arbeit zu verschiedenen anderen europäischen Staaten57 – und andererseits in der vertieften Betrachtung der diplomatischen Zusammenhänge, damit der Motive der politischen Akteure und insbesondere in Bezug auf die „Göttinger Erklärung“ auch der Motive der beteiligten Atomwissenschaftler. Die vorhandene bündnispolitische Literatur58 sowie auch Küntzel59 wiederum thematisieren zwar teils die Ambitionen der Bundespolitik auf eine nationale Atomrüstung, unterlassen aber jegliche Beschäftigung mit der zugrundeliegenden Technik und beschreiben damit gewissermaßen einen Eisberg nur anhand der Kenntnis um dessen Spitze. Der Unterbau fehlt, und nur anhand dieses Unterbaus ist es möglich, die Zusammenhänge zwischen militärisch-diplomatischen Interessen und der Durchsetzung einer für die zivile Energiegewinnung in vielerlei Hinsicht ungeeigneten Technik fundiert zu untersuchen. Dies ist das Anliegen meiner Arbeit.
Kapitel 2 ist dabei zunächst einer knappen Darstellung der deutschen Kriegsforschungen gewidmet, verbunden mit einer ersten Diskussion der Frage, inwieweit von diesen Arbeiten Kontinuitäten hinüberreichen in die Zeit des Aufbaus der bundesdeutschen Kerntechnikinfrastruktur. Im anschließenden Teilkapitel werden am Beispiel des Manhattan-Projekts die Zusammenhänge zwischen Atomtechnik und Atomwaffen dargestellt und die kernphysikalischen Grundlagen erläutert. Das Kapitel beschließt ein Abriss zu den für die kerntechnische Entwicklung in der Bundesrepublik maßgebenden Geschehnissen zwischen dem Ende des Krieges und der Möglichkeit zur Wiederaufnahme der Kernforschung nach Inkrafttreten der Pariser Verträge.
Zur Einordnung der später analysierten Vorgänge in der Bundesrepublik in einen internationalen Rahmen dient das vorgelagerte Kapitel 3, das den Aufbau der Kerntechnikinfrastrukturen anderer Staaten beschreibt. Insbesondere mit den Teilkapiteln über die Forschungen in Schweden und der Schweiz wird bezweckt, die bundesdeutschen Motive über den Weg der vergleichenden Analyse zu erhellen. Der in Teilkapitel 6.1 angestellte Quervergleich ist insofern eine Fortsetzung von Kapitel 3, als er die Ergebnisse der Kerntechnikentwicklung in den dort betrachteten Staaten mit den in Kapitel 5 dargestellten Arbeiten in der Bundesrepublik vergleicht. Das vorliegende Werk folgt in diesem Punkt einer schon von Kollert verfolgten, jedoch nur betreffs der Darstellung der Entwicklungen außerhalb der Bundesrepublik vollständig verwirklichten Idee.60 War ein hinter dem Aufbau vorgeblich ziviler Kerntechnikinfrastrukturen verborgenes Streben von Regierungen nach nationaler Verfügungsgewalt über unabhängige Nukleararsenale ein Wesensmerkmal der Zeit vor dem Atomwaffensperrvertrag?
Kapitel 4 beleuchtet die spezifischen Motive der verschiedenen bundesdeutschen Akteursgruppen und zeichnet zudem die Rollen einzelner Protagonisten nach, um so die Betrachtung der Gruppen als monolithische Entitäten aufzulockern und damit eine differenziertere Sichtweise auf die von ihnen forcierten Entscheidungen zu ermöglichen.61 Teilkapitel 4.4 nimmt eine Sonderstellung ein, da eine direkte Beteiligung der dort behandelten militärischen Akteure an der bundesdeutschen Atomplanung aus den verwendeten Quellen nicht hervorgeht. Hegte die Bundeswehrführung also gar kein Interesse an einer nationalen Verfügungsgewalt über Atomwaffen – oder sind ihre Angehörigen eher als „graue Eminenzen“ im Hintergrund zu betrachten? Zur Beantwortung dieser Frage sollen die strategischen Planungen der Bundeswehrführung untersucht werden. Außerdem soll erörtert werden, inwieweit sich die Entscheidungen der politischen Akteure und die Planung des Militärs gegenseitig beeinflussten. Die Betrachtung der „Politik“ selbst – Teilkapitel 4.1 – beschränkt sich wiederum auf die Analyse der regierungspolitischen Akteure, da die Oppositionspolitik nur insofern Relevanz für die gewählte Fragestellung besitzt, als sie die vermeintliche Notwendigkeit einer schnellstmöglichen zivilen Kernkraftnutzung in der Bundesrepublik im Betrachtungszeitraum nie in Frage stellte.
Das umfangreichste Kapitel 5 dient sowohl der Darstellung als auch der Analyse des Aufbaus der kerntechnischen Infrastruktur in der Bundesrepublik. Es ist chronologisch gegliedert, wobei die ersten beiden, bis 1961 reichenden Teilkapitel den Schwerpunkt ausmachen und daher jeweils drei weitere Unterkapitel aufweisen, die im Fall von 5.2 angesichts der Parallelität wichtiger Entwicklungen primär nach Thematik angeordnet wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei Planung und Bau der in besonderem Maße mit den Interessen der verschiedenen Akteursgruppen verbundenen Anlagen mit Schwerwasserreaktor. Teilkapitel 5.3 reicht bis zum Ende des Hauptbetrachtungszeitraums der vorliegenden Untersuchung und erörtert Eckpunkte eines Prioritätenwandels, der schließlich zu der unter 5.4 bearbeiteten Abkehr vom Schwerwasserreaktor als Hauptlinie der bundesdeutschen Kerntechnikentwicklung führte.
Kapitel 6 ist schließlich den Ergebnissen und Folgen der bundesdeutschen Atompolitik bis 1963 gewidmet. Dem bereits vorgestellten Vergleich mit dem Ausland folgt unter 6.2 eine Analyse der außenpolitischen Ergebnisse. Im Gegensatz zur Literatur, die ihre Schlüsse zur bundesdeutschen Atomwaffenpolitik – meist im Sinne des Versuchs einer Beteiligung an zur Diskussion stehenden multilateralen Arsenalen – ohne Verbindung zum Bau konkreter Anlagen zieht oder, wie bei Radkau,62 diese Anlagen nicht mit außenpolitischen Resultaten in Bezug bringt, wird hier der Zusammenhang zwischen Kerntechnik und Außenpolitik der Bundesrepublik erstmals fundiert untersucht. Teilkapitel 6.3 beschäftigt sich mit den Bestrebungen der Protagonisten zur Tarnung der mit dem bundesdeutschen Atomprogramm verbundenen Interessen und den Grenzen dieser Tarnung, wobei insbesondere auch die Sicht der DDR auf die Arbeiten im Westen thematisiert wird. Teilkapitel 6.4 ist wiederum den Folgen der anfänglichen Bevorzugung des Schwerwasserreaktors gewidmet und legt gewissermaßen die argumentative Grundlage für die im anschließenden Fazit nochmals diskutierte Schlussfolgerung, wonach erst die den Interessen der verschiedenen Akteursgruppen dienende Festlegung auf den Schwerwasserreaktor dem Durchbruch des Leichtwasserreaktors und damit der gesamten heutigen Kernkraftwerkslandschaft den Boden bereitete.
1.4Quellenlage
Hinsichtlich der Quellenlage bestand die wesentliche Herausforderung darin, die Bedeutung des militärischen Aspekts der Kerntechnik zu analysieren, obwohl die überwiegende Mehrzahl der zur Verfügung stehenden Dokumente – zumindest auf den ersten Blick – nur die zivilen Zwecke thematisiert. Hierin ist vermutlich auch der Grund dafür zu sehen, dass die Literatur sich in Bezug auf die Bundesrepublik bislang nicht umfangreicher mit dem Zusammenhang zwischen „friedlicher“ Kerntechnik und Außenpolitik befasst hat. Doch belegt die geringe Zahl offensichtlicher Indizien automatisch die Nichtexistenz militärischer Interessen? Bei der Auswertung des verwendeten Quellenmaterials wurde angesichts der weitreichenden Dual-Use-Fähigkeiten der Atomtechnik auch in scheinbar unverfänglicher Korrespondenz und vorgeblich rein zivilen Aufstellungen nach indirekten Hinweisen auf mögliche machtpolitische Motive hinter der frühen bundesdeutschen Kerntechnikentwicklung gesucht; eine vorangegangene Beschäftigung mit für den Reaktorbetrieb grundlegenden kernphysikalischen Vorgängen erwies sich dabei als Schlüssel zu manch neuer Erkenntnis.
Von besonderer Bedeutung waren für vorliegende Arbeit die Akten des inzwischen als Teil des Karlsruher Instituts für Technologie firmierenden ehemaligen Kernforschungszentrums Karlsruhe; sie wurden bereits zu Beginn der 1980er Jahre an das örtliche Generallandesarchiv (GLA) abgegeben und sind dort ohne nennenswerte Einschränkungen zugänglich und frei recherchierbar.63 Es lässt sich allerdings nicht mehr vollständig nachprüfen, ob angelegentlich dieses Umzugs Akten ausgesondert wurden. Ähnliches gilt für die im Koblenzer Bundesarchiv lagernden Bestände des ehemaligen Bundesministeriums für Atomfragen,64 des Bundeskanzleramts65 sowie des Wirtschafts- und des Finanzministeriums.66 Problematischer stellte sich die Ausgangslage bei nach wie vor geheim gehaltenen Akten aus den Beständen des Bundesministeriums für Verteidigung67 dar, insbesondere hinsichtlich der Schnittstellen mit dem Bundesministerium für Atomfragen. Nichtsdestotrotz fanden sich in den freigegebenen Dokumenten einige konkrete Hinweise auf das Interesse der militärischen Akteure an einer vom Ausland unabhängigen atomaren Bewaffnung der Bundesrepublik.68
Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung69 und die Akten der Foreign Relations of the United States (FRUS)70 erwiesen sich trotz der vorgenommenen Editierung für das verfolgte Erkenntnisinteresse als ebenso aufschluss- wie hilfreich. Die in öffentlichen Archiven lagernden Nachlässe von führenden Protagonisten der bundesdeutschen Kernkraftfrühphase wie Karl Wirtz,71 dem Kernforscher mit der größten Nähe zu den hier beschriebenen Vorgängen, Heinz Maier-Leibnitz72, seines Zeichens „Architekt des ersten bundesdeutschen Atomprogramms“ (Eckert),73 und Heinz Krekeler,74 Botschafter in Washington und später Euratom-Kommissar, erlaubten tiefe Einblicke in die hinter den Kulissen abgelaufenen Vorgänge auf wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene. Die im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts (PA-AA) gelagerten Bestände75 wiederum ermöglichten es, solche vor der Öffentlichkeit verborgenen Entscheidungen in den Kontext der zeitgenössischen bundesdeutschen Außenpolitik einzuordnen, obgleich das Auswärtige Amt selbst nicht der Ausgangspunkt der Überlegungen zu einer möglichen Verwendung der sich aus der Kerntechnikentwicklung ergebenden außenpolitischen Möglichkeiten war. Zugänglich waren dabei auch ehemals als „streng geheim“ klassifizierte Akten, die erst 201176 freigegeben wurden.
Schwieriger als die Sichtung öffentlich zugänglicher Bestände gestaltete sich die Recherche in den Archiven der relevanten Industriefirmen, von denen insbesondere die damaligen Siemens-Schuckertwerke (SSW) und die Farbwerke Hoechst maßgeblich an der Ausgestaltung der Kerntechnik-Infrastruktur in der jungen Bundesrepublik mitwirkten. Hier mussten erhebliche Einschränkungen bei der Verfügbarkeit der die Kerntechnik betreffenden Bestände hingenommen werden. Letztere erwiesen sich im Falle von SSW77 als unvollständig erhalten. Die Akten des in der heutigen Sanofi S.A. aufgegangenen Hoechst-Konzerns78 wiederum konnten nicht nach eigener Recherche gesichtet werden, sondern nur nach Zuteilung auf Anfrage. Dass bei solcher Vorgehensweise keine ähnlich umfangreiche Auswertung der Bestände vorgenommen werden konnte wie beispielsweise bei der seinerzeit von der Hoechst AG geförderten Arbeit Stephan Lindners zur Geschichte des Werks im Dritten Reich,79 liegt nahe. Nichtsdestotrotz fanden sich wesentliche Korrespondenzen mit den Protagonisten der Industrie auch in den staatlichen Aktenbeständen wieder, so dass trotz solcher Einschränkungen eine fundierte Analyse vorgenommen werden konnte. Ohnehin ganz anders stellte sich die Situation im RWE-Konzernarchiv80 dar. Die große Freigiebigkeit, mit der dort selbst die archiveigenen Inventarlisten zur weiteren Recherche vorgezeigt wurden, mag jedoch auch der Außenseiterposition des Konzerns gegenüber der Gruppe der übrigen Hauptprotagonisten der frühen bundesdeutschen Kernkraftnutzung zu verdanken sein.
Neben den genannten Archivbeständen wurden auch die Publikationen einiger maßgeblich Verantwortlicher aus Wissenschaft, Politik und Industrie ausgewertet. Als wertvoll für die Analyse erwiesen sich hierbei die Memoiren von Adenauer81 und Strauß.82 Beide bieten bemerkenswert offene Einblicke in die ehemals tabuisierte Thematik. Ebenso wie bei Winnackers gemeinsam mit Wirtz verfasstem Plädoyer für einen sorgenfreien Umgang mit der Kerntechnik83 und seinen Erinnerungen an die Entstehung der Branche84 wurden persönlich gefärbte Schilderungen mit der gebotenen kritischen Distanz betrachtet. Ihre Verwendung macht nach Ansicht des Autors dennoch Sinn, dienten diese oftmals anekdotenhaft dargebrachten Erinnerungen doch mitunter zur Schärfung des Gesamtbildes bei einem ansonsten meist verschwiegen behandelten Thema.
Die zeitgenössischen Blicke von außen auf die bundesdeutsche Kerntechnikentwicklung schließlich sind von äußerst unterschiedlichem Charakter. Hier steht neben den Studienergebnissen des Londoner Institute for Strategic Studies, die ein fundiertes Bild der Kernwaffenproduktionsfähigkeit der wichtigsten Industriestaaten zeichnen,85 auch die 1969 vom Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR herausgegebene Publikation „Das Bonner Kernwaffenkartell“.86 Sie besitzt mit treffsicheren Schlüssen über die Zielrichtung der bundesdeutschen Kerntechnik beträchtlichen Erkenntniswert; gleiches gilt für die Akten der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Nationale Verteidigung der DDR, die im Militärarchiv des Bundesarchivs eingesehen werden konnten.87 Als Branchenblatt der kerntechnischen Industrie in der Bundesrepublik fungierte wiederum die Zeitschrift „Atomwirtschaft“, deren Darstellungen zwischen Innen- und Außensicht pendeln und teils von Redakteuren, teils von den Protagonisten aus Wirtschaft und Politik selbst verfasst wurden.88
2.Die Vorgeschichte der bundesdeutschen Reaktorentwicklung
2.1Atomforschung im Nationalsozialismus
Die Entwicklungsarbeiten des deutschen Kernenergieprojekts in den Jahren bis 1945 sind schon lange Gegenstand der historischen Forschung. Das Standardwerk „Die Uranmaschine“,1 im englischsprachigen Original erstmals 1989 erschienen, stammt von Mark Walker, der noch weitere Beiträge2 zum Sujet geleistet hat, die ebenfalls auf einer breiten Basis ausgewerteter Quellen fußen. Da das hier begonnene Teilkapitel lediglich die Vorgeschichte für die Betrachtung der späteren Arbeiten auf dem Gebiet der Atomenergienutzung in der Bundesrepublik darstellen soll, nimmt es weder für sich in Anspruch, der von Walker überzeugend analysierten Geschichte der im Deutschen Reich durchgeführten Kriegsforschungen neue Aspekte hinzuzufügen, noch verfolgt es das Ziel, die von Karlsch3 ins Rollen gebrachte Debatte um einen möglichen, jedoch unbewiesenen4 Atomversuch einer Splittergruppe des deutschen Uranprojekts fortzuführen.
Stattdessen wird der Versuch unternommen, anhand einer überwiegend auf Walkers Darstellungen beruhenden Skizze der deutschen Kernforschung im Krieg die Verbindungslinien aufzuzeigen von der Betätigung der Forscher im Nationalsozialismus zu ihrem späteren Wirken in der Bundesrepublik. Lassen sich bezüglich der Mobilisierung der Wissenschaftler und der Mitwirkung der Industrie Kontinuitäten entdecken und Traditionslinien in der Ausgestaltung der erforschten und verwendeten Technik erkennen, die eine direkte Brücke schlagen vom „Uranverein“ über die „Stunde Null“ hinaus hin zur bundesdeutschen Kernforschung? Eine der Quellen zur Beantwortung dieser Fragen stellen die niedergeschriebenen Erinnerungen von Karl Wirtz dar, dem späteren Leiter des bundesdeutschen Vorzeigereaktorzentrums Karlsruhe, der während des Krieges als Schwerwasserexperte und Mitarbeiter von Heisenberg an den Arbeiten des „Uranvereins“ beteiligt war.5 Wirtz’ Ausführungen sind mitunter anekdotenhaft, jedoch stets präzise; ihre Berücksichtigung wird gerechtfertigt durch Wirtz’ besonders prominente Rolle im bundesdeutschen Atomprogramm und damit für das Gesamtthema der vorliegenden Arbeit.
Nach der Entdeckung der Kernspaltung im Dezember 1938 am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut durch Otto Hahn und Fritz Straßmann lag den umgehend auch in anderen Ländern durchgeführten Experimenten zur Erzeugung einer Kettenreaktion von Kernspaltungen angesichts der gespannten weltpolitischen Lage bereits der Gedanke zugrunde, einen hinsichtlich der potenziellen Zerstörungskraft alles Bisherige übertreffenden Sprengstoff zu erlangen.6 Zwar beschränkte sich die abgedruckte Diskussion der Kernspaltung auf das fundamentale wissenschaftliche Interesse und Fragen der Elektrizitätserzeugung; die Möglichkeit einer Anwendung von Hahns und Straßmanns Entdeckung für militärische Zwecke war jedoch für Experten zwischen den Zeilen zu erkennen und fand die entsprechende Beachtung. Unter strikter Geheimhaltung untersuchten nun Forscher nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch in Frankreich, Großbritannien, Japan, der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten das militärische Anwendungspotenzial der Kernspaltung.7
In Deutschland ging die Initiative dabei von verschiedenen Wissenschaftlern aus, die zur Wehrmacht Kontakt aufgenommen und diese auf die militärischen Anwendungsmöglichkeiten hingewiesen hatten. Besonders in Erscheinung getreten waren diesbezüglich Nikolaus Riehl, Physiker und Leiter der Forschungsabteilung der Auer-Gesellschaft, sowie Paul Harteck, Direktor des Instituts für Physikalische Chemie an der Universität Hamburg und Berater des Heeres für chemische Sprengstoffe, zusammen mit seinem Assistenten Wilhelm Groth.8 Diese waren, so der Befund Mark Walkers, „keine in der Wolle gefärbten Nationalsozialisten“, Riehl habe gar vor den Behörden seine „nichtarische“ Abstammung verheimlichen müssen. Ihre Motivation, das Regime von sich aus auf das militärische Potenzial der Kernkraft hinzuweisen, sei „vermutlich ein Gemisch aus Nationalismus, Patriotismus und beruflichem wie persönlichem Ehrgeiz“ gewesen.9
„Es taucht hier die Frage auf“, erkannte Wirtz als Beteiligter zutreffend im Rückblick, „was die Wissenschaftler dazu bewegte, den Politikern die Möglichkeit einer Atombombe vor Augen zu führen“; die Antwort bestand für ihn vor allem im Umstand, dass schon vor Beginn des Krieges „die Möglichkeit einer Kernkettenreaktion bis zur Verwirklichung in der Atombombe oder im Kernreaktor Allgemeingut einer sehr großen Anzahl von Wissenschaftlern geworden war.“ Deshalb habe es „keinerlei Möglichkeiten“ gegeben, „irgendeinen Schritt, irgendeine Stufe, irgendeine neue Erkenntnis geheimzuhalten, schon gar nicht innerhalb des Kreises der Wissenschaftler.“ Deren Antrieb, den staatlichen Instanzen von sich aus über das militärische Potenzial der neuen Technik Bericht zu erstatten, müsse „wahrscheinlich“ als Resultat der Einsicht gelten, „daß nur mit einer Forschungsaufgabe, die für den Staat und seine Verteidigung wichtig war, wissenschaftliche Arbeit und vielleicht das eigene Überleben in den kommenden chaotischen Jahren möglich sein würde.“10 Allen beteiligten Wissenschaftlern sei dabei „stets bewußt“ gewesen, dass der Bau der Atombombe im Krieg unmöglich sei und man daher „der moralischen Belastung, die mit dem Bau und der Anwendung der Bombe verbunden war, entgehen würde“11 – ein angesichts der zu Kriegsbeginn nur schwer abschätzbaren deutschen Niederlage einerseits und den potenziellen Folgen einer zu einem späteren Zeitpunkt unter Kontrolle des nationalsozialistischen Regimes befindlichen Atomwaffe andererseits kaum plausibler Rechtfertigungsversuch.
Nach Beginn des Krieges fand dann am 16. September 1939 eine erste, vom Heereswaffenamt geleitete Geheimkonferenz zur Aufstellung eines kernphysikalischen Arbeitsprogramms statt. Dessen Teilnehmer, unter ihnen die später auch in der Bundesrepublik aktiven Kernforscher Erich Bagge und Kurt Diebner, wurden mit Gestellungsbefehlen einberufen und somit einerseits zur Mitarbeit zwangsverpflichtet wie andererseits gegen eine drohende Abstellung an die Front gesichert. Im weiteren Verlauf der kerntechnischen Planungen des Heereswaffenamtes zog dieses bald auch Otto Hahn und Werner Heisenberg hinzu. Letzterer, vielgerühmter Physik-Nobelpreisträger von 1932 und trotz seiner nicht einmal 40 Lebensjahre schon seit über einem Jahrzehnt Professor an der Leipziger Universität, entwarf noch 1939 einen theoretischen Plan zum Bau eines Kernreaktors, mit dessen Konstruktion er anschließend beauftragt wurde.12
Zentrum der vom Heereswaffenamt organisierten deutschen Kernforschung war das Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik; die einzelnen Teilgebiete des Projektes wurden dennoch reichsweit an verschiedenen Universitätsinstituten bearbeitet. Das hauptsächliche, weil am ehesten realisierbar scheinende Ziel der Forschungen war es, ein Gemisch aus Uran und einer die Spaltungsreaktion moderierenden Bremssubstanz zu finden und in einem seinerzeit von den deutschen Wissenschaftlern als „Uranmaschine“ oder „Uranbrenner“ bezeichneten Reaktor so anzuordnen, dass eine gesteuerte Kettenreaktion von Kernspaltungen erzeugt und aufrechterhalten werden würde, die nutzbare Wärme und transuranischen Kernbrennstoff produzieren würde.13
Der Wunsch, als Nebenprodukt der Kernspaltung anfallende Transurane zu erhalten, fußte auf der Erkenntnis, dass diese sich aufgrund ihrer leichten Spaltbarkeit als Kernsprengstoff eignen würden; ein Befund, den Carl Friedrich von Weizsäcker im Sommer 1940 sogleich an das Heereswaffenamt übermittelte. Im folgenden Jahr meldete von Weizsäcker dann unter ausdrücklichem Hinweis auf die militärische Verwendungsmöglichkeit ein Patent an auf das Verfahren zur Erzeugung von Energie aus der Spaltung des transuranischen Elements 94, später als „Plutonium“ bezeichnet – das Herstellungsprinzip einer Plutoniumbombe. Schon zu diesem Zeitpunkt war ersichtlich, dass jede funktionierende Uranmaschine sich zur Gewinnung von Transuranen und damit von Kernsprengstoffen eignen würde und damit jede Forschung an Uranmaschinen auch Forschung über Kernwaffen bedeutete.14
Für die Konstruktion einer funktionsfähigen Uranmaschine war es zunächst notwendig, die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse experimentell zu bestätigen. Zudem musste ein Moderatorstoff festgelegt werden, um die zu erzeugende Kettenreaktion abzubremsen; in Frage kamen Graphit und Schweres Wasser (D2O). Für die Verwendung Schweren Wassers sprach, wie sich nach Experimenten Heisenbergs herausstellte, dass für eine damit moderierte Reaktion wesentlich geringere Mengen an Uran als Kernbrennstoff benötigt wurden. Schweres Wasser wurde allerdings bis dato nur von der norwegischen Firma Norsk Hydro produziert; die hergestellten Mengen waren außerdem am äußerst geringen Vorkriegsbedarf von Laboratorien ausgerichtet, somit schwer verfügbar und kostspielig zu erwerben. Daher lag die Präferenz der deutschen Forschung zunächst auf Graphit als Moderatorstoff.15 Das Heereswaffenamt kam jedoch bald zum Schluss, dass die Herstellung von Graphit in der benötigten Reinheit unerschwinglich teuer sei.16
Nachdem sich die Forschergruppe um Heisenberg in der Folge doch auf Schwerwasser als Moderatorstoff festgelegt hatte, stellten sich in Bezug auf dessen Verfügbarkeit infolge des mittlerweile begonnen Krieges neue Probleme ein. Die Vorräte an Schwerem Wasser bei der Herstellerfirma Norsk Hydro waren vor dem deutschen Einmarsch in Norwegen im April 1940 nach England geliefert worden; die weitere Produktion wurde durch Luftangriffe der Alliierten und Sabotageakte gehemmt und sollte 1943 schließlich vollständig zum Erliegen kommen. Trotz entsprechender Versuche der Konzerne Linde und I.G. Farben konnte auch im Reich selbst bis zum Kriegsende keine Großproduktion von Schwerwasser aufgebaut und nur eine vergleichsweise kleine Menge produziert werden. Die Demontage der norwegischen Anlage für einen Wiederaufbau im Deutschen Reich hatte ebenso wenig zu nennenswerten Ergebnissen geführt wie die zeitweilige Erforschung mehrerer unterschiedlicher Ansätze zur Schwerwasserproduktion.17 Unter diesem fortwährenden Mangel der benötigten Moderatorsubstanz litten die Möglichkeiten der am deutschen Kernenergieprojekt beteiligten Wissenschaftler, die für den Bau einer funktionierenden Uranmaschine nötigen Versuche durchzuführen.18
Zudem wurden schnellere Ergebnisse durch den Umstand verhindert, dass man die Arbeiten zwar zielstrebig, aber dennoch nicht unter Hochdruck und mit höchster Priorität begonnen hatte.19 Wie Mark Walker schildert, lag dies allerdings nicht an moralischen Bedenken der Forscher und waren „die Wissenschaftler, die im Auftrag des Heeres über Kernenergie arbeiteten, vom großen Anwendungspotential der Kernspaltung nicht weniger fasziniert [ . . .] als das Heereswaffenamt“.20 Immer wieder wurde letzteres aus den Reihen der beteiligten Forscher ausdrücklich auf die militärischen Ziele des Kernenergieprojekts hingewiesen, nach Riehl, Harteck, Groth und Weizsäcker Ende 1940 und Anfang 1941 auch von Otto Hahn.21 Nichtsdestotrotz – und obwohl sich die deutsche Kernforschung durchaus reger staatlicher Förderung erfreuen konnte – galt das Projekt nicht als unmittelbar kriegswichtig, weshalb die Versorgung mit benötigten Materialien nicht gewährleistet war. Als Folge zögerten sich die Arbeiten trotz zwischenzeitlicher Erfolge hinaus, was wiederum nicht dazu geeignet war, die Priorität der Kernforschung bei der Mittelvergabe zu erhöhen. Angesichts eines aus Sicht der nationalsozialistischen Funktionsträger zunächst überaus günstigen Kriegsverlaufes erschien die vage Aussicht auf eine zukünftige Herstellung neuartiger Kernwaffen aber ohnehin nicht als dringlich.22
Nachdem die deutschen Truppen in ihrem Vormarsch Ende 1941 in der Sowjetunion gestoppt worden und die Vereinigten Staaten in den Krieg eingetreten waren, erschien die Kernforschung, da ein konkreter Kriegsnutzen nach wie vor außer Reichweite schien, umso weniger förderungswürdig. Unter dem Druck drohender Einberufungen wichtiger Mitarbeiter an die Front betonten die beteiligten Atomforscher gegenüber dem Heereswaffenamt die potenzielle militärische Relevanz ihrer Arbeiten noch nachdrücklicher, mussten andererseits aber einräumen, dass für präzisere Aussagen über die Möglichkeit der Herstellung von Kernsprengstoffen die Fertigstellung einer ersten Uranmaschine vonnöten war.23 Erst dann konnte das Problem, mit welchem chemischen Verfahren die erzeugten Transurane vom übrigen Kernbrennstoff zu trennen und damit für den Einsatz in Waffen nutzbar zu machen seien, angegangen werden. Unter diesen Voraussetzungen kamen die Verantwortlichen im Heereswaffenamt während der ersten Monate des Jahres 1942 zum Schluss, dass der Krieg von keiner der Parteien mit Kernwaffen zu gewinnen sei, gaben die Verantwortung für das Kernenergieprojekt an den Reichsforschungsrat ab und forcierten stattdessen die Raketenforschung. Die Arbeiten auf dem Gebiet der Kernspaltung wurden zwar weiterhin finanziell unterstützt, jedoch nur in einem vergleichsweise bescheidenen Rahmen. Die gleichzeitige Intensivierung der Atomforschung in den Vereinigten Staaten und Großbritannien blieb unbemerkt und beeinflusste diese Entscheidung daher nicht.24
Als dann ab Juni 1944 gemäß eines Erlasses von Rüstungsminister Speer nur noch solchen Entwicklungen Unterstützung zukommen sollte, die in der Lage waren, eine kriegsentscheidende Rolle zu spielen, verringerte der Reichsforschungsrat die Zahl der Vorhaben, denen die höchste Dringlichkeitsstufe zugemessen wurde, drastisch. Dank persönlicher Unterstützung durch Speer allerdings gehörte das Kernenergieprojekt auch jetzt noch und bis zum Ende des Krieges zu den wenigen verbliebenen Forschungsvorhaben, die gefördert wurden. Verantwortlich dafür war nicht zuletzt die geschickte Propaganda, die Walther Gerlach, Bevollmächtigter von Reichsmarschall Göring für Kernphysik und Leiter der Sparte Physik im Reichsforschungsrat, gegenüber den Spitzen des Regimes betrieb. So behauptete Gerlach noch Ende 1944 gegenüber Martin Bormann, dem Leiter der Parteikanzlei, dass Deutschland gegenüber allen Konkurrenten im Wettlauf um die Anwendung der Kernenergie einen Vorsprung innehabe – tatsächlich wusste Gerlach nichts von den Vorgängen auf alliierter Seite – und Kernwaffen entgegen aller Erwartungen den Krieg doch noch für das Reich entscheiden könnten.25
„Gerlach bewegte sich“, so das Urteil Mark Walkers, „auf schmalem Grat zwischen großen Versprechungen, auf Grund deren man von ihm erwartete, was er nicht leisten konnte, und dem geschickten Ausspielen der Vision von der Kernenergie, um sich selbst und seinen Mitarbeitern das Überleben zu sichern.“26 Entsprechend dankbar und mit gedanklichem Brückenschlag in die Nachkriegszeit erinnert sich Wirtz: „Gerlach war wohlwollend und fördernd für die Wissenschaftler eingestellt. Ihm und dem Minister Speer verdanken die deutschen kerntechnischen Wissenschaftler in hohem Maße, daß sie überleben konnten. Dies wiederum ermöglichte der Bundesrepublik nach dem Krieg einen erfolgreichen Wiederanfang, der auf anderen Sektoren (z. B. Raumfahrt, Luftfahrt) nicht im selben Maß möglich war.“27
Noch bis Januar 1945 führte eine Arbeitsgruppe um Wirtz Versuche für das Kernenergieprojekt am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik durch. Dort war seit 1943 ein Bunkerlaboratorium in Betrieb, das nicht nur die verschiedenen Versuchsanordnungen beherbergte, sondern, da es gleichzeitig auch als besonders sicherer Luftschutzbunker ausgeführt war, nach Beginn der großen Luftangriffe auf Berlin zunehmend zur Zufluchtsstätte der Institutsmitarbeiter wurde. Angesichts der Verwüstungen durch nahezu tägliche Luftangriffe war die wissenschaftliche Arbeit in Berlin jedoch trotz des vom Bunkerlaboratorium gebotenen Schutzes weitgehend zum Erliegen gekommen. Bereits seit 1943 hatte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit Zustimmung Speers beschlossen, einige Institute in weniger vom Bombenkrieg gefährdete Gebiete zu verlegen. Ein guter Teil der Ausrüstung des Instituts für Physik befand sich inzwischen im württembergischen Hechingen, wo sich seit April 1944 auch Heisenberg selbst aufhielt. Aufgrund der nach dem russischen Vormarsch an der Ostfront immer bedrohlicheren Lage in Berlin verlegten Gerlach und Wirtz schließlich Ende Januar und Ende Februar 1945 die gesamte Versuchsanlage unter abenteuerlichen Bedingungen in einen Felsenkeller ins unweit von Hechingen gelegene Haigerloch. Auch bei den dort durchgeführten letzten Versuchen gelang es aus Mangel an ausreichenden Mengen Schweren Wassers jedoch nicht, den Reaktor in Betrieb zu setzen.28
Eine weitere, von Kurt Diebner geleitete Forschergruppe in der Heeresversuchsanstalt in Gottow, die ebenfalls auf der Basis von Schwerwasser-Anordnungen forschte, konnte letztlich ebenfalls keine entscheidenden Ergebnisse erzielen, obgleich sie im Vergleich mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin schnellere Zwischenerfolge erzielt hatte.29 Die von Rainer Karlsch aufgestellte These, wonach es ihr gelungen sei, einen vergleichsweise primitiven Atombombenversuch tatsächlich durchzuführen,30 konnte hingegen auch mit einer Analyse von Bodenproben durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt im Jahr 2006 nicht bewiesen werden.31 Gesichert scheint indes, dass Diebners Gruppe selbst davon ausging, eine Kernwaffe zu entwickeln und zu testen; ein Vorhaben, das offenbar – auch hier herrscht Unklarheit über die Validität von Karlsch Ergebnissen – in einem Unfall endete. Und gesichert scheint ebenso zu sein, dass außer Gerlach keiner der anderen am deutschen Kernenergieprojekt beteiligten Wissenschaftler von den Ergebnissen Diebners erfuhr.32
Neben dem Konzept einer schwerwassermoderierten „Uranmaschine“ als Hauptlinie der deutschen Reaktorforschung während des Zweiten Weltkriegs forschten die deutschen Wissenschaftler auch an der Technik der Urananreicherung. Dies hätte für den Weg zu einer möglichen Bombe einen Unterschied bedeutet, der im anschließenden Teilkapitel noch detaillierter ausgeführt werden soll. Anders als beim vorrangig verfolgten Ziel der Spaltmaterial-Produktion in einem Natururanreaktor war bei der Anreicherung von Uran durch Isotopentrennung nicht der „Umweg“ über einen Reaktor erforderlich; vielmehr konnte das angereicherte Uran selbst bei entsprechend hoher Konzentration als Spaltstoff in einer Kernwaffe verwendet werden. In diese Richtung weisende, vom Heereswaffenamt bereits 1939 initiierte Versuche waren bis Kriegsende jedoch nicht erfolgreich.33
Denn obwohl bei Verwendung angereicherten Urans kein Reaktor nötig gewesen wäre, hätte die Realisierung einer funktionierenden Anlage zur Isotopentrennung doch insgesamt eines noch weit höheren finanziellen, materiellen und personellen Einsatzes bedurft. Man habe festgestellt, so Wirtz, „daß jede Isotopentrennung auf breiterer Basis einen technischen Aufwand erfordern würde, der den Rahmen des Uranprojekts ganz außerordentlich erweitern würde. Dies und nur dies ist der Grund gewesen, weshalb während des ganzen Krieges in Deutschland niemals an eine Isotopentrennung größeren Stils gedacht wurde.“34 Dass ein mit angereichertem Uran betriebener Reaktor zur Energieerzeugung anders als ein mit Natururan betriebener Typ nicht der Verwendung Schweren Wassers bedurft hätte, sondern mit „leichtem“, herkömmlichen Wasser (H2O) hätte betrieben werden können, war ohnehin erst für die Nachkriegszeit von Bedeutung. Die deutschen Atomwissenschaftler wurden indes nach dem Krieg von den Alliierten begreiflicherweise von der weiteren Entwicklung abgekoppelt; das Kontrollratsgesetz Nr. 25 vom 29. April 1946 verbot jede Art von Kernforschung im Land.35
Wie Mark Walker entgegen mancher von den ehemaligen Protagonisten selbst gestrickten Legenden eines passiven Widerstandes durch Selbstbeschränkung darlegen konnte, beruhte das deutsche Scheitern im Wettlauf um die Atombombe nicht auf moralischen Hemmnissen der beteiligten Wissenschaftler.36 Dennoch kann die Haltung der deutschen Kernforscher gegenüber den möglichen Zielen ihrer Arbeit als durchaus ambivalent gelten. Nachdem sie einerseits aus Motiven wie Ehrgeiz und Patriotismus heraus sowie später im Angesicht einer drohenden Einberufung an die Front dem nationalsozialistischen Regime die militärische Anwendbarkeit der Kernenergie versichert hatten, zogen sich andererseits zumindest einige der Wissenschaftler im weiteren Verlauf des Krieges von dieser ursprünglichen Position zurück. So meldete bereits im August 1941 Wirtz ein Patent für einen Kernreaktor an, ohne in dessen Antrag eine mögliche Produktion nuklearer Sprengstoffe zu erwähnen.37 Auch scheinen, so Walkers Befund, Heisenberg und Weizsäcker im Anschluss an ihr bekanntes Treffen mit Bohr in Kopenhagen im September desselben Jahres das Sujet mit größerer Zurückhaltung behandelt haben, wobei zumindest Heisenberg offenbar schon zuvor gemischte Gefühle hegte.38
Seine revidierte Haltung hinderte Heisenberg freilich nicht daran, im Februar 1942, als die Entscheidung des Heereswaffenamtes über den Fortgang des deutschen Kernenergieprojekts anstand, in einem populärwissenschaftlichen Vortrag vor der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Führungselite des Reiches die große Durchschlagskraft möglicher nuklearer Sprengstoffe zu betonen.39 Spätestens ab 1943 zielte die Kommunikation der Wissenschaftler des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts mit dem Regime vorwiegend auf das Potenzial der Kernspaltung als bloße Energiequelle ab; sie konnten damit, so die Schlussfolgerung Walkers, aber nur „schwerlich die Erinnerung an nukleare Sprengsätze aus dem Bewußtsein der Zuhörerschaft tilgen, auch wenn [. . .] sie die Herstellung von Atombomben nicht mehr mit aller Macht verfolgten.“40
Dass dies indes kaum eine vollständige Läuterung bedeutete, verdeutlicht Wirtz’ noch über vier Jahrzehnte nach Kriegsende niedergeschriebene Enttäuschung über den Misserfolg der deutschen Arbeiten. Einen wesentlichen Anteil an diesem Scheitern maß Wirtz dabei dem Umstand bei, dass Walther Bothe, Leiter der physikalischen Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Medizin in Heidelberg, zu Beginn der Kriegsarbeiten fälschlicherweise eine mangelnde Eignung des zur Verfügung stehenden Graphits als Moderatorstoff für einen Reaktor ermittelt hatte.41 Obgleich Walker inzwischen widerlegt hat, dass Bothes Falschmessung größere Auswirkungen hatte, da das Heereswaffenamt sich letztlich aus Kostengründen gegen Graphit als Moderator entschied,42 ist an Wirtz’ Lamento insbesondere die Wortwahl aufschlussreich. Das von Bothe ermittelte „negative Ergebnis“ sei, so Wirtz, „umso bedauerlicher“ gewesen, als sich später herausgestellt habe, dass die deutsche Industrie durchaus in der Lage gewesen sei, geeigneten Graphit zu liefern.43
Im selben Zusammenhang beklagt Wirtz, dass durch die mangelnde Koordination des Uranprojekts schon zuvor nicht genügend Uran habe beschafft werden können für einen von Harteck geplanten Versuch mit dem Ziel, die Eignung von Kohlenstoff und damit von dessen natürlicher Erscheinungsform Graphit als Moderator nachzuweisen;44 „ein Versuch, der [ . . .] sehr leicht, wenn er mit genügend großen Materialmengen durchgeführt worden wäre, gleich zu Kriegsbeginn zu einem kritischen Reaktor hätte führen können“.45 Dadurch, so Wirtz weiter, „wären die gesamten Kriegsarbeiten auf ein anderes Geleise gebracht gewesen. [ . . .] Die unglücklichen Folgen der Bothe’schen [sic] Graphitmessung wären nicht aufgetreten. Wenn ich sage unglücklich, meine ich dies natürlich in dem Sinne des physikalischen Fortschritts, an dem damals alle interessiert waren. Ob im ganzen für Deutschland ein so früher Erfolg günstig gewesen wäre“, so Wirtz in wahrhaft bemerkenswerter Wortwahl angesichts der möglichen Konsequenzen eines Durchbruchs der deutschen Kriegsforschungen, „müßte auf einer ganz anderen Ebene diskutiert werden.“46
Dass schließlich nach dem Krieg in der Bundesrepublik abermals ein Schwerwasser-Natururanreaktor zum Konzept der Wahl erkoren werden sollte, wirft die Frage auf, inwieweit dies eine „deutsche Linie“ darstellte. Tatsächlich beruhte die Tradition der Verwendung von Schwerwasser als Moderatorstoff in erster Linie auf den jeweiligen Rahmenbedingungen, die eine Verwendung von Graphit als nicht ratsam erschienen ließen. Waren während des Krieges Bothes Fehlberechnung und die Überzeugung des Heereswaffenamtes, Schwerwasser vergleichsweise günstig aus Norwegen beziehen zu können, ausschlaggebend gewesen,47 so führten in der Bundesrepublik zwei andere und noch genauer zu betrachtende Hauptgründe zur Wahl von Schwerwasser als Moderatorstoff: Zum einen die nur geringen inländischen Uranvorkommen, da ein Graphitreaktor deutlich größere Mengen Natururan benötigte,48 zum anderen das auf die Absicht einer möglichst großen Plutoniumproduktion deutende und auch von Industrieseite unterstützte Ziel der Wissenschaftler um Wirtz, einen möglichst hohen Neutronenfluss zu erzielen.49
Eine Traditionslinie bestand somit faktisch vor allem in Form einer Tradition des Pragmatismus. Gleichwohl erfuhr das Konzept des Schwerwasserreaktors nach dem Krieg gerade durch den Verweis auf die zuvor bereits gewonnenen Erfahrungen eine Stärkung. Dies verwundert insbesondere nicht mit Blick auf die personelle Kontinuität von der Reaktorforschungsgruppe am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik zu den nach dem Krieg in Göttingen und später dann Karlsruhe tätigen Wissenschaftlern.50 Unter diesen Voraussetzungen war es tatsächlich, wie Heisenberg später im Rückblick nahelegte, „kein Zufall, daß das erste Atomkraftwerk, das von einer deutschen Firma ins Ausland, nämlich nach Argentinien, geliefert wird, mit einem Reaktorkern versehen ist, der so, wie wir es im Kriege geplant hatten, aus Natur-Uran und schwerem Wasser besteht.“51 Es soll an späterer Stelle noch deutlicher darauf hingewiesen werden, wie erstaunlich es anmutet, dass deutsche Wissenschaftler sich innerhalb von nur zwanzig Jahren zweifach mit Schwerwasserreaktoren bereitwillig darum mühten, ihrer Regierung Plutonium zur Verfügung zu stellen, dabei beide Male – einmal rückblickend, einmal forschungsbegleitend – die ausschließliche Friedfertigkeit ihrer Absichten beteuerten und, schließlich, die Öffentlichkeit diesen Bekundungen in beiden Fällen Glauben schenkte.52 Damit basiert die Traditionslinie auf Seiten der Wissenschaft auf zwei Kontinuitäten: Einer technischen in Gestalt der Schwerwasserreaktorlinie – und einer personell-argumentativen der beteiligten Akteure.
Die staatliche Steuerung der Atomforschung im „Dritten Reich“ wiederum ist insofern mit derjenigen der Bundesrepublik zu vergleichen, als auch nach 1955 die verschiedenen Forschergruppen und Kernforschungseinrichtungen nur lose miteinander verbunden waren und die staatlichen Stellen keine Konzentration der Arbeiten im Stile des Manhattan-Projekts bewirkten. Diese Gemeinsamkeit beruht freilich auf unterschiedlichen Voraussetzungen: Wurden während des Krieges die Chancen auf die rechtzeitige Fertigstellung einer Atombombe für zu gering erachtet, musste in der jungen Bundesrepublik darauf geachtet werden, den Anschein einer rein zivil orientierten und daher primär von der Privatwirtschaft zu errichtenden Kernkraftinfrastruktur so weit wie möglich zu wahren.53 Die fraglos bestehende Kontinuität einer Selbstverwaltung der Industrie in Rüstungsangelegenheiten, basierend auf den zur Kriegszeit durchgeführten Reformen Speers, berührt den Bereich der Kernforschung jedoch nur am Rande: Die Rolle der Atomphysik war in der Anfangszeit der Reaktorentwicklung größer, der Reaktorbau hingegen vor allem eine technische Angelegenheit, weshalb der Anteil der Industrie an der Kerntechnikentwicklung in der Bundesrepublik entsprechend bedeutender ausfiel als noch während des Krieges.54 Bemerkenswert ist indes, dass an das unter Kriegsbedingungen naheliegende Autarkiestreben der beteiligten Politiker, Wissenschaftler und Industriellen durch die Wahl des Schwerwasserreaktorkonzepts in der Bundesrepublik angeknüpft wurde.55
Obgleich nicht mit dem Reaktorbau selbst befasst, sollte speziell die Chemieindustrie in der Bundesrepublik mit Vehemenz die Entwicklung der Kernforschung beeinflussen. Die Vertreter der einstigen I.G. Farben beteiligten sich nicht nur auf der Seite der Wirtschaft an der bundesdeutschen Kernenergieentwicklung, sondern teils auch von neuen Positionen in der Politik aus. Stärker als die marginale Kontinuität der Expertise zwischen den Bemühungen um den Aufbau einer Schwerwasserproduktion durch die I.G. Farben und den entsprechenden Arbeiten von deren Nachfolgekonzernen in der Bundesrepublik fällt dabei die noch genauer zu erörternde personelle Kontinuität in der Unternehmensführung insbesondere der Farbwerke Hoechst ins Gewicht, verkörpert durch die Figur Karl Winnackers. Eine Tradition der nuklearen Fachkenntnis findet sich auf Industrieseite am ehesten bei der Degussa, die sowohl zur Zeit des „Dritten Reiches“ als auch in der Bundesrepublik mit der Herstellung von Brennelementen betraut war.56
2.2Atomtechnik und Atombomben
Fast alle zwischen 1939 und den Anfängen der Atoms-for-Peace-Kampagne 1954 gebauten atomtechnischen Anlagen dienten einem militärischen Verwendungszweck.57





























