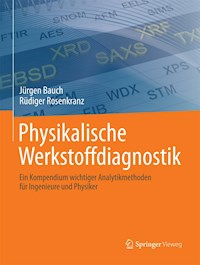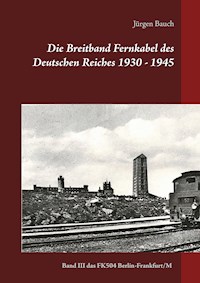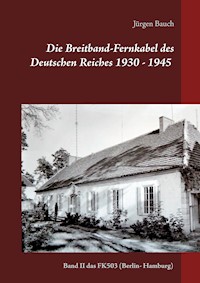
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch 2.Auflage 2020 beschreibt die Entstehung und die Nutzung des Breitband-Fernkabels FK503 der Deutschen Reichspost von 1934 - 1945 sowie die Planung zur Einspeisung eines Fernsehsignales von Berlin nach Hamburg. Für ein Breitband-Fernkabel zur Übertragung eines Signals bis zu 4 MHz wurde alle 35 km ein Verstärkeramt und alle 17,5 km ein Zwischenverstärker gebaut. Zusätzlich zum Fernsehsignal konnten im Bereich bis 1 MHz 200 Telefongespräche übertragen werden. Band II Das Fernkabel FK503 Berlin - Hamburg Weiterhin sind vorgesehen Band I Das Fernkabel FK501/502 Berlin-Leipzig-München Im Januar 2018 erschien Band III Das FK504 Berlin - Brocken-Frankfurt/M - Gr. Feldberg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
0. Vorwort
1. Die Breitband-Fernkabel des Deutschen Reiches 1935-1945
1.1 Das FK503 und seine Geschichte
1.1.1 Wie kam das Fernsehen nach Hamburg
1.2 Der Kabelverlauf des FK503
2. Die Verstärkerämter und Verteilerschächte des FK503
2.1 Das Kopfamt Berlin II
2.1.1 Der Verteilerschacht in Fahrland
2.2 Das Verstärkeramt Tremmen
2.2.1 Der Verteilerschacht in Garlitz
2.3 Das Verstärkeramt Rathenow
2.3.1 Der Verteilerschacht in Hohengören-Damm
2.4 Das Verstärkeramt Jarchau
2.4.1 Der Verteilerschacht in Grävenitz
2.5 Das Verstärkeramt Kleinau
2.5.1 Der Verteilerschacht in Riebau
2.6 Das Verstärkeramt in Cheine
2.6.1 Der Verteilerschacht in Növentien
2.7 Das Verstärkeramt in Masendorf
2.7.1 Der Verteilerschacht Bienenbüttel
2.8 Das Verstärkeramt Lüneburg
2.8.1 Der Verteilerschacht Tönhausen
2.9 Das Endamt in Hamburg
3. Die Kabel, die Hersteller und die Lieferanten
4.0 Die Endämter, Verstärkerämter und Zwischenverstärker
4.1 Das Vielbandsystem B200
4.2 Die Endämter
4.3 Die Verstärkerämter
4.4 Die Verteilerschächte / Zwischenverstärker
5.0 Die Strom- und Wasserversorgung
5.1 Die Stromversorgung
5.1.1 Netzersatzanlagen der DRP im Verlauf des FK503/FK504
5.1.2 Die Notstrom und Batterie Versorgung
5.2 Die Wasserversorgung
6. Die Verstärkerämter und Fernkabel nach 1945 in Deutschland
6.1 In der Provinz Sachsen SBZ (DDR)
6.1.1 Die Kabel und die Kabeldemontage in der SBZ
6.1.2 Die Verstärker u. die Verteilerschächte und deren Demontage
6.2 In der Besatzungszone WBZ (BRD)
6.2.1 Die Kabel und ihre weitere Verwendung nach 1945(WBZ)
6.2.2 Die Verstärkerämter und Verteilerschächte in der WBZ
7. Abkürzungen und Maßeinheiten
8. Literatur und Bildnachweise
8.1 Literaturquellen
8.2 Bildquellen
8.3 Adressen
8.4 Reproduktionen aus folgenden Archiven und Archivalien
8.4.1 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt Dessau
(
LHASA,DE)
8.4.2 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt Magdeburg
(LHASA MD)
8.4.3 Landeshauptarchiv Niedersachsen Wolfenbüttel
8.4.4 Bundesarchiv Berlin Finckensteiner Allee
8.4.5 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam
0. Vorwort
In diesem Buch „Die Breitband Fernkabel des Deutschen Reiches 1930-1945-2020, Band II das FK503“,2.Auflage wurden neue Erkenntnisse aus Kabelfunden und Hinweisen von Zeitzeugen eingearbeitet. Weiterhin wurden einige Bilder überarbeitet bzw. entfernt. Das Buch entstand nach über 7- jähriger Recherche in vielen Archiven und an Original Plätzen des ehemaligen Breitband Fernkabels FK503 Berlin – Hamburg.
Das Breitband Fernkabel FK503 war mit das erste in der Welt welches zur Übertragung eines regelmäßigen Fernsehprogramms genutzt wurde.
Eine wichtige Funktion bekam dieses Kabel während des Krieges als die Fernseh-Übertragungen eingestellt wurden und das Kabel für die Übertragung von bis zu 200 Telefon-Gesprächen und eines Radarsignales von Tremmen nach Berlin genutzt wurde.
Durch die hohe Dämpfung, auch des Fernsehsignals bei 4 MHz, musste alle 35 Km ein Verstärkeramt gebaut werden. Das war die halbe Strecke des sonst üblichen Verstärker-Amt Abstandes. Dieser Abstand wurde dann noch einmal halbiert, um die Dämpfung bei der Übertragung des Fernsehsignals bis 4 MHz auszugleichen.
In diesem Buch, Band II das FK503, wird versucht ein Überblick über die Planung und Realisierung eines zur damaligen Zeit einmaligen Projektes zu geben.
Es werden alle im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung notwendigen Maßnahmen, Bauten und technischen Anlagen im Buch beschrieben.
Ein besonderer Punkt ist dem Novum der Radarübertragung (Landbriefträger) vom Radarturm (Jagdschloss) bei Tremmen nach Berlin zum Flak-Turm, als Sondernutzung des Kabels gewidmet.
Die umfassende Recherche für dieses Buch begann im Jahre 2013 am Ort des ehemaligen Verstärker-Amtes II der Deutschen Reichspost in Berlin Stallupöner Allee.
Von hier ausgehend wurde versucht alle Standorte im Verlauf des Breitband Fernkabels FK503 zu dokumentieren!
Weiterhin wurde bisher Band III, das FK504 Berlin – Brocken-Frankfurt/M-Gr.Feldberg im BOD Verlag unter ISBN 978-3-7460-0926-1 veröffentlicht.
Die Veröffentlichung von Band I dem Fernkabel FK501/502
Berlin-Leipzig-München ist in Arbeit.
Der IV.Band München – Wien, das FK510 ist in weiterer Planung.
Blankenburg, d.01.06.2020
1. Die Breitband-Fernkabel des Deutschen Reiches 1935-1945
Bild 1 Das Kabelnetz so um 1938 vom FK501 – FK511
Aus der Karte geht hervor, dass es zum Zeitpunkt 1938/1939 ein umfangreiches Kabelnetz der Deutschen Reichspost gab. Fast alle Kabel wurden durch die Deutsche Fernkabelgesellschaft bei der die DRP Mitgesellschafter war gelegt. Die meisten Kabel waren für die Telefonverbindungen gelegt wurden. Die Kabel FK501/FK502 (Berlin-Leipzig und Berlin-München) sowie das Kabel FK503 (Berlin-Hamburg) waren die ersten Kabel, die für die Übertragung von Telefon-Bildsignalen genutzt werden konnten. Das FK501 versorgte Leipzig mit Bildsignalen, das FK503 Hamburg und das FK504 sollte die Fernsehsender Brocken und Gr.Feldberg speisen.
1.1 Das Fernkabel FK503 und seine Geschichte
1.1.1 Wie kam das Fernsehen nach Hamburg
Hamburg sollte bis Ende 1945 eine der 3 Städte in Deutschland sein in der ein Fernsehkabelnetz betrieben wurde. In den Städten Berlin, Leipzig und Hamburg wurde ein Fernsehkabel-Netz aufgebaut, welches Fernsehstuben und auch Großbildprojektoren mit Fernsehsignalen versorgen sollte. Leipzig konnte über das Fernkabel FK501 und Hamburg über das Fernkabel FK503 Signale von Berlin empfangen.
Aus www.filmmuseum-hamburg.de Artikel von von Dr. Gerhard Vogel
„Wer das Glück hat, in einem Umkreis von 60 bis 80 Kilometer von Berlin zu wohnen, wer überdies noch das nötige Geld hat, sich einen der recht teuren Empfänger zu kaufen, der kann heute schon täglich die Fernseh-Übertragungen aus der Reichshauptstadt empfangen. Wir armen Provinzler aber werden noch eine gute Weile warten müssen, bis wir an dieser Neuerung teilhaben können...“, so schrieb der Chronist des „Hamburger Anzeigers“ am 8. Mai 1935 und berichtete, dass es auch in Hamburg Initiativen gab: Arbeitsgemeinschaften beschäftigten sich intensiv mit dem Problem des Fernsehfunks und veranstalteten monatlich Vorträge. Baukästen für die private Konstruktion von Fernsehempfängern – wie vorher auch für Detektor- und Radioapparate – gab es seit 1929 bereits auf dem Markt.
Auf der Funkausstellung im Jahre 1934 in Hamburg hatte der Physikstudent Johann Gröber, damals 21 Jahre, seine Geräte (Sender und Empfänger) vorgeführt und auch im darauffolgenden Jahr zeigte er erneut im privaten Kreis seine Erfindungen, über die in Zeitungsmeldungen berichtet wurde.
Zwei weitere Ereignisse waren im Hinblick auf das Fernsehen in Hamburg von Bedeutung: Die 37. Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker im Juni und die Hamburger Funkausstellung im Oktober 1935.
Am 20. Juni 1935 fand in Hamburg im Hinblick auf die Fernsehentwicklung eine Premiere statt: zum ersten Mal – 3 Tage nach der Auslieferung der fabrikneuen Geräte von Telefunken und Daimler – wurde auf dem Heiligengeistfeld anlässlich der 37. Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker ein Wagenkonvoi platziert und erprobt. Die Deutsche Reichspost hatte die erste fahrbare Fernsehsendeanlage bauen lassen: insgesamt 20 schwere Fahrzeuge gehörten zu dieser Produktionseinheit. „Staunend steht der Laie vor den geheimnisvollen Apparaten, Maschinen und Geräten, Wunderwerken deutscher Technik“, weiß der Berichterstatter des „Hamburger Fremdenblattes“ am 17. 6. 1935 zu berichten.
Bild 2 Fernsehsenderzug 1 am 01.06.35 auf dem Heilgengeistfeld Hamburg (aus MFK Berlin)
Bild 3 Fernsehsenderzug am 01.06.35 auf dem Heilgengeistfeld Hamburg in Marschordnung (aus MFK Berlin)
Um die Qualität der Bilder und Töne zu testen, wurden 12 Empfangsstellen in Hamburg (u. a. Musikhalle, technische Staatslehranstalten, Postamt Schlüterstraße) eingerichtet; fertig produzierte Filme über Sport und Kulturereignisse sowie Live- Sendungen vom Heiligengeistfeld wurden gezeigt. Der Empfang der Signale auf dem Hapagdampfer „Caribia“ (technisch keine Besonderheit) fand in der Hafenstadt natürlich besondere Beachtung. Von 1941 bis 1943 ist das Berliner Programm auch in den Hamburger Fernsehstuben zu empfangen, beispielsweise am Dammtor, in der Schlüterstrasse oder im Postamt Altona. Vom ersten deutschen Einheitsfernseher "E1" zum Preis von 675 Reichsmark werden bis zum Krieg nur 50 Stück verkauft. Auf Anordnung des Oberkommandos der Wehrmacht wird das Programm von "Paul Nipkow" im August 1939 eingestellt. Die technische Weiterentwicklung des Fernsehens wird mit Beginn des Krieges unterbrochen. Das gesendete Programm läuft nur noch zur Betreuung der Truppen weiter und sendet Musik, Unterhaltung und Propagandanachrichten. Später stehen Empfangsgeräte in fast allen Lazaretten im Berliner Raum, "um unseren verwundeten Soldaten Erholung und Freude zu bringen". Im November 1943 wird der Berliner Fernsehsender im Amerika-Haus von Bomben zerstört.
Aus www.filmmuseum-hamburg.de
Das Berliner Programm im Hamburger Fernsehdrahtfunk
„Bereits am 20.12.1938 genehmigte das Reichspostministerium die Versorgung mit dem Programm des Paul-Nipkow-Senders aus Berlin in Hamburg. Damit wurde der Fernseh-Drahtfunk eingeführt: das Breitbandkabel 503 von Berlin nach Hamburg übertrug neben dem Fernsehsignal weitere 200 Telefongespräche, endete im Fernamt Schlüterstraße und sollte an folgenden Orten öffentlich zugänglich sein:
Eppendorfer Landstraße, Postamt 20: Raum für 40 Personen
Dammtor: Raum für 60 Personen
Altona Postamt: Raum für 25 Personen
Jungfernstieg 26-33, Hamburger Hof: Raum für 30 Personen
Fernsprechamt Große Allee (Großbildstelle für 60 Personen)
Fernsehstelle Stephansplatz - Schlüterstraße 53
Der Reichsstatthalter am Harvesterhuder Weg 10 sowie der Bürgermeister an der Bellevue 24 waren gleichermaßen durch eine Sonderleitung mit dem Fernsehsignal versorgt. Im Postamt Jungfernstieg war ein zusätzlicher Abtaster aufgestellt, der bei eventuellen Störungen ein Ersatzprogramm geliefert hat. Der Hamburger Fernseh-Drahtfunk wurde am 17. Juni 1941 eröffnet, musste 1943 wegen der Zerstörungen durch den Bombenkrieg aufgegeben werden. Publizistisch wurde diese Phase nicht begleitet. Die Berliner Fernsehsendungen waren der Öffentlichkeit nicht zugänglich, sie wurden in Änderung der ursprünglichen Pläne für die Truppenbetreuung eingesetzt.
Im November 1943 hatten Brandbomben in Berlin die Fernsehsender zerstört, dennoch wurden bis in das Jahr 1944 Programme ausgestrahlt, „um unseren verwundeten Soldaten Erholung und Freude zu bringen. So verfolgt ein fester Zuschauerkreis die künstlerische Entwicklung dieses neuen Instruments, das später einmal dem ganzen Volk gehören wird“, so eine Mitteilung der Reichsrundfunk- Gesellschaft in ihrem Januar-Heft 1944.
Fernsehgeräte in Privathaushalten waren nicht in Betrieb, der Zugang zum Kabel verwehrt. Nach dem Krieg wurden am 6.3.1946 die noch vorhandenen Apparaturen beschlagnahmt und mussten an England abgegeben werden. Ein Fernsehempfänger (Baujahr 1939) konnte lange Zeit im Hamburger Postmuseum besichtigt werden, er befindet sich z. Zt. jedoch im Arsenal.“
Zum Stand der Fernsprechübertagungstechnik (VDE Fachberichte 1936)
„Die Fernsprechübertragungstechnik hat in den letzten Jahren einen starken Anstoß erhalten durch die Einführung des Fernsehbetriebes und die damit verbundenen Aufgabenstellungen.