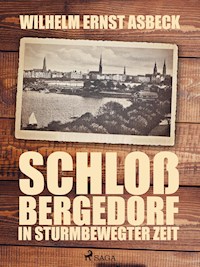Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der auf wahren Begebenheiten beruhende historische Roman erzählt die Geschichte des Hamburger Holzhändlers Otto Brüggemann (1600–1640), der mitten im Dreißigjährigen Krieg den kühnen Plan entwickelte, für Herzog Friedrich den Dritten von Holstein-Gottorp den persischen Handel über Holstein zu leiten und damit den damals im Orienthandel führenden Mächten Holland und England die Stirn zu bieten. Im Zentrum des Romans steht die Reise, die Brüggemann – in seinem Gefolge unter anderem der berühmte Barockdichter Paul Fleming – vom Oktober 1633 bis August 1639 nach Russland und Persien unternahm. Neben Stationen in Moskau auf der Hin-und Rückreise verbrachte er insgesamt drei Jahre in Ispahan, dem heutigen Isfahan, wo er mit dem Schah verhandelte. Nach Hamburg zurückgekehrt, wird er wegen Amtsmissbrauch zum Tode verurteilt. Wilhelm Ernst Asbecks Fazit: "Es liegt eine tiefe Tragik über dem Leben Brüggemanns, der eine der größten Taten seiner Zeit vollführte, fast sein Ziel erreichte und dessen Werk dann, nicht ohne eigene Schuld, doch scheiterte." Asbeck indes hat durch seinen gelungenen Roman nicht nur Brüggemanns Leben und Wirken dem Fast-Vergessenwerden entrissen, sondern der Welt auch eine spannende, informative und noch heute höchst lesenswerte Lektüre geschenkt!Wilhelm Ernst Asbeck (1881–1947; Pseudonym: Ernst Helm) war ein deutscher Schriftsteller. Wilhelm Ernst Asbeck lebte in Hamburg; während des Zweiten Weltkriegs übersiedelte er nach Burg (Dithmarschen). Sein literarisches Werk besteht vornehmlich aus Romanen, Erzählungen, Märchen, Theaterstücken und Hörspielen, die sich häufig historischen Stoffen annehmen und überwiegend in Asbecks norddeutscher Heimat, etwa im Raum Hamburg und an der Nordseeküste, aber auch etwa in Skandinavien angesiedelt sind.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Ernst Asbeck
Die Brücke nach Ispahan
Roman
Saga
Die Brücke nach Ispahan
© 1937 Wilhelm Ernst Asbeck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517819
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com
Geleitwort
Dieses ist der Roman des Hamburger Holzhändlers Otto Brüggemann. Er hatte den gewaltigen Plan, mitten im Dreissigjährigen Krieg für Herzog Friedrich dem Dritten von Holstein-Gottorp den persischen Handel – Holland und England zum Trotz – über Holstein zu leiten.
Ich habe mich, soweit es der Rahmen eines Romans zulässt, an geschichtliche Belange gehalten, in der Hauptsache an des Holsteinischen Gesandtschaftssekretärs Adam Olearius „Moskowitische und persianische Reisebeschreibung“.
Es liegt eine tiefe Tragik über dem Leben Brüggemanns, der eine der grössten Taten seiner Zeit vollführte, fast sein Ziel erreichte und dessen Werk dann, nicht ohne eigene Schuld, doch scheiterte.
Wilhelm Ernst Asbeck
Erster Teil
Ein grosser Plan wird geboren
Am 20. Februar 1600 sass der Holzhändler Hugo Brüggemann mit gestütztem Haupt sinnend in seinem Büro. Stunde auf Stunde wartete er in Furcht und Sorge. Diese entsetzliche, unerträgliche Ungewissheit! Die ganze Nacht hindurch schon lag seine Frau in Schmerzen, nun sind der Morgen und auch der Mittag vergangen. Bleigrau senkt sich die frühe Abenddämmerung hernieder und immer noch keine Erlösung.
In den weiten Kontor- und Lagerräumen wurde eine Öllampe nach der anderen angezündet; der einsame Mann achtete nicht darauf. Seine Gedanken umgaben heute nur sein Weib. Eine lähmende, furchtbare Angst überfiel ihn.
Wurde nicht soeben sein Name gerufen? Deutlich vernehmbar und doch wie aus einer anderen Welt kommend? Er blickte zur Tür, von dort musste das Schicksal zu ihm treten.
Minuten vergingen, endlose Minuten, die ihm wie Ewigkeiten erschienen. Da stand plötzlich jemand im Zimmer. Eine bleiche, zitternde Gestalt. Er hatte sie nicht kommen hören. War sie wie das Unheil auf leisen, unhörbaren Sohlen hereingeschlichen, oder schienen seine Sinne von den Dingen des wirklichen Lebens abgelenkt?
Eine gedämpfte, bebende Stimme erzählte, dass ihm soeben ein Sohn geboren sei, aber dem Herrn dort oben habe es gefallen, sein Weib zu sich zu nehmen. – – –
Schweigend hatte der Kaufmann die Botschaft vernommen, stumm stand er wenige Tage später am Grab der geliebten Frau. Keine Träne weinte er; stolz und aufrecht bot er dem Schicksal Trotz.
Er hatte sich nicht unterkriegen lassen, als das einzige Wesen, das er auf Erden liebte, von ihm genommen wurde. Nur wortkarg war er seitdem geworden. Er glich einem knorrigen Baum, dem die Sonne entzogen, der nun langsam dahinwelkte, an dessen Mark der Wurm zehrte und ihn allmählich aushöhlte. – – –
Zehn Jahre vergingen. Sein angeborenes Gerechtigkeitsgefühl war zu gross, als dass er das Kind entgelten liess, die unschuldige Ursache seines Unglückes zu sein; aber, wenn er auch den geheimen Hass niederrang, Liebe konnte er für seinen Sohn nicht aufbringen. Dieser zarte, schmächtige Bursche hatte nichts mit ihm gemein.
Fast ängstlich blieb er bemüht, jeder Begegnung mit ihm aus dem Wege zu gehen. Da fügte es das Schicksal, dass er eines Tages einen unfreiwilligen Einblick in die Empfindungswelt seines Sohnes tun musste. –
In der Steinstrasse geschah es. Hier gewahrte er plötzlich, dass sein Junge in kurzem Abstand vor ihm dahinschlenderte. Aus der schmalen Altstädter-Fuhlentwiete tauchte ein stämmiger Bursche von etwa sechzehn Jahren auf, wild, verwahrlost, mit plumpen, rohen Gesichtszügen. Als dieser den zarten, gutgekleideten Otto erblickte, schien dem Raufbold der Gedanke zu kommen, dem Jüngeren und Schwächeren einen Streich zu spielen. Er ging neben dem Kleinen her, hänselte ihn mit Redensarten und belegte ihn mit üblen Schimpfworten. Da flammte in des Kindes Augen der Zorn über all dies Hässliche und Gemeine auf. Er verbot dem Grossen sein rüpelhaftes Benehmen. Der jedoch stiess ihn vom Bürgersteig und schlug ihn ins Gesicht. Was dann geschah, kam so unerwartet und schnell, dass der alte Brüggemann den Vorgängen kaum zu folgen vermochte. Wie eine Pantherkatze sprang sein Sohn den Rauflustigen an, klammerte seine Beine wie Schraubstöcke um den Leib des Gegners und drückte ihm mit beiden Händen die Kehle zu. Vergeblich versuchte der andere sich aus der Umklammerung zu befreien; er mochte zerren und schlagen, soviel er wollte. Die Wut verlieh dem Beschimpften eine Widerstandskraft, an der jeder Angriff abprallte. Zwar lief Otto das Blut aus Mund und Nase, aber die Schläge schienen nur seinen blinden Zorn zu erhöhen; tiefer und fester krampften sich seine Finger um den Hals des Widersachers. Dunkelrot war der Kopf des Raufboldes, und die Augen begannen ihm aus den Höhlen zu treten.
Eine zahlreiche Zuschauermenge hatte sich angesammelt. Sie war Zeuge der wüsten Herausforderungen gewesen und freute sich, dass der schmächtige, zehnjährige Knabe es fertigbrachte, dem stämmigen Flegel den richtigen Bescheid zu geben.
Wie aus einem Traum erwachte der Kaufmann. Schnell trennte er die Kampfhähne. Der Grosse rang nach Atem, aber in seinen Augen blitzte es boshaft und rachgierig auf. Als er jedoch einen Blick auf des Holzhändlers Hünengestalt warf und dieser ihm obendrein ein paar schallende Ohrfeigen verabreichte, hielt er es doch für ratsamer, sich heulend und schimpfend aus dem Staube zu machen. – –
Daheim sassen Vater und Sohn einander gegenüber. Kein Wort war bisher zwischen ihnen gewechselt worden. Endlich brach der Ältere das Schweigen: „Weisst du, dass du den Jungen beinahe umgebracht hättest?“
Ein Zug tiefster Verachtung legte sich um des Knaben Mund: „Es wär’ nicht eben viel daran verlorengegangen; von seiner Sorte gibt es mehr als zuviel!“ war die Antwort. – –
Von diesem Tage an verfolgte der Kaufherr mit grösster Aufmerksamkeit den Werdegang seines Kindes. Wenige Jahre später nahm er Otto in sein Handelshaus auf. Sein Grundsatz lautete: ein Geschäftsmann, der vorwärtskommen will, muss hart sein und einen klaren Blick haben. Diese Eigenschaften traten in Ottos Wesen von Jahr zu Jahr schärfer hervor. Mit Feuereifer widmete er sich seinem Beruf. Er besass ein schnelles Auffassungsvermögen und einen fast krankhaft übersteigerten Hang zum Geldverdienen. Er und sein Vater lebten und schafften nur für das alte Handelshaus, aber darüber hinaus verband sie kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das Herz des Sohnes, das sich in den Jahren der Kindheit vergeblich nach Liebe gesehnt hatte, war erkaltet, und in Brüggemann erlosch dieser heilige Funke beim Tod seines Weibes. – –
Einundzwanzig Jahre waren seit Ottos Geburt vergangen, da starb der Vater. Das Ereignis ging dem Sohn nicht sonderlich nahe. Er kannte jetzt nur ein Ziel: Geld verdienen, Ansehen und Ehre erringen, hoch über die Köpfe seiner Mitbürger emporsteigen!
*
In einer jener seltsamen Strassen Amsterdams, durch deren Mitte sich ein Kanal zieht, zu beiden Seiten mit Bäumen bestanden und die Ufer durch viele kleine Brücken miteinander verbunden, stand um diese Zeit ein alt-ehrwürdiges Patrizierhaus. Dort wohnte der Kaufherr David van Scheijten, Inhaber eines der bedeutendsten Handelsunternehmungen Hollands. Er, ein Mann in den besten Jahren, galt als das Urbild jener bedächtigen, klugen und doch wagemutigen Händler, die das Ansehen und die Macht des kleinen Staates begründet und Jahrhunderte hindurch behauptet hatten.
Vor ihm sass ein Herr von etwa dreissig Jahren. Seine Kleidung war europäisch und betont vornehm, doch sie stand im krassen Gegensatz zu seinem Gesicht, das rundlich und von quittengelber Farbe war. Das pechschwarze Haar trug er gescheitelt, von wohlriechenden Ölen durchtränkt, lag es glatt zurückgekämmt. Ein schmaler, zusammengekniffener Mund und eine hervorspringende Hakennase gaben seinem Antlitz das Aussehen eines Raubvogels. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt, wenn man seine nachtdunklen Augen betrachtete. Er hatte einen ruhelosen, stechenden Blick. Sein Körper war untersetzt und breit. An den Fingern seiner klobigen Hände trug er kostbare Ringe. Sein Wesen setzte sich zusammen aus einem Gemisch von aalglatter Unterwürfigkeit, Rücksichtslosigkeit und Geschäftsklugheit.
Er hatte in lässiger Haltung auf einem Stuhl Platz genommen, während Mynheer im Sofa sass. Beide Herren schmauchten Pfeife.
Vor dem Holländer lagen mehrere Empfehlungsbriefe ausgebreitet, die er mit grosser Aufmerksamkeit las; dann faltete er sie sorgsam zusammen und gab sie seinem Gegenüber zurück, indem er fragte: „Sie sind also Perser?“
„Jawohl, mein Herr, aber erzogen bin ich in europäischem Sinne. Mein Vater liebte die Kultur des Abendlandes, und Sie werden aus meiner Kleidung und Sprache feststellen, dass ich bald mehr Holländer als ein Kind meines Geburtslandes bin.“
„Leben Ihre Eltern nicht mehr?“
„Nein. – Dort unten sieht die Welt anders aus, als im geruhsamen Holland. Es ist nicht ungefährlich, ein Würdenträger am Hofe Abbas zu sein. Vater fiel in Ungnade. Ein unbedachtes Wort genügte. Er und meine Mutter wurden enthauptet.“
„Sie sprechen über diese Dinge, als berichteten Sie die alltäglichsten Begebenheiten“, unterbrach ihn der Handelsherr.
„Würden Sie im Iran leben, so wüssten Sie, dass jedermann, der sich in der Umgebung des Schahs befindet, damit rechnet, eines Tages eines gewaltsamen Todes zu sterben. Niemand bei uns sieht etwas Besonderes darin.“
„Wirklich, ein verlockendes Land, in dem Sie zu Hause sind!“
„Unser Glaube lehrt uns, eines jeden Menschen Schicksal sei ihm von Gott vorgeschrieben.
„Ich würde jedenfalls versuchen, mein Geschick zu meistern“, konnte van Scheijten nicht unterlassen zu bemerken.
„Ich tat ein gleiches; hielt mich vom Hofe fern und wurde Kaufmann.“
„Und Abbas?“
„Er ist ein grosszügiger Herrscher, der dem Sohn nicht nachträgt, dass einst sein Vater in Ungnade gefallen ist. Er sieht es gern, wenn ich Beziehungen zu fernen Ländern anknüpfe, und er unterstützt mich in meinen Bemühungen weitgehendst.“
„Ja, Sie versprechen sich also aus der Verbindung mit meinem Hause guten Nutzen für sich und – – mich?“
Mit der ganzen Leidenschaft des Südländers schilderte der Gefragte den Reichtum seiner Heimat und die vielseitigen Möglichkeiten, mit den Erzeugnissen Persiens grosse Geschäfte zu machen. Ein leichtes würde es für ihn sein, die Franzosen und Engländer aus dem Felde zu schlagen und das Alleinhandelsrecht für fast alle Staaten des Abendlandes in die Hände Mynheer van Scheijtens zu lenken.
Als die beiden Männer spät in der Nacht schieden, war der Vertrag unterzeichnet, und das Handelshaus David van Scheijten erklärte sich bereit, in Ispahan eine Faktorei zu errichten, deren Leitung in Operchis Hände gelegt wurde.
Lange, nachdem der Perser gegangen war, dachte van Scheijten noch darüber nach, ob er richtig gehandelt habe. Ein Vermögen legte er dort draussen fest!
*
Fünf Gäste weilten eines Abends in Otto Brüggemanns Heim in der grossen Reichenstrasse: die Familie Tullae und der Schweizer Stadler.
Andreas Tullae galt als ein Künstler in seinem Beruf. Ratsherren, Grafen und Fürsten zählten zu seinen Kunden. Vor vielen Jahren war einer seiner Vorfahren von Reval nach Hamburg übergesiedelt und als Uhrmacher zugelassen worden. Das Handwerk hatte sich von Geschlecht zu Geschlecht, von dem Vater auf den Sohn vererbt. Christine, die Gattin Tullaes, entstammte einer reichen Kaufmannsfamilie. Beide lebten in glücklicher Ehe, die nur dadurch getrübt wurde, dass der Name Tullae mit ihnen aussterben würde; denn sie besassen keinen Sohn, sondern nur zwei Töchter. Auf diese konnten sie allerdings stolz sein; in ihnen fanden sich Anmut, Geist und Schönheit vereint. Barbara hiess die ältere. Ein stattlicher junger Mann von fünfunddreissig Jahren hatte neben ihr Platz genommen, Johann Rudolph Stadler, des Uhrmachers erster Gehilfe, der wegen seiner Kunstfertigkeit einen guten Ruf genoss. Sein offenes Gesicht, die weltgewandten Umgangsformen, sowie sein bescheidenes und doch sicheres Auftreten gewannen ihm alle Herzen. Er stammte aus Zürich. Tullaes jüngere Tochter, Elisabeth, kaum neunzehn Jahre alt, sass Brüggemann zur Seite.
Die Unterhaltung verlief lebhaft. Hier spürte man nichts von den Schrecken und dem Elend des furchtbaren Krieges, der seit fast acht Jahren die deutschen Lande überzog. Frohes Lachen und Gläserklang hallten durch den Raum.
Draussen hörte man einen Wagen anfahren und vor dem Hause halten. Unwillkürlich verstummte das Gespräch. Wenige Augenblicke später ward die Tür geöffnet; der treue, wortkarge Diener Steen Jenson trat ein, überreichte seinem Herrn eine Karte und flüsterte ihm etwas zu.
Brüggemann horchte auf und sah sich die Karte an. Unter fremden, ihm unbekannten Zeichen stand in lateinischen Buchstaben: „Nicolaus Jacob Operchi, Kaufmann, Ispahan, Persien.“
Unwillkürlich hatte der Hausherr mit halblauter Stimme gelesen. Nun war allseitig das Interesse erweckt. Ein persischer Kaufmann in Hamburg, das gab es nicht alle Tage!
„Ich lasse bitten!“ – Gleich darauf geleitete Jenson den Fremden hinein.
Operchi machte eine weltmännische Verbeugung, begrüsste die Anwesenden in gebrochenem Deutsch und fragte, ob man ihn verstehen werde, wenn er Holländisch rede, da er diese Sprache besser beherrsche. Brüggemann und Stadler bejahten.
„So bitte ich gütigst zu entschuldigen, dass ich so spät noch um eine Unterredung ersuche. Da ich aber weiss, dass ein Handelsherr am Tage stets sehr beschäftigt ist und einer Sache von grosser Wichtigkeit nicht die erforderliche Zeit widmen kann, so nahm ich mir die Freiheit, nach Feierabend vorzusprechen. Dabei ahnte ich allerdings nicht, dass ich störend in den Familienkreis eindringen würde.“
Brüggemann machte ihn mit den Anwesenden bekannt, forderte ihn auf, an der Tafel teilzunehmen und sein Gast zu sein.
Bald kam ein lebhaftes Gespräch in Gang. Der Perser erzählte von der Schönheit seiner Heimat, von Gebräuchen und Sitten, von Land und Leuten.
In Stadlers Augen begann das Feuer der Abenteuerlust zu leuchten. Sein unruhiger Geist hatte ihn schon mit kaum zwanzig Jahren in die Welt hinausgetrieben; er kannte die Schweiz, Oberitalien, Südfrankreich, den Rhein und Holland, wo er ein Jahr in Amsterdam verbrachte.
Operchi nannte den Namen van Scheijten. Ja, den Mann schätzte auch Stadler sehr; er war bei Mynheer aus- und eingegangen und ob seiner Kunstfertigkeit hoch angesehen gewesen. Diese gemeinsame Bekanntschaft schlug schnell die Brücke zu einem herzlichen Ton.
Mit grosser Spannung folgten der alte Tullae und die Damen der Unterhaltung. Brüggemann und Stadler übersetzten ihnen den Inhalt.
Der Perser erzählte, dass er bisher den Landweg gewählt habe, um die Völker und die Möglichkeit neuer Verbindungen an Ort und Stelle zu studieren. Dann fuhr er fort:
„Oft, sehr oft, bin ich auf Ihren Namen gestossen, und ich freue mich Ihnen sagen zu können, dass ich nur Gutes hörte. Überall rühmt man Ihren tatkräftigen Unternehmungsgeist. Weitschauend, wie Sie sind, beschränken Sie sich nicht nur auf den Holzhandel, sondern verleiben immer neue Zweige Ihrem Geschäft ein. Das gibt mir den Mut, Sie aufzusuchen. Ich will Ihnen den Weg bahnen zu ungeahnten Verdienstmöglichkeiten!“
Der Hamburger lehnte sich lächelnd zurück. Er betrachtete alle Dinge nüchtern und sachlich. So fragte er denn: „Und welchen Vorschlag wollen Sie mir unterbreiten?“
„In Ispahan eine Faktorei zu errichten.“
„Unter Ihrer Leitung natürlich?“
„Gewiss; denn ich kenne die Eigenarten des Landes und seiner Märkte wie kein zweiter. Zudem besitze ich das grösste kaufmännische Unternehmen Persiens. Es ist nichts Geringes, was ich Ihnen vorschlage. Sie sollen von Hamburg aus den Handel mit den Erzeugnissen des Irans, Arabiens und des Orients für den gesamten Norden in die Hände bekommen.“
„Sollten da andere Staaten nicht auch mitzureden haben?“
„Portugal und Spanien sind längst ausgeschaltet, Italien hat nie bei uns festen Fuss fassen können; eine Zeitlang besassen Frankreich und England grösseren Einfluss in Ispahan. Jetzt ist ihnen in Holland ein neuer Wettbewerber entstanden. Es hat aber an den Südstaaten des Abendlandes ein hinreichend weites Absatzgebiet. Nun steht es bei mir, Ihnen Mittel- und Nord-Europa zu überlassen. Wohlverstanden, Ihnen allein!“
Die Gespräche währten bis tief in die Nacht. Brüggemann stand dem Vorschlag nicht ablehnend gegenüber, aber zu einem Vertrag konnte er sich nicht sofort entschliessen. Er wünschte jedoch mit Operchi in Verbindung zu bleiben.
Stadler erhob sich. Sein Gesicht glühte vor Erregung. „Bietet sich in Ispahan auch Gelegenheit für einen tüchtigen Uhrmacher, um vorwärtszukommen?“ fragte er.
Der Perser antwortete: „Selbstverständlich! Es dürfte sogar möglich sein, am Hofe Abbas eingeführt zu werden; ich selbst würde meinen ganzen Einfluss bei dem Schah geltend machen!“
Tullae hörte diesen Vorschlag ungern; es handelte sich um seinen tüchtigsten Gehilfen. Auch Barbara liess den Kopf hängen. –
Aufregende Tage folgten. Im Hause Tullae fand Doppelverlobung statt. Stadler sollte Operchi nach Ispahan begleiten und später seine Braut holen. Sie zeigte sich jetzt voll kindlicher Freude; denn auch sie hatte die Reiselust ergriffen; fremde Menschen und Städte wollte sie kennenlernen und schliesslich an der Seite des geliebten Mannes im Märchenland ein neues Heim finden. Sie war jung und unerfahren, glaubte, da draussen müsse alles leuchtender und schöner sein, als hier oben im Norden; dort im Süden werde ihrer eitel Glück und Freude warten.
Brüggemann bestärkte die beiden in ihrem Vorhaben, bat aber gleichzeitig seinen zukünftigen Schwager, ihm über alles Wissenswerte ausführlich zu berichten, besonders die Augen offenzuhalten, welche Handelsmöglichkeiten sich boten. Auch sollte er die europäischen Niederlassungen auskundschaften und bei der weiten Entfernung das Für und Wider einer solchen Verbindung sorgfältig abwägen.
*
An einem schönen Sommertag des Jahres 1626 verliess in aller Frühe ein stattlicher Zug das Steintor. Zwei Reisewagen, mit allen Bequemlichkeiten der damaligen Zeit ausgestattet, mehrere hochbeladene Plangespanne und eine grosse Anzahl Landsknechte traten die Reise nach Lübeck an. Man tat gut daran, vorsichtig zu sein; denn Unruhe und Feindschaft beherrschten die Welt. Der Heerweg durch den Sachsenwald galt schon in Friedenszeiten wegen der adligen Strauchritter als nicht geheuer. Nun, diese Herren würden sich besinnen, allzu lüstern nach der kostbaren Beute zu greifen: denn sie könnten mit blutigen Köpfen heimgeschickt werden!
Brüggemann ist grosszügig gewesen. Er hat den fremden Gast mit vielen kostbaren Geschenken bedacht, und dieser versprach, ihm aus Ispahan seine Dankbarkeit zu beweisen. Der Kaufherr solle bei der Gelegenheit auch gleichzeitig die wichtigsten persischen Handelsartikel kennenlernen.
Ohne Unfall wurde das Reiseziel erreicht. Es traf sich gut; eine Bark lag zur Abfahrt nach Reval bereit.
Den Abschied empfand Stadler schwerer, als er dachte. In dieser Stunde spürte er, wie tief er mit den aufrechten nordischen Menschen verbunden war, und welchen Gefahren und welcher Ungewissheit er entgegenging. – –
Brüggemann, auf der Hinfahrt der unterhaltendste Gesellschafter, zeigte sich auf der Rückreise still und in sich gekehrt. Ein grosser, kühner Plan begann Gestalt zu gewinnen: immer drückender wurde der Gürtel, den der Dänenkönig Christian IV. um Hamburg legte. Hatte er vordem schon durch seine Kriegsschiffe in der Elbe eine unerträgliche Überwachung und Belastung der Schiffahrt ausgeübt, so prahlte er jetzt ganz offen, die Festung Glückstadt nur deshalb erbaut zu haben, um den Handel der ihm verhassten Hansastadt zu lähmen und nach seiner Neusiedlung zu leiten. Unter solchen Umständen ergab sich die Notwendigkeit, rechtzeitig einen Gegenstoss zu unternehmen. War’s mit dem Schwert in der Faust nicht möglich, so musste ein anderer Weg beschritten werden. Durch den Handel mit Persien glaubte Brüggemann ihn gefunden zu haben. Seine angeborene Vorsicht hielt ihn jedoch davon ab, selbst ein solches Wagnis zu unternehmen. Ihm schwebte ein gewaltiges Unternehmen vor Augen; er dachte dabei an die Ost- und Westindischen Kompanien, wie sie in Frankreich, England und Holland bestanden.
Anfangs versuchte er eine Vereinigung der reichsten Hamburger Handelshäuser zustande zu bringen; die Herren fanden indessen heraus, dass Brüggemann auf jeden Fall sein Schäfchen ins Trockne bringen würde, sie aber gar leicht in die Lage versetzt werden könnten, eintretende Verluste allein zu tragen. Sein Anerbieten fand keine Zustimmung.
Nun wandte er sich an den Rat der Stadt. Man lachte ihn aus. Nein, da werde das Geld aus der Staatskasse denn doch zu wichtigeren Dingen benötigt. In diesen unsicheren Kriegszeiten legte man einen höheren Wert darauf, die Festungswälle instandzuhalten und Landsknechte anzuwerben, als sich auf zweifelhafte Geschäfte mit unbekannten Ländern einzulassen.
Je höher aber sich die Schwierigkeiten türmten, die sich seinem weitblickenden Plan entgegenstellten, um so unbeugsamer reifte in Brüggemann der Entschluss, seinen Gedanken in die Tat umzusetzen. Mit zäher, verbissener Willenskraft richtete er sein ganzes Denken und Sinnen darauf, von Persien das alleinige Handelsrecht für seine Heimat, Dänemark, Schweden, Norwegen und die Küstengebiete der Ostsee zu erlangen; später hoffte er dann auch noch Holland und alle übrigen Wettbewerber aus dem Felde schlagen zu können.
Otto Brüggemanns kühner Gedanke bedeutete für die damalige Zeit etwas Ungeheuerliches. Man schüttelte den Kopf und begann ihn als Sonderling zu verspotten. Niemand glaubte an ihn – bis auf eine: seine Braut Elisabeth Tullae. Sie stärkte sein Zutrauen und zweifelte nicht daran, dass der Tag kommen werde, wo sein Name als der eines der grössten und geachtetsten Kaufherren aller Zeiten genannt werden würde.
Der Gedanke reift zur Tat
Wieder war ein schöner Sommertag. Zwei Jahre vergingen, seitdem Operchi und Stadler Hamburg verlassen hatten.
Andreas Tullae schritt hoch erhobenen Hauptes durch seinen Laden. Nicht ohne Grund suchten ihn die hohen Herren von nah und fern auf; wo fanden sie sonst auch solch eine reiche Auswahl auserlesener Kunstwerke?
Vor einem mächtigen, in Ebenholz gefassten und mit Silber verziertem Uhrwerk blieb er stehen. Es handelte sich um eines seiner herrlichsten Schaustücke; aber es dürfte nicht leicht halten, einen Käufer zu finden, der in der Lage war, den Preis zu zahlen.
Und doch befand sich ein noch kostbarerer Gegenstand in seiner Ausstellung. Da stand auf einem Tisch ein vollständiges, künstliches Bergwerk aufgebaut, in dessen Mitte ein grosses Zifferblatt und im Innern eine Uhr mit Schlagwerk angebracht waren. Mit dem Glockenschlag zwölf belebte sich ein darunter angebrachter Hohlraum. Figuren tauchten aus der Tiefe hervor, und vor den Augen der Beschauer zog in beweglichen Bildern die bekannte Geschichte des verlorenen Sohnes vorüber. Gleichzeitig ward es im Bergwerk lebendig, ein eifriges Hämmern, Arbeiten und Pochen entstand. Mit dem zwölften Glockenschlag fielen die kleinen Bergleute wieder in ihre Erstarrung zurück; das letzte Bild der biblischen Legende verschwand in der Versenkung. –
In des Meisters Werkstatt betätigten sich ein halbes Dutzend Gesellen; aber keiner von ihnen vermochte Stadler zu ersetzen. Tullaes Gedanken weilten bei ihm.
Mitten aus seinem Denken wurde er herausgerissen. Ein Wagen hielt vor der Tür. Eilfertig wollte er dem vermeintlichen Kunden entgegengehen, als Brüggemann – seit Jahresfrist sein Schwiegersohn – und Elisabeth eintraten. Ihnen folgten zwei Angestellte, die Pakete herbeischleppten, eine ganze Fuhre!
„Um Himmels willen, Otto, was soll das? Du versperrst ja jeden Durchgang! Vorsicht! Vorsicht!“
Der Gefragte zeigte ein so stolzes und frohes Lachen, wie der Meister es nie zuvor von ihm gehört hatte.
Tullaes Frau und Barbara eilten herbei; sie schlugen staunend die Hände über dem Kopf zusammen.
„Grüsse aus dem Morgenland“, rief übermütig Elisabeth.
„Auch Post von Rudolf?“ fragte errötend Barbara.
Freilich! Hier, ein langer Brief. Gut geht’s ihm. Ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht! Am Hof des Schahs ist er eingeführt und auf dem besten Wege, ein berühmter und reicher Mann zu werden! – Doch seht, was mir Operchi als Gegengaben sandte!“
Paket auf Paket wurde geöffnet: ein kostbarer Perserteppich, Tücher in leuchtenden, bunten Farben, Seidenstoffe, Damastvorhänge und Decken kamen zum Vorschein. Wunderbare Waffen mit reichem Gold- und Silberschmuck und als Wichtigstes dann Proben von Gewürzen.
„Alle die Herrlichkeiten gehören euch; kommt aber heut’ abend zu uns, damit ihr auch unsere Schätze bewundern könnt“, sprach Elisabeth.
„Operchi ist ein grosszügiger Mann“, meinte bewundernd Tullae.
„Er ist ein schlauer Fuchs, der mich aus meinem Bau locken möchte; er wird aber wenig Glück damit haben“, erwiderte Brüggemann.
„Wie meinst du das?“
„Ich denke, dass ich ihn nicht brauche, um das persische Geschäft zu machen. Selbst ist der Mann!“
Barbara schüttelte den Kopf. „Nein, Otto, ich halte es für richtiger, sich in diesem Fall der land- und leutekundigen Führung des eingesessenen Kaufherrn anzuvertrauen. Du hörst, wie alle erfahrenen Menschen über deinen Plan denken.“
Der Schwager kniff die kleinen, listigen Augen ein wenig zusammen. Ein verschmitztes, fast höhnisches Lächeln spielte um seine dünnen Lippen: „Vielleicht irrt ihr euch alle und werdet euch eines Tages noch wundern!“
„Vielleicht! – Sehr vielleicht!“
Brüggemann blieb die Antwort schuldig. Er trug ausführliche Berichte Stadlers in der Tasche, die für ihn wichtiger und wertvoller schienen, als all der aufgestapelte Kram zu seinen Füssen.
Elisabeth legte ihre Hand auf des Gatten Schulter. Sie schaute ihn an: gläubig, zuversichtlich; dann wandte sie sich an die Schwester und sagte: „Zweifelt nur, du, Vater, Mutter und alle diese kurzsichtigen Kaufherren und Stadtväter, deren Blick nicht weiter reicht, als über die nächsten Grenzpfähle hinaus. Otto wird euch schon eines Tages den Beweis liefern, dass er der Mann ist, nicht nur grosse Pläne zu entwerfen, sondern sie auch durchzuführen.“
Ihre Wangen glühten vor Erregung und blindgläubiger Begeisterung. Die Schwester dachte kühler, nüchterner: „Wie weit, glaubst du, dass sein Schiff kommen würde? Wenn es nicht schon auf der Elbe von den Dänen geschnappt wird, so kapern es Engländer, Franzosen oder Holländer in der Nordsee.“
Elisabeth wollte antworten; da bedeutete ihr Brüggemann zu schweigen. Seine stahlgrauen Augen schauten die Schwägerin fast feindlich an, und ein Zug voll Verachtung legte sich um seinen Mund als wollte er damit ausdrücken: es lohnt sich nicht, mit ihr über derartige Dinge zu reden.
„Kinder haltet Frieden!“ rief Christine, die sanfte, gutherzige Frau. Ihre Tochter hatte schon eine spitze Bemerkung auf der Zunge; doch sie kam nicht mehr dazu, denn von der Strasse herüber drangen laute Rufe, eilige Schritte vieler Menschen, Pferdegetrappel und das Poltern eines Wagens auf holprigem Pflaster. Näher und näher kam der Tumult.
Vor der Tür des Uhrmachers entstand ein Auflauf. Von allen Seiten strömten Neugierige und Schaulustige herbei. So etwas gab es aber auch nicht alle Tage zu sehen! Eine vornehme Reisekutsche hielt. Sie war mit vier prächtig geschirrten Schimmeln bespannt. Eine Fürstenkrone schmückte den Verschlag. Der Kutscher trug eine kostbare Livree, und auf dem rückwärtigen Trittbrett standen zwei reichbetresste Diener. Vier bewaffnete Reiter begleiteten das Gefährt. Kaum war der Wagen zum Stehen gekommen, als auch schon die Betressten herbeisprangen, um den Verschlag zu öffnen.
Ein stattlicher, etwas zur Fülle neigender Herr von reichlich dreissig Jahren stieg aus. Sein Gesicht war oval; zwei kluge, blaugraue Augen blickten stolz und doch gütig in die Welt. Langes Haar wallte bis zur Schulter herab. Er trug Schnurr- und kurzen Knebelbart. Wehende Federn zierten seinen Hut. In Samt war er gekleidet.
Ihm folgte ein Mann, der bereits die Vierzig überschritten hatte. Er erweckte einen mehr kriegerischen Eindruck. Starke Willenskraft und hohe Geistesgaben standen in seinen Zügen geschrieben.
Tullae warf einen verzweifelten Blick auf die im Laden ausgebreiteten „Wunder aus dem Morgenland“. Es blieb jedoch keine Zeit zu verlieren; denn schon bahnten Kriegsknechte und Diener den Hohen Herren eine Gasse durch die gaffende Menge.
Christine und ihre Töchter verschwanden eiligst in die Wohnung. Der Uhrmacher riss die Ladentür auf und eilte den Ankommenden unter tiefsten Ehrfurchtsbezeugungen entgegen. Die Gäste kamen nicht zum erstenmal zu ihm: Herzog Friedrich III. von Holstein-Gottorp und Kielmann, sein Minister und Vertrauter. Freundlich, fast freundschaftlich begrüssten sie Tullae. Der Fürst schätzte die Kunstfertigkeit des Meisters und nicht minder seinen zuverlässigen, achtbaren Charakter.
Brüggemann war ruhig stehengeblieben. Höflich, doch nichts weniger als untertänig, verbeugte er sich. Der Herzog sah den Kaufmann ein wenig betroffen an; aber er kannte den Stolz dieser grossen Handelsherren. Sein Blick blieb erstaunt auf den am Boden liegenden Herrlichkeiten haften.
„Nanu, Meister, was habt Ihr aus Eurer Uhrenwerkstatt gemacht?“
„Mein Schwiegersohn hat soeben eine Sendung aus dem Orient erhalten; um nun mir und den Meinen eine Freude zu bereiten, brachte er uns diese Dinge zum Geschenk. Ich ahnte ja nicht – –“
Friedrich bedeutete Tullae zu schweigen. Er nahm Stück um Stück in Augenschein; besonders die kunstvollen Teppiche und golddurchwirkten Seidenstoffe erregten seine Aufmerksamkeit.
„Ihr müsst ein reicher Mann sein, um so wertvolle Geschenke machen zu können!“
In Brüggemanns Hirn überstürzten sich die Gedanken. Sollte es Zufall oder Schicksalsbestimmung sein, die ihn an dieser Stelle mit dem Fürsten zusammenführte? Da hiess es das Eisen schmieden, solange es heiss war.
„Hoheit“, erwiderte er, „es handelt sich hier um eine bescheidene Auswahlsendung persischer Landesprodukte und um Erzeugnisse persischen Kunst- und Gewerbefleisses.“
Das Interesse des Hohen Herrn erwachte. Der Hamburger verstand es, seine Anteilnahme rege zu erhalten und dauernd zu steigern. Er redete sich in Begeisterung und schilderte lebhaft, welche gewaltigen Handelsaussichten eine Verbindung mit dem Iran bieten würde. Er sprach von ungeheuren Verdienstmöglichkeiten und erzählte dann verbittert, wie all seine kühnen Pläne an der Engherzigkeit und dem kleinlichen Krämergeist der Stadtväter und seiner Mitbürger bis jetzt scheiterten.
Stunden vergingen. Ein wenig enttäuscht, fast beiseitegeschoben, stand der Meister. Da kündete die Uhr vom nahen Jacobiturm die Mittagsstunde. Beim ersten Schlag fielen alle Uhren in Tullaes Laden ein. Im Bergwerk pochte und hämmerte es; die Geschichte vom rerlorenen Sohn erwachte zu neuem, flüchtigem Leben; es herrschte ein Dröhnen und Schlagen, dass man fast sein eigenes Wort nicht zu hören vermochte.
Der Herzog besann sich, weshalb er eigentlich nach Hamburg gekommen sei. Voll Entzücken betrachtete er die Meisterwerke der Handwerkskunst.
Als Friedrich die Ausstellung verliess, konnte Tullae wohl zufrieden sein; denn die beiden kostbarsten Uhren waren mit gutem Verdienst verkauft worden. Noch froher schien aber Brüggemann; hatte sich doch der Herzog für den Abend zu Gast angemeldet, um die bei ihm lagernden persischen Herrlichkeiten zu bewundern. Auch den Bericht Stadlers über Land und Leute und die Handelsaussichten wollte er kennenlernen. Der Wunsch des Hamburger Kaufherrn schien sich zu erfüllen; jetzt hoffte er, zum ersehnten Ziel zu gelangen;
*
Zwischen Grande und Trittau führte damals die Landstrasse über weite Strecken sandigen Brachlandes, das mit Ginsterbüschen und Heidekraut durchzogen war. Sie lag eingekeilt zwischen den Ausläufern des Sachsenlandes und des Linauer Forstes; zur Linken hin und wieder von der Bille begrenzt, die sich in zahlreichen Windungen und Krümmungen ihren Weg bahnte und sich bei der uralten Grander Mühle zu einem langgestreckten Teich erweiterte. Rings wurde die Landschaft von leicht gewellten, mit dichtem Baumbestand bewachsenen Hügeln umrahmt.
Mühselig zogen starke, schwere Pferde hochbeladene Planwagen durch die Einöde; müde schleppten sich einige zwanzig Landsknechte durch den tiefen Sand. Glühend brannte die Mittagssonne.
In einiger Entfernung folgte die Staatskutsche, in der sich Friedrich und sein Kanzler befanden. Kutscher und Diener trugen Flinte und Säbel, die vier begleitenden Reiter ebenfalls.
Brüggemann war aufgefordert worden, im Wagen des Herzogs Platz zu nehmen; er bat aber, die Söldner bewachen zu dürfen. Acht Kürassiere hatte er aus eigener Tasche angeworben. Unermüdlich umkreiste er mit dieser kleinen Schar den Zug. Aufmerksam betrachtete er Busch und Strauch, wohl wissend, dass aus jedem Hinterhalt Tod und Verderben hervorbrechen konnte.
Vor ihm lag eine Anhöhe. Mehrere Birken wuchsen darauf, und ein Gewirr wilder Rosensträucher bildete eine fast undurchdringliche Hecke. Nichts schien sich dort zu regen; aber der Kaufherr traute dem Frieden nicht. Sein scharfes Auge betrachtete argwöhnisch diese kleine, von der Natur errichtete Feste. Er kannte zu gut die Kampfesweise der Wegelagerer. – Windstille herrschte, und doch bewegten sich auf dem Hügel verdächtig die Zweige. Langsam schob sich der Lauf einer Muskete durch das Dickicht.
Brüggemann riss sein Pferd zur Seite; der Degen flog aus der Scheide, und im Galopp sprengte er den verborgenen Feinden entgegen, gefolgt von seinen acht Reitern. Haarscharf am Kopf sauste die Kugel vorbei; kurz hintereinander krachten die Schüsse der Buschklepper, aber auch die Angreifer hatten aufs Geratewohl in die Hecke hineingefeuert. Bevor die Räuber sich richtig zur Wehr setzen konnten, fielen die Söldner und ihr Führer über sie her. Auch die Landsknechte eilten jetzt im Laufschritt herbei; nur die herzoglichen Soldaten umgaben die Kutsche, um sie gegen einen etwaigen rückwärtigen Überfall zu sichern. Die Fuhrknechte hatten ihre Flinten in die Faust genommen, die Pferde zum Stehen gebracht und gingen schussbereit in Deckung.
In wilder Flucht rannten einige zwanzig Kerle dem schützenden Walde zu; doch kaum die Hälfte erreichte ihr Ziel. Blutende, stöhnende Menschen lagen am Boden. Wütende Kriegsknechte schlugen sie tot, wohl wissend, dass ihnen ein gleiches Los beschieden gewesen, falls jenen ihr Anschlag gelungen wäre.
Auch einer der Kürassiere war gefallen, ein anderer wurde verwundet. Brüggemann hatte fürsorglich einen Planwagen mitführen lassen, dessen Boden mit Stroh bedeckt war, und auch an Verbandsstoff fehlte es nicht.
Hier und dort krachten noch vereinzelte Schüsse. Landsknechte schwärmten aus und deckten den Zug gegen einen unerwarteten Flankenangriff; aber die Schnapphähne hatten von der ersten Abfuhr genug und liessen es auf ein neues Treffen nicht ankommen. Unbehindert setzten die Reisenden nun ihren Weg fort. Um die Mittagszeit des nächsten Tages kamen die Türme Lübecks in Sicht, und am Spätnachmittag zogen Gespanne und Begleitmannschaften durch das Holstentor. – –
Friedrich war erfreut, einen Mann wie diesen Kaufherrn gefunden zu haben, der Mut, Vorsicht und Klugheit in sich vereinigte, zudem grösste Freigebigkeit zeigte; denn herrliche Teppiche, Seidenstoffe, kunstvolle Waffen und Gefässe hatte er gespendet; alles Erzeugnisse jenes sagenhaften Morgenlandes, das sich Persien nannte. Er beschloss, ihn für seine Dienste zu gewinnen.
Ursprünglich bestand die Absicht, dass Brüggemann nur die Beförderung der Uhren und Geschenke bis Lübeck begleiten sollte. Jetzt aber bat ihn der Fürst, auf Schloss Gottorp als Gast zu weilen. Gar zu gern folgte der Ehrgeizige dieser Einladung.
In Travemünde lag Friedrichs Schiff zur Abfahrt bereit. Zwei Tage später landete man in Schleswig. Begeistert ward der Landesherr von der Bevölkerung begrüsst. Jeder fühlte die tiefe Verbundenheit zwischen Volk und Herrscher.
Der Jubel galt aber auch Brüggemann. Die Kunde von seiner mutigen Tat, die dem Herzog das Leben rettete, war ihm vorausgeeilt; da er zudem seine Landsknechte – im Gegensatz zu manchem Fürsten und mancher Stadt – reichlich lohnte und den Sold nicht schuldig blieb, so musste er obendrein ein reicher und freigebiger Herr sein.
Über den Inhalt der Planwagen schwirrten die tollsten Gerüchte. Ein Geheimnis umgab den Hamburger, und seine Begleiter sorgten dafür, dass ihm fast märchenhafte Reichtümer und ans Wunderbare grenzende Pläne angedichtet wurden.
*
Im Schlosse zu Gottorp sassen zu später Stunde noch der Fürst, sein Minister und der Handelsherr beisammen. Eine hohe Ehre ward dem Kaufmann zuteil; man ernannte ihn zum herzoglichen Gesandten in Hamburg.
Friedrich hatte soeben mit seinem Gast auf eine frohe und glückliche Zukunft angestossen.
Brüggemann gab Bescheid; dann sprach er weiter: „Würden wir unsere Blicke nur auf die Ereignisse der Gegenwart richten, so müssten wir verzweifeln. Krieg und Verwüstung jahraus, jahrein, nirgends ein Lichtblick. Gen Westen ist jeder freie Handelsweg zu Wasser und zu Lande verschlossen. Unerbittlich zieht der Dänenkönig den Gürtel um Hamburg und die schleswig-holsteinischen Lande enger und enger. Von Glückstadt aus hofft er sein Vernichtungswerk zu vollenden und aus dem Verfall niederdeutscher Lande zu ernten. Weder Eure Herzogliche Hoheit noch die Hansastadt sind stark genug, um Christian mit dem Schwert gegenübertreten zu können. Da bleibt nur eine Möglichkeit, dem drohenden Unheil vorzubeugen: den Blick nach Osten zu richten!“
Friedrich stimmte den Ausführungen beifällig zu.
„Die Kraft eines einzelnen Mannes reicht nicht aus, diesen Plan zu verwirklichen. Gross, gewaltig, muss das Werk aufgezogen werden; ein ganzes Land soll dahinterstehen; dann werden aber auch die aufgewandten Opfer eben nur diesem Lande wieder zugute kommen. Aus einem kleinen Staat wird demnach ein nach innen und aussen gekräftigtes, starkes Reich entstehen, auf das sich die Blicke des ganzen Abendlandes richten werden! Reichtum und Wohlstand halten Einzug. Allen wird diese Tat zum Segen gereichen; bis in die kleinste Hütte soll sie sich auswirken und Not und Sorge für immer daraus verbannen!“
Des Herzogs Augen waren sinnend in die Ferne gerichtet. Wenn das zuträfe, was jener dort sprach! Glücklich machen möchte er sein Volk, es herausführen aus Elend und Unwissenheit, es behüten vor Krieg, Raub und Plünderung.
Wie eine Bestätigung dieser Gedanken fuhr der Kaufherr fort: „Kleinlicher Krämergeist hat die Ratsherren der einst so reichen Hansastadt mit Blindheit geschlagen. Ich erblicke in der Begegnung mit Eurer Hoheit die Hand des Schicksals! Es ist eine gütige Fügung, die Euch ausersehen hat, den Glanz und Ruhm der Fugger und Welser in den Schatten zu stellen. Wenn Hunderte und Aberhunderte von Jahren vergangen sein werden, der Name des weitblickenden Friedrichs des Dritten von Holstein-Gottorp wird in der Geschichte der Menschheit weiterleben; denn er war es, der kühn und besonnen den Handel des Orients an sich brachte, der die prächtigen Erzeugnisse des Morgenlandes über seine Städte zu leiten verstand und alle Länder des Nordens mit Persiens kostbaren Stoffen und Gewürzen versorgte!“
Kielmann erhob sich: „Was unser Gast spricht, klingt verlockend; doch ich bitte zu bedenken, dass andere Länder längst ihre Niederlassungen dort unten begründet haben. Ich fürchte, dass wir zu spät kommen, keineswegs aber mächtig genug sind, die Holländer, Engländer und Franzosen zu verdrängen.“
Der Herzog warf einen fragenden Blick zu Brüggemann.
Der Kaufherr lächelte. Es war ein seltsames Lächeln, so wie ein Erwachsener die einfältige Entgegnung eines Kindes hinnehmen würde. Er wandte sich an den Minister und sprach: „Auf diesen Einwurf war ich gefasst. Wenn Ihr, wie ich, die Handelsverbindungen mit dem Iran mit offenen Augen verfolgt hättet, so würdet Ihr immer und immer wieder finden, dass die persischen Herrscher die Eigenart zeigten, gewissermassen das Alleinhandelsrecht jeweilig einem Volk zu übertragen. Anfangs geschah es unter dem Druck überlegener Erobererstaaten, wie Portugal und später Spanien. Doch die stolzen Herrscher dort unten unterwerfen sich auf die Dauer nicht dem Zwang und beantworten Gewalt mit Gewalt, sobald sie hierzu mächtig genug geworden sind. Die Portugiesen und Spanier haben es am eigenen Leib erfahren. Mit Feuer und Schwert wurden ihre Niederlassungen erzwungen; mit Tod und Vernichtung sind sie beseitigt und die lästigen Gäste davongejagt worden. – Franzosen und Engländer verhielten sich klüger. Sie sandten friedliche Kaufherren nach dort, denen es gelang, mehr oder weniger günstige Handelsverträge abzuschliessen. Dann kamen die Holländer. Sie verstanden es, mit Hilfe ansässiger Händler, den Eindringlingen das Wasser abzugraben, so dass ihre Faktoreien zur Bedeutungslosigkeit herabsanken und die getroffenen Abkommen nach Ablauf der vereinbarten Frist nicht erneuert wurden.“
Eine Pause entstand. Wieder war es Kielmann, der die Frage aufwarf: „Und Ihr glaubt, dass es uns gelingen wird, das mächtige Holland aus dem Sattel zu heben?“
„Würde der holländische Staat dahinterstehen, so müsste ich einsehen, dass unser Unternehmen aussichtslos ist; da aber nur eine reiche holländische Firma Trägerin des Handelsrechtes ist, die obendrein von einem Perser in Ispahan geleitet wird, der heute beim Schah gut angeschrieben sein mag, bei dem launischen Charakter des Herrschers aber schon morgen in Ungnade fallen kann, so bin ich des Erfolges sicher; denn wir kommen nicht als einzelner Kaufherr, sondern im Namen eines ganzen Landes! Hier tritt der Fall ein, dass ein wahrhaft weitblickender Fürst die Handelsverbindungen selbst anknüpft und, alle Zwischenhändler ausschaltend, Reich zu Reich in Beziehung tritt. Dass die hieraus entstehende Freundschaft des mächtigen Schahs das Ansehen Eurer Hoheit in der ganzen Welt steigern wird, liegt auf der Hand!“
Friedrich erwärmte sich mehr und mehr für die gewaltige Idee des Hamburgers. „Gut“, meinte er, „es ist möglich, dass sich hieraus politische Vorteile ergeben können, deren Tragweite wir heute noch gar nicht abzusehen vermögen. Doch wie stellt Ihr es Euch vor, die Fäden zum Schah anzuknüpfen, und wie wollen wir die Güter von dort in unsere Heimat schaffen?“
„Beide Schwierigkeiten erscheinen im ersten Augenblick grösser, als sie es in Wirklichkeit sind. Unser erstes Ziel muss sein, uns die Freundschaft und Unterstützung des russischen Zaren zu sichern. Eine Gesandtschaft wird dies zuwege bringen. Männer, die Geist, Mut und Unternehmungslust besitzen, sollen ihre Führer sein; prunkvolles Autreten und kostbare Geschenke sind erforderlich. Ist dieser Teil unseres Planes ausgeführt, so muss der Schah in Ispahan aufgesucht und mit ihm der Handelsvertrag abgeschlossen werden.“
Der bedächtige Staatsmann fragte: „Und wenn die Perser nun nicht wollen?“
„Dann sollte man dem Führer der Gesandtschaft den Kopf vor die Füsse legen; denn nur seine Unfähigkeit wäre schuld, wenn das Unternehmen scheitern würde!“
„Meint Ihr?“
„Es ist meine felsenfeste Überzeugung!“
Der Herzog mischte sich ins Gespräch: „Und wenn ich nun Euch selbst zum Führer dieser Gesandtschaft ernenne?“
„So wäre der höchste Wunsch meines Lebens erfüllt!“
„So sicher seid Ihr des Erfolges?“
„Ja, so gewiss!“
„Lasst weiter hören, wie Ihr Euch die Beförderung der Waren denkt.“
„Der Seeweg scheidet vorläufig aus. Auch die Karawanenstrasse über Klein-Asien ist bei den gespannten Verhältnissen zwischen der Türkei und dem Iran zu unsicher. Jedoch mit den Schutzbriefen des Zaren versehen, erlangen wir die denkbar grösste Sicherheit. Der Weg führt von Ispahan zum Kaspischen Meer, von dort mit dem Schiff bis zur Wolga, auf ihr eine gute Strecke weiter, dann durch Russland bis Reval. Die Ostsee ist wenig gefährdet, so dass der Rest der Reise wieder zu Wasser bewerkstelligt werden kann.“
Stunde um Stunde berieten die drei Herren. Noch manche Bedenken Kielmanns musste der Kaufmann zerstreuen; aber er hatte das Vertrauen des Herzogs gewonnen und als man sich am frühen Morgen endlich zur Ruhe begab, wusste Brüggemann, dass sein Gedanke zur Tat reifen werde.
Widerstände und Zweifel
Friedrich der Dritte glich von jenem Tage an einem Spieler, der alles auf eine Karte gesetzt hatte. Es wurde ein gefährliches Spiel! Wie trunken schien er! Sein ganzes Tun und Denken kreiste nur noch um die Gestaltung des persischen Planes. Ein Rausch hielt seine Sinne umnebelt. Er sah nichts mehr als dies eine Ziel. Ihm opferte er alles: den Wohlstand und die Liebe seiner Untertanen, die Schlagkraft seines Heeres.
Geld brauchte er, viel Geld, und jeder Weg galt ihm recht, es zu beschaffen. Da waren die reichen Inselfriesen. In blutigen Schlachten hatten sie seinen Vorfahren Thron und Leben gerettet, aber das Gedächtnis mancher Fürsten ist oft kurz, wenn es sich um Dankbarkeit handelt, jedoch lang, wenn sie glauben, dass ihr Stolz getroffen sei. Friedrich glaubte nun hierzu Ursache zu haben; denn die Strandinger besassen nicht geringeren Stolz als er und hielten fest an verbrieften Rechten. Sie wollten keinen Herrn über sich anerkennen.
Unter der Maske der Hilfsbereitschaft war der Herzog zu ihnen gekommen und hatte sich ihr Vertrauen erschlichen. Es gelang ihm, sie zu überreden, dass ein Fähnlein Landsknechte sich zu ihrem Schutz – wie er sagte – auf Nordstrand einnistete. Durch List wusste er immer neue Söldnerhaufen hinüberzuschaffen und mittels Verrat bekam er die Arglosen in seine Gewalt. Er liess freiheitliebende Männer Jahre hindurch im Kerker schmachten und demütigte das aufrechte Volk so tief, dass es an der Lither Fähre selbst die eigene Zwingburg errichten musste.
Hass flammte auf! Unauslöschlicher Hass! Der Fürst lachte des ohnmächtigen Grimmes und erpresste Jahr um Jahr höhere Abgaben. Dieses Inselreich bildete seine Haupteinnahmequelle; aus ihm wurde der grösste Teil jener ungeheuren Summen geschöpft, die das persische Unternehmen verschlingen sollte.
*
Zwischen dem Herzog und seinem Minister hatte sich eine Kluft aufgetan. Hart auf hart prallten die Anschauungen gegeneinander. Kielmann sah, wohin der Übereifer seines Herrn führen musste. Mehr als die Hälfte des ohnehin zu schwachen Heeres war entlassen worden; die Steuern wurden immer rücksichtsloser eingezogen.
Die beiden sassen einander gegenüber. Die Wangen des Kanzlers glühten vor Erregung. Er sprach: „Wahnsinn ist es, in diesen Kriegszeiten, wo der kleinste Fürst aufrüstet, soviel nur in seinen Kräften steht, die Waffen aus der Hand zu legen.“
„Ich wünsche den Frieden“, lautete die Antwort.
„Wer den Frieden will, muss stark sein, um sein Land gegen Überfall, Raub und Brandschatzung schützen zu können!“
„Mögen Dänen und Schweden unter sich ausfechten, was sie miteinander auszumachen haben; ich wünsche nicht in diese Händel hineingezogen zu werden.“
„Eben, weil Ihr es mit niemandem verderben wollt, verderbt Ihr es mit allen!“
„Ein vermiedener Krieg ist segensreicher als hundert gewonnene Schlachten. Ich lege einen höheren Wert darauf, einst von der Nachwelt der Friedfertige genannt zu werden, als der Siegreiche!“
In Kielmanns Augen loderte ein seltsames Feuer. Er sprach mit fester, fast drohender Stimme: „Ihr irrt! Eine Schlacht, die den Bauern und Bürgern Raub, Mord und Brandstiftung erspart, ist hundertmal segensreicher als eine schmachvolle Neutralität, die das wehrlose Land grausamen Feinden preisgibt. Nicht den Friedfertigen, nein, den Schwächling wird Euch die Nachwelt heissen!“
Friedrichs Faust sauste auf den Tisch. „Kielmann!“ rief er zornbebend.
Unbeirrt fuhr jener fort: „Ihr mögt mich meines Amtes entheben, Ihr könnt mir Eure Freundschaft entziehen oder mich gar der Freiheit und des Lebens berauben; nichts soll mich hindern, meine Pflicht zu tun und für das einzutreten, was ich für das Recht und für das Wohl Eurer Untertanen als unerlässlich erachte!“
Der Fürst legte den Arm um des Vertrauten Schulter. Auge in Auge standen die Männer einander gegenüber. Endlich sagte Friedrich: „Unsere Freundschaft wird nie durch ein offenes, ehrliches Wort getrübt werden; aber du irrst dich, nicht ich! Ich werde mit den Feinden verhandeln; meiner Beredsamkeit soll es gelingen, meinem Volk die Schrecken des Krieges zu ersparen.“
Der Kanzler lachte. Es war ein bitteres Lachen: „Das Schaf will den reissenden Wolf von seiner Friedensliebe überzeugen! – Ha, ha! – Als ob Herrenmenschen wie Christian, Oxenstjerna, Wallenstein und Tilly eine andere Sprache verständen, als die der Gewalt! Stellt hunderttausend wohlausgerüstete Soldaten auf die Beine, baut Festungen und lasst Kanonen giessen, und Ihr sollt sehen, wie alle Welt um Eure Freundschaft buhlt! Dann wird es niemand wagen, Euer Land ohne Eure Einwilligung zu betreten; keinem fremden Landsknecht sollte es einfallen, einem Eurer Bürger auch nur ein Haar zu krümmen! Hättet Ihr weniger in dickleibigen, vergilbten Büchern und alten, verblichenen Pergamenten studiert, würdet Ihr Eure Blicke minder in märchenhafte Fernen als auf die nahe Wirklichkeit gerichtet haben, es wäre heute besser um Euch und Euer Land bestellt.“
„Ich weiss, wir werden über diese Punkte nie einig werden, und ich verstehe es; denn du bist als Soldat erzogen und hast deine Erfahrungen im Krieg gesammelt.“
„Ich liebe Künste und Wissenschaften nicht weniger als Ihr; wenn aber mein Haus brennt, so lösche ich erst das Feuer und verschiebe alle übrigen Dinge auf eine Zeit, in der die Gefahr vorüber ist!“
Friedrich blickte eine Weile schweigend zu Boden; dann entgegnete er: „Mit dem Schwerte dreinzuschlagen, haben sie alle im Laufe der Jahre gelernt; aber es muss auch in Kriegszeiten Fürsten geben, bei denen Kunst und Wissenschaft eine Zufluchtsstätte finden und deren Blick über die engen Grenzen der Heimat hinausreicht.“
Eine grosse Ruhe schien über Kielmann gekommen zu sein. „Ihr jagt einem Trugbild nach. Je mehr ich über Eure phantastischen Pläne nachdenke, um so mehr erachte ich es als Euer Freund und Berater für meine Pflicht, Euch vom Abgrund zurückzureissen, bevor es zu spät ist. Wie ein böser Geist ist Brüggemann in Euer Schloss eingedrungen. Denkt an die Zeit zurück, wo Ihr ihn nicht kanntet. Eure Untertanen liebten und verehrten Euch, und heute? Man wendet sich ab, wenn Ihr naht; Hass, Tränen und Flüche sind die Frucht seiner Saat.“
„Glaubst du, ich leide weniger darunter als du? – O nein, mein Freund; aber das Harte, was jetzt geschieht, muss eintreten, um das grosse Werk reifen zu lassen. Der Hass, die Tränen und die Flüche meiner Untertanen sind der Boden, aus dem die Frucht der Freude, des Glückes und des Reichstums für alle meine Landeskinder erblühen wird! Es kommt der Tag, an dem sie mich verstehen lernen und meine Taten segnen werden. Wer ein grosses Ziel vor Augen hat, muss alle kleinlichen Bedenken beiseiteschieben!“
„Nein und abermals nein! Wer ein grosses Ziel verfolgt, darf deswegen nicht zum Henker seines Volkes werden! Er muss warten lernen, bis die Zeit der Reife da ist; Ihr aber wollt die unreife Frucht vorzeitig vom Baum pflücken! – Oh, dass ich Euch die Binde von den Augen reissen könnte! Seht um Euch! Die nordfriesischen Inseln werden von den Dänen gebrandschatzt; die Westküste hinauf ziehen Wallensteins Truppen, sengend, brennend und raubend; und, anstatt ihnen ein Heer entgegenzustellen, bilden die von Euch entlassenen Landsknechte Räuberbanden, die das flache Land heimsuchen. Nacht für Nacht färben Feuersbrünste den Himmel blutigrot! Was von diesem Gesindel verschont bleibt, das treiben Eure Büttel von der Scholle, weil der kleine Bürger, Bauer und Handwerker nicht mehr in der Lage ist, die ungeheuren Abgaben zu zahlen, die Ihr in Eurer Verblendung von ihnen fordert!“
*
Im Hause Tullae herrschte Freude! Ein Brief aus Ispahan war eingetroffen.