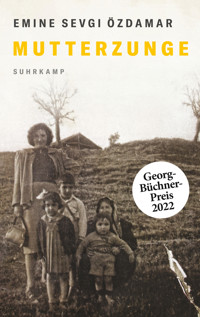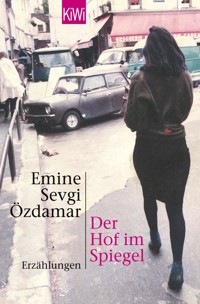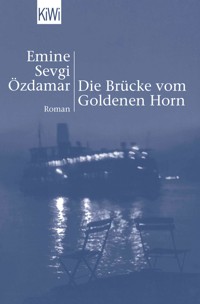
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die mutige Reise einer Wandererin zwischen zwei Welten: Die Georg-Büchner-Preisträgerin Emine Sevgi Özdamar erzählt mit scharfem Blick und poetischer Zunge vom Leben einer jungen Türkin im Berlin und Istanbul von 1968, über die Fabrikarbeit bei Telefunken und die Sehnsucht nach der Schauspielerei, über das Heimweh und das Erwachen als Frau, über den politischen Aufbruch, APO und Anatolien, und den Alptraum politischer Repression.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Emine Sevgi Özdamar
Die Brücke vom Goldenen Horn
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Emine Sevgi Özdamar
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Emine Sevgi Özdamar
Emine Sevgi Özdamar, geboren am 10. August 1946 in der Türkei.
Mit 12 Jahren erste Theaterrolle am Staatstheater Bursa im Bürger als Edelmann von Molière.
1965 bis 1967 Aufenthalt in Berlin, Arbeit in einer Fabrik.
1967 bis 1970 Schauspielschule in Istanbul.
Erste professionellen Rollen in der Türkei als Charlotte Corday im Marat-Sade von Peter Weiss und als Witwe Begbick in Mann ist Mann von Bert Brecht.
1976 an der Volksbühne Ost-Berlin.
Mitarbeit bei dem Brecht-Schüler und Regisseur Benno Besson und bei Matthias Langhoff.
1978 bis 1979 Paris und Avignon.
Mitarbeit an Benno Bessons Inszenierung Kaukasischer Kreidekreis von Bert Brecht. Aufgrund der vorangegangenen Theaterarbeit Doktorandin an der Pariser Universität Vincennes.
1979 bis 1984 Engagement als Schauspielerin beim Bochumer Schauspielhaus unter der Intendanz von Claus Peymann.
Im Auftrag des Schauspielhauses Bochum entstand ihr erstes Theaterstück Karagöz in Alemania, erschienen im Verlag der Autoren, Frankfurt. 1986 im Frankfurter Schauspielhaus unter eigener Regie aufgeführt.
Lieber Georg von Thomas Brasch, Regie Karge/Langhoff; Mutter von Bert Brecht; Weihnachtstod, Buch und Regie Franz Xaver Kroetz, Kammerspiele München; Im Dickicht der Städte von Bert Brecht, Freie Volksbühne Berlin; Faust, Regie Einar Schleef, Frankfurter Schauspielhaus; Die Trojaner von Berlioz, Regie Berghaus, Frankfurter Oper; Drei Schwestern von Anton Tschechow, Théâtre de la Ville, Paris, Regie Matthias Langhoff, Die Troerinnen von Euripides, Théâtre Amandière, Paris, Regie Matthias Langhoff.
Darunter Freddy Türkenkönig, Regie Konrad Zabrautzky; Yasemin, Regie Hark Bohm; Airport, Rückflug nach Teheran, Regie Werner Masten; Eine Liebe in Istanbul, Regie Jürgen Haase; Happy Birthday, Türke, Regie Doris Dörrie; Die Reise in die Nacht, Regie Matti Geschonneck.
Seit 1982 freie Schriftstellerin.
1982 erstes Theaterstück Karagöz in Alemania, erschienen im Verlag der Autoren, Frankfurt.
1991 zweites Theaterstück Keloglan in Alemania, die Versöhnung von Schwein und Lamm, Verlag der Autoren, Frankfurt.
2001 drittes Theaterstück Noahi, Verlag der Autoren, Frankfurt. Noahi bearbeitet die Arche-Noah-Geschichte im Rahmen des Projektes Mythen für Kinder und wird im Frankfurter Schauspielhaus uraufgeführt.
Erster Erzählband Mutterzunge, Rotbuch-Verlag, 1990.
Der Erzählband Mutterzunge gehört zu den Best Books of Fiction published 1994 in America (Publisher’s Weekly).
Erster Roman Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei Türen aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1992. Der Roman erscheint außer in Deutschland auch in Frankreich, England, Griechenland, Katalonien, Finnland, den Niederlanden, Spanien, Polen, der Türkei, Norwegen und Kanada.
Ingeborg Bachmann Preis 1991
Walter Hasenclever-Preis 1993
Stipendium des Deutschen Literaturfonds 1992
New York-Stipendium des Deutschen Literaturfonds 1995
International Book of the Year, London Times Literary Supplement, 1994
Zweiter Roman Die Brücke vom Goldenen Horn, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1998 (auch als KiWi 554)
Arbeitsstipendium der Landeshauptstadt Düsseldorf
Adalbert von Chamisso-Preis 1999
Preis der LiteraTour Nord 1999
Im Frühjahr 2001 erschien ihr neuer Erzählband Der Hof im Spiegel
Künstlerinnenpreis des Landes NRW im Bereich Literatur / Prosa, 2001
Dritter Roman Seltsame Sterne starren zur Erde, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2003
Literaturpreis der Stadt Bergen-Enkheim, Stadtschreiberin 2003
Erhielt am 21. November 2004 den Kleist-Preis
Kunstpreis Berlin 2009 des Landes Berlin, von der Sektion Literatur der Akademie der Künste als Fontane-Preis verliehen
Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille 2010
Alice-Salomon-Poetik-Preis 2012
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die mutige Reise einer Wandererin zwischen zwei Welten: Emine Sevgi Özdamar erzählt mit scharfem Blick und poetischer Zunge vom Leben einer jungen Türkin im Berlin und Istanbul von 1968, über die Fabrikarbeit bei Telefunken und die Sehnsucht nach der Schauspielerei, über das Heimweh und das Erwachen als Frau, über den politischen Aufbruch, APO und Anatolien, und den Alptraum politischer Repression.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
1998, 1999, 2002, 2006, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einer Idee von Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Ara Güler
ISBN978-3-462-30408-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Förderung
1. Teil Der beleidigte Bahnhof
Die langen Korridore des Frauenwonayms
Wir standen Tag und Nacht im Licht
Der plötzliche Regen kam wie Tausende von leuchtenden Nadeln herunter
Die freilaufenden Hühner und der hinkende Sozialist
2. Teil Die Brücke vom Goldenen Horn
Der lange Tisch im Restaurant »Kapitän«
Die Zigarette ist das wichtigste Requisit eines Sozialisten
Der Sarg des toten Studenten schwamm tagelang im Marmara-Meer
Wir konnten den Mond mit dem Getreide füttern
Die Stimmen der Mütter
Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert durch ein Arbeitsstipendium der Landeshauptstadt Düsseldorf
1. TeilDer beleidigte Bahnhof
Die langen Korridore des Frauenwonayms
In der Stresemannstraße gab es damals, es war das Jahr 1966, einen Brotladen, eine alte Frau verkaufte dort Brot. Ihr Kopf sah aus wie ein Brotlaib, den ein verschlafener Bäckerlehrling gebacken hatte, groß und schief. Sie trug ihn auf den hochgezogenen Schultern wie auf einem Kaffeetablett. Es war schön, in diesen Brotladen hineinzugehen, weil man das Wort Brot nicht sagen mußte, man konnte auf das Brot zeigen.
Wenn das Brot noch warm war, war es leichter, die Schlagzeilen aus der Zeitung, die draußen auf der Straße in einem Glaskasten hing, auswendig zu lernen. Ich drückte das warme Brot an meine Brust und meinen Bauch und trat mit den Füßen wie ein Storch auf die kalte Straße.
Ich konnte kein Wort Deutsch und lernte die Sätze, so wie man, ohne Englisch zu sprechen, »I can’t get no satisfaction« singt. Wie ein Hähnchen, das Gak gak gak macht. Gak gak gak konnte eine Antwort sein auf einen Satz, den man nicht hören wollte. Jemand fragte zum Beispiel »Niye böyle gürültüyle yürüyorsun?« (Warum machst du soviel Krach, wenn du läufst?), und ich antwortete mit einer deutschen Schlagzeile: »Wenn aus Hausrat Unrat wird.«
Vielleicht lernte ich die Schlagzeilen auswendig, weil ich, bevor ich als Arbeiterin nach Berlin gekommen war, in Istanbul sechs Jahre lang Jugend-Theater gespielt hatte. Meine Mutter, mein Vater fragten mich immer: »Wie kannst du so viele Sätze auswendig lernen, ist es nicht schwer?« Unsere Regisseure sagten uns dort: »Ihr müßt eure Texte so gut auswendig lernen, daß ihr sie sogar im Traum sprechen könntet.« Ich fing an, im Traum die Texte zu wiederholen, manchmal vergaß ich sie, wachte mit einer großen Angst auf, wiederholte sofort die Texte und schlief wieder ein. Texte vergessen – das war, als ob eine Trapezartistin in der Luft nicht die Hand ihres Partners erreicht und herunterfällt. Die Menschen aber liebten die, die zwischen Tod und Leben ihre Berufe ausübten. Ich bekam Applaus am Theater, aber nicht zu Hause von meiner Mutter. Sie hatte mir manchmal sogar ihre schönen Hüte und Ballkleider für meine Rollen geliehen, aber als ich durch das Theater die Schule fallen ließ, sagte sie zu mir: »Wieso lernst du deine Schulaufgaben nicht so gut auswendig wie deine Rollen? Du wirst Sitzenbleiben.« Sie hatte recht, ich lernte nur Theatertexte, sogar die Texte der anderen, mit denen ich spielte. Als ich sechzehn Jahre alt war, spielte ich im Sommernachtstraum von Shakespeare die Rolle der Königin der Elfen, Titania.
»Haydi, halka olun, bir peri şarkısı söyleyin
(Kommt! einen Ringel, einen Feensang!)
Dann auf das Drittel ’ner Minute fort!
Ihr, tötet Raupen in den Rosenknospen! …«
Ich schaffte die Schule nicht mehr. Meine Mutter weinte. »Kann jetzt Shakespeare oder Molière dir helfen? Theater hat dein Leben verbrannt.« – »Theater ist mein Leben, wie kann mein Leben sich selbst verbrennen? Jerry Lewis hat auch kein Abitur gemacht, aber du liebst ihn, Mutter. Auch Harold Pinter hat für das Theater die Schule verlassen.« – »Die heißen aber Jerry Lewis und Harold Pinter.« – »Ich werde in die Schauspielschule gehen.« – »Wenn du keinen Erfolg hast, wirst du unglücklich. Du wirst verhungern. Mach deine Schule fertig, sonst wird dein Vater dir kein Geld geben. Du könntest Anwältin werden, du liebst es zu reden. Anwälte sind wie Schauspieler, aber sie verhungern nicht, was meinst du? Mach dein Abitur.« Ich antwortete:
»Adi olmayan cinsten bir ruhum. (Ich bin ein Geist nicht von gemeinem Stande.)«
Meine Mutter antwortete: »Du willst einen Esel aus mir machen und mir Angst machen, als wäre ich dein Todfeind, und willst mich tödlich quälen. Vielleicht habe ich daran Schuld, aber ich bin deine Mutter und verliere bald die Geduld.«
Sie weinte. Ich antwortete ihr: »Pflegt Spott und Hohn in Tränen sich zu kleiden.«
»Meine Tochter, du bist so entsetzlich wild und noch so jung.«
»Nein, nein, Mutter, ich will nicht trau’n.
Noch länger Eu’r verhaßtes Antlitz schauen,
Sind eure Hände hurtiger zum Raufen,
So hab’ ich längre Beine doch zum Laufen!«
Ich lachte zu Hause nicht mehr, weil der Krach zwischen mir und meiner Mutter nie aufhörte. Mein Vater wußte nicht, was er machen sollte und sagte nur: »Tut euch kein Leid an! Warum zwingst du uns zu harten Reden?« Ich antwortete:
»Ich werd’ erstaunt euch Antwort geben.
Die schöne Helene verriet mir ihren Plan,
Aus diesem Wald zu flüchten.«
Die Sonne schien in Istanbul, und die Zeitungen hingen vor den Kiosken mit Schlagzeilen: »Deutschland möchte noch mehr türkische Arbeiter«, »Deutschland nimmt Türken.«
Ich dachte, ich werde nach Deutschland gehen, ein Jahr arbeiten, dann werde ich die Schauspielschule besuchen. Ich ging zur Istanbuler Vermittlungsstelle. »Wie alt bist du?« – »Achtzehn.« Ich war gesund und bekam nach zwei Wochen einen Paß und einen Einjahresvertrag für Telefunken in Berlin.
Meine Mutter sagte nichts mehr, sondern rauchte nur ununterbrochen. Wir saßen in Rauchschwaden, mein Vater sagte: »Allah soll dir in Deutschland Vernunft beibringen. Du kannst nicht mal Spiegeleier braten. Wie willst du bei Telefunken Radiolampen herstellen? Mach die Schule fertig. Ich will nicht, daß meine Tochter Arbeiterin wird. Das ist kein Spiel.«
Im Zug von Istanbul nach Deutschland war ich ein paar Nächte auf dem Zugkorridor hin- und hergelaufen und hatte mir alle Frauen, die als Arbeiterinnen dort hinfuhren, angeschaut. Sie hatten ihre Strümpfe bis unter die Knie gerollt, ihre Strumpfbänder aus dickem Gummi hinterließen Spuren auf der Haut. An ihren nackten Knien konnte ich besser erkennen, daß wir noch weit weg von Deutschland waren, als an den Schildern der Bahnhöfe, an denen wir vorbeifuhren und deren Namen wir nicht lesen konnten. Eine Frau sagte: »Was für ein nicht aufhörender Weg.« Alle waren schweigend einverstanden, keine hatte daran gedacht, einen Ton von sich zu geben, nur die Raucherinnen holten ihre Zigaretten heraus, schauten sich gegenseitig in ihre Gesichter und rauchten. Die, die nicht rauchten, schauten zum Fenster. Eine sagte: »Es ist wieder dunkel geworden.« Eine andere sagte: »Gestern wurde es auch so dunkel.« Jede Zigarette schob den Zug schneller voran. Keine schaute auf die Uhr, sie schauten auf die Zigaretten, denen sie dauernd Feuer gaben. Wir hatten uns seit drei Tagen, drei Nächten nicht ausgezogen. Nur ein paar Schuhe lagen auf dem Zugboden und vibrierten mit dem Zug. Wenn eine der Frauen zur Toilette gehen wollte, zog sie sich schnell irgendwelche Schuhe an, so liefen die Frauen mit den Schuhen der anderen zu den verstopften Toiletten und hüpften dabei komisch in den fremden Schuhen. Ich merkte, daß ich Frauen suchte, die meiner Mutter ähnlich waren. Eine hatte ähnliche Fersen wie meine Mutter. Ich setzte meine Sonnenbrille auf und fing an, leise zu weinen. Ich sah auf dem Zugboden keine Schuhe, die von meiner Mutter waren. Wie schön hatten in Istanbul ihre und meine Schuhe nebeneinander gestanden. Wie leicht zogen wir zusammen unsere Schuhe an und gingen ins Kino zu Liz Taylor oder in die Oper.
Mama, Mama.
Ich dachte, ich werde ankommen, ein Bett kriegen, und dann werde ich immer an meine Mutter denken, das wird meine Arbeit sein. Ich fing an, noch stärker zu weinen und war böse, als ob nicht ich meine Mutter, sondern meine Mutter mich verlassen hätte. Ich versteckte mein Gesicht hinter dem Shakespearebuch.
Als die Nacht zu Ende war, kam der Zug in München an. Die Frauen, die ihre Schuhe seit Tagen ausgezogen hatten, hatten dicke Füße und schickten die, die ihre Schuhe anbehalten hatten, Zigaretten und Schokoladen kaufen. Çikolata – Çikolata.
Ich lebte mit vielen Frauen in einem Frauenwohnheim, Wonaym sagten wir. Wir arbeiteten alle in der Radiofabrik, jede mußte bei der Arbeit auf dem rechten Auge eine Lupe tragen. Auch wenn wir abends zum Wonaym zurückkamen, schauten wir uns oder die Kartoffeln, die wir schälten, mit unserem rechten Auge an. Ein Knopf ging ab, die Frauen nähten auch den Knopf mit dem geöffneten rechten Auge an. Das linke zwickte sich immer zusammen und blieb halb geschlossen. Wir schliefen auch so, das linke immer etwas gezwickt, und am Morgen um fünf Uhr, wenn wir im Halbdunkel unsere Hosen oder Röcke suchten, sah ich, daß auch die anderen Frauen wie ich nur mit dem rechten Auge suchten. Seitdem wir in der Radiolampenfabrik arbeiteten, glaubten wir unserem rechten Auge mehr als unserem linken Auge. Mit dem rechten Auge hinter der Lupe konnte man mit der Pinzette die dünnen Drähte der kleinen Radiolampen biegen. Die Drähte waren wie die Beine einer Spinne, sehr fein, ohne Lupe fast unsichtbar. Der Fabrikchef hieß Herr Schering. Sherin sagten die Frauen, Sher sagten sie auch. Dann klebten sie Herr an Sher, so hieß er in manchen Frauenmündern Herschering oder Herscher.
Wir waren seit einer Woche in Berlin. Der Herscher wollte, daß wir am 10. November, dem Todestag von Atatürk, wie in der Türkei genau um fünf nach neun ein paar Minuten für Atatürk aufstehen. Wir standen am 10. November um fünf nach neun in der Arbeitshalle von unseren Maschinen auf, und wieder waren unsere rechten Augen größer als die linken. Die Frauen, die weinen wollten, haben mit den rechten Augen geweint, deswegen liefen ihre Tränen über ihren rechten Busen auf ihren rechten Schuh. So machten wir mit den Tränen für Atatürks Tod den Berliner Radiofabrikboden naß. Die Neonlichter an den Decken und an den Maschinen waren stark und trockneten die Tränen schnell. Manche Frauen hatten ihre Lupe beim Aufstehen für Atatürk auf ihrem rechten Auge vergessen, ihre Tränen sammelten sich in der Lupe und erzeugten Nebel in den Lupen.
Wir sahen den Herscher nie. Die türkische Dolmetscherin trug seine deutschen Wörter als türkische Wörter zu uns: »Herscher hat gesagt, daß ihr euch …« Weil ich diesen Herscher nie sah, suchte ich ihn im Gesicht der türkischen Dolmetscherin. Sie kam, ihr Schatten fiel über die kleinen Radiolampen, die wir vor uns hatten.
Während der Arbeit wohnten wir in einem einzigen Bild: unsere Finger, das Neonlicht, die Pinzette, die kleinen Radiolampen und ihre Spinnenbeine. Das Bild hatte seine eigenen Stimmen, man trennte sich aus den Stimmen der Welt und von seinem eigenen Körper. Die Wirbelsäule verschwand, die Brüste verschwanden, die Haare verschwanden. Manchmal mußte man Nasenschleim hochziehen. Man schob das Nasenschleimhochziehen immer weiter vor sich her, als ob es das vergrößerte Bild, in dem wir wohnten, kaputtmachen könnte. Wenn die türkische Dolmetscherin kam und ihr Schatten auf dieses Bild fiel, zerriß das Bild wie ein Film, der Ton verschwand, und es entstand ein Loch. Wenn ich dann auf das Gesicht der Dolmetscherin schaute, hörte ich wieder die Stimmen der Flugzeuge, die irgendwo im Himmel waren, oder ein metallenes Ding fiel auf den Fabrikhallenboden und machte Echos. Ich sah, daß den Frauen genau in dem Moment, in dem sie die Arbeit unterbrachen, Schuppen auf ihre Schultern fielen. Wie ein Postbote, der einen Einschreibebrief bringt und auf die Unterschrift wartet, wartete die Dolmetscherin, nachdem sie für uns Herscherings deutsche Sätze ins Türkische übersetzt hatte, auf das Wort Okay.
Wenn eine Frau als Antwort anstelle des englischen Okay das türkische Wort tamam benutzte, fragte die Dolmetscherin nochmal: »Okay?«, bis die Frau »Okay« sagte. Wenn eine Frau sie mit dem Okay etwas warten ließ, weil sie gerade die kleinen Beine einer Radiolampe mit ihrer Pinzette bog und keinen Fehler machen wollte oder vor ihrer Lupe die Lampe kontrollierte, pustete die Dolmetscherin aus Ungeduld ihren Pony von ihrer Stirn hoch, bis das englische Okay kam.
Wenn wir mit ihr zum Fabrikarzt gingen, sagten wir zu ihr: »Sag dem Arzt, daß ich wirklich krank bin, okay?« Das Wort Okay kam auch ins Frauenwonaym …
»Du putzt morgen das Zimmer, okay?«
»Tamam.«
»Sag Okay.«
»Okay.«
In den ersten Tagen war die Stadt für mich wie ein endloses Gebäude. Sogar zwischen München und Berlin war das Land wie ein einziges Gebäude. In München aus der Zugtür raus mit den anderen Frauen, rein in die Bahnhofsmissionstür. Brötchen – Kaffee – Milch – Nonnen – Neonlampen, dann raus aus der Missionstür, dann rein in die Tür des Flugzeugs, raus in Berlin aus der Flugzeugtür, rein in die Bustür, raus aus der Bustür, rein in die türkische Frauenwonaymtür, raus aus der Wonaymtür, rein in die Kaufhaus-Hertietür am Halleschen Tor. Von der Wonaymtür gingen wir zur Hertietür, man mußte unter einer U-Bahn-Brücke laufen. Bei Hertie im letzten Stock gab es Lebensmittel. Wir waren drei Mädchen, wollten bei Hertie Zucker, Salz, Eier, Toilettenpapier und Zahnpasta kaufen. Wir kannten die Wörter nicht. Zucker, Salz.
Um Zucker zu beschreiben, machten wir vor einer Verkäuferin Kaffeetrinken nach, dann sagten wir Schak Schak. Um Salz zu beschreiben, spuckten wir auf Herties Boden, streckten unsere Zungen raus und sagten: »eeee«. Um Eier zu beschreiben, drehten wir unsere Rücken zu der Verkäuferin, wackelten mit unseren Hintern und sagten: »Gak gak gak.« Wir bekamen Zucker, Salz und Eier, bei Zahnpasta klappte es aber nicht. Wir bekamen Kachelputzmittel. So waren meine ersten deutschen Wörter Schak Schak, eeee, gak, gak, gak.
Wir standen morgens um fünf Uhr auf. In den Zimmern standen sechs Betten, immer zwei übereinander.
In den ersten zwei Betten meines Zimmers schliefen zwei Geschwister, die nicht verheiratet waren. Sie wollten Geld sparen und ihre Brüder nach Deutschland holen. Sie redeten von ihren Brüdern, als gehörten sie zu einem Leben, das sie schon gelebt hatten, als sie ein anderes Mal auf der Welt gewesen waren, so daß ich manchmal dachte, ihre Brüder seien tot. Wenn eine weinte oder das Essen nicht zu Ende aß oder sich erkältet hatte, sagte die andere zu ihr: »Deine Brüder sollen das nicht hören. Wenn das deine Brüder hören!« Nach der Fabrikarbeit trugen sie im Wonaym Morgenmäntel in hellblauer Farbe aus elektrisierten Stoffen. Wenn sie ihre Tage hatten, waren auch ihre Haare elektrisch geladen, und ihre Mäntel aus elektrisierten Stoffen gaben im Zimmer Geräusche von sich. Wenn eine von diesen Geschwistern aus dem Bett herunterkam und in der halbdunklen, nassen Morgenzeit ihre Schuhe anzog, zog sie manchmal die Schuhe von ihrer Schwester an, und ihre Füße merkten es nicht, weil ihre Schuhe so ähnlich waren.
Am Abend nach der Arbeit gingen die Frauen in ihre Zimmer und aßen an ihren Tischen. Aber der Abend fing nicht an, der Abend war weg. Man aß, weil man die Nacht schnell ins Zimmer reinholen wollte. Wir sprangen über den Abend in die Nacht.
Die beiden Geschwister saßen am Tisch, stellten einen Spiegel an einen Kochtopf und wickelten ihre Haare mit Lockenwicklern. Beide hatten ihre Strümpfe bis unter ihre Knie gerollt. Ihre nackten Knie zeigten mir, daß im Zimmer bald die Lampe ausgemacht würde. Die beiden sprachen, als ob sie im Zimmer allein wären:
»Eile dich, wir müssen schlafen.«
»Wer macht heute das Licht aus, du oder ich?«
Eine stand an der Tür, die Hand am Lichtschalter, und wartete, bis die andere sich ins Bett gelegt hatte. Sie legte dann ihren Kopf mit den Lockenwicklern auf das Kissen, als ob sie mit einem Auto vorsichtig rückwärts einparken würde. Wenn sie den Kopf richtig hingelegt hatte, sagte sie: »Mach aus!« Dann machte ihre Schwester das Licht aus.
Wir, die anderen vier Mädchen, saßen noch am Tisch, manche schrieben Briefe. Die Dunkelheit schnitt uns auseinander. Wir zogen uns im Dunkeln aus. Manchmal fiel ein Bleistift herunter. Als alle im Bett lagen und alles still war, hörten wir die elektrisierten Stoffe der beiden hellblauen Morgenmäntel, die an den Haken hingen.
Seitdem ich in Istanbul ein Kind war, hatte ich mir angewöhnt, jede Nacht zu den Toten zu beten. Ich sagte zuerst die Gebete auf, dann sagte ich die Namen der Toten, die ich nicht gekannt, von denen ich aber gehört hatte, auf. Wenn meine Mutter und Großmutter erzählten, sprachen sie viel von den Menschen, die gestorben waren.
Ich hatte ihre Namen auswendig gelernt, zählte sie jede Nacht im Bett auf und gab ihnen für ihre Seelen die Gebete. Das dauerte eine Stunde. Meine Mutter sagte: »Wenn man die Seelen der Toten vergißt, werden ihre Seelen Schmerzen bekommen.« Auch in den ersten Nächten in Berlin betete ich für die Toten, aber ich wurde schnell müde, weil wir so früh aufstehen mußten. Ich schlief dann, bevor ich die Namen aller meiner Toten aufgezählt hatte, ein. So verlor ich langsam alle meine Toten in Berlin. Ich dachte, wenn ich nach Istanbul zurückgehe, werde ich dort wieder anfangen, meine Toten zu zählen. Die Toten hatte ich vergessen, nicht aber meine Mutter. Ich legte mich ins Bett, um an meine Mutter zu denken. Ich wußte aber nicht, wie man an die Mutter denkt. Sich in einen Filmschauspieler zu verlieben und in der Nacht an ihn zu denken – zum Beispiel wie ich mit ihm küssen würde – war leichter.
Wie aber denkt man an eine Mutter?
In manchen Nächten lief ich wie in einem zurücklaufenden Film von der Wonaymtür zum Zug, mit dem ich hierhergekommen war. Auch den Zug ließ ich zurücklaufen. Die Bäume liefen rückwärts am Fenster vorbei, aber der Weg war zu lang, ich kam nur bis Österreich. Die Berge hatten ihre Köpfe im Nebel, und im Nebel war es schwierig, einen Zug rückwärts fahren zu lassen. Dort schlief ich dann ein. Ich merkte auch, wenn ich nichts aß und hungrig blieb, dachte ich an meine Mutter, oder wenn ich die Haut an meinem Finger etwas herausriß und es weh tat. Dann dachte ich, dieser Schmerz ist meine Mutter: So ging ich öfter mit Hunger ins Bett oder mit Schmerzen an den Fingern.
Rezzan, die über mir schlief, aß auch nicht richtig. Ich dachte, auch sie denkt an ihre Mutter. Rezzan blieb lange wach, und sie drehte sich im Bett im Dunkeln von links nach rechts, dann nahm sie ihr Kopfkissen von einem Ende des Bettes und legte es an das andere Ende. Nach einer Weile fing sie wieder an, sich von links nach rechts, von rechts nach links zu drehen. Unten dachte ich mit halbem Kopf an meine Mutter, und mit der anderen Hälfte fing ich an, auch an Rezzans Mutter zu denken.
In den anderen beiden Etagenbetten schliefen zwei Cousinen aus Istanbul. Sie arbeiteten in der Fabrik, um dann an die Universität zu gehen. Eine hatte zwei Zöpfchen und tiefe Narben im Gesicht, weil sie während der Pubertät ihre Pickel nicht in Ruhe gelassen hatte, und sie stank aus dem Mund. Die andere Cousine war schön und schickte die, die aus dem Mund stank, zur Post oder zu Hertie. Einmal kam sie von der Post zurück, und die schöne Cousine zwang sie, sich auf den Tisch zu legen, sie krempelte ihre Ärmel hoch bis zur Schulter, dann zog sie ihren Gürtel aus ihrer Bluejeans und schlug mit dem Gürtel auf den Rücken ihrer Cousine. Die beiden Geschwister in ihren hellblauen Morgenmänteln, Rezzan und ich sagten:
»Was machst du?«
Sie rief: »Die Hure ist zur Post gegangen und zu spät zurückgekehrt.«
Wir sagten: »Sie hat doch keine Flügel, sollte sie denn fliegen? Sie ist nicht zu spät gekommen.«
»Nein, mischt euch nicht ein.
Mischt euch nicht ein.
Mischt euch nicht ein.
Mischt euch nicht ein.«
Bei jedem Satz schlug sie auf den Rücken ihrer Cousine, aber schaute dabei in unsere Augen. Ihre Pupillen drehten sich wie ein verrückt gewordenes Licht, ihr rechtes Auge war wie bei allen anderen Frauen größer als ihr linkes.
In dieser Nacht, als alle in ihren Betten lagen, die zwei Geschwister mit ihren Lockenwicklern übereinander in zwei Betten, die beiden Cousinen übereinander in zwei Betten, ich und Rezzan übereinander in zwei Betten, kletterte plötzlich die Cousine, die aus dem Mund stank und geschlagen worden war, zu ihrer Cousine, die schön war und geschlagen hatte, ins obere Bett. Sie holten im Dunkeln die Decke aus dem Bettbezug heraus, ließen diese auf den Boden fallen und krochen in den Bettbezug wie in einen Schlafsack, knöpften ihn zu, und so – zugeknöpft in diesem Sack – küßten sie sich matsch matsch und liebten sich. Und wir, die anderen vier, hörten uns das an, ohne uns zu bewegen.
Gegenüber dem Frauenwonaym stand das Hebbeltheater. Das Theater war beleuchtet, und ein Reklamelicht ging ständig an und aus. Dieses Licht fiel auch in unser Zimmer. Wenn die Reklame ausging, hörte ich von dem Tag an im Dunkeln Kußstimmen matsch matsch, wenn die Reklame an war, sah ich die im Halblicht glänzenden Lockenwickler der beiden Geschwisterköpfe auf ihren Kopfkissen und die ausgezogenen zwei Paar Schuhe auf dem Linoleumboden.
Rezzan, die über mir schlief, zog in der Nacht ihre Schuhe nie aus. Sie lag immer in ihren Kleidern und Schuhen im Bett. Im Schlaf hielt sie in ihrer Hand die Zahnbürste, und die Zahnpasta lag unter ihrem Kopfkissen. Rezzan wollte wie ich Schauspielerin werden. In manchen Nächten sprachen wir leise von Bett zu Bett im an- und ausgehenden Hebbeltheaterlicht über Theater. Rezzan fragte: »Welche Rolle willst du spielen, Ophelia?« – »Nein, für Ophelia bin ich zu dünn, zu groß. Aber Hamlet vielleicht.« – »Warum?« – »Ich weiß es nicht. Und du?« – »Die Frau in ›Die Katze auf dem heißen Blechdach‹ von Tennessee Williams.« – »Ich kenne Tennessee nicht.« – »Er war homosexuell und hat fürs Theater die Schule verlassen, wie wir.« – »Weißt du, daß auch Harold Pinter die Schule verlassen hatte?« – »Kennst du von Harold Pinter ›The Servant‹?« – »Nein.« – »Ein Aristokrat sucht einen Diener. Am Ende wird der Diener zum Herr und der Herr zum Diener. Gute Nacht.« Rezzan schwieg, im an- und ausgehenden Licht des Hebbeltheaters glänzten die Haarwickler der beiden Geschwister in ihren Betten. Wenn wir um fünf Uhr morgens aufstanden, war Rezzan schon fertig. Sie putzte ihre Zähne und kochte Kaffee, in einer Hand eine volle Kaffeetasse, in der anderen die Zahnbürste. Zähneputzend schuff schuff lief sie in den langen Korridoren des Frauenwonayms hin und her. Alle anderen Frauen liefen noch in ihren Morgenmänteln, mit Handtüchern um ihre Körper oder in Unterhosen herum. Rezzan aber war schon in Jacke und Rock. Alle Frauen schauten auf Rezzan, als ob diese ihre Uhr wäre, und wurden schneller. Manchmal gingen sie sogar zu früh zur Bushaltestelle, weil Rezzan schon dort stand. Rezzan schaute im Dunkeln Richtung Bus, und die Frauen schauten auf Rezzans Gesicht.
Zur Morgenzeit hatte das Hebbeltheater keine Lichter an. Nur unsere auf den Bus wartenden Frauenschatten lagen auf dem Schnee. Als der Bus kam und uns aufnahm, blieben auf dem Schnee vor unserem Frauenwonaym nur unsere Schuhspuren und Kaffeeflecken, denn manche Frauen kamen mit ihren vollen Kaffeetassen zur Haltestelle, und wenn der Bus kam und die Tür aufging tisspamp, schütteten sie den Rest auf den Schnee. Der Brotladen hatte seine Lichter an, im Zeitungskasten stand heute die Schlagzeile: ER WAR KEIN ENGEL. Aus dem rechten Busfenster sah ich die Zeitung, aus dem linken Busfenster sah ich den Anhalter Bahnhof, der wie das Hebbeltheater gegenüber unserem Wonaym stand. Wir nannten ihn den zerbrochenen Bahnhof. Das türkische Wort für »zerbrochen« bedeutete gleichzeitig auch »beleidigt«. So hieß er auch »der beleidigte Bahnhof«.
Kurz bevor wir in der Fabrik ankamen, mußte der Bus eine lange, steile Straße hochfahren. Ein Bus voller Frauen kippte nach hinten. Dann kam eine Brücke, dort kippten wir nach vorne, und dort sah ich an jedem nassen, halbdunklen Morgen zwei Frauen Hand in Hand gehen. Ihre Haare waren kurzgeschnitten, sie trugen Röcke und Schuhe mit stumpfen Absätzen, ihre Knie froren, hinter ihnen sah ich den Kanal und dunkle Fabrikgebäude. Die Brücke hatte kaputten Asphalt, der Regen sammelte sich in seinen Löchern, im Buslicht warfen die beiden Frauen ihre Schatten auf dieses Regenwasser und auf den Kanal. Die Schatten ihrer Knie zitterten im Regenwasser mehr als ihre echten Knie. Sie schauten nie auf den Bus, schauten aber auch sich selbst nicht an. Eine dieser Frauen war größer als die andere, sie hatte die Hand der kleinen Frau in ihre genommen. Es sah aus, als ob sie in dieser Morgenzeit die einzigen bebenden dieser Stadt wären. Der Morgen, durch den sie so liefen, war wie mit der Nacht aneinandergenäht. Kamen sie aus der Nacht oder kamen sie aus dem Morgen, ich wußte es nicht. Gingen sie zur Fabrik oder zum Friedhof, oder kamen sie von einem Friedhof?
Vor der Radiolampenfabrik gingen alle Türen des Busses auf, der Schnee kam mit dem Wind in den Bus hinein und stieg an Frauenhaaren, Wimpern und Mänteln wieder aus. Der Fabrikhof schluckte uns im Dunkeln. Es schneite dichter, die Frauen kamen dichter zusammen, gingen in den leuchtenden Schneeflocken, als ob jemand Sterne auf sie schüttelte. Ihre Mäntel, Röcke flatterten und gaben leise Geräusche zwischen den Fabriksignalen ab. Der Schnee ging mit ihnen bis zur Stechuhr, mit einer nassen Hand, tink tink tink, drückten sie die Karten hinein, mit der anderen schüttelten sie den Schnee von ihren Mänteln. Der Schnee machte die Arbeiterkarten und den Boden vor dem Pförtnerhaus naß. Der Pförtner hob sich ein bißchen aus seinem Stuhl, das war seine Arbeit. Ich übte meinen deutschen Satz, den ich aus der Zeitungsschlagzeile heute gelernt hatte, bei ihm. »Erwarkeinengel« – »Morgenmorgen«, sagte er.
In der Arbeitshalle gab es nur Frauen. Jede saß da allein vor einem grüngefärbten Eisentisch. Jedes Gesicht schaute auf den Rücken der anderen. Während man arbeitete, vergaß man die Gesichter der anderen Frauen. Man sah nur Haare, schöne Haare, müde Haare, alte Haare, junge Haare, gekämmte Haare, ausfallende Haare. Wir sahen nur ein Frauengesicht, das Gesicht der einzigen Frau, die stand, Frau Mischel. Meisterin. Wenn die Maschinen der griechischen Arbeiterinnen kaputtgingen, riefen sie nach ihr: »Frau Missel, komma.« Ihre Zungen konnten kein Sch aussprechen. Wenn wir, unsere Lupen auf unseren rechten Augen, auf Frau Missel schauten, sahen wir die eine Hälfte von Frau Missel immer größer als ihre andere Hälfte. So wie sie unsere rechten Augen immer größer als unsere linken Augen sah. Deswegen schaute Frau Missel immer auf unsere rechten Augen. Ihr Schatten fiel den ganzen Tag auf die grünen Arbeitstische aus Eisen.
Die Gesichter der Arbeiterinnen konnte ich nur im Toilettenraum sehen. Dort standen Frauen vor den weißen Kachelwänden unter Neonlampen und rauchten. Sie stützten mit ihrer linken Hand ihren rechten Armbogen, und die rechte Hand bewegte sich mit der Zigarette in der Luft vor ihren Mündern. Weil die Toilette sehr starke Neonlichter hatte, sah auch das Rauchen wie eine Arbeit aus. Damals konnte man für zehn Pfennig von deutschen Arbeiterinnen eine Zigarette kaufen. Stuyvesant-HB.
Frau Missel kam manchmal, machte die Tür auf und schaute in den Toilettenraum, sagte nichts, machte die Tür zu, ging. Dann warfen die letzten Raucherinnen, als ob die Lampen ausgegangen wären, ihre Zigaretten in die Toiletten und drückten das Toilettenwasser herunter. Auf leisen Füßen gingen wir dann aus dem Toilettenraum in die Arbeitshalle, aber die Toilettenwassergeräusche kamen noch eine Weile hinter uns her. Wenn wir uns hinsetzten, waren unsere Haare immer etwas nervöser als die Haare der Frauen, die ihre grünen Tische nie zum Rauchen verließen.
Die ersten Wochen lebten wir zwischen Wonaymtür, Hertietür, Bustür, Radiolampenfabriktür, Fabriktoilettentür, Wonaymzimmertisch und Fabrikgrüneisentisch. Nachdem alle Frauen bei Hertie die Sachen, die sie suchten, finden konnten und Brot sagen gelernt hatten, nachdem sie sich den richtigen Namen ihrer Haltestelle gemerkt hatten – zuerst hatten sie sich als Namen der Haltestelle »Haltestelle« notiert – machten die Frauen eines Tages den Fernseher im Wonaymsalon an.
Der Fernseher stand von Anfang an da. »Wir gucken mal, was es da drin gibt«, sagte eine Frau. Von dem Tag an schauten viele Frauen im Wonaymsalon am Abend im Fernsehen Eiskunstläufen. Auch dabei sah ich die Frauen wieder von hinten, wie in der Fabrik. Wenn sie aus der Radiolampenfabrik ins Wonaym kamen, zogen sie sich ihre Nachthemden an, kochten in der Küche Kartoffeln, Makkaroni, Bratkartoffeln, Eier. Das Geräusch von kochendem Wasser, Pfannenzischen mischte sich mit ihren dünnen, dicken Stimmen, und alles stieg in der Küchenluft hoch, ihre Wörter, ihre Gesichter, ihre verschiedenen Dialekte, Messerglanz in ihren Händen, die auf die gemeinsamen Kochtöpfe und Pfannen wartenden Körper, nervös laufendes Küchenwasser, im Teller eine fremde Spucke.
Es sah aus wie die Schattenspiele im traditionellen türkischen Theater. Dort kamen Figuren auf die Bühne, jede redet in ihrem Dialekt – türkische Griechen, türkische Armenier, türkische Juden, verschiedene Türken aus verschiedenen Orten und Klassen und mit verschiedenen Dialekten – alle verstanden sich falsch, aber redeten und spielten immer weiter, wie die Frauen im Wonaym, sie verstanden sich falsch in der Küche, aber reichten sich die Messer oder Kochtöpfe, oder eine krempelte der anderen ihren Pulliärmel hoch, damit er nicht in den Kochtopf hineinhing. Dann kam die Heimleiterin, die einzige, die Deutsch konnte, und kontrollierte, ob alles in der Küche sauber war. Nach dem Essen zogen die Frauen ihre Nachthemden aus, zogen sich ihre Kleider an, manche schminkten sich auch, als ob sie ins Kino gehen würden, und kamen in den Wonaymsalon, machten das Ficht aus und setzten sich vor die Eiskunstläufer. Wenn die Älteren so im Kino saßen, gingen wir, die jüngsten drei Mädchen – wir waren alle drei Jungfrauen und liebten unsere Mütter – vom Wonaym zur gegenüberstehenden Imbißstube. Der Mann machte Buletten aus Pferden – wir wußten es nicht, weil wir kein Deutsch konnten. Buletten waren das Lieblingsessen unserer Mütter. Die Pferdebuletten in der Hand, gingen wir zu unserem beleidigten Bahnhof (Anhalter Bahnhof), aßen die Pferde und schauten auf die schwach beleuchteten türkischen Frauenwonaymfenster. Der beleidigte Bahnhof war nicht mehr als eine kaputte Wand und ein Vorbau mit drei Eingangstoren. Wenn wir mit den Imbißbulettentüten in der Nacht ein Geräusch machten, hielten wir den Atem an und wußten nicht, ob wir es waren oder jemand anderes. Dort auf dem Boden des beleidigten Bahnhofs verloren wir die Zeit. Jeden Morgen war dieser tote Bahnhof wachgeworden, Menschen sind da gelaufen, die jetzt nicht mehr da waren. Wenn wir drei Mädchen da liefen, kam mir mein Leben schon durchlebt vor. Wir gingen durch ein Loch hinein, gingen bis zum Ende des Grundstücks, ohne zu sprechen. Dann liefen wir, ohne es uns zu sagen, rückwärts zurück bis zu dem Loch, das vielleicht einmal die Tür vom beleidigten Bahnhof gewesen war. Und beim Rückwärtslaufen pusteten wir unseren Atem laut heraus. Es war kalt, die Nacht und die Kälte nahmen unseren lauten Atem und machten ihn zu dichtem Rauch. Dann gingen wir wieder zur Straße, ich schaute hinter mich, um unsere Atemreste von vorhin hinter dem Türloch in der Luft noch zu sehen. Es sah so aus, als ob der Bahnhof in einer ganz anderen Zeit stand. Vor dem beleidigten Bahnhof stand eine Telefonzelle. Wenn wir drei Mädchen an ihr vorbeigingen, redeten wir laut, als ob uns unsere Eltern in der Türkei hören könnten.
Die Heimleiterin, die kleine Türkin, die einzige im Wonaym, die Deutsch sprach, sagte eines Abends: »Heute abend hat die Radiolampenfabrik ein Tanztreffen arrangiert mit englischen Soldaten.« Ein Bus kam, holte uns Frauen ab und fuhr uns zu den englischen Kasernen in Berlin. Die Frauen setzten sich an Militärtische, und die Soldaten standen an der Bar und luden uns zum Tanzen ein. Alle gemeinsamen Kochtöpfe und Pfannen waren vergessen. Heute abend gab es Soldaten. Die Soldaten tanzten mit uns, wir kehrten mit Soldatenlächeln in unser Wonaym zurück. In dieser Nacht guckte keine Frau in die anderen Frauenaugen. Die Frauen liefen in langsamen Schritten zu ihren Sechsbettzimmern und öffneten ihre Bettdecken, als ob es für sie eine schwere Arbeit wäre, sich ins Bett zu legen. Manche knöpften ihre Nachthemden auf und öffneten vielleicht zum erstenmal die Zimmerfenster. In der Nacht wehte durch die Fenster Schnee auf die schlafenden Decken, und am Morgen standen wir alle als nasse Frauen auf. Dann schmierten alle Frauen die Margarine sehr leise auf ihre Brote und aßen sie auch leise, dann legten sie sich wieder auf ihre Betten. Die Zimmer schwiegen, und aus jedem Bett schaute ein Frauengesicht. Dann sammelten sie sich im gemeinsamen Wonaymsalon und erzählten: Eine war Opernsängerin in der Türkei gewesen. Aber eines Tages brachte der neue Operndirektor in Istanbul seine Frau mit. Diese Frau war keine Starsängerin, aber er ließ für sie Mikrophone auf der Opernbühne aufstellen. Deswegen war die Sängerin nach Deutschland gekommen. Eine andere hatte in Smyrna einen amerikanischen Soldaten kennengelernt, er wollte sie heiraten, aber sie mußte ihre Reise nach Amerika selber bezahlen. Deswegen kam sie nach Deutschland, um für das Flugticket nach Amerika Geld zu verdienen. Die dritte war Geheimpolizistin in Istanbul gewesen und hatte sich in einen Geheimpolizisten verliebt, der gleichzeitig in türkischen Filmen Starrollen spielte und heimlich auch andere Frauen liebte. Die Geheimpolizistin haute vor diesen verheimlichten Liebesgeschichten des Geheimpolizisten nach Deutschland ab. Ein anderes Mädchen hieß Nur. Nur sagte, ihre Brüste wären so groß, daß ihr sogar der Rücken weh täte, wenn sie sich ins Bett legte. Sie war als Arbeiterin nach Deutschland gekommen, um ihre Brüste operieren zu lassen.
Die Heimleiterin, die als einzige Deutsch konnte, nahm nach der Tanznacht mit den englischen Soldaten Männer mit auf ihr Zimmer. Jedesmal lud sie dann ein Mädchen auf ihr Zimmer ein, um später sagen zu können, daß der Mann der Liebhaber dieses Mädchens gewesen war. Bald danach flog die Heimleiterin aus dem Fabrikwonaym raus, aber nicht, weil sie Männer mit auf ihr Zimmer genommen hatte. Die Frauen im Wonaym bekamen aus der Türkei Pakete mit türkischen Würsten. Wenn der Postbote mit den Paketen kam, waren die Frauen in der Fabrik, die Heimleiterin nahm die türkischen Würste, versteckte sie unter ihrem Bett, zeigte uns die Papiere der Deutschen Post und übersetzte: »Die Würste aus der Türkei sind giftig, krank. Die Deutsche Post hat sie beschlagnahmt.« Die Frauen aber fanden ihre türkischen Würste unter ihrem Bett, gingen mit den Würsten zum Radiolampenfabrikdirektor, und die Heimleiterin wurde entlassen.
Die Radiolampenfabrikdirektoren schickten uns ein türkisches Ehepaar als Leiter. Der Mann mußte im Wonaym arbeiten, seine Frau wurde unsere Dolmetscherin in der Fabrik.
Unser neuer Heimleiter sagte, er sei Künstler und Kommunist. Keine wußte, was ein Kommunist ist. Abends lehrte er uns Frauen die deutsche Sprache. Alle Frauen versammelten sich im gemeinsamen Wonaymsalon, nach der Arbeit zogen sie nicht mehr ihre Nachthemden an, die Eiskunstläufe gingen im nicht eingeschalteten Fernseher weiter, und wir lernten Deutsch bei unserem kommunistischen Heimleiter. Er saß mit seinem türkischen Musikinstrument Saz vor den Frauen und sang ein türkisches Lied in Deutsch, das wir alle in Türkisch kannten: »Grüßen Sie meinen Vater, er muß tausend Lira bezahlen und mich aus dem Gefängnis befreien.« Alle Frauen wiederholten es. Er lächelte und zog an seinem Schnurrbart. Draußen vor dem Hebbeltheater gingen die Zuschauer langsam ins Theater, und wir im Wonaym wiederholten die deutschen Sätze. »Er soll tausend Lira bezahlen und mich aus dem Gefängnis befreien.«
Wenn die Frauen beim Wiederholen Schwierigkeiten hatten, sagten sie: »Das Mädchen mit der Hose soll es wiederholen, wir haben es vergessen.« Ich wiederholte seine Sätze. Der kommunistische Heimleiter sagte: »Hast du schon einmal Theater gespielt?« – »Ja, sechs Jahre.« – »Das hört man. Was hast du gespielt?« – »Titania im Sommernachtstraum.«
»Ich bitte dich, du holder Sterblicher,
Sing noch einmal! Mein Ohr ist ganz verliebt …«
Er antwortete:
»Ich bin ein Geist nicht von
gemeinen Stande;
Ein ew’ger Sommer zieret meine Lande …«
»Ihr Name, ehrsamer Herr?«
»Vasıf«, sagte er und zog an seinem Schnurrbart.
Der kommunistische Heimleiter sagte uns, daß er den lesbischen Cousinen ein Zweibettzimmer geben würde, damit sie sich in Ruhe lieben könnten. So zogen die Cousinen aus unserem Sechsbettenzimmer aus. Vorher küßten sie uns alle, als ob sie auf eine große Reise gehen würden, die eine weinte, deswegen nahm ihr Rezzan die Sachen aus den Händen, und ich brachte die Weinende bis zu ihrem neuen Zimmer. In unserem Sechsbettenzimmer blieben ihre Betten leer. Die Geschwister, die hellblaue Morgenmäntel aus elektrisierten Stoffen trugen, hatten, seitdem die Cousinen sich in den Nächten im Bettbezug liebten, angefangen, sich morgens hinter ihren Betten versteckt anzuziehen. Erst wenn sie ihre Mäntel schon anhatten, setzten sie sich beide zusammen auf das unterste Bett, zogen gleichzeitig ihre Schuhe an, machten die Lampe aus und gingen aus dem Zimmer. Wir machten die Lampe wieder an. Obwohl die lesbischen Cousinen jetzt weg waren, zogen sich die Geschwister weiter heimlich hinter ihren Betten an und sagten, daß beide Cousinen Mason (Freimaurer) wären. Ich wußte nicht, was Mason bedeutete. Sie redeten wieder von ihren Brüdern: »Gut, daß unsere Brüder das nicht wissen.« Sie sagten auch zu mir und Rezzan: »Gut, daß euer Vater nicht weiß, daß ihr mit lesbischen Mädchen in einem Zimmer geschlafen habt.« Rezzans Vater war aber tot. Sie sprachen soviel über ihre Brüder und über unsere Väter, daß ich dachte, ihre Sätze über die Brüder und Väter weben ein Spinnennetz, das das ganze Zimmer und unsere Körper bedeckt. Ich fing an, vor ihren Brüdern und vor meinem Vater Angst zu kriegen. Ich hatte sogar Angst vor Rezzans totem Vater. Jedesmal, wenn ich Angst bekam, schrieb ich an meine Mutter einen Brief mit solchen Sätzen: »Gott schützt mich hier mit der Hilfe meines Vaters – ich schwöre, ich werde hier keine schlechten Sachen machen.«
Die beiden Geschwister kauften für ihre Brüder bei Hertie Anzüge und Waschpulver und legten diese Sachen über die beiden leeren Betten der lesbischen Cousinen. Die Männeranzüge lagen auf den Betten, und in der Nacht, wenn am Hebbeltheater die Reklamelichter an- und ausgingen, fiel das Licht in unser Zimmer, dann sah ich im Reklamelicht wieder ihre glänzenden Haarwickler an ihren Köpfen und die glänzenden Knöpfe der Männeranzüge, die über zwei Betten wie Körper lagen.
Wenn wir drei Mädchen, in unseren Händen die Pferdebuletten, auf die andere Seite der Straße gegenüber unserem Wonaym zu unserem beleidigten Bahnhof gingen und bei der Telefonzelle vorbeiliefen, sprach ich jetzt vor der Telefonzelle nicht mehr laut, sondern leise, in der Angst, daß meine Eltern mich in Istanbul hören könnten. Bald aber kam ein Buch in unser Zimmer, und das nahm mir die Angst vor den Brüdern und vor meinem Vater und Rezzans totem Vater. Unser kommunistischer Heimleiter hatte viele Bücher, die wir, wenn wir wollten, lesen konnten. Das Buch brachte Rezzan ins Zimmer – Oscar Wildes »Bildnis des Dorian Gray«. Sie las soviel in diesem Buch, daß sie zu diesem Buch wurde, und sie erzählte mir in der Nacht die Geschichte. Ihr Kopf hing vom oberen Bett herab zu mir herunter, ich sah sie nur als Kopf. Wenn das Reklamelicht kurz ausging, verschwand der Kopf, aber die Geschichte hörte ich im Dunkeln weiter. Wenn sie über Dorian Gray erzählte, flüsterte sie, weil die Geschwister schon schliefen. Mein Körper gewöhnte sich an diese Angst und befreite mich aus der Angst vor Brüdern und Vätern.
Unser kommunistischer Heimleiter war sehr häßlich und komisch. Tag und Nacht stand seine Tür offen. Wie ein Postbote seiner eigenen Komik lief er im Wonaym herum und hielt sein Gesicht so, als ob er eine komische Maske trüge, die er jedem zeigen wollte, um ihn zum Lachen zu bringen. Seine Frau kam mit uns im Bus aus der Fabrik zurück und legte sich öfter etwas hin. Sie lag dann im Bett, der kommunistische Heimleiter saß hinter einem Tisch, ein Buch in seiner Hand, die Tür stand offen. Die Frauen kamen und gingen an dieser Tür vorbei. Er schaute nicht zu ihnen hin, aber hielt sein Gesicht immer wie eine lachende Maske hinter dem Buch. Er las im Buch und sagte jeder Frau, die vorbeikam, »Gutentag, Gutentag«, und dabei blätterte er in dem Buch. Manchmal, wenn er das Wort »Gutentag« genau beim Umblättern sagte, sagte er »Guten …« – dann blätterte er um – »… tag«. Er und seine Frau hatten in der Türkei Theater gespielt. Sie wurden dann von einem Theaterfestival eingeladen. So kamen sie nach Deutschland, spielten ihr Stück und blieben in Deutschland. Er ging tagsüber zu einem deutschen Theater, um sich Proben anzugucken, das Theater hieß »Berliner Ensemble«. Wenn er mit seiner Frau redete, sagte er »Brecht … Weill … Helene Weigel … Die Helene hat mir heute gesagt … Ich habe Helene gesagt …«. Wenn ich in der Nacht im Bett lag und an meine Mutter dachte, dachte ich auch an die Helene, ich übte ihren Namen: Helene Weigel. Die Frau des kommunistischen Heimleiters – er sagte zu ihr »meine Taube« – hatte mich gerne, sie fragte mich: »Was machst du heute abend?« Das Wort Abend! Ich hatte vergessen, daß es Abende gibt. Ich suchte den Abend in meinem Kopf. Die Taube sagte; »Komm mit uns zum Theater, du willst doch später Schauspielerin werden.« Wir gingen ins andere Berlin zum Berliner Ensemble und sahen ein Stück, »Arturo Ui«. Die Männer in Gangsteranzügen hoben ihre Hände hoch, es gab einen Chefgangster, der auf einem hohen Tisch stand. Ich verstand kein Wort und liebte es und liebte die vielen, vielen Eichter im Theater. In den Ostberliner Straßen bekam ich plötzlich eine Sehnsucht nach Zuhause, nach Istanbul. Ich roch die Luft und sog sie in mich hinein. Die Taube erzählte mir, daß man in Ostberlin und Istanbul das gleiche Dieselbenzin benutzte.
Unser kommunistischer Heimleiter lief im Wonaym manchmal mit nacktem Oberkörper herum. Er war dünn wie ein Skelett und hatte überall Haare, bis zu seinem Hals – wie ein Pullover. Wenn die Frauen ihn sahen, holten sie aus ihren Körpern Stimmen, als ob sie nackt wären und ein Mann sie ansehen würde. Er spielte weiter auf seinem Musikinstrument türkische Lieder, die er in deutsch sang:
Ach die Weiden der Smyrna
ihre Blätter regnen runter
uns nennen sie Banditen
unsere Geliebten sind wie die jungen Weiden.
So lernten wir, noch bevor wir in deutsch gelernt hatten, »Tisch« zu sagen: »Ach die Weiden der Smyrna, ihre Blätter regnen runter.«
Mit dem kommunistischen Heimleiter fing ein anderes Leben an. Bevor er kam, waren wir im Wonaym nur Frauen gewesen. Die Frauen suchten in den anderen Frauen die Mütter, die Schwestern oder die Stiefmütter, und wie die Schafe, die in einer Regennacht vor Blitz und Donner Angst hatten, kamen sie sich zu nah und drückten sich manchmal bis zur Atemlosigkeit. Jetzt hatten wir einen Hirten, der singen konnte. Er gab uns Bücher und sagte: »Hier, ich gebe dir meinen besten Freund.« Einer von seinen besten Freunden war Tschechow. So war er nicht der einzige Mann, den wir hatten. Mit ihm kamen in unser Frauenwonaym andere Männer: Dostojewski, Gorki, Jack London, Tolstoi, Joyce, Sartre und eine Frau, Rosa Luxemburg. Ich kannte vorher keinen von ihnen. Manche Frauen holten sich von ihm die Bücher, die sie vielleicht nicht lasen, aber sie liebten diese Bücher wie ein Kind, das fremde Briefmarken liebt, sie liebten es, diese Bücher in ihren Taschen zu haben, wenn sie in den Bus zur Radiolampenfabrik einstiegen.
Wenn unser kommunistischer Heimleiter mit einer Frau sprach, fing er seine Sätze immer mit dem Wort »Zucker« an. Wenn er zu mehreren Frauen sprach, sagte er »Zuckers«. »Zuckers, geht, setzt euch hin, ich komme gleich«, »Zucker, hier ist ein Brief für dich.« Die Frauen, die ihn liebten, fingen auch miteinander an, sich mit »Zucker« und »Zuckers« anzusprechen. Die Frauen, die ihn nicht liebten, sagten nicht »Zucker« zueinander. So teilte sich langsam das Frauenwonaym auf in die Frauen, die »Zucker« sagten, und in die Frauen, die nicht »Zucker« sagten. Wenn die Frauen in der Küche mit den Töpfen und Pfannen kochten, verteilten sich auch die Töpfe und Pfannen zwischen den Frauen, die sich mit »Zucker« ansprachen, und denen, die sich nicht mit »Zucker« ansprachen. Die, die »Zucker« zu sich sagten, gaben die Töpfe, nachdem sie mit dem Kochen fertig waren, den Frauen, die auch »Zucker« zu ihnen sagten, und die, die nicht »Zucker« sagten, gaben die Töpfe denen, die nicht »Zucker« sagten. Die Frauen, die »Zucker« sagten, fanden den Abend. Sie gingen nach der Fabrikarbeit jetzt nicht mehr sofort in die Nacht hinein. So teilte sich das Wonaym noch mal zwischen den Frauen, die ihre Abende hatten, und den Frauen, die über den Abend sofort in die Nacht sprangen. Wenn diese Frauen ins Bett gingen, gingen im Hebbeltheater, das unserem Wonaym gegenüberstand, die Zuschauer langsam ins Theater. Die anderen fingen an, ihre Abende in die Länge zu ziehen. Sie kauften Schallplatten, so kam Beethovens 9. Sinfonie ins Frauenwonaym und ein Schlager: »Junge, komm bald wieder«. Im Wonaymsalon lief der Fernseher vor sich hin, sie hörten sich hintereinander ohne Pause den Beethoven und »Junge, komm bald wieder« an, so, als ob, wenn sie eine Sekunde ohne diese Töne und Stimmen blieben, der Abend aus ihren Händen wieder abhauen würde. Es war so laut, daß manchmal sogar unser kommunistischer Heimleiter schrie: »Esels, legt euch hin! Esels, geht schlafen!« Die Frauen, die nicht »Zucker« sagten, nahmen aber sein neues Wort »Esel« in ihre Münder und schrien jetzt aus ihren Zimmern in den Wonaymsalon: »Esels, legt euch hin!« Wir drei Mädchen gehörten auch zu Esels. Auch der Morgenbus, der uns zur Fabrik brachte, teilte sich in zwei Frauengruppen auf. Die Frauen, die nicht »Zucker« sagten, sondern »Esels, legt euch hin!«, setzten sich jetzt als Gruppe vorne in den Bus, und die, die »Zucker« sagten und Esels waren, hinten in den Bus. In der Fabrik aber setzte sich jede an ihren alten Platz. Die, die ihre Abende in die Länge zogen und dabei von der Nacht etwas klauten, gingen in der Fabrik öfter auf die Toilette, die Lupe vor ihrem rechten Auge. Hinter der Lupe schauten jetzt unsere rechten Augen noch schläfriger als unsere linken. Wir kauften im Toilettenraum von den deutschen Arbeiterinnen weiter für zehn Pfennig Zigaretten und gingen mit der Zigarette auf die Toilette. Wenn wir auf die Toilette gingen, vergaßen wir öfter, unsere Lupen von unserem rechten Auge abzunehmen, so sahen unsere Zigaretten, die wir in der Toilette rauchten, viel größer aus. Wir rauchten drinnen und schliefen dort etwas ein. Die Meisterin, Frau Missel, aber kam und holte uns aus der Toilette. So teilten sich langsam auch in der Fabrik die Frauen in die, die in der Toilette schliefen, und in die, die in der Toilette nicht schliefen.
Irgendwann halfen Beethovens 9. Sinfonie und »Junge, komm bald wieder« nicht mehr, die Abende in die Länge zu ziehen. Die Frauen, die Esels waren, gingen jetzt aus dem Wonaym raus. Das automatische Licht im Hauskorridor ging von diesem Tag an immer an und aus und die Wonaymtür mit lautem Quietschen auf und zu. Wir drei jüngsten Mädchen des Frauenwonayms gingen durch die Straßen von Berlin zum Bahnhof Zoo, zum Aschinger, und aßen dort Erbsensuppe und nicht mehr die Pferdebuletten von unserer Imbißbude neben dem beleidigten Bahnhof. Wir sprachen aber weiter laut, wenn wir an unserer Telefonzelle neben unserem beleidigten Bahnhof vorbeigingen, damit uns unsere Eltern in der Türkei hören konnten. An manchen Abenden, wenn wir drei Mädchen vom Zoo-Aschinger spät zu unserem Wonaymzimmer zurückkamen und in der Nacht unsere Fingernägel mit einer Feile feilten, schmiß eine andere Frau, die schon im Bett war, ihr Kopfkissen nach uns und schrie uns an: »Ihr werdet noch Nutten werden!« Ich übte weiter jeden Morgen am deutschen Zeitungsstand meine Sätze, die ich nicht verstand, und antwortete mit auswendig gelernten Zeitungsschlagzeilen gegen das Kopfkissen:
HARTE BANDAGEN
GUCKEN KOSTET MEHR
SOWJETS BLIEBEN NUR ZAUNGÄSTE.
Als wir durch die Berliner Straßen liefen, erstaunte mich, wie wenig Männer auf den Straßen zu sehen waren, auch in den Abendzeiten gab es nicht viele Männer zu sehen. Mich erstaunte auch, daß die Männer, die ich sah, sich nicht zwischen den Beinen kratzten, wie viele türkische Männer in türkischen Straßen. Und manche Männer trugen den Frauen, neben denen sie gingen, ihre Taschen und sahen so aus, als ob sie nicht mit diesen Frauen verheiratet wären, sondern mit diesen Taschen.
Sie gingen durch die Straßen, als ob das Fernsehen sie gerade filmen würde. Die Straßen und Menschen waren für mich wie ein Film, aber ich selbst spielte nicht mit in diesem Film. Ich sah die Menschen, aber sie sahen uns nicht. Wir waren wie die Vögel, die irgendwohin flogen und ab und zu auf die Erde herunterkamen, um dann weiterzufliegen.
Wir waren alle nur für ein Jahr hergekommen, nach einem Jahr wollten wir alle zurückkehren. Wenn wir uns im Spiegel anschauten, lief keine Mutter, kein Vater, keine Schwester hinten im Raum an uns vorbei. Im Spiegel sprachen unsere Münder nicht mehr mit der Mutter oder Schwester. Wir hörten nicht mehr ihre Stimmen, ihr Kleiderflüstern, ihr Lachen vor dem Spiegel, so sahen wir uns jeden Tag im Spiegel als einsame Menschen. Nachdem wir im Spiegel verstanden hatten, daß wir alleine waren, war alles leichter. So gingen wir drei Mädchen zum Wienerwald am Ku’damm und aßen halbes Huhn. Dann habe ich den Christus gesehen. Wir waren, um uns zu wärmen, in eine Kirche gegangen, und dort sah ich zum erstenmal Christus am Kreuz. Auch in Istanbul war Christus einer unserer Propheten. Ich liebte ihn als Kind, aber ich hatte nichts vom Kreuz gehört, meine Großmutter hatte mir erzählt, daß Christus als Baby alleine in einem Korb im Fluß schwamm. Ich liebte auch seine Mutter Meryem.
In der Fabrik rauchten wir weiter Stuyvesant in der Toilette und schliefen dort ein, die Meisterin, Frau Missel, holte uns wieder heraus, die fehlerhaften Radiolampen kamen in den Mülleimer. Wenn es zu viele Radiolampen waren, kauften wir von den Männern, die in den Fabrikpausen mit Koffern kamen, Parfüm, Seife und Creme. Wir unterschrieben auch Papiere, ohne zu wissen, daß es Enzyklopädien-Abonnements waren, das Geld ging vom Monatslohn ab. Wir glaubten, daß die Meisterin, Frau Missel, wegen der kaputten Radiolampen weniger böse wäre, wenn wir die Sachen kauften.