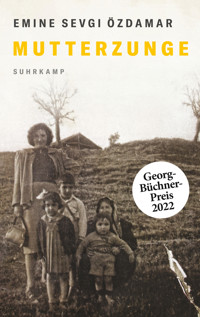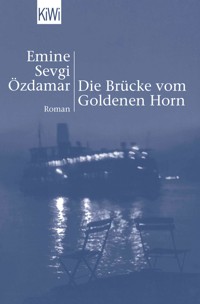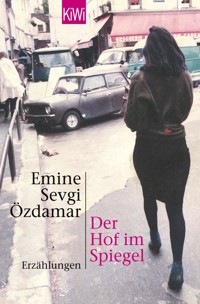9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seltsame Sterne starren zur Erde - ein faszinierender Blick auf ein geteiltes Berlin der 70er Jahre, voller Aufbrüche, Liebesgeschichten und Theater-Leidenschaft. Emine Sevgi Özdamar, eine junge türkische Schauspielerin, zieht es 1976 aus Istanbul in die pulsierende, geteilte Stadt Berlin. Noch geprägt von Erinnerungen an die Militärdiktatur in ihrer Heimat, träumt sie davon, das Theater Bertolt Brechts an der Ostberliner Volksbühne kennenzulernen. Mit staunenden Augen und umwerfendem Witz erzählt Özdamar von einem einzigartigen Berlin: das Leben ihrer WG-Mitbewohner im Westberliner Wedding, die Begegnungen mit türkischen Einwanderern, die politischen Ereignisse des "deutschen Herbstes" und die täglichen S-Bahnfahrten zwischen West und Ost. Vor allem aber entdeckt sie ihre Liebe zum Theater Heiner Müllers und Benno Bessons, das ihr neuen Lebensmut schenkt. Als Regieassistentin an der Volksbühne hält sie die Proben zu Müllers Die Bauern und Goethes Bürgergeneral in faszinierenden Skizzen fest. Seltsame Sterne starren zur Erde ist ein ganz besonderes Buch - ein berührender Roman und ein wertvolles Zeitdokument, das ein versunkenes Berlin voller kleiner und großer Geschichten lebendig werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Emine Sevgi Özdamar
Seltsame Sterne starren zur Erde
Wedding – Pankow 1976/77
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Emine Sevgi Özdamar
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Emine Sevgi Özdamar
Emine Sevgi Özdamar, geboren am 10. August 1946 in der Türkei.
Mit 12 Jahren erste Theaterrolle am Staatstheater Bursa im Bürger als Edelmann von Molière.
1965 bis 1967 Aufenthalt in Berlin, Arbeit in einer Fabrik.
1967 bis 1970 Schauspielschule in Istanbul.
Erste professionellen Rollen in der Türkei als Charlotte Corday im Marat-Sade von Peter Weiss und als Witwe Begbick in Mann ist Mann von Bert Brecht.
1976 an der Volksbühne Ost-Berlin.
Mitarbeit bei dem Brecht-Schüler und Regisseur Benno Besson und bei Matthias Langhoff.
1978 bis 1979 Paris und Avignon.
Mitarbeit an Benno Bessons Inszenierung Kaukasischer Kreidekreis von Bert Brecht. Aufgrund der vorangegangenen Theaterarbeit Doktorandin an der Pariser Universität Vincennes.
1979 bis 1984 Engagement als Schauspielerin beim Bochumer Schauspielhaus unter der Intendanz von Claus Peymann.
Im Auftrag des Schauspielhauses Bochum entstand ihr erstes Theaterstück Karagöz in Alemania, erschienen im Verlag der Autoren, Frankfurt. 1986 im Frankfurter Schauspielhaus unter eigener Regie aufgeführt.
Lieber Georg von Thomas Brasch, Regie Karge/Langhoff; Mutter von Bert Brecht; Weihnachtstod, Buch und Regie Franz Xaver Kroetz, Kammerspiele München; Im Dickicht der Städte von Bert Brecht, Freie Volksbühne Berlin; Faust, Regie Einar Schleef, Frankfurter Schauspielhaus; Die Trojaner von Berlioz, Regie Berghaus, Frankfurter Oper; Drei Schwestern von Anton Tschechow, Théâtre de la Ville, Paris, Regie Matthias Langhoff, Die Troerinnen von Euripides, Théâtre Amandière, Paris, Regie Matthias Langhoff.
Darunter Freddy Türkenkönig, Regie Konrad Zabrautzky; Yasemin, Regie Hark Bohm; Airport, Rückflug nach Teheran, Regie Werner Masten; Eine Liebe in Istanbul, Regie Jürgen Haase; Happy Birthday, Türke, Regie Doris Dörrie; Die Reise in die Nacht, Regie Matti Geschonneck.
Seit 1982 freie Schriftstellerin.
1982 erstes Theaterstück Karagöz in Alemania, erschienen im Verlag der Autoren, Frankfurt.
1991 zweites Theaterstück Keloglan in Alemania, die Versöhnung von Schwein und Lamm, Verlag der Autoren, Frankfurt.
2001 drittes Theaterstück Noahi, Verlag der Autoren, Frankfurt. Noahi bearbeitet die Arche-Noah-Geschichte im Rahmen des Projektes Mythen für Kinder und wird im Frankfurter Schauspielhaus uraufgeführt.
Erster Erzählband Mutterzunge, Rotbuch-Verlag, 1990.
Der Erzählband Mutterzunge gehört zu den Best Books of Fiction published 1994 in America (Publisher’s Weekly).
Erster Roman Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei Türen aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1992. Der Roman erscheint außer in Deutschland auch in Frankreich, England, Griechenland, Katalonien, Finnland, den Niederlanden, Spanien, Polen, der Türkei, Norwegen und Kanada.
Ingeborg Bachmann Preis 1991
Walter Hasenclever-Preis 1993
Stipendium des Deutschen Literaturfonds 1992
New York-Stipendium des Deutschen Literaturfonds 1995
International Book of the Year, London Times Literary Supplement, 1994
Zweiter Roman Die Brücke vom Goldenen Horn, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1998 (auch als KiWi 554)
Arbeitsstipendium der Landeshauptstadt Düsseldorf
Adalbert von Chamisso-Preis 1999
Preis der LiteraTour Nord 1999
Im Frühjahr 2001 erschien ihr neuer Erzählband Der Hof im Spiegel
Künstlerinnenpreis des Landes NRW im Bereich Literatur / Prosa, 2001
Dritter Roman Seltsame Sterne starren zur Erde, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2003
Literaturpreis der Stadt Bergen-Enkheim, Stadtschreiberin 2003
Erhielt am 21. November 2004 den Kleist-Preis
Kunstpreis Berlin 2009 des Landes Berlin, von der Sektion Literatur der Akademie der Künste als Fontane-Preis verliehen
Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille 2010
Alice-Salomon-Poetik-Preis 2012
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein Buch über ein nun schon versunkenes Berlin, betrachtet wie von einem anderen Stern, voller kleiner und großer Liebesgeschichten und Entdeckungen diesseits und jenseits der Mauer.
Berlin, Mitte der 70er Jahre. Eine geteilte, eingeklemmte Stadt, und doch voller heftiger und stiller Aufbrüche in Ost und West. Genau dorthin zieht es 1976 eine junge türkische Schauspielerin aus Istanbul, noch niedergedrückt von Erinnerungen an die Militärdiktatur im eigenen Land, aber mit einem großen Traum: das Theater Bertolt Brechts an der Ostberliner Volksbühne kennen zu lernen.
Mit staunenden Augen und umwerfendem Witz erzählt Emine Sevgi Özdamar von einem Berlin, das kein Deutscher so je gesehen hat: das Leben ihrer WG-Mitbewohner im Westberliner Wedding und ihrer Ostberliner Freunde in Pankow, die türkischen Einwanderer in der Nachbarschaft, die politischen Ereignisse des »deutschen Herbstes«, die täglichen S-Bahnfahrten zwischen West und Ost, kleine und große Liebesgeschichten und vor allem ihre heiße Liebe zum Theater Heiner Müllers und Benno Bessons, das sie zurück ins Leben holt. Als Regieassistentin an der Volksbühne hält sie die Proben zu Müllers Die Bauern und Goethes Bürgergeneral in faszinierenden Skizzen fest, die diesem ganz besonderen Buch einen zusätzlichen Reiz und dokumentarischen Wert geben.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
2003, 2004, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einer Idee von Rudolf Linn, Köln
Coverillustration: Rudolf Linn, Köln
Coverfoto Rückseite: © Ulf Andersen/Gamma/Studio X
ISBN978-3-462-30410-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
2. Teil
Zitatnachweise
1. Teil
Der Hund bellte und hörte nicht auf. Manchmal lief er in den zweiten oder dritten Hof, seine Stimme entfernte sich, aber dann kam sie wieder näher. Ich konnte nicht mehr schlafen, Else Lasker-Schülers Buch lag auf dem zweiten Kopfkissen. Bevor ich einschlief, hatte ich ein paar Zeilen auswendig gelernt.
Seltsame Sterne starren zur Erde,
Eisenfarbene mit Sehnsuchtsschweifen,
Mit brennenden Armen die Liebe suchen …
Ich wiederholte die Sätze, als sollten Elses Wörter und meine Stimme das Hundegebell im Hof beruhigen. Da der Hund aber noch lauter bellte, fing auch ich an, beim Sprechen lauter zu werden, und schrie die Sätze fast. Woher kam dieser Hund? Bis jetzt hatte es keinen Hund hier im Hof gegeben. Ich starrte hilflos auf das Buch, als ob es mir helfen könnte. Der Hund bellte und bellte, ich schwieg und hörte meine Zähne klappern. Die Heizungen in dieser ehemaligen Fabriketage waren alle abgestellt, wie immer an Feiertagen und an Samstagen und Sonntagen. Und wenn die Schneiderinnen und Büglerinnen aus der Etage unter uns an den Wochenenden nach Hause gingen, fing überall im Haus die Kälte an, auch hier in der obersten Etage, wo sieben Leute wohnten.
Wenn jetzt die anderen hier wären, könnte man die Kälte sehen. Peter würde vielleicht baden, und wenn er aus dem heißen Badewasser herausstiege, würde es um seinen Körper herum dampfen.
Wenn an solchen heizungslosen Tagen die sieben Freunde durch den langen, großen Raum in die Küche kamen, ging ihr heißer Atem in der Kälte einen halben Meter vor ihnen her, als ob ein Flugzeug am Himmel einen langen Strich zieht und eine Himmelsstraße baut. Wenn zwei von uns in ihren gegenüberliegenden Zimmertüren standen und in der Kälte miteinander redeten, sah ich auf dem Korridor zwei Atem miteinander sprechen, und wenn jemand durch diese hindurchlief, verletzte er kurz die beiden sprechenden Atem und ging mit seinem eigenen Atemhauch vor sich her in die Küche. Nur der Atem konnte die Kälte kurz zerreißen. Wenn wir alle in der Küche um den großen, runden Tisch saßen und aßen und dabei sprachen, sah ich sieben Atemstraßen über dem Tisch wie die Lichtstrahlen von sieben Taschenlampen in einer finsteren Nacht.
Vor diesen sieben Leuten hatten hier andere Menschen gewohnt, die AA-Kommune. Sie waren zu Otto Mühl nach Österreich in ein Selbsterfahrungsseminar gefahren und von dort kahlgeschoren zurückgekehrt, auch Frauen und ein Kind. Sie sagten: Alle Unterschiede müssen abgeschafft werden, kein Privatbesitz, keine festen Beziehungen. Alle Frauen schliefen mit allen Männern, und sie durften nicht wissen, wer der Vater ihrer Kinder war. Auch die Sprache sollte abgeschafft werden, weil die Sprache Klassenunterschiede aufbaute. Die Sprache war ein Machtinstrument, deswegen zurück zum Urschrei. Nur das physische Muß und Elend sollte herausgeschrien werden, wie bei Kindern. Auch die Kinder schrien ja nur ihr physisches Muß heraus, sagten sie. Sie sprachen nicht mehr, sie schrien nur, deswegen waren die kahlgeschorenen Vormieter dauernd heiser. So war ihr schreiender Atem an den kalten Samstagen und Sonntagen in der ehemaligen Fabriketage noch länger gewesen als der meiner sieben Freunde, bei denen ich jetzt wohnte. Bei der AA-Kommune flogen in alle Richtungen Raketen in den Himmel und ließen ihre Spuren zurück, wenn sie so schrien.
Ich hatte die Leute von der AA-Kommune nicht mehr kennengelernt, weil sie herausgeprügelt worden waren, bevor ich hierhergekommen war. Die Lampe, die über dem Tischtennistisch im großen Raum hing, hatte damals auch etwas von den Schlägen abgekriegt – von den fünf Glühbirnen waren drei kaputtgeschlagen worden, und das Gestell der Lampe hing noch immer krumm wie ein Denkmal der AA-Kommune-Zeit an der Decke. Niemand von uns reparierte diese Lampe. Man spielte unter ihr Tischtennis, und ab und zu wurde sie von den Bällen getroffen und wackelte. Wenn zwei in der Kälte Tischtennis spielten, sah es aus, als ob zwei Atem einen Ball hin und her warfen.
Hinausgeschmissen hatte die AA-Kommune Reiner. Er hatte die ehemalige Fabriketage gemietet, mit Wänden aus dünner Pappe sieben Zimmer gebaut, an die Studenten vermietet und auch selbst dort gewohnt. Als die Studenten dann eines Tages kahlgeschoren aus Otto Mühls Selbsterfahrungsseminar zurückkamen und ständig schrien, holte Reiner aus Frankfurt seine Drückermafia und veranstaltete eine riesige Schlägerei. Die Drücker kamen in VW-Bussen mit Stöcken unter ihren Mänteln und gingen sofort auf die schreiend frühstückenden AA-Kommune-Leute los, auch die Drücker und die Kinder schrien. Und auch die Näherinnen und Büglerinnen in der unteren Etage, die die Schreie hörten und die zerschlagenen Fensterscheiben vor ihren Fenstern herunterfallen sahen, fingen an zu schreien, einige vergaßen die schweren Bügeleisen auf den Hosen, die sie gerade bügelten, und rannten auf die Straße. Die Hosen verbrannten auf den Bügeltischen, bis der Meister – der einzige Mann unter den Büglerinnen, ein kleiner Mann mit hervorstehendem Bauch, der taub war – die Bügeleisen senkrecht stellte. Reiner gewann, die AA-Kommune zog aus und hinterließ in den Schränken amerikanische Militärunterwäsche und viele T-Shirts, die für eine Mark pro Stück im Military-Shop zu kaufen waren und von denen ich wegen der Kälte ein paar übereinander angezogen hatte. Es gab auch grüne Soldatenschuhe in den Schränken, die wir an den kalten Tagen öfter anzogen.
Wieder bellte der Hund. Warum jaulte er so? Hatte ihm vielleicht jemand auf die Pfoten getreten? Ich muß Wasser trinken, das wird mir helfen, wieder zu schlafen. Ich ging durch den langen Korridor und den großen Raum zur Küche. Dieser Weg war so lang, daß Inga an den kalten Tagen mit dem Fahrrad zur Toilette fuhr, ihr Atem fuhr mit. Ich machte in allen Zimmern die Fichter an. In Jens’ Zimmer lag ein Stofftier im Bett, ein Bär, seine Glasaugen waren beschlagen. In Susannes Zimmer stand neben der Schreibmaschine ein Aschenbecher voller gefrorener Kippen, in Ingas Zimmer eine offene Wasserflasche, das Wasser war gefroren. Bei Janosch lag eine angebissene Schokolade gefroren auf der Tastatur seiner Schreibmaschine, ich sah darauf den Abdruck seiner Zähne und dachte, er lächelt mich an. Als ich die Tür zu Reiners Zimmer aufmachte, ging plötzlich das Radio an. Wie warm die Stimme des Mannes war, der gerade sprach! Ich legte meine Hände auf das Radio, aber die Kälte des Metalls brannte. Auf einem Teller lag eine angebissene Bockwurst mit gefrorenem Ketchup und sah aus wie Popkunst. In Barbaras Zimmer stand eine Kiste voller zusammengefrorener Bonbons und Schokolade neben ihrer Schreibmaschine, und es kam mir so vor, als ob die Bonbons vor Kälte grinsten. Vor allen Zimmertüren standen Schuhe, die mit Barbaras Schokolade und Bonbons gefüllt waren. Aus Peters Stiefeln nahm ich im Vorbeigehen ein Stück Schokolade.
In dem großen Raum stand neben der Tischtennisplatte und den kaputten, hinkenden Sesseln ein Weihnachtsbaum, an dem farbige Glühbirnen leuchteten, und ein Klavier. Ich faßte jede einzelne Birne an und spielte schnell ein do re mi fa so la …
Auf dem runden Küchentisch lagen Reste von Lebkuchen, eingewickelt in Plastikfolie, die beschlagen war. Ingas Mutter hatte sie mitgebracht. Mit ihrem Vater wollte Inga nichts zu tun haben, weil er ein Nazi gewesen war, nur die Mutter durfte sie besuchen. Das lange Fabrikwaschbecken mit fünf Wasserhähnen war voll mit ungespültem, vereistem Geschirr. Von der Küche ging es ohne Tür ins Bad, in dem eine dreibeinige Badewanne stand, voll mit altem Badewasser. Ich steckte meinen Finger in das kalte Wasser und sagte »Peter«. Er hatte als letzter gebadet, bevor alle zu ihren Familien gefahren waren. Auf dem Badewannenrand lag noch ein aufgeschlagenes Buch: Karl Marx, Das Kapital. Auch das Buch war hart gefroren, so wie die Handtücher, die dort an den Haken hingen. Am Dachfenster draußen sah ich Eiszapfen. Man konnte sich nicht auf die Klobrille setzen, die Kälte würde einem die Haut aufreißen. Auf dem Toilettenboden lagen viele Zeitungen der letzten Wochen und Monate. Auch die Schlagzeilen sahen aus wie gefroren:
NACH FRANCOS TOD WIRD JUAN CARLOS I.
KÖNIG VON SPANIEN
ANGOLA WEITER IM BÜRGERKRIEG
VIETNAM STEHT VOR DER WIEDERVEREINIGUNG
GEWALTSAMER TOD DES REGISSEURS PASOLINI
DREIZEHN JAHRE HAFT FÜR KANZLERSPION GUILLAUME
KISSINGER ZU GAST IN FÜRTH
Ich stopfte die Zeitung mit Pasolinis Foto gegen die Kälte vorne in meinen Pullover und machte die Tür zum Dachgarten auf, stieß mit dem Kopf gegen die Eiszapfen und sah den Mond über Berlin und ein paar Sterne, die in der Kälte ruhig leuchteten. Meine Zähne klapperten. Seltsame Sterne starren zur Erde.
Das Hundegebell aus dem Hof kam lauter herauf. Bevor ich die Tür zum Dachgarten zumachte, sah ich unter dem Mond und den Sternen den Ostberliner Fernsehturm. Die Ostberliner Volksbühne, in der ich als Hospitantin arbeitete, war über Weihnachten geschlossen. Auch in meinem Zimmer hörte ich den Hund weiter bellen. Was hatte er wohl? Wem gehörte dieser Hund? Vielleicht einer alten Frau, die gerade gestorben war? Vielleicht war die Teiche schon gefroren? Vielleicht bellte der arme Hund deswegen seit Stunden. Man sagte, in Berlin gäbe es in jeder Straße ein Bestattungsinstitut, weil viele einsame alte heute starben, besonders Weihnachten.
Ich nahm Elses Gedichtbuch in die Hand und las laut den Klappentext. Meine Hände, meine Stimme und das Buch zitterten. »Dies war die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte. Ihre Themen waren vielfach jüdisch, ihre Phantasie orientalisch, aber ihre Sprache war deutsch, ein üppiges, prunkvolles, zartes Deutsch …« Der Hund bellte und hinderte mich am Lesen, ich schrie ein Gedicht:
Warum, suchst du mich in unseren Nächten,
In Wolken des Hasses auf bösen Sternen!
Laß mich allein mit den Geistern fechten.
Vielleicht hatte der Hund sich nur verlaufen, aber ein Ostberliner Hund war es nicht. Auch die Hunde konnten nicht über die Mauer. Der Hund bellte schon wieder, und so laut. Ich hielt es nicht mehr aus. Morgen wäre ich sowieso zum Theater in Ostberlin gefahren. Es ist 5 Uhr 30 am Morgen. Ich fahre sofort, der Hund kann mir nicht in den Osten folgen. Draußen ist es nicht kälter als hier drinnen, ich werde nach Ostberlin gehen und die letzten Weihnachtsstunden dort verbringen. Was soll ich anziehen? In Istanbul hatte ich nie einen Mantel gebraucht. Ich schaute in allen Zimmern und Schränken nach, in Reiners Zimmer fand ich einen Parka auf dem Bett. Reiner war nach Westberlin gekommen, weil er seinen Militärdienst nicht machen wollte. Er stammte aus München und hatte dort vor drei Richtern eine Gewissensprüfung abzulegen. Die drei Richter fragten Reiner: »Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einem Wald, über Ihnen fliegt ein Militärflugzeug mit einer Bombe, das Bayern bombardieren und sechs Millionen Menschen töten will. Im Wald finden Sie eine Waffe, die dieses Flugzeug abschießen kann. Was würden Sie tun?« Reiner hatte gesagt: »Ich würde auf das Flugzeug schießen und den Piloten töten, um München zu retten.« Damit war er durchgefallen. Die richtige Antwort, meinte er, wäre gewesen: »Ich bin Pazifist, ich kann nicht einen Menschen töten, um sechs Millionen Leben zu retten.« Oder: »Ich bin homosexuell.« Dann mußte Reiner eine zweite Prüfung machen, die Frage war diesmal: »Hätten Sie am Stauffenberg-Attentat auf Hitler teilgenommen?« »Nein, ich töte niemanden«, sagte Reiner und fiel ein zweites Mal durch. »Sie hätten also nichts gegen Hitler unternommen!« Beim dritten Mal sagte er: »Ich will Theologie studieren, ich bin Pazifist, der Soldat ist kein Mörder und ich bin homosexuell.« Reiner war wieder durchgefallen.
Ich verließ die kalte Fabriketage in Westberlin und fuhr nach Ostberlin. Der Hund bellte immer noch.
Ich ging an dem Puff unten im Haus, an dessen Eingang das Schild »Milchladen« hing, vorbei. Die Vorhänge waren immer zugezogen, türkische Männer gingen hier rein und raus. Als ich Richtung S-Bahn lief, knisterte die Zeitung, die ich unter meinen Pulli gestopft hatte. Auf der Straße lag Glatteis. Die Autofahrer würden heute ihre Fenster freikratzen müssen. Die ganze Stadt würde mit diesem Geräusch aufwachen. Die S- Bahn war leer, als ich im Wedding am Gesundbrunnen einstieg, um zum Grenzübergang Friedrichstraße zu fahren. Die S-Bahn bewegte sich wie ein Tier, das sich in der Landschaft mal zeigte, dann verschwand und sich wieder zeigte. Sie fuhr jetzt durch die drei stillgelegten Geisterbahnhöfe, ohne anzuhalten, Humboldthain, Nordbahnhof, Oranienburger Straße, und kam am Grenzübergang Friedrichstraße an. Ich hatte Angst in der S-Bahn. Einmal hatte ich mit einer alten Westberliner Frau, die mit ihrem Gebiß wackelte, in einem Abteil gesessen, als plötzlich ein Mann vor mir stand und seinen rechten Arm auf meine Lehne legte. »Hey, willst du in einer Stunde tausend Mark verdienen? Wir werden dich nur fotografieren.« »Ich brauche keine Arbeit.« Er setzte sich mir gegenüber und masturbierte. Die alte Frau saß da, kaute an ihrem Gebiß und sah weg. Sie war eine dieser Frauen, die in ihren Wohnungen gerahmte Bilder ihrer im Krieg gefallenen Männer hatten und von deren Betten seit fünfunddreißig Jahren nur eine Hälfte benutzt war. Wenn diese Frauen ihre Bettwäsche waschen, dachte ich, waschen sie nur die Wäsche ihrer Hälfte. Die Hälfte der Toten, mit denen sie schlafen, ist sicher immer sauber.
Heute früh, am letzten Weihnachtstag, saß niemand außer mir in der S-Bahn. Der Zug wurde immer langsamer, als er durch die stillgelegten Ostberliner Bahnhöfe fuhr, die Dunkelheit drang von außen herein, und ich staunte, wie viele Lichter im Zug brannten. Am Grenzübergang Friedrichstraße hatten die Intershops ihre Rolläden heruntergelassen, so wie am Puff »Milchladen« im Wedding immer die Vorhänge geschlossen waren. Bevor ich die Treppen zum Grenzübergang hochging, zog ich die Westzeitung aus meinem Pullover, riß das Foto von Pasolini heraus und steckte es in meine Tasche. Die Zeitung, die ich nicht mit nach Ostberlin nehmen durfte, warf ich weg. Als ich in die Abfertigungshalle kam, dachte ich wegen der vielen Lichter, ich bin in einem Ballsaal, der Tanz ist zu Ende, die Menschen sind nach Hause gegangen, nur ein paar Pförtner stehen dort, und endlich ist es warm. Ich gab meinen Paß ab, dann tauschte ich sechs Mark fünfzig Westgeld in Ostgeld und bezahlte fünf Mark Visagebühren. Außer mir gab es keinen Menschen am Grenzübergang. Die ostdeutschen Polizisten standen einsam an ihrem Posten, das einzige Geräusch war das Schlagen des Stempels auf das Visapapier, das die Erlaubnis zur Einreise bedeutete. Tschlak. Ich sagte »Fröhliche Weihnachten« zu den Grenzpolizisten. Keiner fragte mich, »Was ist der Grund Ihrer Einreise?« Ich hätte sagen müssen: »Hundegebell.«
Jetzt bin ich in Ostberlin, ich habe mich vor dem Hundegebell gerettet. Wie in einem Märchen, hinter dir die Riesen, wirfst du den Kamm, und es entsteht ein Meer zwischen dir und den Riesen. Jedesmal, wenn ich hierherkam, vergaß ich den anderen Teil der Stadt, als ob tatsächlich ein großes Meer diese beiden Teile voneinander trennen würde. Ich konnte die beiden Teile nie zusammendenken und mir vorstellen, daß meine sieben Freunde in Westberlin nur drei Haltestellen von hier entfernt wohnten. Zu Fuß wären es zwanzig Minuten gewesen. Sich die beiden Teile zusammen vorzustellen, war genauso schwer wie sich Freddy Quinn und Mozart auf einer Schallplatte zu denken. Die Menschen, die sich auf einem Platz bewegten, sahen aus wie zu Schatten gewordene Figuren aus vergilbten Bildern. Ich schaute in manche Gesichter, so wie ich mir das Selbstportrait von Rembrandt, auf dem er ein alter Mann geworden war, anschaute und immer wieder anschaute, um mir vorzustellen, was er damals gedacht hatte, was das Geheimnis in seinem Gesicht war. In Westberlin sagten meine Freunde, daß in Ostberlin die Frauen so traurig aussähen. Ich sah diese Traurigkeit nicht, ihre Gesichter waren geheimnisvoll, wie Rembrandts Selbstportraits. Die wenigen Waren in den Ostberliner Schaufenstern beruhigten mich, eine kleine Waschwanne, ein Fahrradspiegel oder ein Fahrradschloß sahen aus wie archaische Gegenstände, und ich kam mir so vor, als sähe ich mir gerade in einem kleinen Museum Gegenstände aus einer anderen Zeit an. Manche Verpackungen für Kaffee, Bohnen oder Salz sahen aus, als hätten Kinder auf der Straße vergilbte Papierstücke oder Pappe gesammelt und daraus Pakete gebastelt. Darauf haben sie dann IMI oder Eisbecherset-Stieleisbereiter oder Weizenin oder Jensisal Speisevollsalz oder Solzenkuchen oder Putzi oder Mondos aus reinem Naturgummi geschrieben. Mit der Schrift haben sie sich mehr Mühe gegeben als mit dem Verpacken. Auch das DDR-Auto Trabant hatte etwas von einer Kinderzeichnung, die Farben waren Babywäsche-Farben: blau, rosa, grün. Die Autos fuhren wie aufgezogene Spielautos, aber wenn sie auf den alten Kopfsteinpflasterstraßen hintereinanderherfuhren und klapperten, rutschten die Kohlen, die wie schwarze Eier aussahen, in den Hauskellern die Kohlehaufen hinunter. Die Menschen, die im Trabant am Steuer saßen, sahen so aus, als säße der Motor in ihrem Körper, der das Auto mitnimmt. Im Westen sahen die Fahrer in ihren Autos aus, als ob nicht sie führen, sondern das Auto, während sie nur darin säßen und rauchten. Der Fahrer hieß nicht Hans, sondern Mercedes.
Ich lief die Friedrichstraße links hoch in Richtung Brechttheater, dem Berliner Ensemble. Auf der Spreebrücke blieb ich stehen, sah die Bäume im Hof des Theaters. An den Asten hingen Eiszapfen wie an den Fenstern meiner Westberliner WG. Von der Brücke fielen Eisklumpen auf den zugefrorenen Spreekanal, auf dem ein einsamer Mann einen Stock für seinen Hund warf. Der Hund rannte los, rutschte auf seinem Hintern und schüttelte sich. Auf dem Eis lag eine DDR-Zigarettenschachtel der Marke cabinet. Diese Marke rauchte auch ich, ich kriegte immer Kopfweh davon, aber ich rauchte sie weiter, weil viele Schauspieler an der Volksbühne diese Marke rauchten. So hatten wir die gleichen Kopfschmerzen.
Josef arbeitete als Physiker an der Uni in Zürich. Er ging oft zum Bahnhof, um dort von jugoslawischen und türkischen Arbeitern ihre Sprachen zu lernen. Dann fuhr er nach Istanbul, sprach mich mit seinem Türkisch auf der Straße an und fragte mich nach einem billigen Hotel: »Weib, wo ist ein Hotel?« Ich lachte und sagte: »Lassen Sie uns doch Deutsch sprechen.« Die Straße, die ich gerade herunterlief, war sehr steil, und so liefen wir zusammen in schnellen Schritten die Straße hinunter, genauso schnell sprachen wir auch, und als wir unten ankamen, wußten wir vieles voneinander: Als Kind war er einmal für schizophren erklärt worden, er hatte eine Frau, eine Geliebte, eine Katze, einen Leguan und viele Freunde unter den Fremdarbeitern in Zürich. Seine Mutter schrieb Gedichte. Er hörte von mir, daß ich geschieden war, daß ich noch im Magnet meines Mannes stand, daß ich seit einem Jahr mit keinem Mann schlafen konnte, daß wegen des Militärputsches meine Theaterkarriere kaputtgegangen war und daß ich, seitdem das Theater, in dem ich zuletzt die Witwe Begbick aus Mann ist Mann von Brecht gespielt hatte, vom Militär geschlossen worden war, als Werbefilmregisseurin für Coca-Cola, Pepsi Cola und Banken arbeitete, daß ich Flugangst hatte und meine Großmutter sehr liebte. Dann stieg er mit mir in den Bus, und zusammen stiegen wir wieder aus, gingen zu meiner Wohnung, in der ich mit meiner Großmutter, meiner Schwester und meinem Bruder wohnte. Wir sprachen weiter auf der Treppe, sprachen immer weiter, und Josef blieb bei uns wohnen. Nach zwei Wochen fuhr er nach Zürich zurück, und nun schrieben wir uns lange Briefe. Er las meine Briefe seinem Freund, dem jüdischen Buchhändler Pinkus, vor, und Pinkus sagte: »Schön.«
Ein paar Wochen später kam Josef wieder nach Istanbul. Als ich in einer Nacht in meinem Zimmer weinte, weil ich nach meinem Mann und meinem Theater Sehnsucht hatte, brachte mir meine Großmutter ein Glas Wasser. »Warum weinst du? Hast du geträumt, daß ich tot bin?« Sie war sehr alt, wie alt genau wußte sie nicht. Ich trank das Wasser, weinte aber noch mehr. Sie legte meine Brecht-Schallplatte auf, weil ich in der letzten Zeit diese Platte immer wieder angehört und die Lieder auf Deutsch mitgesungen hatte.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.
Aber ich weinte weiter, und Großmutter holte Josef dazu, so wie man einen Arzt holt. Sie dachte, alle Leute, die lesen und schreiben können, sind Ärzte. Als er das erste Mal zu uns gekommen war, hatte sie ihn sofort gebeten: »Untersuche mich mal.« Jeden Morgen hatte die Großmutter Josef Tee gemacht, und er fühlte ihren Puls. Nach ein paar Tagen hatte Großmutter ihn gefragt: »Willst du meine Enkelin heiraten?« Josef scherzte: »Ja, und Muslim will ich auch werden.« Großmutter glaubte wie viele Muslime, daß man, wenn man einen Andersgläubigen zum Islam bekehrt, direkt ins Paradies kommt, ohne in der Hölle zu brennen. Sofort wusch sie sich, auch Josef mußte sich waschen und sich ihr gegenübersetzen. Sie betete und fragte Josef: »Bist du willig und bereit, Moslem zu werden?« »Ja«, sagte er. Großmutter sagte: »Jetzt bist du Moslem. Setz dich auf den Teppich und wiederhole meine Gebete.« Großmutter zitterte vor Glück. »Ich habe das Paradies gewonnen. Ich werde ins Paradies gehen.« Vor Freude konnte sie nicht schlafen, wir lachten die ganze Nacht auf dem Balkon.
Jetzt holte sie Josef auch für mich. »Doktor, komm, hilf ihr.« Josef setzte sich auf einen Stuhl neben meinem Bett. »Warum weinst du?« »Ich bin unglücklich in meiner Sprache. Wir sagen seit Jahren nur solche Sätze wie: Sie werden sie aufhängen. Wo waren die Köpfe? Man weiß nicht, wo ihr Grab ist. Die Polizei hat die Leiche nicht freigegeben! Die Wörter sind krank. Meine Wörter brauchen ein Sanatorium, wie kranke Muscheln. Es gibt eine Stelle am Ägäischen Meer, wo drei Ströme Zusammenkommen. Man bringt Säcke mit Muscheln aus Istanbul, Izmir, Italien dorthin, die im schmutzigen Wasser krank geworden sind. Das saubere Wasser aus den drei Strömen heilt in ein paar Monaten die erkrankten Muscheln. Dieses Stück Meer nennen die Fischer Muschelsanatorium. Wie lange braucht ein Wort, um wieder gesund zu werden? Man sagt, in fremden Ländern verliert man die Muttersprache. Kann man nicht auch in seinem eigenen Land die Muttersprache verlieren?«
Josef sagte: »Ich glaube, du sagst nicht die ganze Wahrheit. Deinen allergrößten Kummer versteckst du vor mir. Du leidest unter der Trennung von deinem Mann. Sprich zu mir, sag die Wahrheit.«
Dieses »Sag die Wahrheit« verursachte bei mir schmerzende Nadelstiche, als ob ein Teil meines Körpers seit langem eingeschlafen war und nun wieder durchblutet wurde. Ich konnte nicht mehr reden. Meine Tränen tropften noch schneller auf die Bettdecke. Draußen sah ich im Straßenlampenlicht den Regen, aber meine Tränen waren schneller als die Regentropfen. Irgendwann, nach einer halben Stunde, hörte der Regen auf und, als ob der Regen der Dirigent meiner Tränen gewesen war, hörte auch ich auf zu weinen. Josef gab mir sein Schweizer Taschentuch, rot mit weißen Blumen darauf, ich schneuzte hinein. »Warum habt ihr euch getrennt?« – »Ich weiß es nicht. Nach dem Militärputsch wurde das Theater geschlossen, in dem ich gearbeitet hatte. Mein Mann konnte seine Filme nicht mehr drehen, wir wohnten im Wald in einem Holzhaus, durch die Bäume sahen wir das Marmarameer. Der Hausbesitzer, ein Chemiker, hatte in einer Glasfabrik gearbeitet und die Arbeiter bei einem Streik unterstützt. Nachdem er entlassen worden war, pflanzte er siebzehn Arten von Rosen im Garten und sprach nie wieder über Politik. Dort in dem Garten hörte ich die Zucchini wachsen. Sie machten Tschttscht in der Nacht. Die Auberginen sahen aus wie Babys, denen man lilafarbene Windeln aus Samt angezogen hatte. Abends liefen Igelfamilien unter den Maulbeerbäumen umher, die Glühwürmchen flogen um unsere Körper und Köpfe herum, wenn wir unter dem Lindenbaum am Tisch saßen. Tagsüber streikten einmal die Fischer unten am Meer, plötzlich war das Meer voller Fischerboote. Eine blinde Hündin lag im Schatten der Bäume und säugte ihre Kinder.
Wir waren gezwungen zu heiraten. Ohne Trauschein konnte man damals keine Wohnung mieten. Die Vermieter hatten Angst, daß alle jungen Menschen Anarchisten sind, im Untergrund arbeiten, aber der Trauschein machte dich legal. Das war eine Idee von den Offizieren der Militärputschisten. Ein Dichter hat aber gesagt: ›Ehe ist gegen die Gesundheit.‹ Ich glaubte an seinen Satz.«
»War das der Grund?«
»Ich weiß es nicht.
Wenn wir uns liebten, dachte ich immer an die Menschen, die in den Gefängnissen saßen. Sie können niemanden küssen, sie haben niemanden, mit dem sie wie zwei Löffel im Bett liegen können. Jedes Fleisch, das wir brieten, jeder Apfel, in den ich biß, kam mir vor wie ein Verrat an denen, die im Gefängnis saßen. Ein blinder Anwalt mußte in einem Gefängnis am Marmarameer in einer engen Zelle einen Monat lang stehen. Er konnte sich nicht hinhocken, sich nicht hinlegen, auf der Zellenerde lag getrocknete Scheiße von den Gefangenen vor ihm. Er konnte nur im Stehen pinkeln und scheißen, und wenn das Meer Wellen schlug, stieg das Wasser durch die Risse in der Gefängnismauer bis hoch zu den Knien des blinden Anwalts.
Josef, jetzt, in meinem Land, wo der Morgen kein Morgen zu sein scheint, wo nur die Sterne mit Sternen sprechen können, aber nicht Menschen mit Menschen, mit wem sprach der Junge, der zwanzig Jahre alt war, aber auf seinem Foto aus der Zeitung wie fünfzehn aussah? Er schnitt im Gefängnis aus einer Zeitung ein Bild aus. Ein Mädchen. Ein Dorfmädchen. Wenn man diesen Jungen nach der Folter zu seiner Zelle zurücktrug, legte er sich nicht ins Bett, sondern unter das Bett und sprach mit dem Bild des Mädchens. ›Heute haben sie mit mir das gemacht … das gemacht.‹ Wie viele Monate lang? Die ratlosen Nächte verbringen mit einem Papiermädchen?
Wenn in unserem Haus im Wald abends der schöne Wind, Lodos, vom Meer kam und mein Hemd aufblies oder die von der Sonne müden Blätter bewegte, dachte ich, dieser Wind ist ein Brief der Getöteten. Sie blasen in mein weißes Hemd, damit ich an ihre dunklen Betten denke. In der Nacht wurden die Schatten der Bäume, zwischen denen ich hin und her lief, lebendig. Ich versuchte, nicht mit den Füßen auf sie zu treten. Wenn morgens meine Haare aus der Bürste ins Waschbecken fielen, dachte ich, dies sind nicht meine Haare, dieses Waschbecken ist ein Gefängniswaschbecken, dort im Spiegel, das ist der Kopf eines Gefangenen, der sich wie ein verrückt gewordener Vogel selbst die Haare vom Körper reißt.
Ich lief im Stadtzentrum Istanbuls umher, plötzlich rannten die Menschen. Wohin? Das Obst auf den Ständen in den Straßen kam mir komisch vor. Was suchten dort ein Granatapfel, die Weintrauben? Wem sollten sie schmecken? Wie die Menschen, die auf den Straßen durch Kugeln umfielen, fiel auch das Obst aus den Tüten eines Mannes, der vor Angst davonrannte. Menschen verschwanden ganz plötzlich und wurden zu Fotos. Die Eltern liefen mit Fotos in den Händen herum und fragten: ›Wo sind unsere Kinder?‹ Ich dachte, das Land stirbt, alle werden getötet. Ich muß vorher noch alle Menschen fotografieren.«
Josef stand auf und machte das Licht im Zimmer an. Seine Brille war beschlagen, er schaute immer wieder in mein Gesicht und reichte mir das Wasserglas wie ein volles Glas Whisky. Ich trank, dann trank er die andere Hälfte. »Josef, während eines Militärputsches steht alles still. Auch die Liebe. Plötzlich gehst du in ein Café, dort sitzt dein Freund nicht mehr, der gestern noch dort war. Du gehst an seinem Haus vorbei, es sind keine Lichter an.«
»Und dein Mann?«