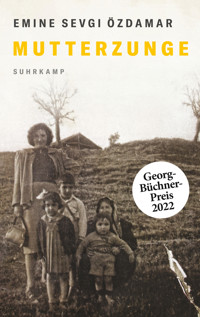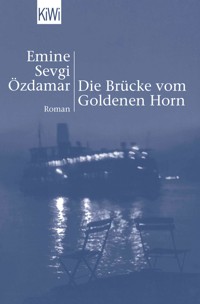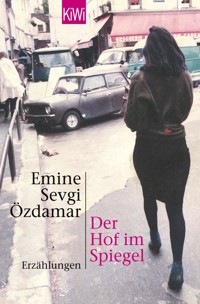14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emine Sevgi Özdamars Bestseller ist die wortgewaltige Begehung eines Raums zwischen Bedrohung und Geborgenheit – ein vielstimmiges Loblied auf ein Nachkriegseuropa, in dem es für kurze Zeit möglich schien, mit den Mitteln der Poesie Grenzen einzureißen. Er ist der sehnsuchtsvolle Nachruf auf die Freunde, Künstler, Bekanntschaften, die sie auf ihrem Weg begleiteten.
Nach dem Militärputsch 1971 flieht die Erzählerin aus Istanbul übers Meer nach Europa. Wie auch andere Künstlerinnen und Künstler, Linke und Intellektuelle fürchtet sie um ihre Existenz. Im Gepäck: das unbedingte Verlangen, den so jäh gekappten kulturellen Reichtum ihres Landes andernorts bekannt zu machen und lebendig zu halten. Im geteilten Berlin, auf den Boulevards von Paris, im Zwiegespräch mit bewunderten Dichtern und Denkern, findet sie schließlich eine »Pause der Hölle«, in der Kunst, Politik und Leben uneingeschränkt vereinbar scheinen.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1017
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Emine Sevgi Özdamar
EIN VON SCHATTENBEGRENZTER RAUM
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2021
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2021.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2021Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Ara Güler/Magnum Photos/Agentur Focus
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-518-76954-6
www.suhrkamp.de
EIN VON SCHATTENBEGRENZTER RAUM
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Die Orthodoxkirche spricht
Insel
Die Orthodoxkirche spricht
Da ist Europa
Wände, Mosquito und Krähen sprechen
In Draculas Grabmal
Raus aus Draculas Grabmal
Liebe Edith Piaf
Telefonzelle
Efterpi de la Glacière
Im Hotelzimmer
Metro Chemin Vert
In der Pause der Hölle
Die große Illusion
Monat August, schauen wir beide in den Himmel
Raum 18
Woyzeck
Die Toten im Schuhkarton
Die kommenden Kriege sind Religionskriege
Wie ein Schluchzen in den Ruinen
Un Manteau
Leben mit Spiegelmenschen
Lieber Wolfgang Hilbig
Wohnung mit zwölf Fenstern
Der junge Schwarze mit den zu großen gelben Schuhen
Mutterzunge
Mein Vater löste sich wie ein ausgetrocknetes Insekt auf
Epilog
QuellenBildnachweisZitatnachweis
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Prolog
Plötzlich war ich wach. Geräusche hinter der Wand, als würde ein Lastwagen immer wieder versuchen, durch die Wände durchzukommen. Tiere rannten oben im Dachboden, auch nebenan klopften Tiere mit ihren Füßen an die Wand. Jemand weinte, wahrscheinlich die blinde Frau, die jeden Morgen gegen vier Uhr vor ihrer offenen Haustür steht und dem Wind zuhört. In diesem Moment sieht sie aus, als ob sie sehen kann. Jede Nacht brennt die Lampe in ihrem Zimmer. Sie sitzt auf ihrem Bett, manchmal schläft sie im Sitzen, mit offenen Augen, und sieht, wenn sie so schläft, wieder aus, als ob sie sehen kann. Wenn sie träumt, sieht sie wieder, weil sie erst mit zwölf blind geworden ist. Die Bilder, die sie zwölf Jahre gesehen hat, sind nicht mit ihr blind geworden. Sie haben sich jetzt nur von den zu schwarzer Leere gewordenen Gassen und Zimmern in die Träume der blinden Frau zurückgezogen. Jetzt kamen wieder die Geräusche, als ob ein Lastwagen hinter der Wand stünde und sich immer wieder vorwärtsbewegte, um durch die Wand zu fahren. Nach jedem Geräusch rieselten Staub und verfaultes Reisig von der alten Zimmerdecke, wo die Deckenbalken mit der Zeit morsch geworden und auseinandergegangen waren.
Ich ging hinunter in die Küche.
Das Morgenlicht draußen, das mit einem Bein noch in der Nacht stand, hatte sich durch die Fenster über den Tisch und die Stühle schon hingesetzt und mit seinem traurigen Schatten die Küche aus dieser Welt getrennt, um diesen Ort wieder den Toten zu geben, die einmal hier gewohnt hatten.
Jetzt rieselten auch aus dem Kamin kleine Steine und Sand herunter und stießen mit dem Deckel des großen Blechtopfes zusammen und sprangen mit mechanischen Geräuschen in alle Richtungen in der Küche auseinander. Oben im Kamin gurrten ein paar Tauben und schlugen vielleicht mit den Flügeln gegen die engen Kaminmauern.
Das traurige Licht wuchs jetzt von den Stühlen über den Boden, über den aus dem Kamin herabgeregneten und in der Küche in alle Richtungen auseinandergegangenen Sand und über die kleinen Steine, um die Hände der Toten, die einmal diesen Kamin gemauert hatten, in dieser Halb-Nacht-halb-Tag-Stunde wiederzusehen, als jetzt die ganze Insel noch schlief und nur die blinde Frau wach vor ihrer offenen Tür stand und dem Wind zuhörte.
Ich lief Richtung Haustür, wo die Geräusche herkamen, als ob ein Lastwagen immer wieder versuchte, durch die Wand durchzukommen. Ich öffnete die Tür, die enge Gasse, durch die nicht einmal ein Auto fahren kann, stand leer, nur von der gegenüberliegenden niedrigen, kaputten Mauer fielen ein paar schwere Steine herunter. Ein Esel stand da mit einem langen Seil um seinen Hals, das an dem einzigen Baum in dem verwilderten Garten festgebunden war. Der Esel wollte sich von diesem Seil befreien, lief immer wieder vorwärts, so weit das Seil reichte, und haute mit seinem ganzen Körper und den Hufen gegen die niedrige Mauer. Hinter dem Esel stand die Ruine einer griechischen Kapelle und dahinter die griechisch-orthodoxe Kirche.
Als ich mit hochgerecktem Kopf zu der Orthodoxkirche hinschaute, drehte der Esel auch seinen Kopf nach hinten Richtung Kirche und blieb ruhig da so stehen. Hatte die Kirche, als ich noch schlief, dem Esel etwas erzählt, dass er dann so unruhig wurde, oder hatte die Kirche mit sich selbst gesprochen, und der Esel hatte sie gehört? Sprach die Orthodoxkirche schon immer mit sich selbst, oder sprach sie nur diese Nacht mit dem Esel, beide verlassen von ihren Menschen, beide festgebunden an einen Platz, von dem sie nicht weglaufen konnten. Alle Füße der Menschen, die diese Gassen runter zum Hafen laufen, dann wieder hoch zu ihren Häusern, waren schon vor Stunden verschwunden. Diese Füße lagen jetzt hinter den Haustüren als Schuhe und mussten auf den Morgen warten. Erst in einer Stunde werden die Schuhe von den Fischern, die aufs Meer fahren, wieder Richtung Tür gedreht, um sie anzuziehen, einige Fischerfrauen werden sich in ihren Nachthemden fremd fühlen, wenn sie von ihrem Bett aus auf ihren weggehenden Mann schauen. Fangen diese Männer an, durch die dunklen, steilen, engen Steinpflastergassen mit eiligen Schritten Richtung Hafen zu laufen, werden einige sogar, ohne ihren Lauf zu unterbrechen, beim Vorbeigehen an manches Fenster klopfen: »Memet, Memet, steh auf, es ist fünf Uhr – kayık kalkıyor –, das Boot fährt ab.« Das Wasser, mit dem sie ihre Gesichter schnell gewaschen haben, wird zuerst in ihren Gesichtsfurchen stehen bleiben und erst auf halbem Weg zum Hafen auf die Erde fallen.
Wenn diese Fischer in ihren kleinen Booten aufs Meer fahren, werden sie schweigen, weil es noch Nacht ist. Aber die Motoren ihrer Boote, die nicht für Boote gebaut wurden, sondern für Ackerbewässerungsanlagen, werden laut und lauter, bis der ganze Bootsboden zu zittern anfängt, und manchem Fischer wird durch das Zittern des Holzbodens die Nase jucken. Takatakatakatakatakatakatakatakatakataka. Diese Geräusche werden wie himmelgroße Messer die Nacht in Stücke zerreißen. Wenn die Nachtstücke anfangen, ins Meer zu fallen, werden Tausende von Krähen sich auf die Hausdächer oder Telegrafenmasten der Insel hinsetzen und im Chor krächzen, bis in der weit entfernten Moschee der Imam anfängt, das Morgengebet zu singen. An der Kuppel der Orthodoxkirche sind zwei Lautsprecher befestigt. Von der Kuppel der Kirche wird die Stimme des Imams durch die geschlossenen Fenster in die Häuser schleichen und in den Zimmern anfangen, herumzulaufen. Die Stimme wird die Handtücher, die im Dunkeln in sich ruhend hängen, anfassen, die Lichtschalter an- und ausdrehen, die Bettlaken unruhig machen und alle Hunde mit nur halb offenen Augen zum Bellen bringen. Dann wird nebenan der Hahn krähen, üüürürürü. Dann wird es wieder still sein, bis das von Schatten verfolgte Licht anfängt, zuerst die Bäume zu beleuchten. In dem Moment werden ein paar Pfirsiche aus dem Baum herunterfallen.
Aber es ist noch Zeit.
Jetzt sind der Esel, die Orthodoxkirche, die blinde Frau, die vor ihrer offenen Haustür steht, und ich allein.
Über uns die Nacht hat aus den dunkelsten Ecken ihrer Erinnerungen etwas herausgeholt und hat dieses Etwas zwischen der Orthodoxkirche, dem Esel, der blinden Frau und mir in der Luft leise verteilt.
Die Orthodoxkirche spricht
Insel
Auf dieser Insel waren alle Häuser miteinander verwandt. Auch die Menschen sahen sich ähnlich. Man konnte sogar denken, dass sie hinter ihren Haustüren an den Nägeln ähnliche Masken hängen hatten, die sie, bevor sie aus dem Haus gingen, aufsetzten, auch die Hände sahen so aus, als ob sie die gleichen Händemasken angezogen hätten. Einige waren Fischer, andere Olivenpflücker.
Diese türkische Insel liegt genau gegenüber der griechischen Insel Lesbos.
Die Inselmenschen hier hatten drei Winde, Imbat, Poyraz, Lodos. Auch den Yıldızwind, aber der kam hier nicht so oft vorbei. Imbat kam dagegen sehr oft, Imbat wehte genau von gegenüber, aus Richtung Lesbos, setzte zuerst die Häuser von Lesbos in Nebel und Dunst, kam dann auf dem Rücken der fliegenden Pferde über das Ägäische Meer, das diese beiden Inseln verband, galoppierend hierher, wehte alle Wäsche, die auf den Balkonen oder in den Gärten hing, nach hinten, boxte ununterbrochen in die Bäuche der Bettwäsche, der Hosen, Unterhosen, Kissenbezüge, Unterröcke, Nylonstrümpfe, flapflapflap. Alles wurde vom Imbat nach hinten gefegt, die Haare der Fischer, die Haare der Fischerfrauen, die Haare der Kinder, die Haare der Pferde und die Ohren der Esel. Die Papiere, die auf den steilen Steinpflastergassen lagen, flogen bei Imbat rückwärts vom Meer weg die Gassen hoch. Imbat klebte die Kleider der Frauen an ihre Körper, stellte die Brüste, Bäuche und Schenkel und Schenkelzentren der Frauen zur Schau. Früher, im Osmanischen Reich, gingen die Mütter in die türkischen Bäder, um ein gut gebautes Mädchen für ihre Söhne als Frau zu suchen. Brautschau im türkischen Bad. Das machte Imbat auch.
Wenn an manchen Tagen der Imbatwind aufhörte, zu wehen, und Poyrazwind an seine Stelle trat, machte er das Gegenteil. Poyraz wehte aus den Bergen und fegte alles nach vorne Richtung Meer. Die Haare der Fischer flogen von hinten nach vorne, und die Kleider der Fischerfrauen klebten sich an ihre Körper, sodass ihre Popos und Beine von hinten – wie von Bildhauern modelliert – auf den Gassen zu sehen waren. So verwandelten beide Winde, Imbat und Poyraz, wenn sie kamen, diese Insel sofort in einen Salon de Louvre, in dem man die Venusstatuen einmal von vorne, einmal von hinten betrachten konnte. Der Poyrazwind, der aus den türkischen Kazbergen in Richtung Lesbos wehte, setzte Lesbos nicht wie Imbat in Dunst und Nebel, sondern machte die Lesboshäuser von Weitem einzeln sichtbar.
Der dritte wichtige Wind, Lodos, weil er ein warmer Wind war, wenn er kam, haute als Erstes jedem auf der Insel eins ins Gesicht. An den Lodostagen liefen die Frauen, Männer, Kinder, Esel und Ziegen, bekümmert auf die Erde schauend wie die Trollfiguren aus Peer Gynt, auf den engen, steilen Gassen oder am Hafen, mit langsamen Schritten wie in einem Slow-Motion-Film, herum. Sogar die Fliegen flogen langsam und sprachen nicht wızvızwızvız, sondern wı wı wı. Und das Meer sah bei Lodos wie ein ohnmächtig auf die Erde gefallener Himmel aus. Durch die Hitze schienen die Fensterscheiben der Häuser, als ob sie sich schweratmend ausdehnen und zerplatzen würden. Einer der älteren Fischer hatte erzählt, dass, als Hitler Lesbos bombardierte, hier auf dieser türkischen Insel alle Fensterscheiben zerplatzt waren, und die vielen Glasscheiben auf den sonnigen Gassen hätten scharf wie Messer ins Auge gestochen, und die Griechen aus Lesbos flüchteten damals vor Hitler mit den Booten hierher.
Wie die Winde Imbat, Poyraz, Lodos, die behaupten, dass sie hier auf dieser Insel wohnen und nicht die Menschen, genauso denken auch die Tiere. Lassen wir jetzt die unzähligen Möwen, die auf den fünfundzwanzig unbewohnten Inseln um diese Insel herum leben und wann und wie es ihnen beliebt ihren Möwenbabys das Fliegen beibringen und, um ihre Jungen zum Fliegen zu animieren, als erwachsener Möwenchor mit lauten Möwenstimmen, der sich wie ein ständiges Lachen anhört, schreien und als Chor stundenlang die Möwenbabys vom Felsen in den Himmel hoch, vom Himmel hinunter ans Meer, dann wieder hoch in den Himmel treiben, lassen wir sie auf den niedrigen oder hohen Felsen alle Steine als ihre Möwentoilette benutzen und hinter den Fischerbooten als Schwanz eines Drachen in Gruppen hinterherfliegen und im Himmel warten, bis die Fischer kleine, zum Verkauf untaugliche Fische aus ihren Netzen wieder ins Meer schmeißen. Kaum schwimmen die kleinen, halb toten Fische im Meer, rufen die Möwen, bevor sie die Fische in ihren schnell auf- und zuschnappenden Schnäbeln aus dem Meer in den Himmel entführen, wieder als Chor laut, so laut wie nur Möwen schreien können, ohne den Himmel in Stücke zu zerschneiden, um alle Möwen von den fünfundzwanzig unbewohnten Inseln zum Essen einzuladen. Und die kommen tatsächlich. Aber lassen wir die Möwen, die auf ihren von Menschen noch unbewohnten fünfundzwanzig Inseln leben, essen, scheißen, den Kindern Fliegen beibringen. Hier, auf unseren von Menschen bewohnten Inseln, konnte man sagen: Neben den Winden Imbat, Poyraz und Lodos waren es die Katzen und Grillen, die alle Bäume und Gärten und die Dächer und die Gassen besetzt hielten. zızızızızızızızızızızızızızızızı-zızızızızızızızızızızızızı.
Wenn die Fischerfrauen, sich in ihren Kleidern fremd fühlend, die engen, steilen Gassen in Richtung Hafen hinunterliefen, tönte über ihren Köpfen das zızızızızızı von den Grillen und unten zwischen ihren Füßen das miau, miau, miau, miau. Wenn es die Frauen satthatten, diese Stimmen, die die Bäume und die Erde besetzt hielten, zu hören, drohten sie mit hochgereckten Hälsen den Grillen mit einem »sus yeter geber – genug, schweig, stirb«, und den Katzen drohten sie, mit gesenkten Köpfen, sie zu einer der fünfundzwanzig unbewohnten Inseln zu bringen, dorthin zu verbannen.
Ich bringe dich zur Nackten Insel.
Ich bringe dich zur Melinainsel.
Ich bringe dich zur Feigeninsel.
Die Feigeninsel, eine dieser fünfundzwanzig unbewohnten Inseln, hatte einmal vier Feigenbäume, an denen wirklich sehr gute Feigen wuchsen. Aber einer der Fischer hatte vor sechs Jahren die vier Feigenbäume zerhackt, um sie im Winter im Ofen zu verbrennen, und alle anderen Fischer schimpften seit sechs Jahren auf den Holzhacker, weil sie keinen Schatten mehr fanden, wenn sie in der Bucht der Feigeninsel die Netze auswarfen und eine Zigarette unter einem Baum rauchen wollten. Die Fischer liebten den Baum, sie waren immer auf dem wackelnden Boot, und oben, wenn sie ihre Köpfe hochhoben, sahen sie einen Himmel, der auch wie das Wasser beweglich war, mit irgendwohin ziehenden Wolken, die zuerst wie ein Tier aussahen, dann wie sich vom Tier in körperlose Watte auflösende Himmelsgassen. Und aus diesen Himmelsgassen plötzlich und gezielt direkt zu den Fischernetzen fliegende Möwen. An die Möwen wurden Schimpfwörter ausgeteilt, die Möwen nahmen aber nur die Fische mit zum Himmel, die Schimpfwörter der Fischer fielen ins Wasser. Die Fischer hatten immer Möwengeschichten, sie gaben den Möwen einen Frauennamen: Aziza. »Aziza geldi, Aziza geldi, Aziza gitti. Ich zog gerade das Netz raus, was sah ich, Aziza ist gekommen.«
Die Fischerfrauen hatten keine Azizageschichten zu erzählen, sie schimpften nicht auf die Azizas, sie sahen sie fast nie. Dafür hatten sie Ziegen oder Pferde und Katzen.
Die Frau Ayşe zum Beispiel. Die wohnte oben auf der Hügelspitze dieser Insel. Sie sagte, seit dreißig Jahren gehe ich nicht mehr zum Hafen hinunter. Da war Ayşe frisch verheiratet, sie kam aus einem Bergdorf. Ihr Mann wollte sie hinunter zum Hafen ausführen, dort tranken sie Tee in einem Teehaus, der Ehemann hatte ein Pferd oben zu Hause, er sagte zu Ayşe: »Warte hier, ich werde zu dem Restaurant gehen und altes Brot für das Pferd abholen.«
Ayşe wartete ein paar Stunden, dann lief sie alleine die steile Gasse hoch, wollte nach Hause, da aber die Häuser so ähnlich aussahen, fand sie zuerst ihr Haus nicht. Als sie es doch fand, sah sie ihren Mann das Pferd füttern und mit ihm sprechen. Sie schwor, nie wieder zum Hafen zu gehen. »Geh mit deinem Pferd zum Hafen Tee trinken«, sagte sie, und seit dreißig Jahren hält sie sich an ihren Schwur und schimpft auf das Pferd.
Eine der Nachbarinnen, die nie geheiratet hat, hatte eine Schwester, die, so wie sie, ein unverheiratetes Mädchen war. Sie stach Löcher in die Katzenohren und hängte ihnen aus Silberfäden Ohrringe daran. Das machte sie, wenn die Katzen anfingen, nach den Katern zu schreien. Und sie zog den Katzen Walnussschalen über die Pfoten, die sie beim Betreten des Hauses als Hausschuhe anziehen sollten.
Eine andere Fischerfrau hatte zu Hause eine Ziege, aber die Ziege ließ sie nicht an sich ran, weil, laut der Frau, die Ziege in ihren Mann verliebt war. Wenn er zur Ziege ging, leckte sie ihm die Hand. Wenn die Frau dabei war, trat die Ziege der Frau gegen die Beine und umarmte mit ihren Vorderbeinen den Fischer an den Schultern. Eine andere Fischerfrau haute mit einem Hirten und seiner Ziegenherde ab, ihr Ehemann klaute aus der Herde den Ziegenbock und versteckte ihn, der Hirte drehte durch: »Wo ist der Bock!« Es war Herbst, Paarungszeit. Der Ehemann sagte zum Hirten: »Gib mir meine Frau zurück, und ich geb dir deinen Ziegenbock«, nach drei Wochen tauschten sie Frau gegen Ziegenbock.
Alle haben hier irgendwelche Tiergeschichten. Ob sie wahr sind, weiß man nicht. Die Männer reden nicht über ihre Frauen, aber über Azizas, und die Frauen reden nicht über ihre Männer, aber über Ziegen und Pferde.
Die Stimmen der Nachbarn hört man bis 21 Uhr. Zwischen ihren Stimmen reden auch Katzen, Schafe, Vögel. Wenn zwei ältere Nachbarn miteinander reden, hört es sich an, als ob zwei Papageien sprächen. Halb griechisch, halb türkisch. Ela bre Hasan. Kala bre pedakimu. Um 21 Uhr ziehen die Menschen sich gut an, Ela Hasan, Ela Sevim, und gehen zum Hafen zu den Kaffeehäusern. Ab 21 Uhr hört man keine Menschenstimmen aus den Häusern. Nur nebenan klopfen die Tiere mit ihren Füßen an die Wand. Alle Füße, die zum Hafen hinuntergehen, müssen an der Orthodoxkirche vorbeilaufen.
Als ich zum ersten Mal vom Hafen zur Orthodoxkirche lief, es ist lange her, sah der Himmel noch nach dem starken Regen unentschlossen aus: Soll er den Mond hergeben oder ihn mit den Sternen zusammen vor den Augen der Welt verstecken? Der Weg zu der Kirche war dunkel, ein paar Straßenlampen hatten sehr schwache Lichter, einige brannten nicht. Der Wind schob die halb zugezogenen Vorhänge an den Fenstern der Häuser mal in die Zimmer hinein, dann holte er sie wieder heraus zur Straße und zeigte mir die Zimmer. In einem Zimmer stand eine kleine alte Frau, die sich nicht bewegte, sie hatte ein Tuch in der Hand. Im nächsten Haus saß ein Mann im Pyjama auf einem Sessel, dann setzte sich ein kleines Kind zu ihm. Im nächsten war der Raum beleuchtet, aber keiner war drin. Ich sah ein großes gerahmtes Foto an der Wand hängen, ein Mann und eine Frau. Ab und zu liefen Leute zu zweit den Steinpflasterweg hoch, oder ein Mann mit einer Frau lief den Weg hinunter Richtung Hafen. Alle ihre Körper, ihre Füße, ihre Haare kannten die Wege, die sie gingen. Es waren ihre Kindheitsgassen, hoch, runter, runter zum Hafen, dann wieder hoch nach Hause.
»Mama, ich bin da.«
»Sohn, geh Salz kaufen. Vergiss das Petroleum nicht.«
»Mama, ich hab das Geld verloren. Ich hatte es in der Hand, aber der Wind Poyraz hat es mir weggenommen.«
»Wenn dein Vater kommt, wird er dir den Wind zeigen.«
»Mama, ich will vor dir sterben.«
»Was sagst du, Tochter?«
»Ja, ich liebe dich sehr, ich kann ohne dich nicht leben, lass mich sterben, vor dir.«
»Und ich, Tochter?«
»Mama, ich habe im Garten eine weiße Schlange gesehen.«
»Hier haben Schlangen nichts zu suchen. Du hast etwas anderes gesehen.«
»Mama, ich schwöre, es war eine Schlange, wenn ich lüge, soll ich blind werden.«
All diese Sätze waren sicher in den Häusern, die ich auf dem Weg zur Orthodoxkirche sah, gefallen. Und als Kindheitssätze wohnten sie seit Jahren mit den jetzt groß gewordenen Menschen unter den Kissen oder den Betten oder hinter den Bilderrahmen, einige Sätze wohnten sicher auch in den Brunnen, die in den Gärten dieser Häuser im Dunkeln mit Würde ihre Einsamkeit aushielten und den Menschen erlaubten, mit einem heruntergelassenen Eimer aus ihnen Wasser zu holen, und sicher lagen in dem aus diesem Brunnen gezogenen Wasser auch jedes Mal die Sätze ihrer Kindheit.
»Mama, der Eimer ist in den Brunnen gefallen.«
»Du Malaka.«
»Mama, der Regen kommt unter der Tür durch ins Haus rein.«
»Mama, ich kriege meine Tage.«
Und in diesen Häusern lagen sicher nicht nur diese türkischen Sätze, sondern in der Tiefe des Brunnens oder in den unteren Schichten der Hausmauern oder in den Zimmerdecken oder unter den Holztreppen, weit unten, lagen auch griechische Sätze, Stimmen von damals, denn bis 1922 und seit Homer hatten hier auf dieser Insel die türkischen Griechen gelebt. Das Osmanische Reich war nach dem Ersten Weltkrieg zerfallen, die Deutschen und Osmanen verloren als Verbündete den Krieg gegen die Engländer, Italiener, Griechen und Franzosen, die das Osmanische Reich untereinander aufteilten. Atatürk und seine Leute kämpften weiter gegen die Besatzer, gewannen den Krieg, und die neue Republik hieß Türkische Republik. Wer war denn damals Türke? Der Türke war eine Zukunftsidee. Das Zugrundegehen des Osmanischen Reiches hatte Angst, Trauma, Unsicherheit hinterlassen. Alle Türken sollten sich unter einem Nationendach einfinden, damit sie keine Angst mehr hatten, und wer nicht Türke war, war ein Problem für die neue Nation. Und so mussten die türkischen Griechen die Türkei verlassen, und der Rest, die da als Türken standen, sollten sich unter diesem Nationendach sammeln und mussten immer wieder ihr Eine-Nation-Werden beschwören, um diese Nation zu nationalisieren.
1923 wurden die türkischen Griechen von hier nach Lesbos und Kreta transportiert und die griechischen Türken, die jahrhundertelang in Griechenland auf Lesbos und Kreta gelebt hatten, hierher auf diese Insel geholt. Das nannten sie Austausch der Völker. Aber die Toten in den Gräbern konnte man nicht austauschen, die Friedhöfe blieben, und die Sprachen konnte man auch nicht austauschen. Die griechischen Türken, die von Lesbos und Kreta hierhergeholt wurden, sprechen hier seit Generationen neben Türkisch auch Griechisch, und die türkischen Griechen, die von hier nach Griechenland gejagt wurden, sprechen auf Lesbos und Kreta seit Generationen untereinander weiter neben Griechisch auch Türkisch.
Und von beiden Küsten aus sehen die Menschen jeden Abend die Lichter der anderen Küste, an der ihre Großeltern gelebt haben, und wenn ein Grieche vor Lesbos ertrinkt, taucht seine Leiche hier an dieser türkischen Insel auf, und wenn ein Türke hier ertrinkt, taucht seine Leiche vor Lesbos auf. Die Winde und das Meer tauschen die Toten und bringen sie zu ihren Ursprungsorten. Die Orthodoxkirche, die auf dieser Insel bleiben musste, ist seit 1923 ein Waisenkind, keine Kerzen, keine Messe, keine Griechen, die die Tür auf- und zumachen. Was hat die Kirche damals gesehen, als die Menschen weggingen: einen Korbstuhl, vom Wind umgekippt, zurückgelassene Klammern auf den Wäscheleinen, Essensreste in den Kochtöpfen; einen Weggehenden, der einen Ast mit reifen Zitronen bis zum Schiff hinter sich herzieht; einen Menschen, der es bereut, nicht alle Ecken der Insel gesehen zu haben, die er verlassen muss; sich, bevor sie weggehen, bei ihren Toten entschuldigende Menschen auf den Friedhöfen; Haare aus den Fellen der geschlachteten Tiere, die mitgenommen werden, fliegen auf das Meer; Jasminduft in der Luft; Tausende von ungepflückten Tomaten auf den Feldern; in einem verlassenen Haus drei zerbrochene Brillen; auf den Gassen Kissen, Matratzen, Sessel, auf denen die zurückgelassenen Hunde und Katzen sitzen; eine Taube mit hängendem Kopf; Zigarettenrauch über dem Ägäischen Meer; an der Tür eines Hauses, in das nie zurückgekehrt wird, ein Vorhängeschloss; die Olivenbäume voller Staub bewegen sich im Wind, das Warten nicht gepflückter irritierter Oliven; aus einem offen gelassenen Wasserhahn fließt noch Wasser; auf einem Tisch ein volles Teeglas, im Wind zittert der Tisch, Tee rinnt in die Untertasse; die ungepflückten, zerplatzten oder von den Vögeln halb gefressenen Feigen an den Bäumen; aufgeplatzte Granatäpfel an den Bäumen; ein verlassener Lastwagen, voll mit gepflückter Baumwolle, Baumwollfetzen vom Wind an das Geländer der Ladefläche geweht und dort hängen geblieben; an eine Gartenmauer gelehnt eine Leiter; ein von einem Fuß verlorener, auf der Straße liegender linker Schuh; die Angelausrüstung des Popen, vergessen in der Kirche; an der Hauptstraße Telegrafenmasten, aus den Telegrafen unaufhörliches Ticken; in die Erde eingelassene Tonkrüge für das Olivenöl, ohne Deckel; nicht geerntete Weintrauben, von Mücken umschwirrt; Blut von den geschlachteten Tieren; zwei herrenlose Pferde schwimmen hinter den Schiffen her, auf denen ihre Besitzer fahren.
Sie gehen auf eine lange Reise
Schauen auf die zurück, die bleiben
Vom Oberdeck eines Schiffes
Sie werden nicht wiederkommen
Sie werden nicht zurückkehren
Sie stehen wie verwurzelt
Wie verwurzelt stehen sie nebeneinander
Schauen mit altbekanntem Blick
Auf jeden Einzelnen, der unten blieb
Du kannst sie nicht zurückhalten
Auch wenn du auf Knien gehst
Bleib, bleib hier
Bleibt jemals einer zurück
Das Schiff fährt ab
Die Reise fängt an
Einmal dorthin, zu dem sich nie irrenden Schiff
Und dann, irgendwann in dich, tief in dich hinein
Dein Herz öffnet sich blutend
Dort werden diese Toten eintreten
In einen Ort, den sie kennen
Ab jetzt bist du Lastenträger für
die Toten
Die Griechen, die die Kerzen angezündet haben, gehen auf das Schiff, die Kerzen in der Orthodoxkirche brennen noch; die Hunde irren auf dem Friedhof herum; flatternde Tischdecken in einem Kaffeehaus am Meer; abgeschnittene Köpfe im Brunnen, der einsame Hund sieht den Kopf seines Besitzers und heult. In welcher Mondphase und bei welchem Wind, Poyraz, Imbat, Lodos, Meltem, sind sie weggefahren? Wenn Schiffe am selben Tag die türkischen Griechen von hier nach Lesbos und, umgekehrt, die griechischen Türken von Lesbos hierher trugen, müssten die Haare der einen nach hinten und die der anderen nach vorne geflattert sein. Sprachbrunnen. Flüsternde Häuser ohne Menschen.
Die Orthodoxkirche spricht
Als ich vor der geschlossenen Tür der Orthodoxkirche stand, sprangen zwei Katzen aus einer der Fensterhöhlen, und im Haus nebenan bellte ein Hund. An die alte Tür der Orthodoxkirche war ein langes Seil geknotet, und das andere Ende vom Seil war an das Bein eines Schafes gebunden. Das Schaf lief, so weit das Seil reichte, nach vorne, dort fiel das Licht aus dem Nebenhaus auf sein Fell, da lief das Schaf wieder bis zu der Tür der Kirche und blieb im Dunkeln stehen. Jemand suchte im Haus nebenan im Radio einen Sender. Erst türkische Radiostimmen, dann ein griechisches Lied. Der Hund bellte wieder. Dann kam aus dem Haus eine Frau mit einer Taschenlampe.
»Wollen Sie die Kirche sehen?«
Bevor ich ja sagte, sagte sie: »Schau in den Himmel, schau, schau, wie der Mond rauskommt, morgen gibt es keinen Regen.«
Sie löste das Seil von der Tür, behielt es aber in der Hand, damit das Schaf nicht weglief. Das Lied aus dem Radio wurde im Haus lauter gedreht. Die Frau rief: »Mach leise, Tochter.« Das Radio wurde aber noch lauter. »Kennen Sie ihn, das ist Giorgos Katsaros. Ein sehr altes Rembetikolied: ›Mana mou eimai fthisikos‹. Das bedeutet, Mutter, ich bin schwindsüchtig«, sagte sie und übersetzte mir das Lied in dem dunklen Kircheneingang:
»Ich habe schwere Schwindsucht, behüte meinen anderen Bruder, Mutter, damit er sich nicht ansteckt, Mutter, schicke die Ärzte weg, dass sie mich nicht martern, weil sie nicht fähig sind, mich zu heilen, ich weine, meine Augen brennen, meine Seele altert leidend, mit Qualen verbringe ich mein Leben in der Fremde.
Ein sehr trauriges Lied, als Kind hat es mich schon zum Weinen gebracht. Übrigens, mich nennt man Zehra Teyze.«
Die Frau wurde plötzlich leise, flüsterte: »Diese schöne Kirche haben sie zu dem dunkelsten Ort der Welt gemacht. Seit Jahren versuchen wir, zuerst meine Großmutter, jetzt ich, die Kirche zu schützen. Ich schließe die Tür immer ab, aber diese Diebe kommen durch die Kirchenfenster. Sie sagen: ›Als die türkischen Griechen vor Jahren hier wegmussten, haben sie bestimmt ihr Gold in der Kirche versteckt.‹ Malakas. Glauben Sie mir, ich schäme mich vor den Griechen, die von Lesbos hierherkommen, um die Kirche ihrer Großeltern zu sehen.«
»Sie sprechen sicher sehr gut Griechisch.«
»Als Kind habe ich es gelernt. Mein Großvater kam damals im Völkeraustausch mit meiner Großmutter von Lesbos hierher, sie sprachen miteinander griechisch, so sprachen meine Eltern auch, alle hier auf der Insel können Griechisch. Als meine Großeltern hierherkamen, waren die türkischen Griechen schon weggeschickt worden, ihre Häuser standen leer. Man sagte den Angekommenen: ›Geht, sucht euch ein Haus.‹ Mein Großvater ging damals ins Haus neben der Kirche. Die vertriebenen türkischen Griechen wussten, wie man Häuser baut, alle Häuser der Insel sind ihre Arbeit. Kommen Sie.«
Wir gingen zu dritt, zuerst das Schaf, dann die Frau und ich, in die Kirche hinein. Als die Frau die Wände mit der Taschenlampe anleuchtete, flogen vier Fledermäuse aus den Fensterhöhlen. Dann sah ich einen Esel und eine Ziege auf dem umgegrabenen, kaputten, staubigen Kirchenboden stehen. Die Frau sprach mit beiden Tieren halb griechisch, halb türkisch, begrüßte sie, sagte: »Der Esel ist artig, aber die Ziege schlägt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt meinen Mann. Wenn sie könnte, würde sie bei meinem Mann im Bett schlafen, aber ich lasse sie hier.«
Dann lachte sie. Der Kirchenboden war so voller Staub, dass die Beine der Tiere aussahen, als hätten sie Staubstrümpfe angezogen. Die Frau leuchtete auf eine Wand, auf ein abgeblättertes, zerkratztes Fresko, auf dem man nichts erkennen konnte. Die Frau aber sagte: »Das ist die heilige Meryem, Maria, wie sie Isa, Jesus, in ihren Armen hält. Als ich Kind war, waren Meryems und Isas Bild noch da. Später wurde es zerkratzt. Und hier ist der heilige Yunus, Jonas, als er im Fischbauch war und ihn der Fisch aufs Land gespuckt hat.«
Ich sah nur weißblaue Wellen. Die Wellen waren nicht zerkratzt, aber vom Fisch war nur ein einziges Auge und der Schwanz in den Wellen zu sehen. Die Frau sagte wieder: »Als ich Kind war, konnte man den Fisch und den heiligen Yunus noch erkennen.«
Unter dem Jonasfresko lagen auf dem staubigen Boden ein paar Möwenfedern und eine kleine tote Schlange. Plötzlich kamen die Fledermäuse, vielleicht die, die vorhin hinausgeflogen waren, durch die Fensterhöhlen wieder herein und flogen im Taschenlampenlicht zwischen den Kirchenwänden mit schnellen, unruhigen Schatten hin und her. Ich gab der Frau Geld. Sie schaltete die Taschenlampe aus. Das Schaf rannte hinaus und zog die Frau hinter sich her. Die Frau gab mir die Taschenlampe, sagte: »Ich schließe die Tür später ab, zuerst muss ich das Schaf wegbringen. Wenn Sie wollen, bleiben Sie noch. Ich ziehe die Tür nur zu, sonst läuft die Ziege raus.«
Ich blieb in der dunklen Kirche zwischen den hin und her fliegenden Fledermäusen und dem ruhig dastehenden Esel und der Ziege und dachte im Dunkeln an den Film von Elia Kazan, America, America. In einer der Szenen, im Jahr 1915, sieht man türkische Armenier, die vor nationalistischen Türken in Anatolien in ihrer Kirche Zuflucht gesucht haben. Der letzte Ort, ein Ort, in den sie noch lebendig reingingen und als Tote blieben. Der Ort, wo sie früher immer Hilfe gesucht hatten wegen Liebeskummer oder der Krankheiten ihrer Kinder oder wegen ihrer kranken Mütter, wurde der Ort, wo sie ohne Hilfe starben, die Kirche wurde von draußen angezündet.
Ich knipste die Taschenlampe an. Ziellos lief ich in der Kirche zwischen den genauso ziellos fliegenden Fledermäusen hin und her. Irgendwann dachte ich: Ich höre Stimmen, die aus den Kirchenmauern oder der Kuppel kamen. Griechische Stimmen, deutsche Stimmen, armenische Stimmen, türkische Stimmen. Dann entfernten sich diese Stimmen, und ich sah plötzlich Kaiser Wilhelm und einen osmanischen Sultan und Enver Pascha, der die Armenier in den Tod geschickt hatte, an der Kirchenwand, an der Stelle, wo Maria und Jesus nicht mehr zu erkennen waren, als neues Fresko entstehen. Aber dieses Fresko bewegte sich. Was machte der Sultan? Er bückte sich, damit Kaiser Wilhelm den Rücken des Sultans als Tisch benutzen konnte, um ein Papier zu unterschreiben. Das Papier war eine Verbündetenerklärung für den Ersten Weltkrieg. Kaiser Wilhelm unterschrieb, der Sultan räusperte sich und richtete sich wieder auf, Kaiser Wilhelm faltete das Papier zusammen und steckte es in die Innentasche seiner Uniformjacke und schenkte Enver Pascha ein Gewehr namens »Mauser«. Der Sultan massierte seine schmerzende Hüfte, und Enver Pascha schoss mit der Mauser in die Kirchenkuppel. Durch den Schuss regnete aus der Kuppel Staub herunter und hörte nicht auf, bis der Sultan, Enver Pascha und Kaiser Wilhelm unter diesem Staub verschwunden waren. Es drängten sich plötzlich so viele türkische Griechen und türkische Armenier aus der Zeit des Ersten Weltkriegs an der Wand in das Fresko. Ein türkischer Grieche lief nach vorne mit zwei Armenierinnen, die anderen blieben hinter ihnen stehen. Der türkische Grieche hielt seinen Hut in der Hand und sprach aus dem Fresko, er sagte: »Nero – Wasser.« Dann sagte er: »Als ich und die Töchter von Meimari, mein Bruder und die anderen Christen nach Ulukışla kamen, sind wir in den Zug gestiegen bis nach Mersin, in Mersin haben uns die Türken außerhalb der Stadt in ein Lager gebracht. Es war dort nicht auszuhalten. Schmutz, Krankheiten, Tote. Dort traf ich meine Schwestern. Die erzählten mir, dass meine Mutter, meine Frau und meine zwei Kinder nicht mehr leben würden. In Mersin blieb ich zwanzig Tage. In der Nacht ging ich in eine Kirche und schlief dort. Dann kam ein griechisches Schiff, Arhipelagos, und brachte uns nach Griechenland. Ich lief tagelang in Piräus im Hafen herum, suchte nach einer Arbeit. Die fragten mich: ›Kannst du als Lastenträger arbeiten?‹ Ich schaffte es nicht, meine Beine zitterten.«
Neben dem Griechen standen die zwei armenischen Mädchen mit Schürzen über ihren Kleidern. Sie sagten:
Wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht sprechen.
Schon ewig lange dürfen wir nicht sprechen.
Das Letzte, was wir sahen.
Es schneite,
es war kein Tag, keine Sonne,
plötzlich die nackten Feigenbäume,
unter denen wir liefen, fingen an zu schreien:
O weh uns, ihr Verlorenen.
Ihr werdet nie wieder sehen eine
Herdflamme in eurem Haus.
Beraubt eurer Leben, schon eurer Schatten beraubt.
Nichts wird von euch, so melden wir euch,
zu eurem Herd wiederkehren.
Jungfrauen, flehend fallen wir vor euch auf die Knie.
Wir sehen mit diesen Augen, die blind sein wollen,
euren jammervollen Totenmarsch,
von dem ihr nie wieder zurückkehrt und
nie wieder
unter unsren Schatten ewige Treue
eurem Schönsten versprecht.
Ja, Feigenbäume sind wir
und strömen unser Gefühl in Tränen aus,
ein unsagbares Unrecht wird euch geschehen,
wo ihr sogar als Tote nicht mehr sprechen könnt.
Ihr werdet dulden, lange, zu lange,
euren Tod ohne Gräber, ohne die Totenmusik,
die sich auf euren toten Haaren kurz niedersetzt.
Oh, in welch Unglück stürzt ihr?
Ein Unrecht wird geschehen, so schnell,
nicht mal Tränen werden herabfallen
über eure hellen Wangen,
in den Flüssen, in waldigen Tälern,
über euch ein Mond, der selbst
seinen eigenen Tod treffen wollte,
anstatt euren Tod zu beleuchten.
Als die zwei armenischen Mädchen aus dem Wandbild sprachen, kam ein türkischer Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, der seinen Kopf unter dem Arm trug, dazu, stellte sich neben die zwei armenischen Mädchen und sagte: »Ich starb, kurz nachdem ich meine brennende Zigarette mit acht Männern geteilt hatte. Damals hatte keiner verstanden, warum ein deutscher Kaiser sich zum Beschützer des Osmanischen Reiches aufspielte. Goltz, Falkenhayn, Sanders, Enver Pascha, Talât Pascha, all diese Narzissten, gefährliche Kriegsmaschinen, spielten Hand in Hand mit dem Leben von Soldaten, die von ihren Müttern Henning oder Ahmed gerufen wurden. Am Ende ist dort ein toter Henning, da ein toter Esel, hier ein toter Ahmed. Gestorben sind wir auf den Schlachtfeldern. Das Leben ist kurz, der Tod ist lang im Höllenhimmel.«
Als der Soldat ohne Kopf zu Ende gesprochen hatte, sah ich unter den Menschen plötzlich meine tote Großmutter. Die zwei Armenierinnen aus dem Fresko liefen zu ihr und nahmen meine Großmutter in die Arme.
Meine Großmutter kam aus Kappadokien, wo damals viele türkische Armenier und türkische Griechen lebten. Als junge Frau hatte sie den Ersten Weltkrieg gesehen. In meiner Kindheit in Istanbul stand sie plötzlich von ihrem Stuhl oder Sessel auf, hob ihre Arme, streckte ihre Finger in die Luft und fing an zu schreien: »Aboo aboo, wie die armenischen Bräute sich von den Brücken hinuntergestürzt haben.«
Jetzt stand sie im Fresko neben zwei Armenierinnen, ihren Jugendfreundinnen, und schrie genau wie in meiner Kindheit von der Kirchenwand herunter: »Aboo aboo, wie die armenischen Bräute sich von den Brücken hinuntergestürzt haben, gesehen haben sie mit ihren jungen Augen, die blind sein wollten, die Hölle und das Feuer auf dieser Erde, die Schürze noch über ihren Kleidern, barfuß, die Augen groß, die Hände groß, die Füße groß vom Totenmarsch, ihre Kinder als Skelette vor ihren Füßen, das Feuer, in dem sie lange liefen, liefen und liefen, war siebenmal heißer als das Höllenfeuer. Aber wohin gingen sie, die Schürze noch über ihren Kleidern? Aber wohin sollten sie gehen? Zu welcher Hoffnung? Getrieben von den Bösen, die auf den Pferden saßen. Diese Bräute konnten lesen und schreiben. Sie lasen im Dorf unsere Briefe, schrieben auch für uns Briefe mit zartem Charakter an unsere Männer, die weit weg waren, noch weiter als die Orte in den Träumen, dort mit Gewehren, still in ihren Mantel gehüllt, mit den Kriegsläusen saßen. Sie saßen unter dem Sternenhimmel, den Sternen, die ihren kommenden Tod vor ihnen von oben aus sahen, aber nicht mit Sternenhänden diese jungen Männer, noch unschuldig, aufsammeln konnten vor dem Tod. Wir waren gute Nachbarn dieser armenischen Bräute. Als sie noch lebten, kamen armenische Zeitungen aus Istanbul ins Dorf. Als sie starben, kamen keine Zeitungen mehr. Wohin sind alle diese Menschen gegangen, wohin?«
Als meine Großmutter »Wohin sind all diese Menschen gegangen, wohin?« sagte, ging die Kirchentür, die die Frau vorhin hinter sich zugezogen hatte, mit einem starken Windstoß auf. Der Wind trug alte Zeitungen und Papierfetzen von draußen vor sich her in die Kirche. Die Papierstücke flogen hoch und aus dem Fenster hinaus, aber der Wind blieb in der Kirche und zischte zwischen den Wänden so laut, so laut, dass die Fledermäuse, die oben unter der Kirchenkuppel hin und her flogen, in der Luft stehen blieben, als ob der Wind sie bewegungslos gemacht hätte und sie ihm jetzt zuhören würden. Der Wind blies den Staub über den Kirchenboden, schob mich auch vor sich her und drückte mich an die Wand, wo meine Großmutter mit ihren zwei armenischen Freundinnen, dem türkischen Griechen und dem türkischen Soldaten ohne Kopf zusammenstand. Mein Kopf erreichte an der Wand, wohin ich durch den Wind gepresst wurde, gerade die Füße dieser fünf Menschen. Als ich all diese Füße anfasste und meine Hände zuletzt auf Großmutters Füßen und ihren Fersenknochen liegen blieben, fing ich an, laut zu weinen, sodass mein Heulen und die laute Stimme des Windes in der Orthodoxkirche sich ineinandermischten und sich so anhörten, als würden sie gerade von diesen Menschen auf dem Wandbild geboren werden.
Ich liebte meine Großmutter sehr. Sie konnte weder schreiben noch lesen. Wenn sie eine Zeitung sah, zeigte sie mir die Fotos der Menschen in der Zeitung und fragte mich jedes Mal: »Ist er tot oder lebt er noch?« Ich antwortete dann: »Ja, er ist tot, Großmutter«, »nein, er lebt, Großmutter.« Sie war dreimal verheiratet. Ihren ersten und ihren zweiten Mann hatte sie im Ersten Weltkrieg verloren. Wir Kinder scherzten mit ihr, fragten: »Großmutter, mit welchem Mann wirst du im Paradies zusammenleben, Großmutter?« Dann lachten wir.
Als ich mich jetzt in der Kirche an diese Sätze aus der Kindheit erinnerte, hörte ich auf zu weinen, weil sich in die laute Stimme des Windes jetzt Kinderlachen mischte, und meine Großmutter sprach von der Kirchenwand herab, auch lachend, als ob ich sie gerade gefragt hätte: »Mit welchem Mann wirst du im Paradies zusammenleben, Großmutter?«, und sie antwortete genau wie in meiner Kindheit:
»Welcher Mann, was weiß ich«, sagte sie, »der erste hatte so eine schöne Stimme. Er ging in den Krieg. Bismarck-Krieg nannten es die Großen – oder sagten sie Willem-Krieg? Täglich scharten sich die Witwen in den Gassen. Sie schrien: ›Das wenige Licht in unseren Augen wurde trüber, Fluch sei dem Manne, der uns verbrannte in Höllenglut. Fluch sei dem deutschen Kaiser und dem Enver Pascha, dem blutigsten, dessen Schlangenzähne alle armenischen und türkischen Mutterbrüste gebissen haben.‹ Die Gasse vor unseren Häusern, die Wände unserer Häuser, die Türen, die Fenster sahen so aus, als ob nimmermüde Würmer da lauschten, mit zitterndem, verzerrtem Munde sich an jetzigem, zukünftigem Witwenunglück berauschten, Krieg, klirrende Waffen in den Lagern, Krieg, eine Waffe namens Mauser.«
Als Großmutter »eine Waffe namens Mauser« sagte, hörte ich draußen vor der Kirche ein Auto anhalten. Der Fahrer stieg aus, ließ den Motor laufen und sprach mit jemandem. Die Scheinwerfer streiften über die Fensterhöhlen der Kirche und beleuchteten an der Kirchenwand genau das Fresko, wo der Sultan mit Kaiser Wilhelm und Enver Pascha staubbedeckt dicht beieinanderstand. Der Wind, der vorhin die Kirchentür aufgedrückt und in der Kirche laut geheult hatte, war weg. Jetzt war es in der Kirche still, nur der Motor von dem Auto war zu hören. Der türkische Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, der seinen Kopf unter seinem Arm trug, lief zu den drei Staubbedeckten und sagte: »Krieg, ein großes Festmahl für Würmer, Krieg, ein den Würmern treuer Würmervater, Würmer zeigten sich ohne Scham auf den Schlachtfeldern. He, Tote, wir wagen uns an euch heran und plündern euch. Armer Kriegstoter, sein letzter, sein treuester Freund, ein Wurm. Schlachtfeld, eine herrschaftlich gedeckte Würmertafel.«
Das Auto fuhr jetzt weiter, seine Lichter zogen sich von den Kirchenwänden zurück. Es war jetzt dunkel in der Kirche, die Stimmen im Dunkeln sagten: »Wir verloren alle unsere Kinder, wir, von Mücken umschwirrt, gesehen haben wir mit diesen Augen, die blind sein wollten, unsere Engel unter die Erde kriechen. Eselschrei. Der weinte um unser schwarzes Schicksal.«
Die Stimme meiner Großmutter sagte:
»Als die Großen meinen ersten Mann in diesen Bismarck-Krieg, oder hieß es Willem-Krieg, holten, schaute mein erster Mann am Ende der Gasse sich noch mal um, sah stumm sein entferntes Haus, hörte die tiefe Unruhe, die in meiner Brust atmete. Eines Tages, es regnete in Strömen, die Dächer flogen, die Tiere ertranken in den Bächen, an diesem öden Abend kam er zurück, zitternd spürte ich, er war nicht mehr der, den ich gekannt hatte. Ein verdunkelter Schatten bewachte seinen zu Trümmern geschlagenen Jünglingskörper. Er hatte eine offene Wunde, die Würmer gingen dort hin und her. Er nahm sich die Nacht als Freundin, schlief mit ihr. Als er starb, konnte man ihn nicht aus den Händen der Nacht nehmen. Er ist mit der Nacht begraben. Jedes Stück Nacht, das mit Toten geht, nimmt uns von unserem Schlaf etwas weg. Mich gaben sie dann seinem Bruder als Frau. Ein Dorfgelehrter. Er setzte sich mit seiner schwarzen Tafel und der weißen Kreide täglich auf seinen Esel, der ihn sehr liebte, ging in die anderen Dörfer, lehrte die Menschen lesen und schreiben. Er sagte, unter den Menschen, die er trifft, versteht keiner, warum sich ein deutscher Kaiser zum Beschützer des Osmanischen Reiches erklärt hat. Er sagte mir: ›Zu früh bist du geboren, gutes Herz, es kommen noch schwere Zeiten.‹ Dann fasste er meinen Bauch und sagte: ›Unser Kind wird in eine brennende Welt kommen.‹ Eines Morgens holten ihn zwei Gendarmen, aus ihren Mündern nach Müdigkeit stinkend, gaben ihm ein Gewehr namens Mauser. Er wollte nicht gehen, sie zogen ihn an seinen Haaren auf den steinigen Weg. Zu dieser Stund' wurde sein Esel verrückt, zitterte gewaltig hinter langen Wimpern, blickte verstohlen, wartete Jahr um Jahr auf seinen Besitzer, doch der kam nicht. Nicht mal sein Schatten blieb ihm übrig. Ich blieb mit deinem Vater allein.«
Als sie »ich blieb mit deinem Vater allein« sagte, zeigte sie in meine Richtung. Ich leuchtete mit der Taschenlampe auf das Wandbild. Alle schauten jetzt auf mich. Der Grieche, die zwei armenischen Freundinnen meiner Großmutter, der türkische Soldat ohne Kopf. Sie alle zeigten mir mit ihren gestreckten Armen die Richtung, wo Kaiser Wilhelm, der Sultan und Enver Pascha staubbedeckt standen. Der Sultan, Kaiser Wilhelm und Enver Pascha hoben ihre Köpfe aus dem Staub etwas heraus, wie drei Statisten ohne Dialoge oder Monologe, die unterm Staub bleiben mussten. Alle anderen gingen nebeneinander Arm in Arm in Richtung der drei Staubbedeckten. Sie sagten im Chor: »Diebe. Diebe. Es ging für euch nur um Diebstahl. Wo sind unsere Kinder, unsere Mütter, unsere Männer, und wo sind unsere Gräber, wo sind unsere Häuser und Felder, unser Silber und unsere Ikonen, wo ist unser Leben, wo ist unser freier Atem unter dem Himmel. Beraubt unserer Leben, sogar unserer Schatten beraubt. Ein unsagbares Unrecht ist uns allen geschehen.«
Die letzten Sätze der Menschen im Fresko waren: »Es ging nur um Diebstahl. Diebe.«
Plötzlich fing der Esel, der in der Kirche bis jetzt sehr ruhig gestanden hatte, mit seinem ganzen Körper an zu schreien, wie nur die Esel schreien können. Die Menschen im Fresko, die Arm in Arm standen und auf Kaiser Wilhelm und Enver Pascha spuckten, drehten sich zu dem Eselgeschrei, sprachen wieder im Chor: »Kala bre pedakimo, sakin ol kocakulak – ruhig, mein Großohr.« Der Esel wurde ruhig, und die Ziege lief in Richtung der drei Staubbedeckten, Wilhelm, Enver und der Sultan, drehte ihren Hintern Richtung Kirchenwand, schiss auf ihre Gesichter.
Die Frau, die mir die Orthodoxkirche aufgemacht hatte, rief von draußen: »Sind Sie noch drin? Sind zwei Katzen in die Kirche gekommen?« »Nein!« Ich knipste die Taschenlampe aus und wieder an. An den Wänden der Kirche waren jetzt nur die zerkratzten Bilder von Maria, Jesus und Jonas zu sehen. Ich machte die Lampe wieder aus und ging aus der Kirche, die jetzt ganz still war. Aus dem Radio nebenan kam wieder ein altes griechisches Lied, die Frau stand draußen allein im Dunkeln, ohne das Schaf, aus dem Haus nebenan rief die Mädchenstimme:
»Mama, wo ist mein Schulatlas?«
Die Frau rief: »Er ist da, wo du ihn hingetan hast, Malaka.«
Die Frau fragte mich: »Sind Sie aus Istanbul?«
»Ja.«
»Wann sind Sie gekommen?«
»Gestern.«
»Da hat es geschneit«, sagte die Frau.
»Ja, es hat geschneit.«
»Bis jetzt kamen nur Griechen aus Lesbos, um die Kirche zu besuchen. Ich schäme mich für die Kirche, keiner kümmert sich. Die türkischen Beamten in der Stadt auf der Insel gegenüber, zu der unsere Insel gehört, lieben uns nicht. Ich kann Ihnen den Grund sagen. Als meine Großeltern und die anderen Türken aus Lesbos und Kreta hierherkamen, gab es hier nur türkische Soldaten. Sie verteilten den Neuangekommenen etwas Essen und Trinken und zeigten ihnen von Griechen verlassene Häuser, in die sie reingehen sollten. Da hat sich ein Soldat in eines der Mädchen verliebt, eine aus Kreta, immer nach ihr gepfiffen, gegenüber dem Haus, wo sie wohnte, gestanden, und eines Abends sei er durch das Fenster in ihr Zimmer reingegangen, sagte man. Der Vater dieses Mädchens und ein paar andere aus Kreta haben den Soldaten getötet. Lange her, fünfzig Jahre. Seitdem sind die Offiziere in der Stadt gegen unsere Insel. Sie reparieren unsere Straßen nie. Das Abwasser rinnt durch die Gassen hinunter. Sie nennen uns die Griechensaat. Das Mädchen ist inzwischen Greisin, sie lebt noch, da oben rechts am Hügel.«
Der Hund der Frau war inzwischen aus dem Haus herausgekommen, lief auf dem Vorplatz zwischen der Kirchentür und den Beinen der Frau hin und her.
Als ich die steile Steinpflastergasse zurück zum Hafen lief, schob der Wind wieder die halb aufgezogenen Vorhänge an den gleichen Fenstern, die ich, als ich zur Kirche gegangen war, gesehen hatte, in die Zimmer hinein, dann holte er sie wieder heraus zur Straße und zeigte mir dieselben Zimmer. Ich sah wieder den beleuchteten Raum, in dem jetzt auch niemand war, und sah wieder nur das große gerahmte Foto an der Wand, einen Mann und eine Frau. Im nächsten Haus saß der Mann im Pyjama weiter auf dem Sessel, und das kleine Kind kam gerade wieder ins Zimmer. Und im nächsten Haus stand wieder die kleine alte Frau, die sich nicht bewegte, mit dem Tuch in der Hand.
Damals, als ich aus Istanbul hierherkam, hatte ich mich gefragt: Warum bin ich hier? Oder vielleicht hatte ich mich nicht gefragt, ich weiß es nicht mehr, es ist so lange her. Damals, Anfang der Siebzigerjahre, hatte das türkische Militär geputscht und war in alle Träume der jungen oder nicht jungen Menschen mit seinen großen, schweren Flügeln aus Eisen geflogen, um sie in Stücke zu brechen. Unsere Generation und die zwei Generationen nach uns waren als Verlierer auf die Welt gekommen. Déjà perdu. Bevor sie auf die Welt gekommen sind, hatten sie das Leben, das sie leben sollten, von Anfang an verloren. Jetzt hatten uns die, die mit Eisenflügeln und in gut geschnittenen Uniformen herumliefen, gezeigt, was Macht heißt. Wir waren die Chöre der Ohnmächtigen, der Machtlosen. Die Uniformierten standen jeden Morgen am Himmel mit ihren Eisenflügeln, flogen über die fahrenden Busse, Schiffe, Menschen, über die die Straßen kehrenden Straßenfeger, über die in die Schule gehenden Kinder, über alle Dächer der Häuser, über die Störche, die gerade mit ihren Jungen neben den Schornsteinen saßen, und die mit den eisernen Flügeln oben im Himmel dirigierten alle Tiere und Menschen unten zu einem Satz: »Euch zeigen wir, wie der Tod lang wird im Höllenhimmel, ihr Aleviten, ihr heimlichen Marxisten, ihr Kurden, ihr Professoren, ihr Gewerkschafter, ihr Journalisten.«
Damals stürzte ein türkisches Passagierflugzeug in der Nähe von Paris in einen Wald. Eine der Flugzeugtüren ging auf, und die Menschen fielen aus Tausenden Metern Höhe durch die offene Tür zur Erde. In einer Istanbuler Zeitung gab es eine Zeichnung, wie die Menschen vom Himmel fielen, und ein Foto vom Wald, wo das Flugzeug abgestürzt war: ein Menschenfuß ohne Strümpfe, ohne Schuh stand auf der Erde, senkrecht, als ob er gerade einen Schritt nach vorne machen wollte, ohne sein Bein, den Körper und den Kopf. Ich schaute mir damals diese Zeitungsbilder an, sagte: »Das ist das, was hier in der Türkei mit den Menschen passiert.« So liefen die Menschen damals auf den Istanbuler Straßen, ohne Kopf, ohne Körper, wie von dem Himmel auf die Erde gefallen, herum. Die da oben fliegen in den Hubschraubern, die da unten rennen, beim Rennen verlieren sie ihre Schuhe, noch bevor sie ihr Leben, nicht weit entfernt von ihren Schuhen, verlieren. Ein Schuss fällt, alle werfen sich auf den Boden, liegen wie mit Nadeln aneinandergesteckte Kleider auf der Erde: Und diese Kleider bewegen sich vorsichtig, falten sich mal so, mal so auf der Erde, aber manche stehen nicht mehr auf. Die Angst damals in den Gesichtern der Menschen in den Istanbuler Straßen erinnerte mich an die Gesichter der Irren in einem Irrenhaus, die vor dem Wächter Angst hatten.
Ich spielte damals in Istanbul in dem Peter-Weiss-Stück Marat/Sade die weibliche Hauptrolle Charlotte Corday. In dem Stück ist sie eine Irre. Wegen meiner Rolle ging ich zu einer Istanbuler Irrenanstalt, um die Verhaltensweisen der Irren und ihre Körperhaltungen zu studieren. Der Wächter schloss die Tür auf zu einem großen Gemeinschaftssaal, wo sich die kranken Frauen aufhielten. Ich sah zuerst nur Licht, es wuchs von draußen herein, durch mehrere hohe, vergitterte Fenster an den drei Wänden, wie Tausende durchsichtige Pfeile fiel es von oben herunter Richtung Mitte des Saals. Dort trafen sich die Lichter und standen da wie ein glänzender, übergroßer Buchstabe »V«, der vom Boden bis zur Decke reichte. Alle Frauen hatten sich genau in dieser Mitte gesammelt, dort standen sie, als ob sie unter diesem Licht von draußen sich gerade waschen wollten oder das Licht in die Hand nehmen, mit ihm reden, ihm ein paar Fragen stellen, das Licht in die Unterwäsche stecken, das Licht nicht mehr loslassen, bis es draußen dunkel wird. Das Licht wird hier, nur hier und nur mit ihnen wohnen. Draußen ist die Welt blind. Aber als die Frauen den Wächter bemerkten, fingen sie an zu schreien. Sie schrien so, als ob ein Flugzeug, an dem eine sehr große Rasierklinge montiert war, gezielt auf sie losfliegen würde. Sie schrien, ihre Gesichtsfalten schrien, ihre Haare schrien unter diesem in die Mitte zum V gerammten Licht. Ihre Gesichter bewegten sich im Licht wie in einem welligen Spiegel, der die Gesichter mal in die Länge zieht, mal in die Breite vergrößert, deformiert, ihnen kurz wieder ihre ursprünglichen Gesichter zurückgibt, sie ihnen dann wieder wegnimmt. Ein Auge rechts oben, das andere rechts unten, mal die Nase auf der Stirn, mal ist das ganze Gesicht ein Mund, so bewegten sich die Frauen in diesem Irrenlicht, in diesem Wellenspiegel und umfassten ihren eigenen Körper, die Arme über der Brust gekreuzt – die linke Hand will die rechte Rückenseite fassen, die rechte Hand die linke Rückenseite. So als ob ihre Hände den eigenen Körper zu einem Paket schnüren wollten, zweimal knoten, dreimal knoten, die Knoten so knoten, dass keine Wächterhände diese Knoten lösen konnten. So verschnürt liefen sie vom Licht weg in die dunklen Ecken des Raums. Dort in diesen Ecken sah die Dunkelheit so aus, als ob sie sich wieder in einen dunklen Raum öffnen würde, zu dem aber nur diese Frauen einen Schlüssel hätten und nicht der Wächter.
»Wir müssen gehen«, sagte ich leise zu dem Wächter. Der Wächter stand neben mir, sagte: »Die Welt soll sich von Neuem erziehen lassen. Es wird früher dunkel, als man denkt.«
Die Tür wurde zweimal, dreimal abgeschlossen. Wir liefen durch den Korridor, der seine Zunge gerade geschluckt hatte und nicht mehr sprechen konnte, raus in den Irrengarten. Der Wächter gab mir die Hand, drehte meine in seiner, schaute meine Handfläche und dann den Handrücken an und ließ sie dann los. Ich bedankte mich.
Der Gehweg vom Irrengarten war aus kleinen Steinen gemacht, die sich jetzt unter meinen Schuhen bewegten.
»Ich muss mich hinsetzen«, sagte ich. Aber wer sollte sich hinsetzen? Wie die heißt, die sich hinsetzen wollte, wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, warum sie sich hinsetzen sollte. Sie setzte sich auf eine Bank, die vor einer Gartenmauer stand. Da saß ein Mann, ein Irrer. Ein anderer Irrer stand vor ihm, kratzte mit einem scharfen Stein den Umriss des sitzenden Mannes in den Putz der Mauer dahinter. Der Umzeichnete bewegte sich nicht. Ich bewegte mich auch nicht, nur mein rechter Fuß versuchte, die kleinen Steine auf dem Boden, die sich von ihren Plätzen gelöst hatten, leise wieder zu ordnen. Es war alles still im Garten der Irren, sogar die Steine. Während ich versuchte, meine Arbeit mit dem Fuß ordentlich zu machen, liefen zwei Füße in weißen Arztschuhen vorbei. Ich hatte inzwischen kapiert, dass ich es gewesen war, die vorhin gesagt hatte, ich will mich hinsetzen, aber ich wusste nicht mehr, wie ich hieß. Komischerweise wusste ich aber, dass ich Schauspielerin bin und die Rolle der Charlotte Corday spielen würde. Aber wie heiße ich, wie?
So etwas war mir auch als Kind geschehen. Ich war elf Jahre alt, wir waren in eine neue Stadt umgezogen, nach Ankara, die Möbelträger trugen die Sachen in die neue Wohnung. Auf der Straße sah ich drei Mädchen in meinem Alter, wir fingen sofort an, Seksek zu spielen. Ich hüpfte über die mit Kreide auf die Erde gezeichneten Quadrate, irgendwann schaute ich hoch und sah plötzlich, am Ende der Straße auf einem Hügel, das Atatürk Mausoleum, sehr gerade stehende, höher und höher ragende Säulen, die in Richtung Himmel wuchsen. So ein Gebäude hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. In dem Moment passierte mir etwas Komisches. Ich spielte weiter auf der Straße, die Bewegungen der Mädchen und die vorbeifahrenden Autos wurden langsamer, wenn ein Auto oder ein Militärjeep an uns vorbeifuhr, sah ich nur seine sich langsam drehenden Räder und wollte mich unter diese Räder legen. Zu Hause konnte ich nicht auf dem Stuhl sitzen, ich musste mich auf den Boden legen, ich erkannte meine Mutter, aber nicht mich, ich fragte meine Mutter: »Mutter, wer bin ich?«
»Du bist meine Tochter.«
»Mutter, wie heiße ich?«
Sie sagte mir, wie ich heiße. Ich fragte wieder: »Wie heiße ich, wer bin ich? Wie alt bin ich?«
Meine Mutter und mein Bruder saßen um mich herum, beantworteten mir immer die drei gleichen, sich wiederholenden Fragen: »Wer bin ich, wie heiße ich? Wie alt bin ich?«
Weil ich aber mit ihren Antworten den Weg zu mir nicht fand, kamen auch mein Großvater, mein Vater, meine Großmutter, mein jüngerer Bruder Orhan und meine Schwester Schwarze Rose dazu. Meine Mutter und mein Bruder erzählten den anderen, was ich sie bis jetzt gefragt hatte. Die anderen fingen auch an, mir meine drei Fragen zu beantworten. Eine nackte Glühbirne hing über mir und über ihnen, die ungeöffneten Umzugspakete lagen auf dem Boden, die Jüngeren gingen und brachten den Älteren ein Glas Wasser, weil ihre Münder vom vielen Antworten trocken geworden waren. Irgendwann fragte ich nicht mehr, denn diese Fragen verloren ihre fragenden Stimmen und klangen in meinen Ohren wie die Antworten der anderen, die für mich keine Antworten waren, weil sie mir nicht die Augen über mein Leben öffneten. Alle setzten sich zu Tisch und aßen irgendetwas, ein Stuhl am Tisch war leer, und alle schauten, während sie sehr langsam aßen, zu diesem leeren Stuhl, nicht mehr zu mir. Mein Vater sprach zu dem Stuhl:
»Wenn du wieder gesund bist, bringe ich dir Pokern bei.«
Ich hielt mich an dem Wort »Poker« fest, als wäre es ein über mir hängendes dickes Seil, und ich zog mich an diesem Seil hoch und setzte mich auf eine ungeöffnete Umzugskiste und schlief dort ein.
Am nächsten Tag wusste ich wieder, wer ich war, meine Mutter fragte mich: »Meine Tochter, was ist mit dir passiert?«
»Ich weiß es nicht.«
Jetzt, im Garten der Irren, fragte ich wie damals:
»Wie heiße ich, wie ist mein Name?«
Der Irre, der gezeichnet wurde, stand auf, schaute nicht zur Mauer, wo seine Umrisse eingeritzt waren. Er hielt seine rechte Hand hoch wie ein Tablett, auf dem er etwas balancierte. Ich fragte den Irren: »Was halten Sie in Ihrer Hand?«
Er sagte: »Eine Wolke. Wenn die Bombe herunterkommt, kann ich sie mit der Wolke abhalten.«
Armer Irrer. Guter Irrer. Dich sollte man zum amerikanischen Präsidenten machen. Man wird dich im Fernsehen fragen: »Herr Präsident, was denken Sie, wie viele Eimer brauchten wir, um das ganze Öl aus den arabischen Ländern nach Hause zu schleppen, Herr Präsident?« Hinter dir fahren Lastwagen voller Eimer vorbei, du sagst: »Ich halte die Wolke hoch, damit, wenn die Bombe runterkommt, ich sie mit der Wolke aufhalten kann.«
Ach, dieser Irre im Garten, dieser Irrengarten.
Da ist Europa
Wer hatte mir von dieser Insel erzählt, damals in Istanbul? Ich weiß, ein Fotograf, Teoman Madra, der mich in einer Marat/Sade-Vorstellung sehr gemocht, fotografiert und das Foto auf bearbeitetes Olivenholz geklebt und mir geschenkt hatte. Er sagte, das Olivenholz stamme von einem der Olivenbäume auf dieser Insel, wohin Teomans Familie aus Kreta emigriert war. Teoman sagte: »Man sagt, Apollo ist auf dieser Insel geboren. Es ist eine Zauberinsel, die Menschen sind Türken, aber auch Griechen. Die Frauen dort ziehen sich schwarz an wie die Griechinnen, das machen türkische Bäuerinnen nicht. Von Weitem wirst du Lesbos sehen. Da ist Europa. Frag dort nach Ali Kaptan.«
Damals hatte ich zwei Freundinnen, Mari und Diana. Mari war Istanbuler Armenierin, Diana halb jüdische, halb griechische Istanbulerin, beide wollten nach dem Militärputsch die Türkei schnell verlassen.
Mari warf, bevor sie abfuhr, eine ihrer Lieblingsschallplatten von Bob Dylan ins Marmarameer, damit das Meer an sie denkt. Die Geschichte wiederholte sich. Auch im Jahre 1955 hatten viele Istanbuler Griechen und Juden und Armenier, als in einer Septembernacht nationalistische Türken ihre Läden, orthodoxen Kirchen und Friedhöfe zerstörten, sie töteten und vergewaltigten, aus Angst Istanbul verlassen. Bevor sie Istanbul verließen, warf eine Familie, die auf einer Istanbuler Insel wohnte, alle ihre alten Stimme-seines-Herrn-Schallplatten ins Meer, und die alten, schönen griechischen Lieder auf den Schallplatten schwammen tagelang auf dem Marmarameer. Jeder Tote kann noch singen.
Mari, Diana und ich waren, bevor sie gingen, immer zusammen. Wir waren alle Künstlerinnen, liebten unsere Eltern und Freunde und die Männer, die der türkischen oder armenischen Bohème angehörten, liefen in den Nächten hin und her zwischen Istanbuler Greek-Tavernas und Nachtclubs, zwischen steilen Gassen von Istanbul und Istanbuler Betten, der Geruch der Lindenbäume machte uns in den heißen Nächten schwindlig, und wenn wir spätnachts zum Elternhaus zurückkamen, fielen die Kastanien aus den Bäumen auf unsere Köpfe. Patapatapat.
Keiner sprach über Griechisch-, Armenisch- oder Türkischsein. Wir sprachen von Pasolini, Fellini, Antonioni, Gramsci, Godard, Sartre, Camus, Buñuel, Nâzım Hikmet, über die Surrealisten oder über die komischen Sätze unserer Großmütter. »Sie kommen, sie kommen, uns abzuholen.«