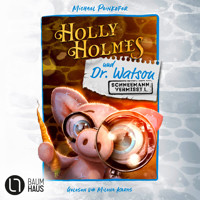8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als ein Mitarbeiter des Schriftstellers Sir Walter Scott unter mysteriösen Umständen stirbt, stellt dieser Nachforschungen an und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Was verheimlicht der königliche Inspector, der eigens aus London geschickt wurde? Was für ein Geheimnis hüten die Mönche von Kelso? Und was hat es mit der ominösen Schwertrune auf sich, auf die Sir Walter und sein Neffe Quentin bei ihren Ermittlungen stoßen?
Ein Schicksal, dessen Ursprung Jahrhunderte zurückreicht, nimmt seinen Lauf ...
Ein spannender historischer Roman vor dem Hintergrund des großen Duells zwischen Schottland und England.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 836
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Als ein Mitarbeiter des Schriftstellers Sir Walter Scott unter mysteriösen Umständen stirbt, stellt dieser Nachforschungen an und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Was verheimlicht der königliche Inspector, der eigens aus London geschickt wurde? Was für ein Geheimnis hüten die Mönche von Kelso? Und was hat es mit der ominösen Schwertrune auf sich, auf die Sir Walter und sein Neffe Quentin bei ihren Ermittlungen stoßen? Ein Schicksal, dessen Ursprung Jahrhunderte zurückreicht, nimmt seinen Lauf ...
Über Michael Peinkofer
Michael Peinkofer studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen«. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Peinkofer
Die Bruderschaft der Runen
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Erstes Buch: Im Zeichen der Rune
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweites Buch: Am Kreis der Steine
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Drittes Buch: Das Runenschwert
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Epilog
Danksagung
Impressum
Meiner Frau Christine gewidmetfür ihre Geduld, Liebe und Inspiration
Prolog
Bannockburn
Im Jahr des Herrn 1314
Die Schlacht war geschlagen.
Der Himmel war düster und matt wie stumpfes Eisen, das jeden Glanz verloren hat. Die wenigen Fetzen von Blau, die den Tag über zu sehen gewesen waren, hatten sich hinter dichten Wolkenschleiern verborgen, die nun die Senke von Bannockburn mit tristem Grau überzogen.
Die Erde schien die Düsternis des Himmels widerzuspiegeln. Schmutziges Braun und erdiges Gelb überzogen die karg bewachsenen Hügel, die das Marschland säumten. Das weite Feld ähnelte einem Acker, der vom Pflug eines Bauern aufgerissen worden war, damit er die Saat aufnähme; doch es war die Saat des Todes, die auf den Feldern von Bannockburn ausgebracht worden war.
Im Morgengrauen waren sie einander begegnet: die Heere der Engländer, die unter ihrem unnachgiebigen Herrscher Edward II. einmal mehr versucht hatten, die aufsässigen Schotten in die Knie zu zwingen, und das Heer der schottischen Clansfürsten und Adeligen, die sich unter ihrem König Robert the Bruce zusammengeschart hatten, um einen letzten, verzweifelten Kampf um die Freiheit zu führen.
Im rauen Sumpfland von Bannockburn waren sie aufeinander getroffen zu jener Schlacht, die endgültig über das Schicksal Schottlands entscheiden sollte. Am Ende hatten Roberts Mannen den Sieg davongetragen, doch er war teuer erkauft worden.
Unmengen lebloser Leiber übersäten das weite Feld, lagen in morastigen Löchern, schauten mit blicklosen Augen und in stillem Vorwurf hinauf zum Himmel, in den sich die zerfetzten Banner der Standarten reckten. Der kalte Wind des Todes strich durch die Senke, und als hätte die Natur Mitleid mit dem Elend der Menschen, stieg sanfter Nebel auf, der sich fahl wie ein Leichentuch über die grausige Szenerie breitete.
Nur hier und dort regte sich noch etwas; Verwundete und Verstümmelte, in denen kaum noch Leben war, versuchten mit heiseren Rufen auf sich aufmerksam zu machen.
Die Räder des Ochsenkarrens, der sich durch den zähen Morast des Schlachtfelds wälzte, quietschten leise. Eine Schar von Mönchen war unterwegs, um inmitten der blutigen Körper nach Verwundeten Ausschau zu halten. Von Zeit zu Zeit hielten sie an, konnten jedoch meist nichts anderes mehr tun, als den Sterbenden mit einem Gebet den letzten Beistand zu leisten.
Die Mönche waren nicht die Einzigen, die zu jener düsteren Stunde über das Schlachtfeld von Bannockburn wanderten. Aus dem dichten Nebel, dort, wo die Dunkelheit bereits nach den Senken griff, kamen zerlumpte Gestalten aus dem Unterholz gekrochen, die keinen Respekt vor dem Tod hatten und die die Armut dazu zwang, sich zu nehmen, was die Gefallenen auf Erden zurückgelassen hatten – Leichenfledderer und Diebe, die jeder Schlacht folgten wie die Aasfresser einer Viehherde.
Lautlos huschten sie aus den kargen Büschen, bewegten sich krabbelnd wie Insekten über den Boden, um über die Toten herzufallen und sie ihrer Habe zu berauben. Hier und dort wurde gestritten, wenn es darum ging, ein gut erhaltenes Schwert oder einen Bogen in seinen Besitz zu bringen, und nicht selten wurden schartige Klingen gezückt, um eine Entscheidung herbeizuführen.
Zwei der Diebe stritten sich um den seidenen Umhang, den ein englischer Edelmann in der Schlacht getragen hatte. Der Ritter würde ihn nicht mehr brauchen, die Axt eines schottischen Clansmannes hatte ihm den Schädel gespalten. Während die Diebe sich um den wertvollen Besitz zankten, tauchte unmittelbar vor ihnen plötzlich eine dunkle Gestalt aus dem Nebel auf.
Es war eine alte Frau.
Sie war klein an Wuchs und ging noch dazu gebückt, doch mit ihrem schwarzen Mantel aus grober Wolle und dem langen, schlohweißen Haar bot sie einen Furcht einflößenden Anblick. Zusammengekniffene Augen starrten aus tief liegenden Höhlen, und eine schmale Habichtsnase schien die von Falten zerfurchten Züge der Alten in zwei Hälften zu teilen.
»Kala«, zischten die Diebe entsetzt, und im nächsten Augenblick war der Kampf um den Umhang entschieden. Treulos ließen die Fledderer das gute Stück zurück und flüchteten sich in den Nebel, der jetzt immer dichter aus der Senke stieg.
Die alte Frau blickte ihnen missbilligend hinterher. Sie empfand keine Zuneigung für jene, die die Ruhe der Toten störten, auch wenn es der Kampf ums nackte Überleben war, der die meisten dazu trieb. Mit ihren wachen, wasserblauen Augen hielt die Alte Umschau und erspähte durch den Nebelvorhang die schemenhaften Umrisse der Mönche, die sich um die Verwundeten kümmerten.
Kalas Kehle entrang sich ein mürrischer Laut.
Mönche. Die Vertreter der neuen Ordnung.
Sie wurden immer zahlreicher in diesen Tagen, überall sprossen Klöster wie Pilze aus dem Boden. Längst hatte der neue Glaube den alten abgelöst, hatte sich als stärker und mächtiger erwiesen. Manches Althergebrachte wurde von den Vertretern der neuen Ordnung fortgeführt. Anderes, was über Generationen hinweg bewahrt worden war, drohte in Vergessenheit zu geraten.
So wie an diesem Tag.
Keiner der Mönche wusste, was sich wirklich auf dem Schlachtfeld von Bannockburn zugetragen hatte. Sie sahen nur das Offensichtliche. Das, woran sich die Geschichte erinnern würde.
Langsam schritt die alte Frau über das von Leichen übersäte Feld, dessen Boden von Blut getränkt war. Verstümmelte Leiber und abgetrennte Gliedmaßen säumten ihren Weg, herrenlose Schwerter und Teile von Rüstungen, die mit Blut und Dreck besudelt waren. Krähen, die sich an den Gefallenen gütlich taten, flatterten kreischend auf, als sie sich ihnen näherte.
Kala sah es mit Gleichmut.
Sie hatte zu lange gelebt und zu viel gesehen, um noch ehrliches Entsetzen zu empfinden. Sie war Zeuge gewesen, wie ihre Heimat von den Engländern unterworfen und grausam unterjocht worden war, hatte den Untergang ihrer Welt erlebt. Blut und Krieg waren die ständigen Begleiter in ihrem Leben gewesen, und tief in ihrem Innern empfand sie einen stillen Triumph darüber, dass die Engländer so vernichtend geschlagen worden waren. Auch wenn der Preis dafür hoch gewesen war. Höher, als einer der Mönche oder irgendjemand sonst unter den Sterblichen es ahnte.
Die alte Frau erreichte das Zentrum des Schlachtfelds. Dort, wo der erbitterteste Kampf getobt und König Robert zusammen mit den Clans des Westens und ihrem Anführer Angus Og die Hauptlast des Angriffs getragen hatte, häuften sich die Körper der Erschlagenen noch dichter als anderswo. Mit Pfeilen gespickte Leichen übersäten den Boden, und hier und dort wälzten sich noch Verwundete, die das zweifelhafte Glück gehabt hatten, einem gnadenvollen Tod zu entgehen – bisher.
Die alte Kala schenkte ihnen keine Aufmerksamkeit. Sie war nur aus einem einzigen Grund gekommen: um sich mit eigenen Augen zu vergewissern, ob sich bewahrheitet hatte, was die Runen ihr erzählt hatten.
Mit einer energischen Geste strich sie das schlohweiße Haar beiseite, das der kühle Wind ihr immer wieder ins Gesicht wehte. Ihre Augen, die den Jahren zum Trotz nichts von ihrer Schärfe eingebüßt hatten, blickten dorthin, wo Robert the Bruce gestanden hatte.
Dort lagen keine Erschlagenen.
Wie das Auge eines Sturms, in dem sich kein Lufthauch regte, war jener Boden, auf dem der König selbst gefochten hatte, unberührt geblieben. Kein Leichnam lag innerhalb des Kreises, den der König verteidigt hatte, gerade so, als hätte Bruce während der Schlacht hinter einer unsichtbaren Mauer gestanden.
Die alte Kala kannte den Grund dafür. Sie wusste von dem Pakt, der geschlossen worden war, und von der Hoffnung, die sich daran knüpfte. Eine trügerische Hoffnung, die noch einmal die Geister der alten Zeit heraufbeschwor.
In der hereinbrechenden Dunkelheit erreichte die alte Frau die freie Fläche und betrat den Kreis, den keines Feindes Fuß berührt hatte. Dort sah sie es.
Die Runen hatten nicht gelogen.
Das Schwert des Bruce, jene Klinge, mit welcher der König die Schlacht gegen die Engländer gefochten und sie geschlagen hatte, war auf dem Feld zurückgeblieben.
Herrenlos steckte es in der Mitte des Kreises im weichen Morast, der sich bereits anschickte, es zu verschlingen. Matt ließ das letzte Licht des Tages das Zeichen schimmern, das in die flache Schneide des Schwertes gearbeitet war, ein Zeichen aus alter, heidnischer Zeit und von großer zerstörerischer Kraft.
»Er hat es getan«, murmelte Kala leise und empfand Erleichterung dabei. Die Last, die sie in den letzten Monaten und Jahren mit sich herumgetragen hatte, fiel von ihr ab.
Für kurze Zeit mochte es den Anhängern der alten Ordnung gelungen sein, den König auf ihre Seite zu ziehen. Sie waren es, die Robert den Sieg auf dem Schlachtfeld von Bannockburn ermöglicht hatten. Aber am Ende hatte er sich von ihnen abgewandt.
»Er hat das Schwert zurückgelassen«, sagte das Runenweib leise. »Damit ist es entschieden. Das Opfer war nicht umsonst.«
Mochten der König und die seinen am Ende dieses Tages feiern und die Früchte ihres Sieges genießen – er würde nicht von langer Dauer sein. Der Triumph auf den Feldern von Bannockburn trug den Keim der Niederlage schon in sich. Bald würde das Land erneut zerfallen und in Chaos und Krieg versinken. Dennoch war an diesem Tag ein bedeutender Sieg errungen worden.
Ehrfurchtsvoll näherte sich Kala dem Schwert. Auch jetzt, da es keinen Besitzer mehr hatte, schien noch große Kraft von ihm auszugehen. Kraft, die zum Guten wie zum Bösen genutzt werden konnte.
Lange hatte diese Klinge das Schicksal des schottischen Volkes bestimmt. Nun aber, da sie von den Mächtigen verraten worden war, hatte sie allen Glanz verloren. Es war Zeit, das Schwert dorthin zurückzubringen, von woher es stammte, und sich des Fluchs zu entledigen, den es in sich barg.
Der Kampf um das Schicksal Schottlands war entschieden, genau wie die Runen es vorausgesagt hatten. Die Geschichte würde sich nicht an das erinnern, was heute in Wahrheit geschehen war, und die wenigen, die es wussten, würden schon bald nicht mehr sein.
Doch die Runen hatten Kala nicht alles gesagt.
Erstes Buch Im Zeichen der Rune
1.
Archiv von Dryburgh Abbey, Kelso
Mai 1822
In der alten Halle herrschte völlige Stille.
Es war die Ehrfurcht gebietende Stille überdauerter Jahrhunderte, die über der Bibliothek von Dryburgh Abbey lag und jeden gefangen nahm, der sie betrat.
Die Abtei selbst existierte nicht mehr; schon im Jahre 1544 hatten die Engländer unter Somerset das ehrwürdige Gemäuer geschleift. Dennoch war es mutigen Mönchen des Prämonstratenser-Ordens gelungen, den größten Teil der Klosterbibliothek zu retten und an einen unbekannten Ort zu bringen. Vor rund hundert Jahren waren die Bücher wieder entdeckt worden, und der erste Herzog von Roxburghe, der als Förderer von Kunst und Kultur bekannt gewesen war, hatte dafür gesorgt, dass die Bibliothek von Dryburgh am Ortsrand von Kelso eine neue Bleibe fand: in einem alten, aus Backsteinen errichteten Kornhaus, unter dessen hohem Dach die unzähligen Folianten, Bände und Schriftrollen seither lagerten.
Das gesammelte Wissen vergangener Jahrhunderte wurde hier aufbewahrt: Abschriften und Übersetzungen antiker Aufzeichnungen, die die dunklen Zeitalter überdauert hatten, Chroniken und Annalen des Mittelalters, in denen die Taten der Monarchen festgehalten worden waren. Auf Pergament und brüchigem Papier, an dem der Zahn der Zeit genagt hatte, war die Geschichte hier noch lebendig. Wer sich an diesem Ort in sie vertiefte, den umwehte der Odem der Vergangenheit.
Eben dies war der Grund, warum Jonathan Milton die Bibliothek so sehr mochte. Schon als Junge hatte die Vergangenheit einen eigentümlichen Reiz auf ihn ausgeübt, und er hatte sich weit mehr für die Geschichten interessiert, die ihm sein Großvater vom alten Schottland und über die Clans der Highlands erzählt hatte, als für die Kriege und Despoten seiner eigenen Tage. Jonathan war überzeugt davon, dass die Menschen aus der Geschichte lernen konnten – allerdings nur dann, wenn sie sich der Vergangenheit bewusst wurden. Und ein Ort wie die Bibliothek von Dryburgh, die davon durchdrungen war, lud wahrhaftig dazu ein.
Hier arbeiten zu dürfen war für den jungen Mann, der an der Universität von Edinburgh historische Studien betrieb, wie ein Geschenk. Sein Herz pochte, als er den großen Folianten aus dem Regal hievte. Staub wölkte auf und brachte ihn zum Husten. Dennoch presste er das Buch, das an die dreißig Pfund wiegen mochte, an sich wie einen wertvollen Besitz. Dann nahm er den Kerzenleuchter und stieg über die schmale Wendeltreppe nach unten, wo die Lesetische standen.
Vorsichtig bettete er den Folianten auf den massiven Eichenholztisch und nahm Platz, um ihn zu sichten. Jonathan war geradezu begierig zu erfahren, welchen Schatz er aus den Gründen vergangener Zeiten gehoben hatte.
Wie man hörte, waren noch längst nicht alle Schriften der Bibliothek geprüft und katalogisiert worden. Die wenigen Mönche, die vom Kloster abgestellt waren, um den Bestand der Bibliothek zu pflegen, waren mit dieser Aufgabe überlastet, sodass noch immer verborgene Perlen in den verstaubten und von dichten Spinnweben überzogenen Regalen schlummern mochten. Allein der Gedanke, eine davon zu entdecken, ließ Jonathans Herz höher schlagen.
Dabei war er eigentlich nicht hier, um die Geschichtswissenschaften um neue Erkenntnisse zu bereichern. Seine tatsächliche Aufgabe bestand darin, einfache Recherchen durchzuführen, eine ziemlich langweilige Tätigkeit, die allerdings gut bezahlt wurde. Zudem hatte Jonathan dabei die Ehre, für Sir Walter Scott zu arbeiten, jenen Mann, der für viele junge Schotten ein leuchtendes Vorbild war.
Nicht nur, dass Sir Walter, der auf dem nahen Landsitz Abbotsford residierte, ein erfolgreicher Romancier war, dessen Werke sowohl in den Stuben der Handwerker als auch in den Herrenhäusern der Adeligen gelesen wurden. Er war auch durch und durch ein Schotte. Seiner Fürsprache und seinem Einfluss bei der Britischen Krone war es zu verdanken, dass viele schottische Sitten und Gebräuche, die über die Jahrhunderte hinweg verpönt gewesen waren, allmählich wieder geduldet wurden. Mehr noch, in manchen Kreisen der britischen Gesellschaft war das Schottentum geradezu in Mode. Dort galt es neuerdings als schicklich, sich mit Kilt und Tartan zu schmücken.
Um das Verlagshaus, das Sir Walter zusammen mit seinem Freund James Ballantyne in Edinburgh gegründet hatte, mit neuem Stoff zu versorgen, arbeitete der Schriftsteller buchstäblich Tag und Nacht und meist an mehreren Romanen gleichzeitig. Zu seiner Unterstützung holte er Studenten aus Edinburgh auf seinen Landsitz, damit sie ihm halfen, geschichtliche Hintergründe zu recherchieren. Die Bibliothek von Dryburgh, die in Kelso lag und damit nur rund zwölf Meilen von Scotts Wohnsitz entfernt, bot ideale Voraussetzungen dazu.
Über einen Freund seines Vaters, mit dem Sir Walter in jungen Jahren die Universität von Edinburgh besucht hatte, war Jonathan an die Volontärsstelle gekommen. Dass seine Arbeit dabei eher stumpfsinniger Natur war und mehr aus trockener Recherche denn aus der Suche nach verschollenen Chroniken und alten Palimpsesten bestand, konnte der hagere junge Mann, dessen Haar zu einem kurzen Zopf geflochten war, recht gut verschmerzen. Immerhin hatte er dafür die Gelegenheit, seine Zeit an diesem Ort zu verbringen, wo Vergangenheit und Gegenwart sich berührten. Manchmal saß er bis spät in die Nacht hier und vergaß über alten Briefen und Urkunden völlig die Zeit.
So auch an diesem Abend.
Den ganzen Tag über hatte Jonathan recherchiert und Material zusammengetragen: Einträge aus Annalen, Herrscherberichten, Klosterchroniken und anderen Aufzeichnungen, die Sir Walter beim Verfassen seines neuesten Romans von Nutzen sein mochten.
Gewissenhaft hatte Jonathan alle bedeutsamen Daten und Fakten herausgeschrieben und in dem Notizbuch festgehalten, das Sir Walter ihm gegeben hatte. Nach getaner Arbeit aber hatte er sich wieder seinen eigenen Studien zugewandt und damit jenem Teil der Bibliothek, dem sein eigentliches Interesse galt: den in altes Leder geschlagenen Sammelbänden, die im oberen Stockwerk lagerten und zum guten Teil noch nicht einmal gesichtet worden waren.
Wie Jonathan festgestellt hatte, waren darunter Pergamente aus dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert: Urkunden, Briefe und Fragmente aus einer Epoche, deren Erforschung sich bislang vor allem auf englische Quellen stützte. Wenn es ihm gelänge, eine bislang unbekannte schottische Quelle aufzuspüren, würde das einer wissenschaftlichen Sensation gleichkommen, und sein Name würde in Edinburgh in aller Munde sein …
Der Ehrgeiz hatte den jungen Studenten gepackt, sodass er jede freie Minute nutzte, um auf eigene Faust in den Beständen der Bibliothek zu recherchieren. Er war sicher, dass weder Sir Walter noch Abt Andrew, der Verwalter des Archivs, etwas dagegen hatten, solange er seine eigentliche Aufgabe pünktlich und gewissenhaft erledigte.
Im Schein der Kerze, der den Tisch in warmes, flackerndes Licht tauchte, studierte er nun eine jahrhundertealte Fragmentsammlung – Bruchstücke von Annalen, die Mönche des Klosters Melrose verfasst hatten, aber auch Urkunden und Briefe, Steuerberichte und dergleichen mehr. Das Latein, in dem die Schriftstücke gehalten waren, war nicht mehr die Hochsprache eines Caesars oder Ciceros, die heutzutage an den Schulen unterrichtet wurde. Die meisten Verfasser hatten sich einer Sprache bedient, die nur noch ansatzweise an die der Klassiker erinnerte. Der Vorteil war, dass Jonathan keine Mühe hatte, sie zu übersetzen.
Das Pergament der Schriftstücke war hart und brüchig, die Tinte an vielen Stellen kaum mehr zu lesen. Die bewegte Vergangenheit der Bibliothek und die lange Zeit, in der die Bücher in verborgenen Höhlen und feuchten Kellern gelagert worden waren, hatten sich nicht gerade vorteilhaft auf ihren Zustand ausgewirkt. Die Folianten und Schriftrollen waren im Verfall begriffen; ihren Inhalt zu sichten und für die Nachwelt festzuhalten musste das Ziel eines jeden interessierten Geschichtskundlers sein.
Aufmerksam besah Jonathan die einzelnen Seiten. Er erfuhr von Schenkungen des Adels an seine Vasallen, von Abgaben, die von den Bauern entrichtet worden waren, und er fand eine komplette Auflistung der Äbte von Melrose. Das alles war interessant, doch keineswegs sensationell.
Plötzlich entdeckte Jonathan etwas, das seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Denn als er erneut umblätterte, änderten sich Aussehen und Form der Einträge. Was er nun vor sich hatte, war kein Brief und keine Urkunde. Tatsächlich fiel es ihm schwer, den ursprünglichen Zweck des Schriftstücks zu bestimmen, denn es erweckte den Anschein, als wäre es aus einem größeren Ganzen herausgerissen worden, möglicherweise aus einer Chronik oder aus alten Klosteraufzeichnungen.
Kalligrafie und Duktus der mit Pinsel aufgetragenen Schriftzeichen unterschieden sich grundlegend von jenen der vorangegangenen Seiten. Auch fühlte sich das Pergament grobporiger und dünner an, was nahe legte, dass es wesentlich älteren Datums war.
Woher mochte dieses Schriftstück stammen?
Und weshalb hatte man es aus seinem ursprünglichen Band herausgerissen?
Wäre einer der Mönche, die die Bibliothek verwalteten, in der Nähe gewesen, hätte Jonathan ihn danach gefragt. Zu dieser späten Stunde aber hatten sich Abt Andrew und seine Mitbrüder bereits zum Gebet und zur Klausur zurückgezogen. Die Mönche hatten sich daran gewöhnt, dass Jonathan sich tagelang in den Hinterlassenschaften der Vergangenheit vergrub. Da Sir Walter ihr volles Vertrauen genoss, hatten sie seinem Studenten einen Schlüssel überlassen, der es ihm zu jeder Zeit gestattete, die Bibliothek aufzusuchen.
Jonathan spürte, wie seine Nackenhaare sich sträubten. Es würde also an ihm liegen, das Rätsel zu lösen, das sich so unverhofft aufgetan hatte.
Im flackernden Schein der Kerze begann er zu lesen.
Es fiel ihm weitaus schwerer als bei den anderen Schriftstücken – zum einen, weil die Seite in einem viel schlechteren Zustand war, zum anderen aber, weil sich der Verfasser eines sehr seltsamen, mit fremden Begriffen durchsetzten Lateins bedient hatte.
Nach allem, was Jonathan herausfinden konnte, gehörte das Blatt nicht zu einer Chronik. Der Form nach – es war immer wieder von »hohen Herren« die Rede – mochte es sich um einen Brief handeln, aber der Sprachstil war dafür sehr ungewöhnlich.
»Vielleicht ein Bericht«, murmelte Jonathan nachdenklich vor sich hin. »Ein Bericht von einem Vasallen an einen Lord oder König …«
Mit detektivischer Neugier las er weiter. Sein Ehrgeiz hatte ihn gepackt und drängte ihn dazu herauszufinden, an wen dieses Schriftstück einst gerichtet gewesen war und worum es im Einzelnen darin ging. Bei der Erforschung der Vergangenheit waren nicht nur solide historische Kenntnisse, sondern auch ein gutes Maß an Neugier gefragt. Jonathan besaß beides.
Die Schrift zu entziffern war ein entmutigendes Unterfangen. Obwohl er inzwischen einige Erfahrungen darin gesammelt hatte, die von Abkürzungen und Änigmen durchsetzten Aufzeichnungen zu lesen und zu deuten, kam er nur ein paar Zeilen weit. Auf den verschlungenen Pfaden, die der Verfasser dieser Schrift beschritten hatte, ließ das Schullatein Jonathan schmählich im Stich.
Immerhin tauchten einige Wörter auf, die seine Aufmerksamkeit erregten. Vom »papa sancto« war immer wieder die Rede – war der Heilige Vater in Rom damit gemeint? An mehreren Stellen tauchten die Wörter »gladius« und »rex« auf, die lateinischen Bezeichnungen für »Schwert« und »König«.
Und immer wieder stieß Jonathan auf Begriffe, die er nicht übersetzen konnte, weil sie eindeutig nicht der lateinischen Sprache entstammten, auch nicht ihrer abgewandelten Form. Er nahm an, dass es sich dabei um Fügungen aus dem Gälischen oder Piktischen handelte, das im frühen Mittelalter noch weit verbreitet gewesen war.
Wie Sir Walter erzählt hatte, pflegten manche der alten Schotten noch immer diese archaischen, lange Zeit verbotenen Sprachen. Was, wenn er die Schriftseite abschrieb und sie einem von ihnen zeigte?
Jonathan schüttelte den Kopf.
Mit dieser einen Seite würde er nicht weit kommen. Er musste den Rest des Berichts zu finden, der irgendwo in den staubigen Eingeweiden der alten Bibliothek verborgen war.
Nachdenklich nahm er den Kerzenleuchter zur Hand. Im flackernden Lichtschein, den die Flammen in das Dunkel sengten, schaute er sich um. Dabei merkte er, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte. Das Gefühl, einem wirklichen Geheimnis auf der Spur zu sein, erfüllte ihn mit Euphorie. Die Wörter, die er entschlüsselt hatte, gingen ihm nicht aus dem Kopf. Handelte es sich tatsächlich um einen Bericht? Möglicherweise um die Botschaft eines päpstlichen Legaten? Was mochten ein König und ein Schwert damit zu tun haben? Und von welchem König war wohl die Rede?
Sein Blick glitt hinauf zur Balustrade, hinter der sich schemenhaft die Regale des oberen Stockwerks abzeichneten. Von dort stammte der Sammelband, in dem er das Fragment entdeckt hatte. Möglicherweise würde er da auch den Rest finden.
Jonathan war sich im Klaren darüber, dass die Aussichten eher gering waren, aber er wollte es wenigstens versuchen. Die Zeit verlor er dabei völlig aus dem Blick – dass es schon weit nach Mitternacht war, hatte er nicht einmal bemerkt. Hastig stieg er die Stufen der Wendeltreppe empor – als ihn ein Geräusch zusammenfahren ließ.
Es war ein heftiges, dumpfes Pochen.
Die massive Eichentür der Bibliothek war geöffnet und wieder zugeschlagen worden.
Jonathan gab einen erschrockenen Schrei von sich. Er hielt die Kerze von sich, um den Raum unterhalb der Balustrade zu erleuchten, denn er wollte sehen, wer der nächtliche Besucher war. Doch der Schein der Kerze reichte nicht weit genug und verlor sich in der staubdurchsetzten Schwärze.
»Wer da?«, fragte Jonathan deshalb laut.
Er bekam keine Antwort.
Dafür hörte er jetzt Schritte. Leise, gemessene Schritte, die sich über das kalte Backsteinpflaster des Bodens näherten.
»Wer ist da?«, fragte der Student noch einmal. »Abt Andrew, sind Sie das?«
Wieder erhielt er keine Antwort, und Jonathan merkte, wie sich eine unbestimmte Furcht in seine angeborene Neugier mischte. Er löschte die Kerze, verengte die Augen zu Schlitzen, und in dem spärlichen Licht der Bibliothek, das nur noch vom Mondlicht herrührte, welches in dünnen Fäden durch die schmutzigen Fenster fiel, bemühte er sich etwas zu erkennen.
Die Schritte kamen unterdessen unbarmherzig näher – und tatsächlich erspähte der Student im Halbdunkel nun eine schemenhafte Gestalt.
»Wer … wer sind Sie?«, fragte er erschrocken. Eine Antwort erhielt er jedoch nicht.
Die Gestalt, die einen weiten, wallenden Umhang mit einer Kapuze trug, blickte nicht einmal in seine Richtung. Ungerührt ging sie weiter, vorbei an den schweren Eichenholztischen und auf die Treppe zu, die auf die Balustrade führte.
Unwillkürlich wich Jonathan zurück, spürte plötzlich kalten Schweiß auf der Stirn.
Das Holz der Stufen knarrte, als die schattenhafte Gestalt ihren Fuß darauf setzte. Langsam kam sie die Treppe herauf, und mit jedem Schritt wich Jonathan noch weiter zurück.
»Bitte«, sagte er leise. »Wer sind Sie? Sagen Sie mir doch, wer Sie sind …«
Die Gestalt erreichte das obere Ende der Treppe, und als sie einen der blassen Strahlen des Mondlichts kreuzte, konnte Jonathan ihr Gesicht sehen.
Sie hatte keines.
Entsetzt starrte Jonathan auf die unbewegten Züge einer Maske, aus deren Sehschlitzen ein kaltes Augenpaar blitzte.
Jonathan zuckte zusammen. Wer ein solch unheimliches Gewand trug und sein Gesicht dazu noch hinter einer Maske verbarg, der führte Böses im Schilde!
Hastig wandte er sich ab und begann zu laufen. Die Treppe hinunter konnte er nicht, weil die unheimliche Gestalt ihm den Weg versperrte. Also rannte er in die andere Richtung, an der Balustrade entlang und in eine der Gassen, die sich zwischen den Bücherregalen erstreckten.
Panik stieg in ihm auf. Die alten Bücher und Aufzeichnungen boten ihm plötzlich keinen Trost mehr. Alles, was er wollte, war zu fliehen – doch schon nach wenigen Schritten war seine Flucht zu Ende.
Die Gasse endete vor einer massiven Wand aus Backsteinen, und Jonathan erkannte, dass er einen schweren Fehler begangen hatte. Er fuhr herum, um ihn wieder gutzumachen – und erkannte, dass es zu spät war.
Der Vermummte stand bereits am Ende der Gasse. Gegen das spärliche Licht war nur seine Silhouette zu sehen. Finster und bedrohlich versperrte sie Jonathan den Weg.
»Was wollen Sie?«, fragte er noch einmal, ohne wirklich auf eine Antwort zu hoffen. Seine Augen rollten panisch, suchten nach einem Ausweg, den es nicht gab. Zu drei Seiten umgaben ihn hohe Wände, er war dem Phantom schutzlos ausgeliefert.
Die Gestalt kam auf ihn zu. Jonathan wich zurück, bis er gegen den kalten Backstein stieß. Zitternd vor Angst, presste er sich dagegen; seine Fingernägel verkrallten sich so sehr in den rauen Ziegelvorsprüngen, dass Blut hervortrat. Er konnte die Kälte fühlen, die von der unheimlichen Gestalt ausging. Schützend riss er die Hände vors Gesicht, sank in sich zusammen und fing leise an zu wimmern, während der Maskierte auf ihn zu trat.
Der Umhang des Vermummten bauschte sich, und Dunkelheit fiel über Jonathan Milton, schwarz und finster wie die Nacht.
2.
Es war früher Morgen, als ein Bote an die Pforte von Abbotsford klopfte.
Sir Walter Scott, der Herr dieses stolzen Anwesens, das sich am Ufer des Tweed erstreckte, nannte seinen Besitz gern eine »Romanze aus Stein und Mörtel«, eine Beschreibung, die auf Abbotsford durchaus zutraf. Denn innerhalb der Mauern aus braunem Sandstein, der Kreuzgänge und Zinnen, die an den Ecken und über den Portalen des Anwesens aufragten, schien es, als wäre die Zeit stehen geblieben … als wäre die Vergangenheit, von der Sir Walter in seinen Romanen schrieb, noch lebendig.
Am frühen Morgen, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen war und der Nebel vom Fluss aufstieg, bot Abbotsford eher ein unheimliches als ein anheimelndes Bild. Doch der Bote, der von seinem Rappen gestiegen war und energisch mit der Faust gegen das schwere Holztor hämmerte, hatte dafür keine Augen. Zu dringend war die Nachricht, die er dem Herrn von Abbotsford zu überbringen hatte.
Dumpf dröhnte das Holz unter den Schlägen wider, und es dauerte nicht lange, bis von der anderen Seite knirschende Schritte im Kies zu hören waren.
Der Riegel des Gucklochs wurde beiseite gezogen, und ein griesgrämiges Gesicht erschien, das dem Hausverwalter gehören mochte. Grau gewelltes Haar umrahmte ein wettergegerbtes Gesicht, aus dem eine gerötete Adlernase ragte.
»Wer bist du, und was willst du zu dieser unchristlichen Stunde?«, verlangte der Verwalter barsch zu wissen.
»Ich komme im Auftrag des Sheriffs von Kelso«, erwiderte der Bote und zeigte das Siegel, das er mit sich führte. »Ich habe eine dringende Nachricht für den Herrn des Hauses.«
»Eine Nachricht für Sir Scott? Um diese Zeit? Kann es nicht warten, bis wenigstens die Sonne aufgegangen ist? Seine Herrschaft schläft noch, und ich möchte ihn ungern wecken. Er bekommt ohnehin wenig Schlaf in diesen Tagen.«
»Bitte«, erwiderte der Bote, »es ist dringend. Es ist etwas geschehen. Ein Unfall.«
Der Hausverwalter musterte den Boten mit prüfendem Blick. Der drängende Tonfall schien ihn zu überzeugen, dass die Angelegenheit keinen Aufschub duldete, denn schließlich zog er doch den Riegel beiseite und öffnete das Tor.
»Nun gut, komm herein. Aber ich warne dich, junger Freund. Wenn du Sir Walter einer Nichtigkeit wegen den Schlaf raubst, wirst du das bereuen.«
Der Bote senkte ergeben das Haupt. Sein Pferd ließ er vor dem Portal zurück und folgte dem Verwalter durch den Kreuzgang, der den Garten säumte, ins Herrenhaus.
Im Haupthaus wies der Verwalter den Boten an, in der Halle zu warten. Beeindruckt vom gotischen Prunk und der altertümlichen Eleganz des Ortes, blieb der Bursche zurück, während der andere sich entfernte, um den Herrn des Hauses zu holen.
Die Eingangshalle von Abbotsford House sah aus, als wäre sie einem früheren Zeitalter entsprungen. Entlang der steinernen Wände reihten sich Rüstungen und alte Waffen, dazu Gemälde und Wandteppiche, die von der glorreichen Vergangenheit Schottlands kündeten. Die hohe Decke war wie in alter Zeit mit Holz getäfelt und vermittelte den Eindruck eines Rittersaals. Oberhalb des gemauerten Kamins, der die Stirnseite der Halle einnahm, prangte das Wappen der Scotts, umgeben von den Tartanfarben des Clans.
Aus einer Tür auf der rechten Seite des Kamins trat unvermittelt ein Mann, der an die fünfzig Jahre alt sein mochte. Mit einer Körpergröße von rund sechs Fuß bot er eine überaus eindrucksvolle Erscheinung. Das ergraute, kurz geschnittene Haar trug er nach vorn gekämmt. Seine Züge waren, seinem stämmigen Wuchs entsprechend, markant und von einer ländlichen Robustheit, wie sie bei adeligen Herren selten zu finden ist. Die kleinen Augen jedoch, die wach und aufmerksam wirkten und denen nichts zu entgehen schien, straften jeden Eindruck von Grobschlächtigkeit Lügen.
Trotz der frühen Stunde war der Mann vollständig angekleidet, ganz nach Art eines Gentlemans; zu grauen, eng geschnittenen Hosen trug er ein weißes Hemd und einen grünen Rock. Als er dem Boten entgegentrat, stellte dieser fest, dass er leicht humpelte.
Kein Zweifel – dies war Walter Scott, der Herr von Abbotsford.
Obwohl der Bote Scott noch nie zuvor persönlich begegnet war, hatte er sowohl von seiner beeindruckenden Erscheinung gehört als auch von der Behinderung, die von einer Krankheit aus Kindertagen herrührte.
Der aufgeweckte Zustand Scotts ließ vermuten, dass es stimmte, was man sich hinter vorgehaltener Hand erzählte: dass der Herr von Abbotsford kaum noch Zeit für Schlaf fand, sondern Tag und Nacht in seinem Studierzimmer weilte, um an seinen Romanen zu schreiben.
»Sire«, sagte der Bote und verbeugte sich, als der Hausherr auf ihn zu trat. »Bitte verzeihen Sie die Störung zu so früher Stunde.«
»Schon gut, mein Sohn«, sagte Sir Walter, und über seine groben Züge legte sich ein jungenhaftes Lächeln. »Ich war noch nicht zu Bett gegangen, und wie es aussieht, wird daraus heute wohl auch nichts mehr werden. Mein treuer Mortimer sagte, es gebe eine Nachricht für mich? Vom Sheriff von Kelso?«
»Das ist richtig, Sire«, bejahte der Bote, »und ich bedauere, dass es keine gute Nachricht ist. Es geht um Ihren Studenten, Jonathan Milton …«
Sir Walters Züge umspielte ein wissendes Lächeln. »Der gute Jonathan. Was ist mit ihm? Hat er über seinem Eifer mal wieder die Uhrzeit vergessen und ist zwischen alten Urkunden und Folianten eingeschlafen?« Er erwartete, dass der Bote sein Lächeln zumindest erwiderte. Das Gesicht des Mannes blieb jedoch ernst.
»Ich fürchte, es ist schlimmer als das, Sire«, sagte er leise. »Es hat einen Unfall gegeben.«
»Einen Unfall?« Sir Walter hob die Brauen.
»Ja, Sire. Ein schreckliches Unglück. Euer Student – Jonathan Milton – ist tot.«
»Er … er ist tot? Jonathan ist tot?«, hörte Sir Walter sich selbst sagen. Er hatte das Gefühl, dass ein Fremder die Worte aussprach, und konnte gar nicht glauben, was er hörte.
Der Bote nickte betroffen. Nach einer endlos scheinenden Pause fügte er hinzu: »Es tut mir sehr Leid, dass ich Ihnen diese Nachricht überbringen muss, Sire. Aber der Sheriff wollte, dass Sie sofort darüber in Kenntnis gesetzt werden.«
»Natürlich«, sagte Sir Walter und hatte Mühe, die Fassung zu bewahren. »Wann ist es geschehen? Und wo?«, wollte er wissen.
»In der Bibliothek, Sire. Offenbar war der junge Herr zu später Stunde noch dort, um zu studieren. Dabei muss er von der Treppe gestürzt sein.«
In Sir Walters Entsetzen mischten sich augenblicklich Schuldgefühle. Jonathan war in seinem Auftrag in Kelso gewesen, hatte für ihn in der alten Bibliothek recherchiert. An dem, was geschehen war, traf ihn also zumindest eine Mitschuld.
»Ich werde sofort nach Kelso aufbrechen«, kündigte er entschlossen an.
»Weshalb, Sire?«
»Weil ich muss«, sagte Sir Walter hilflos. »Es ist das Wenigste, was ich für Jonathan tun kann.«
»Tun Sie das nicht, Sire.«
»Weshalb nicht?«
»Der Sheriff von Kelso ist mit den Untersuchungen befasst, er wird Ihnen zu gegebener Zeit alles mitteilen. Aber … sehen Sie sich nicht die Leiche an. Der Anblick ist schrecklich, Sire. Sie sollten nicht …«
»Unsinn«, fiel Sir Walter ihm barsch ins Wort. »Ich bin lange genug selbst Sheriff gewesen und weiß, was mich erwartet. Welch ein Lehrherr wäre ich, bräche ich jetzt nicht auf, um mich nach den Umständen von Jonathans Tod zu erkundigen?«
»Aber Sire …«
»Genug«, befahl Sir Walter unwirsch, und dem Boten blieb nichts übrig, als sich zu verbeugen und zurückzuziehen, auch wenn er ahnte, dass sein Auftraggeber, der Sheriff von Kelso, über Sir Walters Besuch nicht erfreut sein würde.
Die Ortschaft Kelso lag rund 12 Meilen von Abbotsford entfernt. Der größte Teil Kelsos gehörte zum Besitz des Herzogs von Roxburghe, dessen Vorfahr rund hundert Jahre zuvor ein Schloss am Ufer des Tweed hatte errichten lassen, auf dem die Familie seither residierte. Zusammen mit den Ortschaften Selkirk und Melrose bildete Kelso ein Dreieck, das Scott gern als »sein Land« bezeichnete: Hügel und Wälder, die vom ruhigen Wasser des Tweed durchflossen wurden und für ihn der Inbegriff seiner schottischen Heimat waren. Kelso schätzte er als das romantischste Dorf der Gegend, in dem noch viel vom Geist des alten Schottland lebendig zu sein schien, welchen er in seinen Romanen so gern heraufbeschwor.
An manchen Tagen ließ er sich von seinem Kutscher nach Kelso bringen, um zwischen den alten Steingebäuden am Ufer des Tweed spazieren zu gehen und sich vom Odem der Vergangenheit inspirieren zu lassen. An diesem Morgen jedoch war der Weg nach Kelso ein bitterer.
In aller Eile hatte Sir Walter das Haus über den bestürzenden Vorfall in Kenntnis gesetzt. Lady Charlotte, seine gutherzige Gattin, war sogleich in Tränen ausgebrochen, als sie vom Tod Jonathan Miltons erfahren hatte – sie hatte ihn als einen höflichen und zuvorkommenden jungen Mann kennen gelernt, der sie mit seinem schwärmerischen Patriotismus und seiner Neugier auf die Vergangenheit nicht selten an ihren Gatten in jüngeren Jahren erinnert hatte. Sir Walter hatte unterdessen anschirren lassen und die Kutsche nach Kelso zusammen mit seinem Neffen Quentin bestiegen, der ebenfalls in Abbotsford weilte und seinen Onkel begleiten wollte.
Quentin, der seine Kindheit und Jugendzeit in Edinburgh verbracht hatte, war der Sohn einer Schwester Sir Walters: ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren, stark und groß gewachsen wie die meisten Scotts, dabei aber von einer gewissen Einfalt, die vor allem daher rührte, dass er sein Elternhaus noch nie für lange Zeit verlassen hatte. Quentin war nach Abbotsford gekommen, um bei Sir Walter in die Schule zu gehen – nach dem Willen seiner Mutter sollte der junge Mann Schriftsteller werden wie sein berühmter Onkel.
So sehr Sir Walter dieser Vorsatz schmeichelte, fürchtete er, dass es Quentin an den meisten Voraussetzungen fehlte, die nötig waren, um ein erfolgreicher Romancier zu werden. Zwar verfügte der junge Mann über einen wachen Geist und eine ausgeprägte Fantasie, die beide zum Einmaleins der Schriftstellerei gehörten, doch sowohl seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit als auch die Kenntnis der Klassiker von Plutarch bis Shakespeare ließen doch zu wünschen übrig.
Zudem hatte Quentin eine Neigung, Sachverhalte zu komplizieren und mit seltener Treffsicherheit am Wesentlichen vorbeizusehen, was er fraglos von seinem Vater geerbt hatte. Der analytisch scharfe Verstand und die energische Entschlusskraft, die allen Scotts zu Eigen waren, fehlten ihm gänzlich, und auch eine gewisse Ungeschicklichkeit des Jungen ließ sich nicht von der Hand weisen.
Scott hatte sich dennoch bereit erklärt, Quentin bei sich aufzunehmen und ihn auszubilden. Vielleicht, sagte er sich, musste sein Neffe erst noch entdecken, wo seine wahre Bestimmung lag. Und möglicherweise konnte ihm die Zeit in Abbotsford dabei von Nutzen sein.
»Ich kann es noch immer nicht glauben«, sagte Quentin betreten, während sie in der Kutsche saßen, die über den laubbedeckten Waldweg rumpelte. Für die Jahreszeit war es in den Nächten ungewöhnlich kühl, und beide Männer hatten ihre Umhänge eng um die Schultern geschlungen. »Dass Jonathan tot sein soll, ist einfach unfassbar, Onkel.«
»Unfassbar, in der Tat.«
Walter Scott grübelte düster vor sich hin. Der Gedanke, dass der junge Jonathan nur seinetwegen in Kelso gewesen war und dass er noch am Leben sein könnte, hätte er selbst ihn nicht in die Bibliothek geschickt, ließ ihn nicht los.
Natürlich wusste er, dass das Interesse des jungen Mannes an der Vergangenheit überaus groß gewesen war, und er hatte es als seine Pflicht betrachtet, diese Neigung und das Talent, das Jonathan im Umgang mit der Historie besaß, angemessen zu fördern. Nun jedoch erschienen ihm seine Beweggründe eitel und unaufrichtig.
Was sollte er Jonathans Eltern sagen, die ihren Sohn zu ihm geschickt hatten, damit er lernte und sich weiterentwickelte? Das Gefühl, versagt zu haben, lastete schwer auf Sir Walters Gemüt, und er spürte, wie sich eine bleierne Müdigkeit auf ihn senkte. Er hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan, um an seinem neuesten Roman zu arbeiten, doch das Heldenstück um Liebe, Duelle und Kabale war ihm mit einem Mal gleichgültig. Seine Gedanken galten einzig und allein dem jungen Studenten, der im Archiv von Dryburgh ums Leben gekommen war.
Auch Quentin bot einen elenden Anblick. Jonathan und er waren beinahe gleichaltrig und in den letzten Wochen gute Freunde geworden. Der plötzliche Tod des Studenten setzte ihm zu. Wieder und wieder fuhr er nervös durch sein dichtes braunes Haar, das wirr in alle Richtungen stand. Quentins Rock war wie immer zerknittert, die Schleife nachlässig gebunden. An einem anderen Tag hätte Sir Walter ihn darauf aufmerksam gemacht, dass dies ganz und gar nicht dem Auftreten eines Gentlemans entsprach. An diesem Morgen jedoch war es ihm gleichgültig.
Die Kutsche verließ den Wald, und durch das Seitenfenster war das helle Band des Tweed zu sehen. Nebel lag über dem Fluss und den Uferbänken. Die Sonne, die inzwischen aufgegangen war, verbarg sich hinter dichten grauen Wolken, was Sir Walters Stimmung nur noch mehr verdüsterte.
Endlich tauchten die ersten Gebäude von Kelso zwischen den Hügeln auf. Vorbei an der Taverne und der alten Schmiede rollte die Kutsche die Dorfstraße hinab und kam vor den Steinmauern des alten Kornhauses zum Stehen. Sir Walter wartete nicht erst, bis der Kutscher abgestiegen war. Er öffnete die Tür und stieg aus. Quentin folgte ihm.
Die Morgenluft war feucht und rau, sodass sich der Atem der Männer in der Kälte kräuselte. An den Pferden und der Kutsche, die vor dem Gebäude standen, konnte Sir Walter sehen, dass der Sheriff noch immer vor Ort war. Er gebot dem Kutscher zu warten und trat auf den Eingang zu, der von zwei Angehörigen der Landwehr bewacht wurde.
»Es tut mir Leid, Sire«, sagte einer der beiden, als Sir Walter und Quentin sich näherten – ein grobschlächtiger Bursche, dessen rotblondes Haar ein irisches Erbe vermuten ließ. »Der Sheriff hat allen Unbefugten den Zutritt zur Bibliothek untersagt.«
»Damit hat er Recht getan«, stimmte Sir Walter zu. »Aber ich bin der Lehrherr des Jungen, der in dieser Bibliothek zu Tode gekommen ist. Daher kann ich wohl verlangen, eingelassen zu werden.« Er brachte die Worte mit solcher Entschlossenheit vor, dass der Rothaarige nicht zu widersprechen wagte.
Der Bursche, der einen recht unbeholfenen Eindruck machte, wechselte einen ratlosen Blick mit seinem Kameraden, dann zuckte er mit den Schultern und gab den Weg frei. Durch die große Eichenholzpforte betraten Sir Walter und Quentin das ehrwürdige Gebäude, das einst die Kornkammer der Region gewesen und nun zu einem Speicher des Wissens geworden war. Zu beiden Seiten der Haupthalle erstreckten sich doppelseitige, an die fünf Yards hohe Regale, die sich in engen Gassen gegenüberstanden. Mehrere Lesetische nahmen die freie Mitte der Halle ein. Da das Kornhaus über eine beträchtliche Höhe verfügte, hatte man entlang der Seiten eine Galerie eingezogen, die von einer hölzernen Balustrade begrenzt wurde und auf schweren Eichenholzstützen ruhte. Dort oben standen weitere Regale mit Büchern und Folianten, mehr, als ein Mensch in seinem Leben auch nur sichten konnte.
Am Fuß der Wendeltreppe, die auf die Balustrade führte, lag etwas am Boden, worüber man ein dunkles Tuch aus Leinen gebreitet hatte.
Sir Walter spürte Beklemmung, als ihm klar wurde, dass dies Jonathans Leiche sein musste. Daneben standen zwei Männer, die sich in gedämpftem Ton miteinander unterhielten. Sir Walter kannte sie beide.
John Slocombe, der Sheriff von Kelso, war ein stämmiger Mann mittleren Alters, der einen abgetragenen Rock und das Abzeichen des Gemeindesheriffs trug. Sein Haar war spärlich und seine Nase vom Scotch gerötet, den er sich nicht nur an kalten Abenden gern genehmigte.
Der andere Mann, der die schlichte Wollkutte des Prämonstratenser-Ordens trug, war Abt Andrew, der Vorsteher und Verwalter der Bibliothek. Obwohl das Kloster von Dryburgh nicht mehr existierte, hatte der Orden Andrew und einige Mitbrüder abgestellt, damit sie sich um die Bestände des alten Archivs kümmerten, das auf so wundersame Weise die Wirren der Reformationszeit überdauert hatte. Andrew war ein groß gewachsener, schlanker Mann mit asketischen, aber keineswegs unfreundlichen Zügen. Seine tiefblauen Augen waren wie die Seen der Highlands, geheimnisvoll und unergründlich. Sir Walter schätzte die Ruhe und Ausgeglichenheit, die der Abt an den Tag zu legen pflegte.
Als sie die Besucher erblickten, unterbrachen die beiden Männer ihr Gespräch. John Slocombes Gesicht verriet blankes Entsetzen, als er Sir Walter erkannte.
»Sir Scott!«, rief er aus und kam händeringend auf die beiden Besucher zu. »Beim heiligen Andreas, was tun Sie denn hier?«
»Mich nach den Umständen dieses schrecklichen Unfalls erkundigen«, entgegnete Sir Walter mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
»Es ist schrecklich, schrecklich«, sagte der Sheriff. »Sie hätten nicht kommen sollen, Sir Walter. Der arme Junge …«
»Wo ist er?«
Slocombe merkte, dass der Herr von Abbotsford nicht gewillt war, sich von ihm abwimmeln zu lassen. »Dort, Sir«, sagte er zögernd und trat zur Seite, um den Blick auf das blutige Bündel freizugeben, das auf dem nackten, kalten Steinboden der Bibliothek lag.
Sir Walter hörte, wie Quentin ein leises Wimmern von sich gab, aber er achtete nicht darauf. Sein Mitgefühl und seine Anteilnahme gehörten in diesem Augenblick einzig dem jungen Jonathan, der auf so unerwartete und augenscheinlich sinnlose Weise aus dem Leben gerissen worden war. Obwohl Sir Walter ein stämmiger Mann von bester Konstitution war, merkte er, wie seine Knie weich wurden, als er sich dem Toten näherte.
Die Diener des Sheriffs hatten eine Decke über den Leichnam gebreitet, die sich an einigen Stellen mit dunklem Blut voll gesogen hatte. Auch auf dem Boden war Blut zu sehen. In zähen Rinnsalen war es über die Steinplatten gekrochen und schließlich in der Kälte geronnen.
Sheriff Slocombe blieb an Sir Walters Seite und gestikulierte weiter aufgeregt. »Sie müssen bedenken, Sir Walter, dass es ein Sturz aus großer Höhe war. Der Anblick ist schrecklich. Ich kann Sie nur warnen, den Toten zu be…«
Sir Walter ließ sich nicht beirren. Kurz entschlossen bückte er sich, griff nach der Decke und zog sie fort. Der Anblick, der sich den vier Männern bot, war tatsächlich furchtbar.
Es war Jonathan, daran bestand kein Zweifel. Der Tod hatte ihn jedoch grausam entstellt. In bizarrer Verrenkung lag der Student auf dem Boden. Er schien kopfüber gestürzt und mit großer Wucht aufgeschlagen zu sein. Blut war überall, dazu etwas, das Sir Walter für ausgetretene Hirnmasse hielt.
»Schrecklich, nicht wahr?«, fragte der Sheriff und blickte Sir Walter betroffen an. Während der Herr von Abbotsford erbleichte und betroffen nickte, hielt Quentin es nicht mehr aus. Der junge Mann gab einen gurgelnden Laut von sich, hielt sich die Hand vor den Mund und rannte nach draußen, um sich zu übergeben.
»Ihr Neffe scheint den Anblick nicht zu ertragen«, stellte der Sheriff mit leisem Vorwurf fest. »Ich sagte ja, dass es entsetzlich ist, aber Sie wollten mir nicht glauben.«
Sir Walter erwiderte nichts darauf. Stattdessen überwand er seine Scheu und sein Entsetzen und bückte sich, um von Jonathan Abschied zu nehmen.
Ein Teil von ihm hoffte wohl, Vergebung zu finden, wenn er in das blasse, blutverschmierte Gesicht des Toten blickte. Doch was Sir Walter dort fand, war etwas anderes.
»Sheriff?«, fragte er.
»Ja, Sir?«
»Ist Ihnen der Gesichtsausdruck des Toten aufgefallen?«
»Was meinen Sie, Sir?«
»Die Augen sind weit geöffnet, der Mund aufgerissen. In den letzten Sekunden seines Lebens muss sich Jonathan über irgendetwas sehr entsetzt haben.«
»Er wird gemerkt haben, dass er das Gleichgewicht verlor. Vielleicht wurde ihm für einen kurzen Moment bewusst, dass dies das Ende ist. So etwas kommt vor.«
Sir Walter blickte an der schmalen hölzernen Wendeltreppe hinauf, die sich nur wenige Schritte entfernt in die Höhe rankte.
»Hatte Jonathan Bücher bei sich, als er die Treppe herunterkam?«
»Soweit wir das sagen können, nicht«, erwiderte Abt Andrew, der bislang nur schweigend zugehört hatte. »Jedenfalls wurden keine gefunden.«
»Keine Bücher«, resümierte Sir Walter leise.
Er blickte zur Treppe, versuchte sich vorzustellen, wie das tragische Unglück abgelaufen sein mochte. So sehr er sich auch bemühte, es wollte ihm nicht recht gelingen.
»Verzeihen Sie, Sheriff«, sagte er deshalb, »aber da sind einige Dinge, die ich nicht verstehe. Wie kann ein junger Mann, der keine Last bei sich trägt und beide Hände frei hat, um sich am Geländer festzuhalten, so von dieser Treppe stürzen, dass er auf den Kopf fällt und sich den Schädel bricht?«
Die Farbe in John Slocombes Gesicht wurde um eine Winzigkeit blasser, und Sir Walter, den sein Beruf zu einem aufmerksamen Beobachter gemacht hatte, entging auch nicht das Blitzen, das kurz in den Augen des Sheriffs aufflackerte.
»Was meinen Sie damit, Sir?«, fragte er.
»Dass ich nicht glaube, dass Jonathan von den Stufen gestürzt ist«, sagte Sir Walter, während er sich langsam aufrichtete, zur Treppe ging und die untersten Stufen emporstieg. »Sehen Sie sich das Blut an, Sheriff. Wäre Jonathan tatsächlich von hier gestürzt, müssten die Flecken in Richtung Ausgang deuten. Sie zeigen jedoch in die entgegengesetzte Richtung.«
Der Sheriff und Abt Andrew tauschten einen flüchtigen Blick. »Vielleicht«, meinte der Gesetzeshüter und deutete nach oben, »haben wir uns ja geirrt. Vielleicht ist der arme Junge direkt von der Balustrade gestürzt.«
»Von dort oben?« Sir Walter stieg die Stufen hinauf, die unter seinen Tritten leise knarrten. Langsam ging er an dem mit Schnitzereien verzierten Geländer entlang, bis er die Stelle erreicht hatte, unterhalb deren der Leichnam des Studenten lag. »Sie haben Recht, Sheriff«, stellte er nickend fest. »Von hier könnte Jonathan gestürzt sein. Die Blutspuren würden das bestätigen.«
»Sehen Sie.« Erleichterung war in John Slocombes Gesicht zu erkennen.
»Allerdings«, wandte Sir Walter ein, »wüsste ich nicht, wie Jonathan über die Balustrade gestürzt sein könnte. Wie Sie sehen, Sheriff, reicht mir das Geländer fast bis an die Brust, und ich wurde von meinem Schöpfer mit einer ansehnlichen Postur bedacht. Der arme Jonathan war einen Kopf kleiner als ich. Wie also könnte sich ein Unfall zugetragen haben, bei dem er kopfüber von der Balustrade gestürzt ist?«
In den Zügen des Sheriffs begann es wieder zu arbeiten, seine Kiefer mahlten sichtbar. Er holte tief Luft, um zu antworten, besann sich dann aber anders. Leise vor sich hin murmelnd, kam er die Treppe herauf und gesellte sich zu Sir Walter, um in verschwörerischem Flüsterton mit ihm zu sprechen.
»Ich hatte Ihnen nahe gelegt, dass Sie den Leichnam ruhen lassen sollen, Sir, und ich hatte meine Gründe dafür. Das Schicksal des armen Jungen ist so schon schlimm genug, nehmen Sie ihm nicht auch noch sein Seelenheil.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich will damit sagen, Sir, dass Sie und ich sehr wohl wissen, dass der junge Herr Jonathan nicht von dieser Balustrade gestürzt sein kann, aber dass wir unser Wissen besser für uns behalten sollten. Sie sind darüber im Bilde«, sagte er mit einem Seitenblick auf Abt Andrew, der unten neben dem Leichnam stand und mit gesenktem Haupt betete, »was die Kirche jenen vorenthält, die das größte Geschenk des Schöpfers von sich weisen.«
»Was meinen Sie damit?« Sir Walter blickte dem Sheriff prüfend in das vom Alkohol gerötete Gesicht. »Dass der arme Jonathan Selbstmord begangen haben soll?«
Er hatte lauter gesprochen, als er beabsichtigt hatte, doch Abt Andrew schien ihn nicht gehört zu haben. Der Ordensmann stand weiter in demütiger Haltung und hielt Andacht für Jonathans Seele.
»Ich wusste es von dem Augenblick an, als ich die Bibliothek betrat«, versetzte Slocombe, »aber ich behielt mein Wissen für mich, um dem Jungen ein anständiges Begräbnis zu ermöglichen. Denken Sie an seine Familie, Sir, an die Schande, die sie zu ertragen hätte. Zerstören Sie nicht das Andenken an Ihren Schüler, indem Sie eine Wahrheit ans Licht zerren, die besser verborgen bleiben sollte.«
Walter Scott schaute dem Mann, der in der Grafschaft für die Durchsetzung des Rechts und die Wahrung der Ordnung verantwortlich war, tief in die Augen. Eine Zeitspanne, die John Slocombe wie eine Ewigkeit erschien, verstrich, ehe ein höfliches Lächeln über Sir Walters Miene glitt.
»Sheriff«, sagte er leise. »Ich verstehe, was Sie mir sagen wollen, und ich schätze Ihre« – er legte eine kurze Pause ein – »Diskretion. Aber Jonathan Milton hat keinesfalls Selbstmord begangen. Das würde ich jederzeit beschwören.«
»Wie können Sie sich da so sicher sein? Er verbrachte seine Zeit stets allein, oder nicht? Er hatte kaum Freunde, und soweit mir bekannt ist, wurde er auch nie mit einem Mädchen gesehen. Was wissen wir schon von den Dingen, die sich in einem kranken Geist abspielen?«
»Jonathans Geist war nicht krank, Sheriff«, widersprach Sir Walter. »Er war im höchsten Maße wach und gesund. Ich habe selten zuvor einen Studenten erlebt, der die ihm gestellten Aufgaben mit mehr Eifer und größerer Begeisterung erledigt hätte. Sie wollen mir weismachen, er habe sich absichtlich über dieses Geländer gestürzt, um seinem Leben ein Ende zu setzen? Das hier ist eine Bibliothek, Sheriff. Jonathan hat für das Studium der Geschichte gelebt. Er wäre nicht dafür gestorben.«
»Und wie erklären Sie sich dann, was geschehen ist? Sagten Sie nicht vorhin selbst, der Junge könne keinesfalls von der Treppe gestürzt sein?«
»Sehr einfach, Sheriff. Dass Jonathan sich nicht selbst von der Balustrade gestürzt hat, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es nicht geschehen ist.«
»Ich verstehe nicht …«
»Wissen Sie, Sheriff«, sagte Sir Walter und musterte Slocombe mit eisigen Blicken, »ich denke, dass Sie sehr wohl wissen, worauf ich hinauswill. Ich schließe aus, dass es ein Unfall gewesen ist, der den armen Jonathan das Leben gekostet hat, und ich kann auch nicht glauben, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Also bleibt nur noch eine Möglichkeit.«
»Mord?« Der Sheriff sprach das schreckliche Wort so leise aus, dass man es kaum hörte. »Sie glauben, Ihr Schüler sei ermordet worden?«
»Die Logik lässt keinen anderen Schluss zu«, erwiderte Sir Walter, und Bitterkeit schwang in seiner Stimme mit.
»Welche Logik? Sie haben nur Vermutungen angestellt, Sir, oder etwa nicht?«
»Die allerdings für mich nur den einen Schluss zulassen«, sagte Sir Walter und blickte auf den leblosen Körper seines Schülers hinab. »Jonathan Milton ist heute Nacht eines gewaltsamen Todes gestorben. Jemand hat ihn von der Balustrade in den Tod gestoßen.«
»Das kann nicht sein!«
»Weshalb nicht, Sheriff? Weil es Ihnen Arbeit macht?«
»Bei allem Respekt, Sir, gegen diese Unterstellung verwahre ich mich. Nachdem ich hörte, was geschehen war, bin ich ohne Zögern hierher geeilt, um die Umstände von Jonathan Miltons Tod zu klären. Ich kenne meine Pflichten.«
»Dann erfüllen Sie sie auch, Sheriff. Für mich steht fest, dass hier ein Verbrechen verübt wurde, und ich erwarte, dass Sie alles tun, was in Ihrer Macht steht, um es aufzuklären.«
»Aber … das kann nicht sein. Es ist einfach nicht möglich, verstehen Sie? Seit ich hier Sheriff bin, hat sich noch nie ein Mord in dieser Grafschaft ereignet.«
»Dann sollten Sie sich bei Jonathans Mörder beschweren, dass er sich nicht an diese Regel gehalten hat«, entgegnete Sir Walter bissig. »Ich für meinen Teil werde nicht ruhen, bis ich herausgefunden habe, was wirklich hier vorgefallen ist. Wer auch immer die Schuld an Jonathan Miltons Tod trägt, wird dafür büßen.«
Scott hatte den Flüsterton aufgegeben und in gewohnter Lautstärke gesprochen, sodass nun auch Vater Andrew aufmerksam geworden war. Der Mönch blickte zu ihnen herauf, und Sir Walter hatte das Gefühl, in seinen Zügen Verständnis zu lesen.
»Bitte, Sir«, sagte Sheriff Slocombe, dessen Stimme jetzt einen beinahe flehenden Tonfall annahm. »Nehmen Sie Vernunft an.«
»Ich bin nie klarer bei Verstand gewesen, mein werter Sheriff«, versicherte Sir Walter.
»Aber was gedenken Sie jetzt zu unternehmen?«
»Ich werde die Angelegenheit untersuchen lassen. Von jemandem, der die Wahrheit nicht so scheut wie Sie.«
»Ich habe getan, was ich für richtig hielt«, verteidigte sich Slocombe, »und ich glaube noch immer, dass Sie sich irren. Es besteht kein Grund, die Garnison zu verständigen.«
Sir Walter, der sich schon abgewandt hatte, um wieder nach unten zu steigen, wandte sich um. »Ist es das?«, erkundigte er sich scharf. »Ist es das, was Sie fürchten, Sheriff? Dass ich die Garnison verständigen könnte und ein Engländer hier das Kommando übernähme?«
Der Sheriff erwiderte nichts, doch der verlegene Blick, den er auf den Boden warf, verriet ihn.
Sir Walter seufzte. Er kannte das Problem. Die britischen Offiziere in den Garnisonen, zu deren Aufgaben es auch gehörte, den Landfrieden zu sichern und polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen, hatten die Eigenschaft, wenig kooperativ zu sein. Die Arroganz, mit der sie ihre schottischen Kollegen behandelten, war berüchtigt. Sobald sie den Fall übernahmen, hatte der Sheriff praktisch nichts mehr zu sagen.
Während seiner Zeit als Sheriff von Selkirk hatte Scott wiederholt mit den Hauptleuten der Garnisonen zu tun gehabt. Die meisten von ihnen hassten es, in den rauen Norden versetzt worden zu sein, was die Bevölkerung nicht selten zu spüren bekam. Die Garnison zu alarmieren bedeutete, ganz Kelso ihrer Willkür auszuliefern.
»Sie brauchen sich nicht zu sorgen, Sheriff«, sagte Sir Walter leise. »Ich habe nicht vor, die Garnison zu verständigen. Wir werden selbst herauszufinden versuchen, was dem armen Jonathan zugestoßen ist.«
»Aber wie, Sir? Wie wollen Sie das tun?«
»Mit scharfer Beobachtungsgabe und wachem Verstand, Sheriff.«
Gefolgt von Slocombe, der sich verlegen die Hände rieb, stieg Sir Walter die Stufen hinab und gesellte sich zu Abt Andrew, der wie immer in sich selbst zu ruhen schien, selbst angesichts eines so schrecklichen Ereignisses.
»Wie ich höre, teilen Sie die Theorie des Sheriffs nicht?«, erkundigte sich der Mönch.
»Nein, werter Abt«, erwiderte Sir Walter. »Es gibt zu viele Widersprüche. Zu viel, das nicht zusammenpasst.«
»Das ist auch meine Ansicht.«
»Auch Ihre Ansicht?«, ächzte Slocombe. »Und weshalb haben Sie mir nichts davon gesagt?«
»Weil es mir nicht zusteht, Ihr Urteil in Zweifel zu ziehen. Sie sind der Hüter des Gesetzes, John, oder nicht?«
»Ich denke schon«, sagte der Sheriff ratlos und machte dazu ein Gesicht, das ahnen ließ, dass er sich in Gesellschaft eines gut gefüllten Glases Scotch jetzt wohler gefühlt hätte.
»Dann glauben Sie auch, dass der arme Junge von dort oben hinuntergestoßen wurde?«, fragte Sir Walter.
»Der Verdacht liegt nahe. Auch wenn mich der Gedanke, dass sich in diesen ehrwürdigen Mauern ein kaltblütiger Mord ereignet haben soll, mit Unruhe und Furcht erfüllt.«
»Vielleicht war es kein Mord«, versuchte Slocombe es noch einmal. »Vielleicht war es nur ein Unglück, ein misslungener Scherz.«
»Misslungen, in der Tat«, versetzte Sir Walter bitter und mit einem Seitenblick auf die grausam entstellte Leiche. »Haben Sie Ihre Mitbrüder befragt, Abt Andrew?«
»Natürlich. Aber keiner von ihnen hat etwas gesehen oder gehört. Sie alle befanden sich zur fraglichen Zeit in ihren Kammern.«
»Gibt es dafür Zeugen?«, hakte Sir Walter nach und erntete dafür einen sträflichen Blick des Mönchs. »Verzeihen Sie«, fügte er halblaut hinzu. »Ich möchte niemanden verdächtigen. Es ist nur …«
»Ich weiß«, versicherte der Abt. »Sie fühlen sich schuldig, weil der junge Jonathan in Ihren Diensten stand. Er war in Ihrem Auftrag hier, als es geschah, und deshalb glauben Sie mitverantwortlich für seinen Tod zu sein.«
»Kann man mir das verdenken?« Scott machte eine hilflose Geste. »Am frühen Morgen klopft ein Bote an die Tür meines Hauses und bringt mir die Nachricht, dass einer meiner Studenten tot ist. Und alles, was der zuständige Sheriff dazu liefern kann, sind ein paar fadenscheinige Erklärungen. Wie würden Sie an meiner Stelle reagieren, werter Abt?«
»Ich würde versuchen herauszufinden, was geschehen ist«, erwiderte der Vorsteher der Kongregation offen. »Und ich würde dabei keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten der Betroffenen nehmen. Die Wahrheit zu ergründen hat in diesem Fall absoluten Vorrang.«
Sir Walter nickte, dankbar für die ermutigenden Worte. In seinem Inneren herrschte Verwirrung. Lieber wäre ihm gewesen, es hätte sich eine andere Erklärung für den Vorfall finden lassen. Die Indizien ließen jedoch nur einen Schluss zu: Jonathan Milton war eines gewaltsamen Todes gestorben. Irgendwer hatte ihn über die Balustrade gestoßen, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und es lag an seinem Lehrer, herauszufinden, wer dieser Jemand gewesen war.
»War die Tür der Bibliothek verschlossen, als Sie Jonathan fanden?«, wollte Sir Walter wissen.
»Allerdings«, gab der Abt bereitwillig Auskunft.
»Es gab keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen?«
»Nicht, soweit wir es beurteilen können.«
»Gab es Spuren auf dem Boden? Hinweise, die darauf schließen lassen, dass außer Jonathan noch jemand in der Bibliothek war?«
»Auch das nicht, soweit es sich sagen lässt. Jonathan scheint ganz allein gewesen zu sein.«
»Das ist unheimlich«, kommentierte Sheriff Slocombe mit Verschwörerstimme. »Als ich noch ein Junge war, hat mir mein Großvater von einem ähnlichen Vorfall erzählt. Der Mörder wurde nie gefunden, der Fall nie aufgeklärt.«
»Nun«, seufzte Sir Walter, »wir wollen es zumindest versuchen, nicht wahr? Wissen Sie, wo Jonathan zuletzt gearbeitet hat, werter Abt?«
»Dort, an jenem Tisch.« Der Mönch deutete auf einen der massiven Eichenholztische, die die Mitte der Halle einnahmen. »Wir fanden sein Schreibzeug, aber es lag kein Buch dabei.«
»Dann muss er hinaufgegangen sein, um es zurück an seinen Platz zu stellen«, vermutete Sir Walter. »Möglicherweise wollte er seine Studien beenden.«
»Möglicherweise. Woran hat der junge Herr denn zuletzt gearbeitet?«
»Er hat für einen neuen Roman recherchiert, der im späten Mittelalter spielen wird.«
»Dort oben finden sich aber keine Schriften aus jener Zeit.«
Sir Walter lächelte nachsichtig. »Sie wissen, dass Jonathan nicht nur in meinen Diensten Studien betrieben hat. Sein Eifer, was die Geschichtswissenschaft betraf, war sehr groß.«
»Das ist wahr. Der junge Herr hat oft ganze Nächte damit zugebracht, nach den Geheimnissen der Vergangenheit zu forschen. Möglicherweise …«
»Ja?«, fragte Sir Walter.
»Nichts.« Der Abt schüttelte den Kopf. »Es war nur ein Gedanke. Nichts von Bedeutung.«
»Halten Sie es für möglich, dass es ein Dieb gewesen ist? Jemand, der sich hier in der Bibliothek versteckt und Jonathan aufgelauert hat?«
»Kaum. Was sollte hier wohl gestohlen werden, mein Freund? Hier gibt es nichts als Staub und alte Bücher. Diebe und Räuber interessieren sich in unseren Tagen mehr für volle Mägen und gefüllte Geldbörsen.«
»Das ist wahr«, räumte Sir Walter ein. »Könnten Sie trotzdem überprüfen, ob etwas gestohlen wurde?«



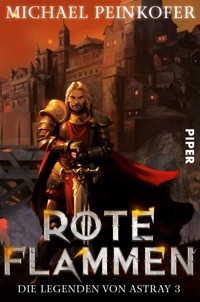
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)