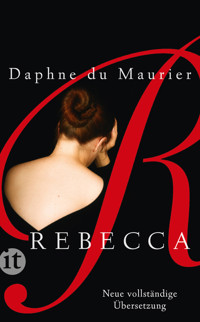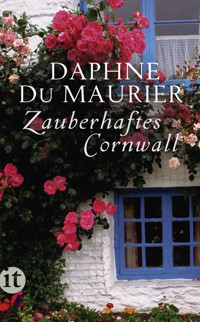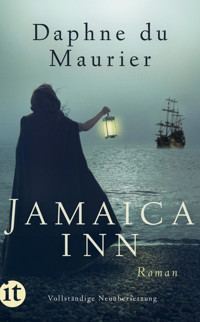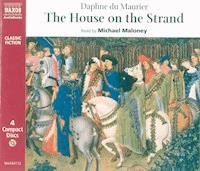10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Des höfischen Lebens in London überdrüssig, entflieht Lady Dona auf den Landsitz der Familie an den Klippen von Cornwall. Dort begegnet sie dem »Franzosen«, einem verwegenen Freibeuter, und sie gerät in den Strudel einer wildromantischen, verbotenen Liebe. Aus der gelangweilten Ehefrau wird die leidenschaftliche Geliebte des Piraten, aus der zärtlichen Mutter eine wagemutige Abenteurerin. Als Schiffsjunge verkleidet, entschlüpft sie ihrem eintönigen Leben und wagt sich in eine Welt voll Liebe und Gefahr. Bis plötzlich ihr Mann Lord Rockingham auftaucht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Daphne du Maurier
Die Bucht des Franzosen
Roman
Aus dem Englischen von Brigitte Heinrich und Christel Dormagen
Insel Verlag
Widmung
Für Paddy und Christopher
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
1
Wenn der Ostwind flussaufwärts bläst, wühlt er das schimmernde Wasser des Helford auf, es wird trüb, und wütende kleine Wellen klatschen an die sandigen Ufer. Bei Ebbe brechen die kurzen Wogen über der Sandbank, und die Watvögel verständigen sich mit lauten Rufen und fliegen zu den Sümpfen landeinwärts, mit den Flügeln die Wasseroberfläche streifend. Nur die kreischenden Möwen bleiben zurück, segeln schwungvoll über den Schaumkronen dahin und stürzen sich auf Futtersuche hin und wieder ins Wasser, ihr graues Gefieder glänzt in der salzigen Gischt.
Die langen Brecher aus dem Ärmelkanal, die von Lizard Point heranrollen, folgen dicht auf die steilen Seen an der Flussmündung, dann kommt, vermischt mit dem aufbrandenden Wasser vom offenen Meer, die braune Flut, angeschwollen nach den jüngsten Regenfällen und brackig vom Schlamm, sie trägt abgestorbene Äste, Stroh und ein merkwürdiges Sammelsurium zurückgelassener Dinge mit sich, auch zu früh gefallenes Laub, junge Vögel und Blütenknospen.
Die offene Reede ist verlassen, denn bei Ostwind lässt sich schwer ankern; und wären da nicht die wenigen, um die Flussmündung verstreuten Häuser und die Sommerhäuser oberhalb von Port Navas, sähe der Fluss noch genauso aus wie in einem längst vergangenen Jahrhundert, einer Zeit, an die es kaum noch Erinnerungen gibt.
Damals erstreckten sich Hügel und Täler in einsamer Pracht, nirgends ein Haus, das die unwirtlichen Felder und Klippen entweihte, keine Schornsteine, die aus den hohen Wäldern ragten. Im Dörfchen Helford gab es ein paar Häuser, doch für das Leben am Fluss waren sie ohne Bedeutung; dieser gehörte den Vögeln – Brachvogel und Rotschenkel, Lumme und Papageientaucher. Anders als heute nutzten damals keine Yachten die Tide, und der friedliche Abschnitt, wo der Fluss sich teilt, Richtung Constantine und Richtung Gweek, war still und ungestört.
Kaum jemand kannte den Fluss außer einigen Seeleuten, die dort Schutz fanden, wenn die Südweststürme über dem Ärmelkanal sie von ihrem Kurs abdrängten. Sie landeten dann an einem unwirtlichen, einsamen Ort, ein wenig beängstigend in seiner Stille, und waren froh, bei günstigem Wind wieder den Anker lichten und Segel setzen zu können. Das Dörfchen Helford bot für einen Seemann auf Landgang keine Verlockungen. Die wenigen Dorfbewohner waren stumpf und unzugänglich, und jemandem, der zu lange Frauen und Wärme vermisst hat, steht der Sinn kaum danach, durch den Wald zu spazieren oder bei Ebbe mit den Watvögeln im Schlamm zu planschen. So blieb der Fluss mit seinen vielen Windungen unbesucht, Wälder und Hügel blieben unbegangen, und all die verschlafene Schönheit des Hochsommers, die dem Helford einen so eigentümlichen Zauber verleiht, blieb unbesehen und unerkannt.
Heute stören viele Stimmen die Stille. Vergnügungsdampfer kommen und gehen und lassen aufgewühltes Kielwasser zurück, Segler statten einander Besuche ab, und selbst der Tagestourist, der gelangweilte Blick übersättigt von unverdauter Schönheit, stapft mit einem Krabbennetz schwerfällig durchs seichte Wasser. Manchmal ruckelt er in einem schnaufenden kleinen Auto über den holprigen, morastigen Pfad, der in einer scharfen Rechtskurve aus Helford hinausführt, und kehrt zum Tee, zusammen mit anderen Touristen, in der steinernen Küche des alten Bauernhauses ein, das einst Navron House war. Selbst jetzt verfügt es noch über eine gewisse Grandezza. Ein Teil des ursprünglichen viereckigen Gebäudekomplexes steht noch und umschließt den heutigen Hof, und die beiden Säulen, die einmal den Hauseingang flankierten und inzwischen von Efeu und Moos überwuchert sind, dienen der modernen, wellblechgedeckten Scheune als Stützen.
Die Küche des Bauernhauses, wo der Tourist seinen Tee zu sich nimmt, war Teil des Speisesaals von Navron House, und die kleine Halbtreppe, die heute mitten in der gemauerten Wand endet, führte einst hinauf auf die Galerie. Der Rest des Hauses wurde offenbar abgerissen oder verfiel, denn das quadratische Gebäude ist zwar recht hübsch, hat aber wenig Ähnlichkeit mit dem Navron House auf alten Drucken, das wie ein E geformt war, und von dessen formalem Garten und Park nichts mehr zu sehen ist.
Der Tourist verzehrt sein Banana-Split und trinkt seinen Tee, lässt seinen Blick lächelnd über die Landschaft schweifen und weiß nichts von der Frau, die vor langer Zeit, in einem anderen Sommer, hier stand, und wie er das Glitzern des Flusses zwischen den Bäumen in sich aufnahm und, das Gesicht dem Himmel zugewandt, die Sonne genoss.
Er hört die anheimelnden ländlichen Geräusche, das Scheppern der Eimer, das Muhen des Viehs, die rauen Stimmen des Bauern und seines Sohnes, die einander über den Hof hinweg etwas zurufen, doch seine Ohren sind taub für den Widerhall einer anderen Zeit, als jemand, die Hände um den Mund gelegt, leise von den dunklen Bäumen pfiff und sogleich eine Antwort erhielt von einem dünnen Menschen, der an der Hauswand kauerte, und als sich gleichzeitig weiter oben ein Fensterflügel öffnete und Dona horchend herausschaute und eine kleine, namenlose Melodie auf den Fenstersims trommelte, während ihr die Locken ins Gesicht fielen.
Der Fluss fließt noch immer, die Bäume rauschen im Sommerwind, bei Ebbe stehen die Austernfischer im Schlick, suchen das seichte Wasser nach Futter ab, und die Brachvögel rufen, doch die Frauen und Männer aus jener Zeit sind vergessen, ihre Grabsteine mit Moos und Flechten überwachsen, ihre Namen nicht mehr zu entziffern.
Heute zertrampelt und durchwühlt das Vieh die Erde über der verschwundenen Terrasse von Navron House, wo einst Schlag Mitternacht ein Mann stand, lächelnd im trüben Kerzenlicht, das gezückte Schwert in der Hand.
Im Frühling pflücken die Bauernkinder am Ufer Schlüsselblumen und Schneeglöckchen, zertreten mit ihren schlammverkrusteten Stiefeln abgestorbene Zweige und das welke Laub eines vergangenen Sommers, und der Fluss, angeschwollen vom Regen eines langen Winters, wirkt desolat und grau.
Die Bäume wachsen immer noch dicht und dunkel am Wassersaum, das Moos ist saftig und grün auf dem kleinen Kai, wo Dona ihr Feuer entfachte und über die Flammen hinweg ihren Liebsten anlachte; doch heute liegt in der Bucht kein Boot vor Anker, dessen Masten keck gen Himmel ragen, keine Kette rasselt in der Ankerklüse, in der Luft hängt kein kräftiger Tabakgeruch, und kein Echo wohlklingender fremdsprachiger Stimmen schallt über das Wasser.
Der einsame Segler, der seine Yacht in der Bucht von Helford zurücklässt und im Hochsommer nachts, wenn die Ziegenmelker rufen, mit seinem Beiboot den Fluss erkundet, zögert, wenn er die Mündung erreicht, denn noch heute ist etwas Geheimnisvolles um sie, etwas Verzaubertes. Fremd, wie er ist, blickt der Segler zurück zu seiner sicher ankernden Yacht und dem breiten Fluss. Er hält inne, auf die Paddel gestützt, und nimmt plötzlich die tiefe Stille über dem Fluss, die schmale, mäandernde Fahrrinne wahr, und fühlt sich – aus unerfindlichem Grund – als Störenfried, als unbefugter Eindringling in ein anderes Zeitalter. Er wagt sich ein Stück am linken Ufer entlang, der Schlag der Ruderblätter erscheint viel zu laut und hallt als fremdartiges Echo von den Bäumen am anderen Ufer wider. Während er langsam vorankommt, verengt sich der Fluss, die Bäume drängen sich noch dichter ans Ufer, und er verspürt einen Zauber, faszinierend, fremdartig, eine merkwürdige Erregung, die er nicht ganz versteht.
Er ist allein, und doch – kann das ein Flüstern sein, dort im seichten Wasser nah dem Ufer, steht dort nicht eine männliche Gestalt, und das Mondlicht spiegelt sich in den Schnallenschuhen und dem Entermesser in seiner Hand? An seiner Seite, ist das nicht eine Frau mit einem Umhang um die Schultern, die dunklen Locken hinter die Ohren frisiert? Er täuscht sich natürlich, es sind nur die Schatten der Bäume, und das Flüstern ist nichts als das Rascheln der Blätter und die leichte Bewegung eines schlafenden Vogels. Plötzlich ist er verwirrt und fürchtet sich ein bisschen, er hat das Gefühl, er dürfe nicht weiter, der Oberlauf des Flusses jenseits des gegenüberliegenden Ufers sei ihm versperrt, müsse unbesucht bleiben. Und so macht er kehrt, wendet den Bug in Richtung Ankerstelle, und während er sich entfernt, werden die Geräusche und das Geflüster stetig lauter, dazu Fußgetrappel, ein Ruf und ein nächtlicher Schrei, dann, in weiter Ferne, ein schwacher Pfiff und eine wundersame, beschwingte Melodie. Er starrt angestrengt in die Dunkelheit, und vor ihm dräuen die massiven Schatten so klar und deutlich wie die Umrisse eines Schiffs. Ein bemaltes Gespensterschiff, anmutig und schön, einer anderen Zeit entsprungen. Jetzt beginnt sein Herz heftig zu pochen, er legt sich in die Riemen, und das kleine Beiboot schießt eilig über das dunkle Wasser, fort von dem Zauber, denn was er gesehen hat, ist nicht von dieser Welt, und das Gehörte entzieht sich seinem Verständnis.
Er erreicht sein sicheres Schiff und blickt ein letztes Mal zurück auf die Flussmündung, sieht, wie der Mond in voller Sommerpracht weiß und schimmernd über den hohen Bäumen aufsteigt und den Fluss in Licht und Schönheit taucht.
Ein Ziegenmelker schwirrt aus dem Farngestrüpp auf dem Hügel, ein Fisch durchbricht mit einem Plätschern die Wasseroberfläche, und langsam dreht sich das Schiff in der auflaufenden Flut, und der Fluss entschwindet seinem Blick.
Der Segler steigt hinunter in die behagliche Geborgenheit seiner Kabine, stöbert zwischen seinen Büchern und findet schließlich, wonach er gesucht hat. Eine Karte von Cornwall, schlecht gezeichnet und ungenau, die er in einer Buchhandlung in Truro einmal zufällig mitgenommen hat. Das Pergament ist verblasst und vergilbt, die Markierungen sind verschwommen. Die Orthographie entstammt einem anderen Jahrhundert. Der Fluss Helford ist allerdings ziemlich exakt eingezeichnet, ebenso die Dörfchen Constantine und Gweek. Doch der Blick des Seglers wandert weiter zu einem kurzen Wasserlauf, der vom großen Fluss abzweigt und unter zahlreichen Windungen weiter westlich ein Tal durchfließt. Jemand hat mit dünnen, verblassten Buchstaben den Namen eingeritzt – Frenchman's Creek, die Bucht des Franzosen.
Der Segler wundert sich ein wenig über diese Bezeichnung, zuckt die Schultern und rollt die Karte wieder ein. Er geht schlafen. Der Anker ist ruhig. Kein Lufthauch weht über dem Wasser, und die Ziegenmelker schweigen. Der Segler träumt – und als die steigende Flut sachte sein Schiff umwogt und der Mond auf den stillen Fluss scheint, dringt leises Gemurmel an sein Ohr, und Vergangenheit wird zu Gegenwart.
Ein längst vergangenes Jahrhundert späht durch Staub und Spinnweben, und er bewegt sich in einer anderen Zeit. Er hört ein Pferd über die Auffahrt von Navron House galoppieren; er sieht, wie das große Tor aufschwingt, dann das bleiche, erschrockene Gesicht des Dieners, der zu dem Reiter in seinem Umhang aufblickt. Er sieht, wie Dona oben an der Treppe erscheint, in ihrem alten Hausmantel, einen Schal um den Kopf, während unten, verborgen auf dem stillen Fluss, ein Mann an Deck seines Schiffs auf und ab geht, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, ein rätselhaftes kleines Lächeln um die Lippen. Die Bauernhofküche wird wieder zum Speisesaal von Navron House, und jemand kauert mit einem Messer in der Hand auf der Treppe, während oben plötzlich der erschrockene Schrei eines Kindes ertönt, von den Wänden der Galerie krachend ein Schild auf die geduckte Gestalt herabstürzt und zwei kleine parfümierte, gelockte King-Charles-Spaniels kläffend und japsend auf den am Boden liegenden Körper zulaufen.
Am Mittsommerabend brennt ein Holzfeuer auf einem einsamen Anlegesteg, ein Mann und eine Frau blicken einander in lächelndem Einverständnis in die Augen, und am frühen Morgen segelt ein Schiff mit der Flut, während die Sonne von einem leuchtend blauen Himmel brennt und die Möwen kreischen.
All das Gewisper und der Nachhall einer verblassten Vergangenheit schwirren im Kopf des Schläfers durcheinander. Er ist mit ihnen und Teil von ihnen – Teil des Meeres, des Schiffs, der Mauern von Navron House, Teil einer Kutsche, die schlingernd über die holprigen Straßen Cornwalls rumpelt, selbst Teil jenes längst vergessenen Londons, künstlich und angemalt, wo junge Fackelträger für Beleuchtung sorgten und beschwipste Galane an der Ecke einer verschlammten Pflastergasse lachten. Er sieht Harry in seinem Satinrock, der, die Spaniels auf den Fersen, in Donas Schlafzimmer stolpert, als sie gerade die Rubine in die Ohrläppchen steckt. Er sieht William mit seinem Knospenmund, dem kleinen, undeutbaren Gesicht. Und zuletzt sieht er La Mouette, die in einem schmalen, gewundenen Flüsschen vor Anker liegt, er sieht die Bäume am Ufer, er hört Reiher und Brachvögel rufen. Und wie er da schlafend auf dem Rücken liegt, nimmt er die zauberische Tollheit jenes vergangenen Mittsommers in sich auf, als der Fluss zum ersten Mal zu einem Refugium wurde und zu einem Symbol des Entkommens.
2
Die Kirchenuhr schlug die halbe Stunde, als die Kutsche klappernd Launceston erreichte und vor dem Gasthof anhielt. Der Kutscher grunzte etwas, und sein Begleiter sprang ab und lief nach vorn zu den Pferden. Der Kutscher hob zwei Finger an den Mund zu einem lauten Pfiff. Sogleich trat ein Stallknecht aus dem Gasthof und rieb sich erstaunt die verschlafenen Augen.
»Wir haben keine Zeit zum Verweilen. Bring gleich Wasser und Futter für die Pferde«, befahl der Kutscher, erhob sich von seinem Bock, streckte die Glieder und blickte sich säuerlich um, während sein Kumpan mit den tauben Füßen stampfte und ihn mitfühlend angrinste.
»Sie haben sich noch nicht das Rückgrat gebrochen, das immerhin ist ein Segen«, rief er leise, »vielleicht sind sie ja die vielen Guineen wert, die Sir Harry für sie bezahlt hat.« Der Kutscher zuckte die Schultern. Er war zu müde und zu steif, um sich zu streiten. Die Straßen waren eine Katastrophe, und falls die Räder brachen und die Pferde umkamen, wäre er der Schuldige, nicht sein Kumpan. Wenn sie wenigstens in Ruhe reisen, sich eine Woche hätten Zeit lassen können für die Strecke, doch bei dieser teuflischen, halsbrecherischen Geschwindigkeit, die weder Mensch noch Tier schonte, und alles nur wegen der schlechten Laune der Lady! Wie dem auch sei, im Moment schlief sie Gott sei Dank, und in der Kutsche war alles ruhig. Doch das war leider Wunschdenken, denn als der Stallknecht zurückkam, einen Wassereimer in jeder Hand, und die Pferde gierig zu saufen begannen, wurde das Kutschfenster aufgerissen, und seine Herrin beugte sich heraus, von Schlaf keine Spur, die Augen groß und klar, und die herrische, kühle Stimme, die er in den letzten Tagen zu fürchten gelernt hatte, so gebieterisch wie immer.
»Warum zum Teufel diese Verzögerung?«, wollte sie wissen. »Haben Sie nicht schon vor drei Stunden angehalten, um die Pferde zu tränken?«
Der Kutscher betete flüsternd um Geduld, kletterte von seinem Bock und trat an das offene Fenster.
»Die Pferde sind dieses Tempo nicht gewohnt, Mylady«, erklärte er. »Sie vergessen, dass wir in den vergangenen zwei Tagen fast zweihundert Meilen zurückgelegt haben – außerdem sind diese Straßen wenig geeignet für so hochgezüchtete Tiere wie Ihre.«
»Unsinn«, kam die Antwort, »je edler, desto ausdauernder. In Zukunft werden Sie nur noch anhalten, wenn ich es befehle. Bezahlen Sie dem Kerl da, was wir ihm schulden, und fahren Sie weiter.«
»Ja, Mylady.« Der Mann wandte sich ab, die Lippen müde und verbissen zusammengepresst, nickte seinem Begleiter zu und kletterte, etwas in seinen Bart murmelnd, wieder auf den Bock.
Die Wassereimer wurden beiseitegeräumt, der begriffsstutzige Stallknecht gaffte verständnislos, die Pferde schnaubten und scharrten erneut mit den Hufen, Dampf stieg von ihren erhitzten Leibern auf, und schon ging es wieder los, über den kopfsteingepflasterten Platz, aus dem verschlafenen Städtchen hinaus zurück auf die holprige, raue Landstraße.
Dona starrte, das Kinn in die Hände gestützt, schlecht gelaunt aus dem Fenster. Die Kinder schliefen noch, das immerhin war ein Segen, selbst Prue, das Kindermädchen, hatte sich, mit offenem Mund und gerötetem Gesicht, seit über zwei Stunden nicht mehr gerührt. Die arme Henrietta hatte sich zum vierten Mal übergeben, jetzt lag sie, eine winzige Ausgabe von Harry, bleich und entkräftet da, das goldene Köpfchen an die Schulter des Kindermädchens gebettet. James tat nie einen Mucks; er schlief den echten, tiefen Babyschlaf, vielleicht würde er erst bei ihrer Ankunft erwachen. Und dann – was für eine jämmerliche Enttäuschung erwartete sie wohl! Klamme Betten zweifellos und verschlossene Fensterläden, das stickige Schimmelaroma unbenutzter Räume, die Gereiztheit überraschter, verärgerter Dienstboten. Und all das nur wegen eines Impulses, dem sie blindlings nachgegeben hatte, wegen eines plötzlich aufwallenden Widerwillens gegen die Sinnlosigkeit ihres Lebens, die endlosen Imbisse, Soupers und Kartenpartien, diese albernen Possen, die höchstens eines Lehrlings auf Urlaub würdig gewesen wären, und diese dämlichen Flirts mit Rockingham – und dann noch Harry selbst, so träge, so sorglos, der den Part des perfekten Ehemanns mit seiner Toleranz, seinem Gähnen vor Mitternacht, der abgeklärten, phlegmatischen Anbetung nur allzu gut spielte. Dieses Gefühl von Sinnlosigkeit war über viele Monate in ihr gewachsen, hatte hin und wieder an ihr genagt wie ein schmerzender Zahn. Doch es hatte den Freitagabend gebraucht, um dieses tiefe Gefühl von Selbsthass und Verzweiflung in ihr aufsteigen zu lassen. Und wegen Freitagabend wurde sie jetzt in dieser verdammten Kutsche hin und her geschleudert, auf einer lächerlichen Reise zu einem Haus, das sie ein einziges Mal in ihrem Leben gesehen hatte und über das sie nichts wusste. Und mit sich schleppte sie in ihrem Zorn und ihrer Wut die zwei verblüfften Kinder und ihr unwilliges Kindermädchen.
Sie gehorchte natürlich einem Impuls, wie sie es schon immer getan hatte. Von Anfang an, ihr ganzes Leben lang – war sie einem Flüstern gefolgt, einer Idee, die aus dem Nichts kam und ihr hinterher ins Gesicht lachte. Aus einem Impuls heraus hatte sie Harry geheiratet, wegen seines Lachens – dessen träge Fröhlichkeit hatte sie angezogen – und weil sie geglaubt hatte, der Ausdruck in seinen blauen Augen verspreche weit mehr, als tatsächlich der Fall war. Doch allmählich erkannte sie jetzt … aber das waren Dinge, die man nicht eingestand, nicht einmal sich selbst, wozu auch, sie waren geschehen, und da stand sie nun mit ihren zwei großartigen Kindern, und nächsten Monat wurde sie überdies dreißig.
Nein, der arme Harry war nicht dafür verantwortlich zu machen, auch nicht das sinnlose Leben, das sie beide führten, die törichten Eskapaden und ihre Freunde oder die erstickende Atmosphäre eines zu frühen Sommers, der sich über den festgebackenen Schlamm und Staub Londons legte, oder das alberne Geplapper im Theater und das seichte, frivole Geschwätz, der zotige Unfug, den Rockingham ihr ins Ohr flüsterte. Es war sie selbst, die die Verantwortung trug.
Sie hatte zu lange eine Rolle gespielt, die ihrer nicht würdig war. Sie hatte eingewilligt, die Dona zu sein, die ihre Umgebung von ihr erwartete – ein bezauberndes, oberflächliches Wesen, das plaudernd durch die Welt spazierte, lachte und schulterzuckend Lob und Bewunderung als selbstverständliche Hommage an ihre Schönheit einheimste, sorglos, anmaßend, bewusst gleichgültig, während ununterbrochen eine andere, fremde Phantom-Dona sie aus einem dunklen Spiegel heraus anblickte und sich schämte.
Dieses andere Ich wusste, dass das Leben weder bitter und wertlos sein noch innerhalb enger Schranken verlaufen musste, sondern tatsächlich grenzenlos und unendlich sein konnte – dass es Liebe und Leid verhieß, Gefahr und Süße und weit mehr als das, viel mehr. Ja, an jenem besagten Freitagabend hatte der Selbsthass sie derart überwältigt, dass sie sich selbst jetzt noch, während die weiche Landluft in dieser Kutsche ihr Gesicht streichelte, den Gestank der heißen Straße vergegenwärtigen konnte, der in London aus dem Rinnstein stieg, dieser Odeur von Erschöpfung und Verfall, der sich auf unerklärliche Weise mit dem schweren, schwülen Himmel, mit Harrys Gähnen, wenn er seinen Rock glattstrich, und mit Rockinghams vielsagendem Lächeln vermischt hatte – als verkörpere all das eine erschöpfte, sterbende Welt, aus der sie sich befreien und die Flucht ergreifen musste, bevor der Himmel auf sie herabstürzte und sie in der Falle saß. Sie erinnerte sich an den blinden Hausierer an der Ecke, der die Ohren nach klimpernden Münzen spitzte, an den Lehrling von Haymarket, der sich mit einem Tablett auf dem Kopf seinen Weg bahnte, mit schriller, trostloser Stimme seine Waren anpries und dabei über irgendwelchen Unrat im Rinnstein stolperte, so dass seine Ware sich über das gesamte Kopfsteinpflaster ergoss. Danach, o Himmel – das überfüllte Theater, der Geruch von Parfüm auf erhitzten Leibern, das alberne Gekicher und der Lärm, die Gesellschaft in der königlichen Loge – der König höchstpersönlich war anwesend –, die ungeduldige Menge auf den billigen Plätzen, die Orangenschalen auf die Bühne regnen ließ und trampelnd und schreiend verlangte, das Stück solle endlich anfangen. Dann Harry, der wie gewohnt unmotiviert lachte und von der Komik des Stücks ganz benebelt war, vielleicht hatte er aber vor ihrem Aufbruch auch einfach zu viel getrunken. Wie auch immer, er hatte an seinem Platz zu schnarchen begonnen, und Rockingham hatte, seine Chance witternd, ein Bein gegen ihres gepresst und ihr etwas ins Ohr geflüstert. Zum Teufel mit seiner Unverschämtheit, seinem besitzergreifenden Gehabe, seiner Vertraulichkeit, und alles nur, weil sie ihm in einem unbedachten Moment einmal erlaubt hatte, sie zu küssen, weil die Nacht so schön gewesen war. Später hatten sie dann im Swan soupiert, den sie, da sein Unterhaltungswert als Neuheit nachgelassen hatte, inzwischen verabscheute – die einzige Ehefrau inmitten einer Schar von Geliebten zu sein, hatte seinen Reiz eingebüßt.
Früher einmal hatte der Swan eine gewisse Anziehungskraft ausgeübt, es hatte ihren Sinn fürs Vergnügen geschärft, mit Harry an Orten zu verkehren, wohin kein anderer Ehemann seine Frau ausführte, dort Seite an Seite mit gewissen Damen der Stadt zu dinieren und zu beobachten, wie Harrys Freunde zunächst schockiert, dann fasziniert reagierten und schließlich ganz fiebrig wurden, wie neugierige Schuljungen, die sich auf verbotenes Terrain vorwagen. Aber selbst damals, selbst zu Anfang, hatte sie einen Anflug von Scham verspürt, eine eigentümliche Erniedrigung, als hätte sie sich für ein Kostümfest verkleidet und das Kostüm hätte nicht richtig gepasst.
Unterdessen hatten Harrys liebenswertes, ein wenig dümmliches Lachen, seine halb schockierte, bestürzte Bemerkung: »Die ganze Stadt redet über dich, die Männer tratschen in den Kneipen«, nicht als Zurechtweisung gewirkt, sondern lediglich als Provokation. Sie hätte sich gewünscht, dass er wütend geworden wäre, sie angeschrien oder sogar beschimpft hätte – aber er lachte nur, zuckte die Schultern und streichelte sie auf seine schwerfällige, ungeschickte Art, damit sie begriff, dass ihre Kaprizen ihm nichts ausmachten, dass es ihn im Grunde freute, wenn die Männer sich über seine Frau das Maul zerrissen und sie bewunderten, weil ihn das in ihren Augen zu einer bedeutenden Persönlichkeit machte. Die Kutsche holperte durch eine tiefe Wagenspur, und James bewegte sich im Schlaf. Sein kleines Gesicht verzog sich, als wollte er gleich weinen, und Dona legte ihm sein Spielzeug, das hinuntergefallen war, wieder in die Hand; er drückte es an seinen Mund und schlief weiter. Er sah aus wie Harry, wenn er eine Bestätigung ihrer Zuneigung verlangte, und sie fragte sich, warum dieses Verhalten bei James so anrührend und gewinnend wirkte, bei Harry aber mehr als nur ein bisschen absurd und ihren heimlichen Unmut weckte.
Als sie sich an jenem Freitagabend ankleidete und passend zu dem Anhänger, den sie um den Hals trug, die Rubine in die Ohren steckte, fiel ihr unvermittelt wieder ein, wie James einmal den Anhänger gepackt und in den Mund genommen hatte. Bei dem Gedanken an James hatte sie leise gelächelt. Harry, der neben ihr stand und die Spitzen an seinen Handgelenken glattstrich, bemerkte ihr Lächeln und verstand es als Aufforderung. »Verdammt, Dona«, hatte er gesagt, »warum siehst du mich so an? Komm, wir gehen nicht ins Theater, zum Teufel mit Rockingham, zum Henker mit der Welt, warum bleiben wir nicht einfach zu Hause?« Der arme Harry, wie eitel, wie typisch für ihn, sich von einem Lächeln, das gar nicht ihm galt, zu sofortiger Anbetung hinreißen zu lassen. »Wie lächerlich du bist«, antwortete sie und wandte sich von ihm ab, damit er mit seinen unbeholfenen Fingern nicht ihre nackten Schultern betatschte. Sein Mund verzog sich umgehend zu dem verdrossenen, störrischen Strich, den sie so gut an ihm kannte. Später würden sie zum Theater aufbrechen, wie schon unzählige Male zuvor zu anderen Stücken und anderen Essen, gereizt und schlecht gelaunt, so dass über dem Abend schon eine gewisse Schärfe läge, noch ehe er überhaupt begonnen hatte.
Er hatte daraufhin seine Spaniels Duke und Duchess gerufen, die kläffend um Leckerbissen bettelten, immer wieder zu seinen Händen hochsprangen und das ganze Zimmer mit ihrem durchdringenden Gebell erfüllten.
»Na los, Duke, auf, Duchess«, hatte er sie angestachelt, »sucht, sucht«, und die Leckerbissen durchs ganze Zimmer und auf ihr Bett geworfen; um hinaufzugelangen, hatten die Hunde sich in die Vorhänge gekrallt und ununterbrochen weiter gekläfft. Dona hatte, bleich, kalt und wütend, die Finger in die Ohren gesteckt, um den Lärm auszublenden, und war aus dem Zimmer gerauscht, nach unten zu ihrer wartenden Kutsche, nur um von heißem Straßengestank und einem luftlosen, leeren Himmel empfangen zu werden.
Wieder holperte und taumelte die Kutsche über die unwegsame Landstraße, und dieses Mal war es das Kindermädchen, das sich rührte – die arme, unglückliche Prue, deren einfältiges, ehrliches Gesicht schlaff und fleckig war vor Müdigkeit –, welchen Groll musste sie gegen ihre Herrin hegen wegen dieser plötzlichen, unerklärlichen Reise. Dona fragte sich, ob sie wohl einen jungen Mann allein in London zurückgelassen hatte, der sich höchstwahrscheinlich als treulos herausstellen und eine andere heiraten würde; Prues Leben wäre zerstört, und all das nur wegen ihr, Dona, ihren Launen und Kapriolen und ihrer maßlosen Unzufriedenheit. Was gäbe es für die arme Prue in Navron House zu tun, außer mit den Kindern in der Auffahrt und im Garten auf und ab zu spazieren und sich seufzend nach den vielen Meilen entfernten Londoner Straßen zu verzehren? Gab es in Navron überhaupt einen Garten? Sie konnte sich nicht mehr erinnern. Es schien alles so lange her, dieser kurze Besuch nach ihrer Hochzeit. Sicher, es gab Bäume und den glitzernden Fluss und hohe Fenster, die aus einem langgestreckten Raum hinausblickten, alles andere hatte sie jedoch vergessen. Ihr war damals so übel gewesen; Henrietta war unterwegs und das Leben eine endlose Abfolge von Sofas, Übelkeitsanfällen und Riechfläschchen. Plötzlich überfiel Dona der Hunger – die Kutsche war gerade an einem Obstgarten vorbeigerumpelt, in dem Apfelbäume blühten, und sie wusste, sie musste jetzt etwas essen, auf der Stelle und ohne viel Federlesens, am Straßenrand in der Sonne. Sie alle mussten etwas zu sich nehmen. Sie streckte den Kopf aus dem Fenster und rief dem Kutscher zu: »Wir machen hier für eine Weile Halt, um zu essen. Kommen Sie und helfen Sie mir, neben der Hecke die Decken auszubreiten.«
Der Mann starrte verdutzt zu ihr hinunter. »Aber die Erde ist vielleicht feucht, und Sie werden sich erkälten, Mylady.«
»Unsinn, Thomas. Ich bin hungrig, wir alle sind hungrig, wir müssen etwas essen.«
Er kletterte von seinem Kutschbock herab, rot im Gesicht vor Verlegenheit, und sein Begleiter wandte sich ab und hüstelte hinter vorgehaltener Hand.
»In Bodmin gibt es eine Herberge, Mylady«, schlug der Kutscher vor, »dort könnten Sie bequem speisen und vielleicht ein bisschen ruhen; das wäre bestimmt passender. Wenn jemand hier vorbeikommt und Sie am Straßenrand sieht … ich glaube kaum, dass das Sir Harry gefallen würde …«
»Verdammt, Thomas, können Sie nicht einfach tun, was ich Ihnen sage?«, meinte seine Herrin, öffnete eigenhändig den Kutschenschlag und trat, das Kleid auf höchst anstößige Weise über die Knöchel gerafft, auf die verschlammte Straße. Armer Sir Harry, dachte der Kutscher, mit so etwas hatte er es tagtäglich zu tun. In weniger als fünf Minuten hatte sie alle im Gras am Straßenrand versammelt, das Kindermädchen, noch nicht ganz wach und mit blinzelnden runden Augen, und die Kinder, die verwundert um sich blickten. »Lasst uns alle ein wenig Ale trinken«, sagte Dona, »wir haben welches in dem Korb unter dem Sitz. Ich habe einen verrückten Appetit auf Ale. Ja, James, du bekommst auch etwas davon.« Und da saß sie nun, die Petticoats unter sich gerafft, die Kapuze verrutscht, stürzte ihr Ale hinunter wie eine beliebige bettelnde Vagabundin, gab sogar ein wenig auf ihre Fingerspitze, um ihren kleinen Sohn davon kosten zu lassen. Dabei lächelte sie die ganze Zeit den Kutscher an, um ihm zu zeigen, dass sie ihm die ruckhafte Fahrweise und seine Halsstarrigkeit nicht übelnahm. »Sie beide müssen auch etwas trinken, es ist genug für alle da«, sagte sie, und die Männer sahen sich gezwungen, mit ihr zu trinken, wobei sie dem Blick des Kindermädchens auswichen. Die hielt das ganze Gelage, ebenso wie die beiden, für unschicklich und sehnte sich nach einem ruhigen Raum in einem Gasthof mit frischem, warmem Wasser, um den Kindern Hände und Gesicht zu waschen.
»Wohin fahren wir?«, fragte Henrietta zum tausendsten Mal, blickte sich angewidert um und drückte das Kleid eng an den Körper, um es vor Dreck und Schlamm zu schützen. »Ist die Reise endlich zu Ende, und wir sind bald wieder zu Hause?«
»Wir fahren zu einem anderen Zuhause«, sagte Dona, »zu einem neuen, viel schöneren. Ihr werdet dort frei im Wald herumspringen und eure Kleider schmutzig machen können, ohne dass Prue euch ausschimpfen wird, denn es wird keine Rolle spielen.«
»Ich will meine Kleider nicht schmutzig machen. Ich will nach Hause«, sagte Henrietta mit bebenden Lippen. Sie sah Dona vorwurfsvoll an und dann – vielleicht war sie müde und alles so seltsam, diese Reise, dieses Herumsitzen am Straßenrand, und sie vermisste ihre tägliche Routine – begann sie zu weinen, und James, bis dahin noch stillvergnügt, riss den Mund auf und brüllte aus Mitgefühl mit. »Schon gut, meine Kleinen, meine Schätzchen«, sagte Prue, »ihr hasst den dummen Graben und die stachlige Hecke.« Sie nahm die beiden fest in die Arme, die deutlichen Untertöne in der Stimme galten ihrer Herrin, die all diesen Aufruhr verursacht hatte, so dass Dona voller Gewissensbisse aufstand und dabei auf die Überreste ihres Picknicks trat. »Also los, lasst uns schleunigst unsere Reise fortsetzen, aber um Gottes willen ohne Tränen«, sagte sie und stand einen Augenblick da, während sich das Kindermädchen und die Kinder mitsamt dem Essen wieder in die Kutsche verfrachteten. Ja, die Luft duftete nach Apfelblüten, nach Ginster und auch ein wenig nach Moos und Torf von den fernen Mooren; und irgendwo, nicht allzu fern, jenseits der Hügel, roch es mit Sicherheit feucht nach Meer.
Vergiss die Tränen der Kinder, vergiss Prues Groll und die zusammengepressten Lippen des Kutschers, vergiss Harry und seine besorgten, traurigen blauen Augen, als sie ihre Entscheidung verkündete. »Verdammt, Dona, was habe ich denn getan, was habe ich gesagt, weißt du denn nicht, dass ich dich vergöttere?« Vergiss all das, denn das hier war die Freiheit, eine Minute lang hier zu stehen; das Gesicht Sonne und Wind entgegengereckt, hieß leben, zu lächeln und allein zu sein.
Am Freitagabend, nach der albernen, idiotischen Eskapade in Hampton Court, hatte sie versucht, es Harry zu erklären. Sie hatte versucht, ihm klarzumachen, was sie meinte, dass nämlich der lächerliche Streich, den sie der Countess gespielt hatten, nur ein verquerer, blödsinniger Spaß war, ein Verrat an ihrer tatsächlichen Haltung; dass sie in Wirklichkeit fliehen wollte, ihrem eigenen Ich entfliehen, dem Leben, das sie gemeinsam führten; dass sie einen kritischen Punkt erreicht hatte und diese Krise allein meistern musste.
»Dann fahr eben nach Navron, wenn du unbedingt willst«, sagte er schmollend. »Ich schicke gleich eine Nachricht, dass sie dort alles für dich vorbereiten, dass das Haus geöffnet wird und Bedienstete bereitstehen. Aber ich verstehe es nicht. Warum so plötzlich, und warum hast du diesen Wunsch nicht schon früher geäußert? Und warum willst du nicht, dass ich mitkomme?«
»Weil ich allein sein möchte, weil ich dich in meiner augenblicklichen Stimmung verrückt machen würde und mich obendrein«, erklärte sie.
»Ich verstehe es nicht«, wiederholte er mit verkniffenem Mund und beleidigtem Blick, so dass sie den verzweifelten Versuch machte, ihm ihre innere Verfassung zu schildern.
»Erinnerst du dich an die Voliere meines Vaters in Hampshire?«, fragte sie, »wo die Vögel regelmäßig gefüttert wurden und in ihrem Käfig umherfliegen konnten? Und wie ich dann eines Tages einen Hänfling freigelassen habe, der aus meinen Händen geradewegs in Richtung Sonne flog?«
»Was willst du damit sagen?«, fragte er und verschränkte die Hände hinter dem Rücken.
»Genauso fühle ich mich. Wie der Hänfling vor seinem Flug«, sagte sie und wandte sich ab und lächelte, auch wenn sie es sehr ernst meinte, denn er wirkte so verwirrt, so hoffnungslos überfordert, wie er da stand in seinem weißen Nachthemd und sie schulterzuckend anstarrte, der arme Kerl. Sie konnte es gut verstehen, er zuckte die Schultern und stieg ins Bett, das Gesicht von ihr ab- und der Wand zugedreht, und sagte: »Hölle und Verdammnis, Dona, warum musst du nur so verflucht durchtrieben sein?«
3
Sie machte sich eine Weile an dem festgerosteten Riegel zu schaffen, der wahrscheinlich monatelang nicht mehr bewegt worden war, dann riss sie beide Fensterflügel auf, um frische Luft und Sonne ins Zimmer zu lassen. »Pfui! Hier riecht es wie in einem Grab«, rief sie, und als ein Sonnenstrahl die Scheibe traf, blickte das Spiegelbild des Dieners sie an, und sie hätte schwören können, dass er lächelte, doch als sie sich umdrehte, war er unbewegt und feierlich wie bei ihrer Ankunft, ein dünner, schmächtiger kleiner Mann mit einem runden Mündchen und seltsam weißem Gesicht.
»Ich kann mich nicht an Sie erinnern«, sagte sie. »Bei unserem letzten Besuch waren Sie noch nicht da.«
»Nein, Mylady«, antwortete er.
»Es gab einen alten Mann – ich habe seinen Namen vergessen –, der hatte Rheuma in sämtlichen Gliedern und konnte kaum gehen. Wo ist er jetzt?«
»Im Grab, Mylady.«
»Ach.« Sie biss sich auf die Lippen und wandte sich wieder zum Fenster. Lachte der Kerl sie etwa aus?
»Und Sie sind an seine Stelle getreten?«, fragte sie über die Schulter und blickte hinaus auf die Bäume.
»Ja, Mylady.«
»Und Ihr Name?«
»William, Mylady.«
Sie hatte vergessen, dass die Menschen in Cornwall so merkwürdig sprachen, fast ausländisch, mit einem eigenartigen Akzent. Zumindest nahm sie an, dass es sich um Kornisch handelte, und als sie sich umdrehte, um ihn erneut zu betrachten, war da wieder dieses angedeutete Lächeln, das sie auch im Fenster gesehen hatte.
»Ich fürchte, wir haben Ihnen eine Menge Unannehmlichkeiten bereitet«, sagte sie, »mit unserer plötzlichen Ankunft und dem Öffnen des Hauses. Es war natürlich viel zu lange verschlossen. Alles ist von einer Staubschicht bedeckt, ich wundere mich, dass es Ihnen nicht aufgefallen ist.«
»Es ist mir aufgefallen, Mylady«, sagte er, »aber da Eure Ladyschaft Navron nie einen Besuch abgestattet hat, schien es mir kaum der Mühe wert, mich um das Putzen der Zimmer zu kümmern. Es fällt schwer, auf eine Arbeit stolz zu sein, die weder bemerkt noch geschätzt wird.«
»Dann macht die untätige Herrin also den untätigen Diener?«, meinte Dona, wider Willen amüsiert.
»Natürlich, Mylady«, antwortete er würdevoll.
Dona schritt den langgestreckten Raum ab und prüfte die Sesselbezüge, die abgewetzt und verblichen waren. Sie strich über die Schnitzereien am Kaminsims und blickte hoch zu den Porträts an der Wand – Harrys Vater, gemalt von Van Dyck, was für ein langweiliges Gesicht er doch hatte –, und dieses hier, diese eingefasste Miniatur, zeigte sicherlich Harry selbst im Jahr ihrer Hochzeit. Sie erinnerte sich wieder – wie jung er darauf aussah und wie aufgeblasen. Sie legte das Porträt beiseite, sich des Blicks des Dieners sehr bewusst – was für ein merkwürdiger Mann er doch war –, schließlich riss sie sich zusammen: Kein Bediensteter hatte sie je in die Knie zwingen können.
»Würden Sie bitte dafür sorgen, dass alle Zimmer in diesem Haus gefegt und abgestaubt werden«, sagte sie, »dass das ganze Silber geputzt wird und überall Blumen stehen, dass, kurzgefasst, so verfahren wird, als wäre die Herrin des Hauses nicht müßig gewesen, sondern wohne schon seit vielen Jahren hier?«
»Es wird mir ein persönliches Vergnügen sein, Mylady«, sagte er mit einer Verbeugung und verließ den Raum. Und Dona stellte irritiert fest, dass er sie erneut ausgelacht hatte, nicht offen, nicht vertraulich, sondern gewissermaßen verstohlen, nur mit den Augen.
Sie trat durch die Fenstertür auf den Rasen vor dem Haus. Immerhin, die Gärtner hatten ihre Arbeit getan, das Gras war frisch gemäht, die strengen Hecken waren geschnitten, alles vielleicht erst gestern oder vorgestern in Eile, nachdem die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft ihrer Herrin eingetroffen war. Die armen Teufel, sie verstand ihre Nachlässigkeit; die reinste Pest musste sie sein, brachte ihren ruhigen Tagesablauf durcheinander, durchkreuzte ihre beschaulichen Gewohnheiten und belästigte diesen komischen Kerl William – war das wirklich Kornisch, was aus seinem Mund kam? – und störte die zwanglose Unordnung, in der er sich eingerichtet hatte.
Aus einem offenen Fenster irgendwo in einem anderen Teil des Hauses hörte sie Prues tadelnde Stimme, die nach heißem Wasser für die Kinder verlangte, und kräftiges Gebrüll von James – der arme Kleine, warum musste er auch gewaschen, gebadet und ausgekleidet werden, anstatt so, wie er war, in eine Decke gepackt und in einer dunklen Ecke schlafen gelegt zu werden? Sie ging über den Rasen auf eine Lücke zwischen den Bäumen zu, an die sie sich noch vom letzten Mal erinnerte, und, ja – sie hatte Recht gehabt, dort unten war der Fluss, schimmernd, gemächlich und geräuschlos. Noch war er von der Sonne beschienen, grün und golden gefleckt, und eine schwache Brise kräuselte das Wasser. Irgendwo sollte es ein Boot geben – sie musste daran denken, William danach zu fragen –, sie würde es besteigen und sich hinaus aufs Meer tragen lassen. Wie unvernünftig, wie abenteuerlich! James musste mitkommen, sie würden beide Hände und Gesicht ins Wasser tauchen und von der Gischt durchnässt werden, Fische würden aus dem Wasser springen, und Seevögel würden sie rufen. O Himmel, endlich entkommen, endlich entronnen, um frei zu sein! Konnte es wahr sein, dass sie mindestens dreihundert Meilen entfernt von der St James's Street war, weg vom Umkleiden fürs Abendessen, dem Swan und den Gerüchen in Haymarket, von Rockinghams abscheulichem, wissendem Lächeln, von Harrys Gähnen und seinen vorwurfsvollen blauen Augen? Hunderte Meilen weg auch von der Dona, die sie verachtete, der Dona, die aus Übermut oder Langeweile oder beidem zugleich der Countess in Hampton Court diesen idiotischen Streich gespielt hatte. In Rockinghams Hosen, maskiert und in einen Umhang gehüllt, war sie mit ihm und den anderen mitgeritten, hatte Harry (zu benebelt vom Alkohol, um zu verstehen, was vor sich ging) im Swan zurückgelassen und Straßenräuber gespielt. Sie hatten die Kutsche der Countess umstellt und sie gezwungen, auf die Landstraße hinauszutreten.
»Wer sind Sie und was wollen Sie?«, hatte die arme kleine alte Dame angstbebend gerufen, so dass Rockingham sein Gesicht an den Hals seines Pferdes pressen musste und vor unterdrücktem Lachen fast erstickte. Sie, Dona, hatte den Anführer gemimt und mit klarer, kalter Stimme gerufen:
»Hundert Guineen oder Eure Ehre.«
Die Countess, die Ärmste, mit ihren mindestens sechzig Jahren und einem Ehemann, der seit über zwanzig Jahren im Grab ruhte, hatte in ihrem Portemonnaie nach Sovereigns gekramt. Voller Angst, der junge Räuber aus der Stadt werde sie in den Straßengraben stoßen. Und als sie Dona das Geld übergab und ihr dabei ins maskierte Gesicht blickte, zitterten ihre Mundwinkel jämmerlich, als sie sagte:
»Verschont mich, in Gottes Namen, ich bin sehr alt und sehr müde.«
Woraufhin Dona, plötzlich von demütigender Scham gepackt, das Geld zurückgegeben und ihr Pferd gewendet hatte und ganz heiß vor Selbstverachtung, blind vor Tränen und dem Gefühl der Erniedrigung in die Stadt zurückgeritten war, während Rockingham brüllte: »Was zum Teufel war das denn, was ist passiert?«, und ihr folgte, und Harry, dem sie erzählt hatten, das Abenteuer werde nur ein Mondscheinritt nach Hampton Court sein, sich, wenn auch ein wenig unsicher bezüglich der Richtung, zu Fuß auf den Heimweg machte, um vor der Haustür auf seine Frau zu treffen angetan mit den Hosen seines besten Freundes.
»Ich hatte vergessen – gab es ein Kostümfest – war der König anwesend?«, fragte er, rieb sich die Augen und starrte sie verständnislos an. »Nein, verdammt noch mal«, antwortete Dona, »mit Kostümfesten ist es von jetzt an vorbei, ein für alle Mal. Ich gehe fort.«
Dann, später, oben im Schlafzimmer dieser endlose Streit, gefolgt von einer schlaflosen Nacht und einem weiteren Streit am nächsten Morgen, dann Rockingham, der vorbeikam und dem Dona Einlass verweigerte, dann ein Bote, der nach Navron ritt und Bescheid sagte, die Reisevorbereitungen und die Reise selbst, und jetzt war sie endlich hier, in Stille und Einsamkeit und immer noch unfassbarer Freiheit.
Hinter den Bäumen ging inzwischen die Sonne unter und tauchte den Fluss in einen matten roten Glanz, die Krähen stiegen auf und versammelten sich bei ihren Nestern, in blauen Fäden stieg aus den Kaminen kräuselnd der Rauch zum Himmel, und William zündete in der Halle die Kerzen an. Sie aß spät und erst als ihr der Sinn danach stand – frühe Abendessen gehörten jetzt, dem Himmel sei Dank, der Vergangenheit an –, und sie genoss die Mahlzeit mit neuem, schuldbewusstem Vergnügen, ganz allein am Kopfende der langen Tafel, während William hinter ihr stand und sie schweigend bediente.
Sie boten einen seltsamen Kontrast, er in seiner nüchternen dunklen Kleidung, mit seiner undurchdringlichen Miene, den Knopfaugen und dem runden Mündchen, und sie in ihrem weißen Kleid, den Rubinanhänger um den Hals und das Haar in modischen Locken hinter den Ohren festgesteckt.
Auf dem Tisch standen hohe Kerzen, vom offenen Fenster wehte ein Lüftchen herein und ließ die Flammen erzittern und tanzende Schatten auf ihr Gesicht werfen. Ja, dachte der Diener, meine Herrin ist schön, aber auch leicht reizbar und ein wenig traurig. Der Mund hat etwas Unzufriedenes, und zwischen den Augenbrauen deutet sich eine Falte an. Er füllte noch einmal ihr Glas und suchte nach Ähnlichkeiten zwischen der Frau vor ihm und dem Porträt oben in ihrem Schlafzimmer. Hatte er nicht erst vergangene Woche mit jemandem dort gestanden, und dieser Jemand hatte mit Blick auf das Bild scherzhaft gefragt: »Werden wir sie jemals zu Gesicht kriegen, William, oder wird sie für immer ein Symbol des Unbekannten bleiben?«, um dann bei näherem Hinsehen mit einem kleinen Lächeln hinzuzufügen: »Die Augen sind groß und sehr schön, William, aber auch ein wenig verschleiert. Da sind Male unter den Lidern. Als hätte jemand sie mit einem schmutzigen Finger hingetupft.«
»Gibt es Trauben?«, unterbrach die Herrin plötzlich das Schweigen. »Ich mag die dunklen, saftigen mit dem samtig staubigen Belag am liebsten.« – »Ja, Mylady«, antwortete der Diener, unsanft in der Gegenwart gelandet. Er holte ihr Trauben, schnitt mit einer silbernen Schere ein Büschel ab und legte es ihr auf den Teller, und bei dem Gedanken an die Neuigkeiten, die er morgen oder übermorgen zu überbringen hätte, wenn das Schiff mit der Springflut zurückkehrte, verzog sich sein Mund.
»William«, sagte sie.
»Mylady?«
»Mein Kindermädchen sagt mir, die Zimmermädchen oben seien alle neu. Sie hätten sie eingestellt, als Sie von meiner Ankunft erfuhren. Sie sagt, eine sei aus Constantine, eine andere aus Gweek, und sogar der Koch sei neu, ein Bursche aus Penzance.«
»Das ist vollkommen richtig, Mylady.«
»Aus welchem Grund, William? Ich war immer in dem Glauben, und ich denke, Sir Harry ebenfalls, dass Navron die ganze Zeit voll mit Personal ausgestattet war.«
»Mir schien, Mylady, und das war möglicherweise falsch, das müssen Sie entscheiden, ein untätiger Bediensteter reiche für das Haus. Ich habe im letzten Jahr ganz allein hier gelebt.«
Sie warf ihm über die Schulter einen Blick zu, während sie ihre Trauben aß.
»Dafür könnte ich Sie entlassen, William.«
»Ja, Mylady.«
»Wahrscheinlich werde ich das morgen früh auch tun.«
»Ja, Mylady.«
Sie aß weiter ihre Trauben und musterte ihn, verärgert, aber auch leicht verblüfft, dass ein Bediensteter ein so rätselhaftes Wesen sein konnte, und wusste, dass sie ihn nicht fortschicken würde.
»Angenommen, ich entlasse Sie nicht, William, was dann?«
»Dann werde ich Ihr treuer Diener sein, Mylady.«
»Wie kann ich mir dessen sicher sein?«
»Ich habe den Menschen, die ich schätze, immer treu gedient, Mylady.«
Darauf wusste sie keine Antwort, denn sein rundes Mündchen war so ausdruckslos wie immer, und auch sein Blick verriet nichts, doch sie spürte in ihrem Herzen, dass er sie gerade nicht auslachte, sondern die Wahrheit sagte. »Soll ich das als Kompliment auffassen, William?«, meinte sie schließlich und erhob sich, während er ihren Stuhl zurückzog.
»Als ein solches war es beabsichtigt, Mylady«, sagte er, worauf sie wortlos aus dem Zimmer rauschte und wusste, dass sie in diesem seltsamen kleinen Mann mit dem eigenartig halb vertraulichen Benehmen einen Verbündeten, einen Freund gefunden hatte. Sie schmunzelte bei dem Gedanken an Harry, der sie verständnislos anstarren würde: »Was für eine verdammte Unverschämtheit, der Kerl gehört ausgepeitscht.«
Natürlich traf all das überhaupt nicht zu, William hatte sich schändlich benommen, er hatte kein Recht, allein in dem Haus zu wohnen, kein Wunder, dass alles verstaubt war und nach Friedhof roch. Dennoch verstand sie ihn, denn war sie nicht aus den gleichen Gründen hergekommen? Vielleicht hatte William eine nörgelnde Ehefrau, ein sorgenbeladenes Leben in einem anderen Teil Cornwalls, vielleicht hatte auch er entkommen wollen? Während sie im Salon saß, in das Feuer starrte, das er für sie angezündet hatte, ein Buch im Schoß, das sie nicht las, fragte sie sich, ob er vor ihrem Erscheinen zwischen den Staubabdeckungen und Überzügen hier gesessen hatte und ihr übelnahm, dass jetzt sie dieses Zimmer benutzte. Oh, dieser wunderbare Luxus der Stille, auf so angenehme Weise allein zu sein, ein Kissen hinter dem Kopf, dazu ein Lufthauch vom offenen Fenster, der ihr übers Haar strich, und das in der Gewissheit, dass niemand mit lautem Gelächter und schnarrender Stimme zu ihr hereinplatzen würde, sondern all dies einer anderen Welt angehörte, einer Welt mit staubigem Pflaster, Gassengestank, Lehrjungen und schrecklicher Musik, einer Welt der Tavernen, falschen Freundschaften und der Sinnlosigkeit. Der arme Harry, er würde jetzt wahrscheinlich mit Rockingham im Swan zu Abend essen, sein Schicksal beklagen, über den Karten dösen, ein bisschen zu viel trinken und sagen: »Zum Teufel, sie hat immerzu etwas von einem Vogel gefaselt, behauptet, sie fühle sich wie ein Vogel, was hat sie verdammt noch mal wohl damit gemeint?« Und Rockingham mit seinem spitzen, maliziösen Lächeln und den zusammengekniffenen Augen, die andeuten sollten, er verstehe ihre weniger erfreulichen Eigenschaften, würde murmeln: »Das frage ich mich auch – das frage ich mich wirklich.«
Als bald darauf das Feuer erloschen war und das Zimmer allmählich abkühlte, ging sie hinauf in ihr Schlafzimmer und davor noch einmal kurz zu den Kindern, um nach dem Rechten zu sehen. Henrietta glich einer Wachspuppe, die blonden Locken rahmten ihr Gesicht, und der Mund war ein wenig geschürzt, während James in seiner Wiege im Schlaf eine Schnute zog, frech und pummelig wie ein kleiner Mops. Sie steckte seine Faust unter die Decke und küsste ihn, und er schlug lächelnd ein Auge auf. Sie stahl sich davon, schämte sich ihrer verstohlenen Zärtlichkeit – es war so primitiv, so verachtenswert, sich zu solch einer Narretei hinreißen zu lassen, nur weil er ein Junge war. Zweifellos würde er später wenig attraktiv sein, fett und aufgedunsen, und irgendeiner Frau das Leben schwer machen.
Jemand – William, vermutete sie – hatte einen Fliederzweig geschnitten und ihn in ihrem Zimmer unter ihrem Porträt auf den Kaminsims gestellt. Der Raum war erfüllt von seinem schweren, süßen Duft. Gott sei Dank, dachte sie, als sie sich auskleidete: Hier gibt es keine trippelnden Spanielpfoten, keine Kratzgeräusche und keinen Hundegestank, das große, weiche Bett gehört mir ganz allein. Ihr Porträt blickte interessiert auf sie herab. Habe ich tatsächlich einen solchen Schmollmund und blicke ich so gereizt? Habe ich vor sechs, sieben Jahren tatsächlich so ausgesehen? Sehe ich noch immer so aus?
Sie schlüpfte in ein weißes, seidig kühles Nachthemd, reckte die Arme über den Kopf und beugte sich aus dem Fenster. Zweige bewegten sich vor dem Himmel. Unterhalb des Gartens, weiter hinten im Tal, strömte der Fluss der Flut entgegen. Sie stellte sich vor, wie das Süßwasser, aufgewühlt vom Frühlingsregen, gegen die salzigen Wellen brandete, bevor beide sich vermischten und dann am Ufer brachen. Sie zog die Vorhänge zurück, damit Licht ins Zimmer strömte, und ging zum Bett und stellte ihren Kerzenhalter auf das Nachttischchen.
Im Halbschlaf dösend, sah sie, wie der Mond Muster auf den Fußboden malte, und fragte sich, was das für ein anderer, stärkerer, strengerer Geruch war, der sich mit dem Flieder mischte, sie wusste keinen Namen dafür. Der Geruch stach ihr jetzt sogar in die Nase, als sie den Kopf auf dem Kissen drehte. Er schien aus der Schublade des Tischchens aufzusteigen, und so streckte sie die Hand aus und öffnete sie, um nachzusehen. Ein Buch lag darin und eine Dose Tabak. Natürlich war es der Tabak, den sie gerochen hatte. Sie nahm die Dose heraus, das Zeug war braun, stark und frisch geschnitten. William war doch gewiss nicht so dreist gewesen, in ihrem Bett zu schlafen, rauchend hier zu liegen und dabei ihr Porträt zu betrachten? Das wäre des Guten ein bisschen zu viel, in der Tat wäre es unverzeihlich. Etwas an diesem Tabak war sehr persönlich, passte so wenig zu William, dass sie sich mit Sicherheit täuschte – und doch – hatte William nicht ein Jahr lang ganz allein in Navron gelebt?