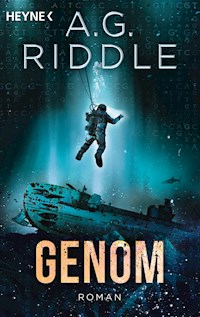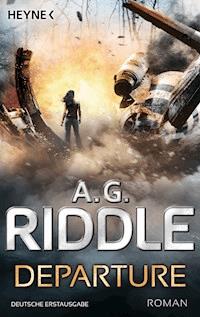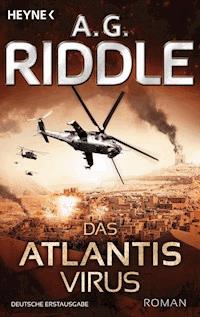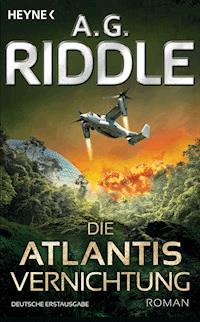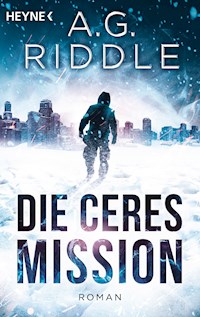
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine neue Eiszeit bedroht die Erde. Ist unser Planet noch zu retten?
Die Sonne wärmt nicht mehr, Eis und Schnee werden die Erdoberfläche bald vollständig bedecken. Eine internationale Mission zur Erforschung des rätselhaften Kälteeinbruchs endet in einer Katastrophe. Emma Matthews, Kommandantin der ISS, muss im Weltall um ihr eigenes Überleben kämpfen. Um sie und die Mission zu retten, schickt die NASA den Wissenschaftler Dr. James Sinclair. Aber auch auf der Erde hat der Kampf begonnen: Ressourcen und Lebensraum werden knapp, die zivilisierte Welt versinkt im Chaos. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt! Emma und James müssen die Menschheit vor dem Schlimmsten bewahren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Anstatt der erwarteten Klimaerwärmung kühlen die Temperaturen auf der Erde drastisch ab. Gletscher breiten sich aus und schränken den Lebensraum der Menschen ein. Die Regierungen arbeiten unermüdlich daran, dieses Phänomen zu erklären.
Emma Matthews, Commander der ISS, entdeckt ein Artefakt, das vermutlich die Sonneneinstrahlung auf die Erde blockiert. Kurz nachdem sie diese Entdeckung an die Erde gemeldet hat, wird die ISS angegriffen. Emma kann sich in ihren Raumanzug retten und überlebt als Einzige. Die NASA schickt ihr eine Rettungskapsel, in der sie überleben, aber nicht zur Erde zurückfliegen kann.
Der Wissenschaftler Dr. James Sinclair nimmt an einer Weltraummission teil, um das Artefakt zu untersuchen. Bald sind Emma und er die letzte Hoffnung der Menschheit.
Der Autor
A. G. Riddle wuchs in North Carolina auf. Zehn Jahre lang hat er diverse Internetfirmen gegründet und geleitet, bevor er sich aus dem Geschäft zurückzog. Seitdem widmet sich Riddle seiner wahren Leidenschaft: dem Schreiben. Riddle lebt in Parkland, Florida.
Lieferbare Titel
Das Atlantis-Gen, Das Atlantis-Virus, Die Atlantis-Vernichtung, Departure, Pandemie, Genom
A. G. Riddle
Die Ceres Mission
Roman
Aus dem Englischen übersetzt von Friedrich Mader
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe WINTER WORLD erschien 2019 bei Legion Books.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2021
Copyright © 2019 by A. G. Riddle
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock.com (tuulijumala, ClickHere, Shukaylova Zinaida, Esteban De Armas, BERNATSKAIA OKSANA, ALEKSANDR RIUTIN, Avesun, Vink Fan) und © Adobe Stock.de (vitezslavmalina)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-25814-6V002
www.heyne.de
Für meine Mutter, die viel zu früh von uns gegangen ist, aber diese Welt als besseren Ort zurückgelassen hat.
1
EMMA
In den letzten fünf Monaten habe ich mit angesehen, wie die Welt stirbt.
Über Kanada und England, über Russland und Skandinavien haben sich Gletscher geschoben und alles auf ihrem Weg niedergewalzt. Nichts deutet darauf hin, dass sie damit aufhören werden. Die Daten sprechen eine klare Sprache.
In sechs Monaten wird das Eis die ganze Erde bedecken und dem uns vertrauten Leben ein Ende setzen.
Ich habe die Aufgabe, die Ursache dafür herauszufinden.
Und die Zerstörung aufzuhalten.
Der Alarm weckt mich. Ich kämpfe mich aus dem Schlafsack und ziehe die Tür zu meiner Schlafstelle auf.
Seit meiner Ankunft in der Internationalen Raumstation ISS schlafe ich schlecht. Vor allem seit dem Beginn der Winterexperimente. Jede Nacht wälze ich mich hin und her, weil mir die Frage keine Ruhe lässt, was die Sonden wohl entdecken und ob die Daten einen Weg zu unserer Rettung aufzeigen werden.
Ich drifte hinaus ins Harmony-Modul und tippe auf den Monitor an der Wand, um den Grund für das Kreischen der Sirene zu identifizieren. Offenbar haben sich die Radiatoren der Solaranlage überhitzt. Ich kann mit bloßem Auge verfolgen, wie die Temperatur in die Höhe klettert. Warum bloß? Ich muss was dagegen unternehmen …
Knisternd meldet sich in meinem Ohrhörer Sergejs Stimme mit ihrem russischen Akzent. »Ist Solaranlage, Commander.«
Ich schaue in die Kamera. »Das heißt?«
Schweigen.
»Sergej, antworte. Sind es Trümmer? Woher kommt der Wärmestau?«
Es gibt eine Million Todesarten auf der ISS. Der Ausfall der Solaranlage gehört zu den sichersten. Und für so eine Störung kommen viele Auslöser infrage. Die Anlage funktioniert ähnlich wie Fotovoltaik auf der Erde: Sonnenstrahlung wird in elektrischen Strom umgewandelt. Bei diesem Vorgang wird sehr viel überschüssige Wärme erzeugt. Diese wird mit Radiatoren abgeleitet, die weg von der Sonne ins Dunkel des Alls gerichtet sind. Wenn sich diese Radiatoren überhitzen, wird die Wärme nicht mehr abgelenkt und dringt in die Station ein. Mit lebensbedrohlichen Folgen.
Wir müssen die Ursache ausfindig machen, und zwar schnell.
Sergej klingt fahrig, vielleicht auch gereizt. »Sind keine Trümmer, Commander. Ich erkläre, sobald ich weiß. Bitte schlaf weiter.«
Die Tür der benachbarten Schlafstelle gleitet auf. Dr. Andrew Bergin schaut mit verquollenen Augen heraus. »Hi, Emma. Was ist los?«
»Die Solaranlage.«
»Okay so weit?«
»Bin mir noch nicht sicher.«
»Sergej, hast du eine Ahnung, woran es liegt?«
»Glaube ich, liegt an Sonneneinstrahlung. Zu hoch«, antwortet Sergej über die Intercom.
»Eine Sonneneruption?«
»Ja. Muss sein. Ist keine Fehlfunktion von einzelnen Radiatoren – sind alle überhitzt.«
»Schalt sofort die Anlage ab. Geh auf Batteriestrom.«
»Commander …«
»Mach es, Sergej. Sofort.«
Der Monitor zeigt die acht Flügel der Solaranlage und ihre dreiunddreißigtausend Solarzellen. Ich beobachte, wie sie erlöschen. Langsam ticken die Temperaturwerte der Radiatoren nach unten.
Wir können eine Weile im Batteriebetrieb laufen. Schließlich machen wir das fünfzehn Mal am Tag – immer wenn sich die Solaranlage im Erdschatten befindet.
Bergin stellt die Frage, die auch mich beschäftigt. »Irgendwelche Daten von den Sonden?«
Ich prüfe es bereits nach.
Vor einem Monat hat ein internationales Konsortium Sonden ins Weltall gesandt, um die Sonnenstrahlung zu messen und nach möglichen Anomalien zu suchen. Die Sonden sind Teil der Winterexperimente – des größten Forschungsunternehmens aller Zeiten. Die Experimente dienen allein dem Ziel, die Ursachen für die Abkühlung der Erde zu ermitteln. Wir wissen, dass die Sonnenleistung nachlässt, obwohl das nicht sein kann. Eigentlich müsste sich die Erde erwärmen.
Die Daten der Sonden werden als Erstes die ISS erreichen. Bisher ist noch nichts eingetroffen. Diese Daten könnten die Menschheit retten. Oder uns einfach mitteilen, wie viel Zeit uns noch bleibt.
Ich sollte mich wieder hinlegen. Doch wenn ich erst mal auf bin, bin ich auf.
Zumal ich es gar nicht erwarten kann, die Daten der Sonden zu sehen. Ich habe Verwandte auf der Erde und möchte wissen, was auf sie zukommt. Außerdem gibt es eine unausgesprochene Frage, die alle sechs Astronauten und Kosmonauten auf der ISS bewegt: Was wird aus uns? Wenn die Welt unaufhaltsam auf ihren Untergang zusteuert – und vielleicht bald nicht mehr existiert –, werden sie uns einfach hier oben lassen? Drei von uns sollen in einem Monat, die anderen drei in vier Monaten zurückkehren. Aber werden unsere Nationen überhaupt die Mittel für eine Rückholung aufbringen? Schon jetzt sind sie mit einer Flüchtlingskrise von noch nie da gewesenen Ausmaßen konfrontiert.
Überall auf der Welt mühen sich Regierungen, Milliarden von Staatsangehörigen in die letzten bewohnbaren Zonen der Erde zu evakuieren. Dabei stehen sie vor einer schweren Entscheidung: Was passiert mit denen, die nicht evakuiert werden können? Und wie viel werden sie investieren, um sechs Menschen aus dem Weltall nach Hause zu holen?
Die Heimkehr ist kein Spaziergang. Die ISS verfügt über keine Rettungskapseln, sondern nur über die beiden Sojus-Raumschiffe, die uns hergebracht haben. Beide sind auf maximal drei Passagiere ausgelegt. Mit ihnen könnten wir die Station verlassen. Dafür wäre allerdings eine Koordination vom Boden nötig, und man müsste uns nach der Landung abholen.
Nach der Rückkehr zur Erde brauchen wir sogar noch mehr Hilfe. Rehamaßnahmen zum Beispiel. Im All verlieren unsere Knochen wegen der fehlenden Schwerkraft ihre Dichte. Am stärksten sind davon die tragenden Knochen betroffen: Becken, Rückgrat und Beine. Die Knochen zerfallen buchstäblich, ähnlich wie bei Osteoporose. Das in den Körper einsickernde Kalzium verursacht Nierensteine – und für solche Beschwerden ist der Weltraum ein denkbar ungünstiger Ort. Einige der ersten Astronauten auf der ISS verloren bis zu zwei Prozent Knochendichte pro Monat. Durch Training konnten wir diese Zahlen deutlich senken, trotzdem muss ich nach der Heimkehr ein Rehaprogramm absolvieren. In welcher Verfassung ich bin, werde ich erst erfahren, wenn meine Füße wieder festen Boden betreten (oder Eis, je nachdem).
Die schlichte Wahrheit ist, dass sich unser Nutzen für die Leute dort unten auf die Winterexperimente beschränkt. Wenn wir nicht klären können, was hinter dem Langen Winter steckt – und wie wir ihn vor allem aufhalten können –, werden wir diese Station nie mehr verlassen. Wir bleiben gefangen zwischen der kalten Dunkelheit des Alls und dem gefrierenden Planeten dort unten. Fürs Erste immerhin sind wir hier zu Hause. Und werden es wohl auch noch eine Weile sein.
Tatsächlich ist es ein gutes Zuhause. Das beste, das ich je hatte.
Ich stoße mich mit Händen und Füßen ab, um mich durch die Ansammlung von Modulen treiben zu lassen, aus denen die ISS besteht. Die Station ist eine Abfolge zusammengeschraubter, im rechten Winkel abzweigender Riesenröhren. Die meisten enthalten Labors, einige sind nur Verbindungsstücke.
Unity ist das erste von den USA gebaute Element der ISS aus dem Jahr 1998. Es verfügt über sechs Kupplungsstutzen, so ähnlich wie Öffnungen in einem Kanalisationssystem.
Ich schwebe weiter in den Tranquility-Knoten, der Ausrüstung zur Lebenserhaltung, Systeme zur Wasser- und Luftaufbereitung und eine Toilette enthält, die so schwer zu benutzen ist, wie man es angesichts der Umstände im All erwarten kann. Ganz zu schweigen davon, dass die ISS von und für männliche Astronauten konstruiert wurde.
Ich drifte weiter in das Aussichtsmodul der Europäischen Weltraumorganisation. Es hat eine Kuppel mit sieben achtzig Zentimeter breiten Fenstern, die einen Panoramablick auf das All und die Erde ermöglichen. Hier bleibe ich einige Sekunden und schaue mich nach allen Seiten um.
Die ISS fliegt in einer Höhe von rund vierhundert Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von achtundzwanzigtausend Stundenkilometern über der Erde. Sie umkreist den Planeten 15,54 Mal am Tag, das heißt, wir sehen alle fünfundvierzig Minuten die Sonne auf- oder untergehen.
Die Station überquert den Terminator, und Nord- und Südamerika erscheinen im Tageslicht.
Wie weiße, knöcherne Finger hat sich das Eis bis in das Blau der Großen Seen ausgebreitet. Bald werden die Gletscher das Wasser überquert haben und ihren Weg nach Süden fortsetzen. Michigan, Wisconsin, Minnesota und Teile von New York wurden bereits evakuiert.
Die USA haben genau gerechnet. Sie wissen, wo die letzten bewohnbaren Zonen der Erde sein werden: unter Meereshöhe. Im kalifornischen Death Valley wurde ein riesiges Lager eingerichtet. Mit Libyen und Tunesien wurden Handelsvereinbarungen geschlossen. Allerdings wissen alle, dass diese Vereinbarungen kaum halten werden. Nicht, wenn es um das Überleben aller geht.
Die Welt wird versuchen, acht Milliarden Menschen durch einen Trichter zu stopfen, in dem nur ein Bruchteil davon Platz hat.
Es wird Krieg geben.
Auf dem Laufband rufe ich einen Zwischenbericht zur Station ab. Sergej hat die Solaranlage noch nicht wieder zum Laufen gebracht. Ich würde gern nachfragen, doch ich weiß inzwischen, dass er am besten arbeitet, wenn man ihn in Ruhe lässt. Wenn sechs Leute in äußerst beengten Verhältnissen miteinander leben, ist das unvermeidlich: Man lernt die Grenzen der anderen kennen.
Ich schaue erneut nach Daten der Sonden (noch nichts) und fange an, E-Mails zu lesen.
Die erste ist von meiner Schwester.
Ich habe nie geheiratet oder Kinder bekommen. Im Gegensatz zu meiner Schwester. Und ihre Kleinen liegen mir sehr am Herzen. In meinen Augen sind das die zwei liebsten Menschen, die es gibt.
Die E-Mail ist ein Film ohne Betreff oder besonderen Inhalt. Nur meine Schwester Madison, die in die Kamera spricht, während ich, mit Gurten gesichert, auf dem Laufband trabe.
»Hi, Em. Ich muss mich kurzfassen, dabei weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. David hat Gerüchte gehört. Es heißt … dass große Veränderungen anstehen. Dass ein Experiment läuft, das erklären soll, woher der Lange Winter kommt. Die Leute in der Gegend verschleudern ihre Häuser für ein Butterbrot und wollen nach Libyen oder Tunesien ziehen. Es ist verrückt. Sie schicken Truppen …«
Ungefähr eine Minute lang brechen Bild und Ton ab. Zensiert. Ich trabe weiter, ohne den Bildschirm aus den Augen zu lassen. Schließlich erscheint wieder das Gesicht meiner Schwester. Sie sitzt noch immer auf der Couch, und neben ihr drängen sich jetzt die Kinder. Owen und Adeline.
»Hi, Tante Em!«, plärrt Owen. »Schau mal!«
Er verschwindet aus dem Bild, dann schwenkt die Kamera, und ich sehe, wie er einen Basketball in einen Korb dunkt, der schätzungsweise einen Meter fünfzig über dem Boden hängt.
»Hast du es aufgenommen?«, fragt er seine Mom.
»Alles drauf.«
»Wenn nicht, kann ich es noch mal machen.«
Ich lächle, als meine Schwester die Kamera wieder auf sich richtet. »Holen sie dich nach Hause? Und wenn ja … wie geht es weiter mit dir? Du kannst ja eine Weile kein Auto fahren und musst ein Rehaprogramm machen. Du kannst natürlich bei uns wohnen, wenn dich die NASA hängen … wenn dir die NASA nicht auf die Beine helfen kann. Schreib mir bald zurück, okay? Ich hab dich lieb.« Madison wendet sich ihren zwei Kleinen zu, die sich inzwischen im Hintergrund streiten. »Verabschiedet euch von Tante Emma.«
Owen reckt den Kopf über die Couchlehne und winkt. »Bye.«
Adeline lässt sich neben ihrer Mutter niederplumpsen und beugt sich, offenbar kamerascheu, zu ihr. »Bye, Tante Emma. Ich hab dich lieb.«
Ich tippe gerade eine Antwort, als ein Dialogfenster erscheint:
Eingehende Daten: Sonde 127
Ich öffne es sofort und überfliege die Messwerte für die Sonnenstrahlung. Geschockt schüttele ich den Kopf. Sie sind viel höher als die Werte auf der Erde, und das kann eigentlich nicht sein, weil die Sonde so ziemlich den gleichen Abstand von der Sonne hat. Wurde die Sonde vielleicht von einer Eruption getroffen? Nein, das ist es nicht. Die Werte bleiben über einen längeren Zeitraum gleich. Möglicherweise ein lokales Phänomen.
Ich öffne das telemetrische Filmmaterial der Sonde, und mir bleibt fast das Herz stehen. Da ist ein Objekt. Irgendwo da draußen. Ein schwarzer Fleck vor der Sonne. Es ist kein Asteroid. Asteroiden sind zackig und felsig. Dieses Objekt ist glatt und rechteckig. Auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es sich handelt, eins steht fest: Dieser Gegenstand ist nicht auf natürliche Weise entstanden.
Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Boden – mit Behörden in den USA, Russland, Europa, China, Indien und Japan. Ich aktiviere den Link zur direkten Kommunikation mit dem Kontrollzentrum Goddard in Maryland.
»Goddard, hier ISS. Gerade kommen die ersten Daten der Sonden rein. Übertragung läuft. Vorab: Eins-zwei-sieben hat etwas gefunden.« Ich suche nach den richtigen Worten. »Erste Bilder zeigen ein … rechteckiges Objekt. Glatt. Offenbar kein Asteroid oder Komet. Wiederhole: Offenbar ein nicht natürliches, konstruiertes Objekt …«
Das Tablet wird dunkel. Das Laufband stoppt. Die Station erbebt. Lichter flackern.
Ich tippe auf die Intercom. »Sergej …«
»Stromüberlastung, Commander.«
Das begreife ich nicht. Die Solaranlage ist abgeschaltet. Wir laufen im Batteriebetrieb.
Erneut erbebt die Station.
Mein Instinkt übernimmt.
»Alle raus aus den Kojen! Sofort zu den Sojus-Kapseln! Evakuierungsprogramm in Kraft!«
Ein Ruck geht durch die Station, und ich werde an die Wand geschleudert. Alles dreht sich. Reflexartig stoßen mich meine Arme hinauf in die Kuppel. Durch die Fenster sehe ich, wie die Internationale Raumstation in Stücke zerbricht.
2
JAMES
Der Aufstand wird bald beginnen.
Ich spüre die Anspannung in der Luft.
Überall, wo ich hinkomme, werden Blicke getauscht, Nachrichten weitergegeben, Geheimnisse geflüstert.
Die Welt friert ein. Das Eis rückt auf uns vor, und wir sitzen alle in der Falle. Wenn wir nicht rauskommen, sterben wir hier.
Was sich da zusammenbraut, ist ein Plan zur Flucht. Das ist das Gute daran. Das Schlechte ist, dass ich nicht Teil dieses Plans bin. Niemand hat mir etwas erzählt, und ich bezweifle, dass sie es noch vorhaben.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als es hinzunehmen. Also mache ich meine Arbeit, ziehe den Kopf ein und schaue Nachrichten.
Auf dem ramponierten Fernseher läuft ein Beitrag von CNN. Durch das Donnern der Maschinen hinter mir ist der Sprecher kaum zu hören.
Am dritten Tag in Folge ist in Miami Schnee gefallen. Das ist ein neuer Rekord, und die Regierung von Florida hat um die Hilfe des Bundes gebeten.
Diese Forderung löste Proteste bei Bewohnern und Regierungen im ganzen Nordwesten aus, die den Bund ihrerseits dazu drängen, die Evakuierungen zu beschleunigen. Je länger sich der Lange Winter hinzieht …
Ich habe keine Ahnung, wer den Begriff Langer Winter geprägt hat. Vielleicht die Medien. Oder die Regierung. Jedenfalls hat er sich durchgesetzt. Die Menschen mögen ihn lieber als Vergletscherung (zu technisch) oder Eiszeit (zu beständig). Langer Winter klingt, als wäre das Ende gleich um die Ecke, als ginge es nur um eine Jahreszeit von ungewöhnlicher Dauer. Ich kann nur hoffen, dass das zutrifft. Sicher weiß man bei der National Oceanic and Atmospheric Administration und anderen Wetterbehörden auf der ganzen Welt inzwischen Bescheid. Uns haben sie jedenfalls nichts gesagt (daher die höchsten Einschaltquoten des Jahrhunderts bei Nachrichtensendungen).
Ein Signalton summt.
Ich ignoriere ihn.
Der nächste Nachrichtenbeitrag beginnt. Ich unterbreche meine Arbeit kurz und lasse die Bilder auf mich wirken.
Der Text am unteren Rand nennt Rosyth am Stadtrand von Edinburgh als Örtlichkeit. Ein Reporter mit kurzem grauen Haar steht auf einem Dock im Schatten eines riesigen weißen Kreuzfahrtschiffs. Die Gangway ist ausgefahren, und ein gleichmäßiger Strom von Menschen schlurft auf das Schiff zu. Die Bäume in der Ferne sind völlig weiß, als wären sie durch und durch gefroren. Der Schnee fällt in dicken Schwaden.
Das Bild hinter mir mag wirken, als würden Erholungssuchende zu einer Urlaubskreuzfahrt aufbrechen, doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Das Schiff, das Sie hier sehen, war bis vor drei Wochen als Emerald Princess unterwegs, ehe es von der Regierung Seiner Majestät aufgekauft und in Summer Sun umbenannt wurde. Es gehört zu einer Flotte von vierzig Kreuzfahrtschiffen, die die Einwohner Großbritanniens vorübergehend in wärmere Breiten transportieren werden.
Die Summer Sun soll nach Tunesien auslaufen, und von dort aus geht es für die Passagiere weiter in ein Auffanglager bei Kebili. Das Lager wurde im Rahmen eines langfristigen Pachtvertrags zwischen Großbritannien und Tunesien eingerichtet. Dieser Schritt folgt ähnlichen Maßnahmen vonseiten Norwegens, Schwedens und Finnlands. Das Programm erinnert an die Operation Pied Piper im Zweiten Weltkrieg, bei der dreieinhalb Millionen Zivilisten evakuiert wurden, um sie vor der Bedrohung durch die Nazis in Sicherheit zu bringen …
Immobilien in der Nähe des Äquators sind inzwischen heiß begehrt. So wie auch mehrere Regionen, die als »Winterrefugien« gelten – Orte unter Meereshöhe mit ungewöhnlich hohen Temperaturen: Death Valley in Kalifornien, in Libyen, Wadi Halfa im Sudan, Dascht-e Lut im Iran und Kebili in Tunesien. Hätte man in diesen Gegenden vor zwei Jahren bei Sonnenaufgang eine offene Tonne Benzin stehen lassen, wäre sie bis Mittag leer gewesen. Verdampft. Früher waren das Wüstenlandschaften. Heute sind sie Fanale der Hoffnung, Oasen im Langen Winter. Zu Millionen strömen die Menschen dorthin und verkaufen ihr Hab und Gut, um in den Lagern einen Platz zu ergattern. Ich frage mich, ob sie dort wirklich sicher sind.
Wieder meldet sich ein Summer. Gleicher Ton, andere Maschine. Trotzdem nicht das Signal, auf das ich warte.
Als es zum dritten Mal summt, sammle ich die Laken aus den drei Trocknern zusammen und falte sie zusammen.
Ich arbeite in der Wäscherei. Schon seit zwei Jahren, seit meiner Einlieferung in das Bundesgefängnis Edgefield. Wie die anderen zweitausend Häftlinge hier beteuere ich meine Unschuld. Doch im Gegensatz zu den meisten von ihnen bin ich tatsächlich unschuldig.
Wenn ich mir etwas vorzuwerfen habe, dann die Erfindung von etwas, wofür die Welt nicht bereit war. Eine Innovation, die ihr Angst einjagte. Mein Fehler – oder mein Verbrechen, wenn man so will – war, dass ich nicht mit der menschlichen Natur gerechnet habe. Menschen fürchten das Unbekannte, vor allem wenn es sich um neue Entwicklungen handelt, die ihr Leben verändern könnten.
Der Staatsanwalt, der meinen Fall übernahm, fand ein obskures Gesetz und statuierte ein Exempel an mir. Die Botschaft an andere Erfinder war eindeutig: So etwas wollen wir nicht.
Mit dreiunddreißig Jahren wurde ich schuldig gesprochen. Wenn ich hier rauskomme, werde ich siebzig sein. (Bei Urteilen eines Bundesgerichts gibt es keinen Hafturlaub. Frühestens nach Absitzen von fünfundachtzig Prozent meiner Strafe kann ich bei guter Führung mit meiner Entlassung rechnen.)
Nach meiner Ankunft in Edgefield tüftelte ich sechs Fluchtmöglichkeiten aus. Zusätzliche Recherchen ergaben, dass nur drei davon gangbar waren. Zwei versprachen sogar eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Das Problem ist nur: was dann? Nach dem Prozess wurde mein Vermögen beschlagnahmt. Jede Kontaktaufnahme mit meinen Freunden und Verwandten würde sie in Gefahr bringen. Und die ganze Welt würde Jagd auf mich machen und mich nach meiner Ergreifung vielleicht sogar umbringen.
Also bleibe ich. Und kümmere mich um die Wäsche. Außerdem versuche ich, etwas zu bewegen. Das entspricht einfach meinem Wesen, und ich habe die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass die menschliche Natur vielleicht das Einzige ist, dem man nicht entrinnen kann.
Tag für Tag erscheinen weniger Wärter zur Arbeit.
Das bereitet mir Sorgen.
Ich kenne den Grund: die Gefängnismitarbeiter ziehen nach Süden in die bewohnbaren Zonen. Keine Ahnung, ob sie von den Bundesbehörden verlegt werden oder in Eigenregie handeln.
Ein Krieg steht bevor – ein Krieg um die letzten bewohnbaren Regionen der Erde. Leute mit militärischer oder polizeilicher Erfahrung werden stark gefragt sein. Das Gleiche gilt für Justizvollzugsbeamte. Sehr wahrscheinlich werden die Lager Gefängnissen ähneln. Der Staat wird also Männer und Frauen brauchen, die sich dank ihrer Ausbildung darauf verstehen, eine große, beengt lebende Gruppe im Zaum zu halten. Davon hängt das Leben der gesamten Gruppe ab.
Und genau das ist ein Problem für mich. Edgefield, South Carolina, liegt auf halber Strecke zwischen Atlanta und Charleston. Zwar schneit es jetzt im August auch hier, aber die Gletscher sind noch nicht zu uns vorgedrungen. Bevor das Eis da ist, muss die Gegend evakuiert werden. Die Evakuierung wird keine Strafgefangenen einbeziehen. Schon mit der Rettung aller Kinder im Land werden die Behörden überfordert sein, von den Erwachsenen gar nicht zu reden. Bestimmt werden sie also nicht auch noch Häftlinge mitschleppen (zumal wenn die Reise über den Atlantik zu den bewohnbaren Zonen in Nordafrika führt). Priorität wird für sie haben, dass die Häftlinge nicht entkommen und den Menschenströmen nach Süden folgen. Das würde bloß zu zusätzlichen Scherereien führen, die sich der Staat nicht leisten kann. Das heißt, sie werden uns hier einsperren. Im günstigsten Fall.
Aufgrund der Umstände habe ich meine Fluchtpläne wiederbelebt. So wie anscheinend alle anderen Insassen auch. Hier herrscht eine Atmosphäre wie kurz vor dem Feuerwerk am Unabhängigkeitstag. Wir alle warten auf die ersten Explosionen. Danach wird alles schnell und schonungslos über die Bühne gehen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer von uns überlebt.
Ich muss mich wirklich beeilen.
Die Tür zur Wäscherei öffnet sich, und ein Vollzugsbeamter tritt ein.
»Morgen, Doc.«
Ich schaue nicht von meinen Laken auf. »Morgen.«
Pedro Alvarez ist meiner Meinung nach einer der besten Wärter hier. Er ist jung und aufrichtig und treibt keine Spielchen.
Zumindest in einer Hinsicht war das Gefängnis gut für mich. Es hat mir eine wertvolle Gelegenheit geboten, die menschliche Natur zu studieren – denn genau dort lag, wie schon erwähnt, mein blinder Fleck und die eigentliche Ursache für meinen unfreiwilligen Aufenthalt hier.
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es den meisten Vollzugsbeamten bei ihrer Tätigkeit nur um eines geht: Macht. Sie entscheiden sich für diesen Beruf, um Macht über andere zu haben. Das beruht auf einer elementaren Eigenschaft der menschlichen Natur: Wir sehnen uns im Erwachsenenalter nach dem, was uns in der Kindheit vorenthalten wurde.
Pedro ist die Ausnahme von dieser Regel. Das machte ihn mir sympathisch. Ich suchte seine Freundschaft und konnte mit der Zeit seine völlig anders geartete Motivation erschließen. Folgendes habe ich über ihn herausgefunden: Seine Verwandten – Eltern, Brüder und Schwestern – leben noch in Mexiko. Er hat eine Frau, die siebenundzwanzig ist wie er, und zwei Söhne, der eine fünf, der andere drei Jahre alt. Außerdem weiß ich, dass seine Frau der einzige Grund ist, warum er hier arbeitet.
Pedro stammt aus Michoacán, einem gebirgigen Bundesstaat von Mexiko, in dem die Drogenkartelle das Sagen haben und Morde häufiger sind als Verkehrsunfälle. Pedro zog hierher, als seine Frau schwanger wurde, weil er nicht wollte, dass seine Kinder genauso aufwachsen wie er.
Untertags arbeitete er in einer Landschaftsgärtnerei, und an den Abenden und Wochenenden studierte er Strafrecht am Spartanburg Community College. Am Abschlusstag teilte er seiner Frau seine Absicht mit, eine Tätigkeit als Sheriff im Spartanburg County anzutreten. Er wollte nicht, dass in seiner neuen Heimat ähnliche Verhältnisse entstehen wie in Michoacán. Hier herrschen Recht und Ordnung, und daran sollte sich um seiner Kinder willen nichts ändern.
Eine weitere Wahrheit: Eltern wünschen sich für ihre Kinder, was sie selbst nie hatten.
Nach Pedros Ankündigung schlug seine Frau im Internet die Sterblichkeitsrate von Polizeibeamten nach und stellte ihm ein Ultimatum: Entweder er suchte sich einen anderen Beruf – oder eine andere Frau.
Letztlich schlossen sie einen Kompromiss. Pedro entschied sich für eine Laufbahn im Strafvollzug, dessen Sterblichkeitsstatistik und Arbeitszeiten für Maria Alvarez akzeptabel waren. Weitere Vorteile waren bessere Zusatzleistungen, Überstundenvergütung, fünfundzwanzig Prozent Aufschlag für Sonntagsarbeit und die Möglichkeit, nach fünfundzwanzig Dienstjahren mit vollen Bezügen in Rente zu gehen – also kurz vor seinem neunundvierzigsten Geburtstag. Eine gute Wahl. Zumindest bis zum Beginn des Langen Winters.
Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Pedro die Anstalt als einer der Ersten verlassen wird. Ich stellte mir seine Rückkehr nach Mexiko vor, wo seine Verwandten leben und bewohnbare Zonen eingerichtet werden. Bald werden die Horden aus Kanada und den USA dort einfallen.
Stattdessen ist er einer der Letzten, die geblieben sind. Meine wissenschaftliche Neugier drängt mich, den Grund herauszufinden. Mein Überlebenswille zwingt mich dazu.
»Hast du den Kürzeren gezogen, Pedro?«
Seine eine Augenbraue wandert nach oben.
Pedro ist so ziemlich der einzige Freund, den ich hier habe, deshalb muss ich die nächsten Worte einfach aussprechen. »Du solltest nicht mehr hier sein. Du müsstest mit Maria und den Kindern schon längst auf dem Weg nach Süden sein.«
Er vertieft sich in den Anblick seiner Stiefel. »Ich weiß, Doc.«
»Warum bist du dann noch hier?«
»Nicht genug Dienstjahre. Oder nicht genug Freunde. Oder vielleicht beides.«
Er hat recht: Beides stimmt. Außerdem rechnen seine Vorgesetzten wahrscheinlich damit, dass er sich zur Wehr setzt, wenn der Aufstand anfängt. In der Welt, in der wir leben, halten die Besten den Kopf für andere hin – und kommen als Erste unter die Räder.
Pedro zuckt die Achseln. »Gehört nicht zu den Zusatzleistungen.«
In der Tür taucht ein Häftling auf und lässt mit starren, weiten Augen den Blick durch den Raum wandern. Total zugedröhnt. Und er hat etwas in der Hand. Marcel ist alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse.
Pedro dreht sich um.
In diesem Moment springt Marcel nach vorn, umschlingt Pedros Oberkörper und Arme mit seiner fleischigen Pranke und hält dem Wärter ein selbst gebasteltes Messer an den Hals.
Die Zeit steht still. Wie durch einen Nebel registriere ich das Surren der Waschmaschinen und Trockner und das beharrliche Plärren der Nachrichten. Dann setzt eine neue Wahrnehmung ein. Ein Poltern in der Ferne wie näher kommender Donner. Ein Mob, der durch die Gänge des Gefängnisses zieht. Rufe übertönen die Schritte, ohne dass Worte zu verstehen sind.
Pedro wehrt sich gegen Marcels Griff.
Ein anderer Insasse erscheint in der Tür. Breiter Brustkasten, völlig überdreht. Seinen Namen kenne ich nicht. Er schreit: »Hast du ihn, Marcel?«
»Hab ihn.«
Der andere huscht davon, und Marcel fixiert mich. »Die wollen uns hier erfrieren lassen, Doc. Das muss dir doch klar sein.« Er wartet.
Ich sage nichts.
Zähneknirschend kämpft Pedro gegen die eiserne Umklammerung an.
»Bist du auf unserer Seite, Doc?«
Pedros rechte Hand reißt sich los und zuckt zu seiner Tasche. Ich habe noch nie eine Waffe an ihm gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt eine besitzt.
Marcel fackelt nicht lange und drückt Pedro das Messer fester an den Hals.
Und ich treffe eine Entscheidung.
3
EMMA
In der Kuppel neben dem Tranquility-Modul schwebend, verfolge ich, wie die Internationale Raumstation zerbeult und zusammengestaucht wird. Wie ein Farmhaus im Mittleren Westen bei einem Tornado.
Die Solaranlage fällt auseinander, die Zellen wirbeln davon wie Dachschindeln. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Vakuum des Weltraums durch einen Riss in die Station eindringt.
In diesem Meer der Zerstörung sehe ich eine letzte Hoffnung: die angedockten Sojus-Kapseln in ihren Buchten. Bloß werde ich es nie bis dorthin schaffen. Genauso wenig wie Sergej und Stephen.
»Pearson, Lewis, Bergin, steigt in die Sojus am Rasswet. Sofort. Das ist ein Befehl.«
Für solche Notfälle haben wir geübt. Die Sojus kann sich in drei Minuten von der ISS lösen und in vier Stunden in Kasachstan landen.
In meinem Ohrhörer knistert eine Stimme, die ich nicht verstehe. Der interne Kanal ist tot. Haben sie mich gehört? Ich kann es nur hoffen.
Und ich muss dem Kontrollzentrum Bescheid sagen.
»Goddard, wir verlassen die ISS …«
Die Wand kracht gegen mich und schleudert mich an das Schott gegenüber. Dunkelheit will mich verschlingen.
Ich stoße mich ab und gleite durch den Tranquility-Knoten. Eine Ohnmacht nagt an mir, doch ich dränge mich hindurch wie eine Schwimmerin, die in einem Strudel gegen das Ertrinken ankämpft.
Ich sitze auf der Station fest, und wahrscheinlich dauert es nur noch wenige Sekunden, bis sie auseinanderplatzt und alles nach draußen gesaugt wird. Ich habe nur noch eine Überlebenschance: einen Raumanzug.
Sofort schlüpfe ich in den nächsten Anzug und schnalle ihn an der Stationswand fest. Damit habe ich Sauerstoff, Strom, Funkverbindung – falls sie noch funktioniert.
»Goddard, hören Sie mich?«
»Wir hören Sie, Commander Matthews. Aktueller Stand?«
Bevor ich antworten kann, explodiert um mich herum das Modul. Ich versinke in Dunkelheit.
Das Bewusstsein kehrt in Wellen zurück. Begleitet von Empfindungen, als würden die Schichten einer Zwiebel abgeschält – anfangs fast nichts, dann immer stärker: Schmerz, Übelkeit und völlige Stille.
Ich bin noch immer festgeschnallt. Das Modul unter mir ist auseinandergerissen. Tief unten erkenne ich die Erde. Ein Eisblock bedeckt Sibirien und schiebt sich auf China zu. Der Gegensatz zwischen dem Weiß und den grünen Wäldern wäre wunderschön, wenn er nicht für Tod und Zerstörung stünde.
Bruchstücke der Station schwirren durch das All wie fliegende Legosteine.
Nirgends eine Sojus-Kapsel.
Auf der Intercom rufe ich nach meiner Crew.
Keine Antwort.
Dann probiere ich es bei den Kontrollzentren.
Keine Antwort.
Ich versuche zu erkennen, ob die Erde größer oder kleiner wird.
Wenn größer, bin ich in einer abnehmenden Umlaufbahn und werde verbrennen.
Wenn kleiner, habe ich mich von der Erdanziehung gelöst und werde hinaus in den Weltraum treiben. Das heißt, ich werde ersticken, sobald mir der Sauerstoff ausgeht. Oder, falls der Sauerstoff lang genug reicht, verhungern.
4
JAMES
Ich stürze vor und packe Marcel am Arm. Mein Gewicht reicht nicht, um den bulligen Kerl umzureißen, doch immerhin löst sich das Messer von Pedros Hals.
Der Wärter windet sich endgültig aus Marcels Griff, zerrt etwas aus der Tasche und rammt es dem Häftling in die Seite.
Ich spüre einen elektrischen Schlag. Marcel zuckt. Das Messer fällt auf den Linoleumbelag, kurz darauf folgen Marcel und ich wie zwei Kartoffelsäcke.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Pedro hier keinen Elektroschocker mit sich führen darf. Benommen registriere ich, dass meine Extremitäten wie tote Gewichte an mir hängen.
Der Bulle zappelt wie ein Fisch auf dem Kai, bis das elektrische Tatt-tatt-tatt aufhört.
Pedro greift nach dem Messer. Zu meiner Überraschung streckt Marcel die Hand aus und packt Pedro am Arm, doch er kann ihn nicht aufhalten, weil er zu schwach ist. Stattdessen ballt er die andere Hand zur Faust und boxt Pedro in die Rippen. Der Wärter schreit auf.
Auf bebenden Gliedmaßen krieche ich hin und drücke Marcels Arm nach unten – gerade als er zum nächsten Schlag ausholt.
Durch die Tür höre ich ferne Stimmen. Eine Gruppe von Leuten nähert sich und ruft Marcels Namen.
Jetzt hat Pedro das Messer, und plötzlich spritzt ein Schwall Blut über Marcels Brust und Arm, der auch mich bedeckt. Ich spüre praktisch, wie er kälter wird.
Marcel gibt ein Gurgeln von sich, und seine Augen werden glasig.
Pedro wälzt sich von ihm herunter und hält sein Funkgerät an den Mund.
Zitternd hebe ich die blutverschmierte Hand. »Nicht, Pedro.«
Er stockt.
Zwischen keuchenden Atemstößen presse ich Worte heraus. »Überzahl … Insassen … gegen Wärter. Hundert … zu eins.«
Das bringt Pedro ins Grübeln. Schließlich schüttelt er den Kopf. »Ich muss los, Doc. Das ist meine Arbeit.«
»Warte. Als er vorhin reinmarschiert ist, hat er dir nicht sofort die Kehle aufgeschlitzt. Warum?«
Nachdenklich kneift Pedro die Augen zusammen.
Ich nehme ihm die Antwort ab. »Er wollte dich als Geisel. Als Druckmittel – falls ihr Plan schiefgeht. Als menschlichen Schutzschild. Wenn du jetzt da rausgehst, werden sie dich einfangen. Dich gegen deine Kollegen benutzen. Dein Bild ins Netz stellen, gefesselt, zusammengeschlagen, damit es die ganze Welt sieht, damit es deine Kinder sehen.«
Pedro schielt Richtung Tür. Sie ist der einzige Eingang zur Wäscherei.
Die Stimmen werden lauter. Wir haben noch eine Minute, vielleicht sogar weniger.
»Es gibt keinen anderen Weg raus, Doc. Bleib einfach hier.«
Ich packe ihn mit der blutigen Hand am Arm, als er aufsteht. »Es gibt einen anderen Weg.«
»Was …«
»Keine Zeit für Erklärungen, Pedro. Vertraust du mir?«
Als die Häftlinge ankommen, liege ich zuckend neben Marcel auf dem Boden.
Sie sind zu sechst und mit behelfsmäßigen Schlagstöcken und Messern ausgerüstet.
Einer hat ein Funkgerät. »Wir haben Marcel gefunden. Er ist tot.«
Sie umringen mich. Am ganzen Körper schlotternd, setze ich mich mühsam auf. Ich bin immer noch so schwach, dass ich mich nicht groß verstellen muss.
»Wer war das?«, schreit der Anführer.
»Hab … ihn nicht gesehen.«
Ein kahler Typ mit üppig tätowierten Armen legt mir eine Klinge an den Adamsapfel.
Ich täusche Todesangst vor – auch das ist nicht weit hergeholt. »War hinter Marcel … beim Reinkommen. Hat ihn mit einem Taser geschockt und ihn auf mich geschubst. Dann bin ich umgekippt.«
Über das Funkgerät sind Schüsse zu hören. Der Anführer tigert auf und ab und stellt bellend Fragen.
»Ich … kann nicht laufen«, krächze ich. »Ihr müsst mich raustragen …«
Die Klinge löst sich von meinem Hals, sie stoßen mich zurück auf den Boden und stürmen hinaus.
Als ich sicher bin, dass sie verschwunden sind, ziehe ich die blutigen Kleider aus und stopfe sie in einen Wäschesack. Ich krieche zum mittleren Trockner und flüstere: »Sie sind weg.«
Das Laken schiebt sich zur Seite, und ich erkenne Pedros Augen. Verschreckt, aber dankbar.
»Bleib hier, bis ich dich hole.«
Zu seinem Glück ist Pedro nicht besonders groß. Trotzdem wird er jeden Knochen spüren, wenn er rauskommt.
Ich bin etwas größer als er, eins achtundsiebzig. Es wird eine knappe Sache, aber ich habe keine andere Wahl. Ich kann kaum gehen. Mit Sicherheit kann ich weder rennen noch kämpfen. Ich bin nicht in der Verfassung, in der man einen Fluchtversuch unternimmt oder sich den Weg ins Freie mit den Fäusten bahnt, sollte es dazu kommen.
Ich drehe den Fernseher laut, um mögliche Geräusche von Pedro oder mir zu übertönen. Plötzlich höre ich etwas aus seiner Maschine und begreife, dass er sein Funkgerät angestellt hat, um sich ein Bild von der Lage zu machen.
»Pedro«, flüstere ich, »du musst das Funkgerät ausgeschaltet lassen. Jeder Laut könnte dein Tod sein, mein Freund.«
Mit diesen Worten quetsche ich mich in einen großen Industrietrockner und verdecke die Glastür mit Bettzeug. Dann warte ich.
Es fühlt sich an, als wäre ich schon seit Stunden hier drin.
Ich lausche den Nachrichten und versuche, ihnen irgendwelche Hinweise zu den Ereignissen da draußen zu entnehmen.
Anscheinend drehen sich alle Beiträge im Fernsehen um den Langen Winter und darum, wie irgendeine Familie darin überlebt.
Ich vermeide jede Bewegung, obwohl mir der ganze Körper wehtut – von der verkrampften Fötusstellung hier drinnen und dem Elektroschock vorhin.
Eine Eilmeldung kommt herein. Die Begriffe »Gefängnisaufstand« und »Nationalgarde« lassen mich hellhörig werden. Ich ziehe das Laken so weit beiseite, dass ich landende Hubschrauber vor dem Gefängnis erkennen kann. Bestimmt sind sie keine zweihundert Meter von mir entfernt.
Die Ausführungen des Reporters entsprechen dem, was ich von Anfang an vermutet habe. »Da der Lange Winter die Polizeiressourcen des Bundes und der Gemeinden stark beansprucht, haben sich die Verhaltensregeln bei Gefängnisaufständen offenbar geändert.«
Ich bin so vertieft, dass ich die Schritte erst höre, als ein Häftling durch die offene Tür tritt. Gleich hinter ihm sind zwei weitere. Sie suchen nach uns. Nach Pedro, um ihn als Druckmittel bei Verhandlungen zu benutzen. Was mich betrifft … wenn sie herausfinden, was ich getan habe, werden sie Rache wollen. Im Gefängnis ist Rache eine große Sache. Und ich weiß nicht, wer die Typen davon abhalten soll.
5
EMMA
Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Stunden könnten vergangen sein. Vielleicht ein Tag. Oder sogar zwei.
Sicher weiß ich nur eins: Ich habe die Dekompressionskrankheit. Nicht so schlimm, dass ich daran sterben könnte, trotzdem reicht es, damit ich jede Sekunde spüre. Ich würde mich wirklich gern übergeben, aber dafür ist jetzt kein guter Zeitpunkt.
Die wissenschaftliche Erklärung der Dekompressionskrankheit geht so: In der ISS und den Raumfähren herrscht ein Druck von 1 Bar – entsprechend dem atmosphärischen Druck auf der Erde auf Meereshöhe. Der Druck von Raumanzügen liegt bei 0,3 Bar – entsprechend dem atmosphärischen Druck auf dem Gipfel des Mount Everest. Bildlich gesprochen wurde ich also in wenigen Sekunden von Seehöhe auf die Spitze des Everest katapultiert. Warum ist das schlecht? Ein plötzlicher Druckabfall führt dazu, dass der Stickstoff, der normalerweise im Blut und Gewebe aufgelöst ist, austritt und Blasen bildet. Als würde man eine Dose Limonade öffnen. Der Inhalt der Dose steht unter hohem Druck. Wenn sie geöffnet wird, trifft er auf einen deutlich niedrigeren Druck. Das Ergebnis? Sprudelnde Blasen. Kohlendioxid, das aus der Flüssigkeit freigesetzt wird. Und genau das passiert jetzt mit mir: Sprudelnde Stickstoffperlen sausen in meinem Körper herum. Ich bin wie eine menschliche Dose Limo, die unter hohem Druck stand und nach dem Öffnen wild vor sich hin schäumt.
Taucher kennen die Dekompressionskrankheit schon lange und schützen sich mit vorbeugenden Maßnahmen. Genau wie die Besatzung der ISS: Vor dem Benutzen eines Raumanzugs folgen wir einem strikten Protokoll zur Druckanpassung. Doch natürlich blieb in dieser Situation keine Zeit dafür. Ich hatte nur die Wahl zwischen Dekompressionskrankheit und Tod.
Und im Augenblick fühle ich mich so schlecht, dass ich mich frage, ob meine Entscheidung wirklich die richtige war.
Mir tut alles weh. Ich bin erschöpft, schrecke aber vor dem Schlaf zurück. Ich habe Angst, nicht mehr aufzuwachen.
Ich klammere mich an mein Leben, an jede Sekunde. Erst jetzt begreife ich, wie sehr ich daran hänge. Wenn alles auf Messers Schneide steht, ist es das, was zählt: der Lebenswille.
Bloß dass ich mit diesem Willen im Moment recht wenig ausrichten kann. Ich beobachte einfach die Trümmer der Station, auf der Suche nach Hinweisen auf andere Überlebende, die mein Eingreifen erfordern würden.
Ab und zu stürzen Trümmer der Station in die Atmosphäre und gehen in Flammen auf. Sie sind wie glühende Körner, die durch eine Sanduhr rieseln und die Sekunden bis zu meinem Untergang herunterzählen.
Ich bin in einer abnehmenden Umlaufbahn, das ist inzwischen klar. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich zusammen mit dem Fragment der Station, an dem ich festgeschnallt bin, in die Atmosphäre falle und ebenfalls verbrenne.
Wieder blitzt es grell in der Richtung der Station. Weitere Trümmer, die verglühen, vermute ich. Doch dann wird das Licht heller, nicht dunkler. Da nähert sich etwas.
Eine Rakete. Die heranschießt.
Eine Kapsel löst sich, und ihre Schubdüsen zünden.
Sie kommt auf mich zu.
Zu mir.
Staunend sehe ich zu. Tränen laufen mir übers Gesicht. Ich werde gerettet.
6
JAMES
Das Wunderbare am Aufenthalt in einem Bundesgefängnis ist, dass man es allgemein gesprochen mit einer etwas gehobenen Sorte von Kriminellen zu tun hat. Es sind keine gewöhnlichen Räuber und Mörder, die im Knast eines Bundesstaates ihre Strafe absitzen. Die Bewohner von Edgefield und anderer Bundesvollzugsanstalten sind kriminelle Superhirne – oder immerhin so ehrgeizig, dass sie grenzüberschreitende Verbrechen begangen oder zumindest gegen ein Bundesgesetz verstoßen haben.
Der Nachteil ist, dass sie Pedro und mich aufgrund ihrer Intelligenz wahrscheinlich finden werden. Meine Befürchtung bestätigt sich, als ich höre, wie sich die Tür des Trockners am Ende der Reihe öffnet. Dann die nächste.
In der Ferne nehme ich automatisches Gewehrfeuer wahr. Die Nationalgarde ist durchgebrochen. Der zeitliche Ablauf passt. Vor ein paar Minuten sind sie aufmarschiert. Verhandlungen gab es nicht. Sie sind sofort vorgerückt, um das Überraschungsmoment zu nutzen.
Die Tür meines Trockners schwingt auf, und eine breite Pranke reißt das Bettzeug weg. Bei meinem Anblick weicht der Mann zurück, hält mir eine Waffe ins Gesicht und brüllt: »Raus da!«
Ich zeige meine Hände und schiebe mich vorsichtig auf die runde Öffnung zu. Mir tut alles weh.
Die Schüsse draußen werden lauter. Es klingt fast wie der Dritte Weltkrieg.
»Schließ die Tür«, ruft der Bewaffnete einem anderen Insassen zu. »Schieb den Tisch davor.«
Inzwischen bin ich halb aus dem Trockner. Am liebsten würde ich wieder hineinkriechen, denn ich weiß, was jetzt kommt. Mann, diese Kerle sind blöd. (Hiermit ziehe ich meine Bemerkungen über die durchschnittliche Intelligenz von Bundeshäftlingen zurück.)
»Raus da, hab ich gesagt!«
So gern ich auch bleiben würde, mit seiner Kanone hat er die besseren Argumente.
Auf unsicheren Beinen torkele ich heraus wie ein Fohlen bei seinen ersten Schritten.
Kurz darauf entdecken sie Pedro. Auch er klettert heraus, bloß dass er mit stolz erhobener Brust dasteht. Er wird mir immer sympathischer. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht hier in der Wäscherei vor die Hunde gehen.
Sie filzen ihn und nehmen ihm das Funkgerät und den kleinen Elektroschocker ab, mit dem er Marcel niedergestreckt hat.
Ich lehne mich an den Trockner. Normales Stehen ist einfach zu schmerzhaft.
Die plötzliche Stille – keine Schüsse mehr – spricht Bände. Der Krieg, der da draußen getobt hat, ist vorbei.
Prasselnd erwacht ein Funkgerät zum Leben. Anscheinend haben es die Gefangenen einem anderen Wärter abgenommen. »An die Personen in der Wäscherei. Es ist vorbei. Kommt mit erhobenen Händen raus. Wir wollen kein weiteres Blutvergießen.«
Der Anführer der versprengten Gruppe entspricht nicht meinen Erwartungen. Er ist weder muskelbepackt noch tätowiert. Er ist ein Weißer in mittleren Jahren mit hoher Stirn und Dreitagebart. Wie ein Typ auf dem Wirtschaftskanal, der den Zuschauern erklärt, warum sie die Aktien seines Unternehmens kaufen sollten, obwohl der letzte Vierteljahresbericht eher beunruhigende Zahlen enthielt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er hier gelandet ist.
Er schreitet den Raum ab, schaut sich um und erkennt, was ich längst weiß: keine anderen Türen, keine Fenster, kein Ausgang. Nur zwei Luftschlitze in der Decke. Und im Gegensatz zu denen in vielen Filmen sind sie zu klein zum Durchkriechen.
Die Stimme des Mannes wirkt ruhig und unbekümmert, als er über Funk antwortet. »Auch wir wollen kein weiteres Blutvergießen. Uns geht es nur um eine Chance zum Überleben. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, der Winter kommt. Wir wollen nicht raus. Wir wollen bloß in Ruhe gelassen werden. Wir sind nicht mehr viele. Es reicht, damit wir das Gefängnisgelände bebauen und uns selbst versorgen, mehr nicht. Wir verlangen nur, dass ihr uns im Gefängnis einschließt. Sperrt die Türen ab und werft den Schlüssel weg. Ihr könnt KI-Drohnen einsetzen und jeden töten, der die Abgrenzung durchbricht. Wir wollen nicht raus. Wir wollen nur überleben.«
Dieser Typ muss der Anführer des gesamten Aufstands sein. Und er ist in der Tat ziemlich schlau. Vermutlich keine guten Voraussetzungen für meine Lebenserwartung.
Er sieht zu Pedro. »Wir haben einen von euren Wärtern.« Er hält Pedro das Funkgerät hin. »Sag ihnen deinen Namen.«
Pedro spuckt auf das Funkgerät.
Ein Insasse mit Blut auf der Brust reißt den Schlagstock in seiner Hand hoch.
»Tu, was er verlangt, Pedro!«, brülle ich. »Sag’s ihnen. Sonst prügeln sie es aus dir raus. Alles wird gut.«
Die anderen Insassen beäugen uns. Der Anführer starrt mich mit schief gelegtem Kopf an. Er spricht, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Ja, das stimmt, Pedro. Alles wird gut. Also, raus damit.«
Ich nicke Pedro zu. Mit zusammengebissenen Zähnen nennt er seinen Namen und seine Position.
Danach fährt der Anführer fort. »Wenn ihr eure Truppen aus dem Gefängnis abzieht und unsere Forderungen erfüllt, bekommt ihr Pedro Alvarez wohlbehalten zurück. Er wird hier rausmarschieren, und wir werden alle zufrieden weiterleben.«
Der Nationalgardist antwortet. »Wir räumen das Gefängnis, aber für alles Weitere habe ich keine Befugnis. Ich muss nachfragen. Gebt uns ein wenig Zeit.«
»Wir werden uns bestimmt nicht vom Fleck rühren. Genauso wenig wie Pedro, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden.«
Der Anführer lässt den Schalter des Funkgeräts los und mustert mich. »Und wer bist du?«
»Der Typ, der die Wäsche macht.«
»Und sich in der Wäscherei versteckt.«
»Wenn nötig.«
Er setzt ein breites Lächeln auf.
Nur seine Kumpel sind nicht amüsiert. Einer richtet ein behelfsmäßiges Messer auf mich. »Das ist ein Zinker, Carl. Am besten, wir schneiden ihm die Därme raus.«
Streng genommen habe ich niemanden verzinkt, sondern nur der Gefängnisbehörde geholfen, deren Position ich für moralisch überlegen halte, zumindest was Pedro Alvarez angeht. Doch für solche Haarspaltereien ist jetzt keine Zeit.
Anführer Carl scheint der gleichen Meinung zu sein. »Finey, du kannst ihm gern die Därme rausschneiden oder sonst was mit ihm anstellen – allerdings erst nachdem das Ganze vorbei ist.«
7
EMMA
Manche Dinge sind mir im Gedächtnis geblieben. Der Weihnachtsmorgen, ich war sechs, als ein brandneues Fahrrad mit Stützrädern neben dem Baum stand. Der Tag von Adelines Geburt. Von Owens Geburt. Und der Tag, an dem ich in eine Sojus-Kapsel auf einer Rakete stieg, die mich ins All tragen sollte.
Der Weltraum war schon immer mein Traum. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war er auch der Grund, warum ich vieles in meinem Leben aufschob. Ehe. Kinder. Sesshaftigkeit.
Jetzt hat er sich in einen Albtraum verwandelt.
Auch der Anblick der auf mich zujagenden Kapsel ist eines der Bilder, die ich nie vergessen werde. Ich bin überwältigt vor Freude. Jemand da unten hat sie losgeschickt – für mich. Um mich zu retten. In einer Welt, die ums Überleben kämpft, haben sie eine Kapsel ins All geschossen, um ein einzelnes Leben zu bewahren.
Das sagt viel über die Menschheit.
Die Kapsel entfaltet ihre kleine Solaranlage wie ein Vogel seine schwarzen Flügel. Weiße Dunstschwaden erblühen an ihren Seiten, als sie mit ihren Schubdüsen manövriert und sich langsam nähert.
Ich erkenne das Logo an der Wand. Ein privates Raumfahrtunternehmen. Normalerweise wäre diese Kapsel in drei Wochen gestartet, um eine neue dreiköpfige Crew heraufzubefördern, die die halbe Besatzung der Station ersetzen sollte – unter anderem auch mich. Sie haben sie früher losgeschickt.
Ich kenne die technischen Daten, weil ich sie ausführlich studiert habe. Es ist eine Personen- und Frachtkapsel mit Platz für bis zu sieben Leuten. Und Tonnen von Vorräten. Von oben nach unten besitzt sie eine Spitze (inzwischen verschwunden), ein Druckabteil für die Crew, ein druckloses Serviceabteil, einen Hitzeschild für den Wiedereintritt in die Atmosphäre und zu guter Letzt einen drucklosen Laderaum, der sich vor dem Wiedereintritt ablöst. Alles super, bis auf ein Problem: Ich habe keinen funktionierenden Andockmechanismus.
Als hätte sie meine Gedanken gelesen, dreht mir die Kapsel ihre Nase zu. Ihre Andockrampe öffnet sich. Ich rechne damit, dass die Atmosphäre von drinnen herausrauscht und die Kapsel zurückbläst. Doch es dringt nur ein sanfter Luftstoß heraus. Also haben sie schon vor dem Start den Druck aus dem Crewabteil abgelassen. Schlau.
Der offene Mund der Kapsel scheint mich anzustarren, dahinter das schwarze All. Beide umkreisen wir die Erde. Die ISS flog mit achtundzwanzigtausend Stundenkilometern. Wir sind inzwischen vermutlich langsamer. Die Kapsel versucht, sich der Geschwindigkeit meiner abnehmenden Umlaufbahn anzupassen, und muss ihre Schubdüsen einsetzen, um möglichst an Ort und Stelle zu verharren. Ein äußerst schwieriges Unterfangen, so als wollte ein Kolibri völlig still halten. Es ist unmöglich.
Was haben sie vor? Ich male mir aus, dass sich etwas aus der Kapsel strecken wird, an dem ich mich festhalten und hineinhangeln kann. Eine Leine vielleicht. Ein Seil. Im Moment würde ich mich schon über eine Lakritzstange freuen. Irgendetwas, um mich da reinzubefördern.
Doch es kommt nichts.
Wartend starrt mich die Kapsel an. Die Frachtlichter blinken auf. Erst nach einer Weile wird mir klar, dass es Morsezeichen sind. Dank der Dekompressionskrankheit bin ich wohl nicht ganz auf der Höhe.
Die Nachricht beginnt erneut.
Punkt Punkt Punkt.
S.
Punkt …
Ich habe den zweiten Buchstaben Verpasst.
Konzentration.
Der dritte Buchstabe: Punkt Strich Punkt.
Oder Strich Punkt Strich?
Ein R oder ein K.
Der nächste Buchstabe: Punkt Punkt.
I.
Dann: Strich Punkt.
N.
Strich Strich Punkt.
G.
S, unbekannt, R oder K, I, N, G.
O nein. Bitte lass das nicht wahr sein.
Die Abfolge beginnt erneut.
Ja. Es heißt: SPRING.
8
JAMES
Als Nächstes erwarte ich Folgendes: Tränengas durch den Luftschacht, Nationalgardisten durch die Tür, eine Schießerei und danach für mich entweder Tod oder Fortsetzung meiner Haft.
Ich liege in allen Punkten falsch.
Die verbliebenen Gefängnisinsassen, insgesamt siebzehn, sammeln sich in der Wäscherei. Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, dass hier ihr einziges Druckmittel ist – Pedro – und dass sie diesen Raum mit nur einem Eingang leichter verteidigen können als das ganze Gefängnis.
Das Funkgerät in Carls Hand knistert, und die Stimme des Einsatzleiters hallt durch die inzwischen ziemlich volle Wäscherei. »An den Sprecher der Aufständischen im Gefängnis Edgefield. Die Abmachung steht. Wir gehen auf eure Bedingungen ein.«
Jubel bricht aus. Mehrere High fives. Nicht besonders freundliche Blicke in meine Richtung.
Pedro wehrt sich – sie haben ihm mit Klebeband die Hände hinter den Rücken gefesselt. »Ich gehe nicht.«
Carl lächelt ihn an. »Du gehst schon, glaub mir. Falls du es nicht bemerkt haben solltest: Wir verhandeln mit Bullen vor dem Gefängnis. Nicht im Gefängnis.« Er nickt einem Häftling zu. »Kneble ihn.«
Ein zusammengeknüllter Kissenüberzug im Mund wird mit Klebeband befestigt.
Carl drückt den Funkschalter. »Tolle Neuigkeit! Dann reden wir mal Tacheles. Wir brauchen ein paar Garantien, dass unser kleiner Freistaat Edgefield nicht überfallen wird. Und mit Garantien meine ich Schusswaffen. Und Bomben. Und eine Sperrzone vor unseren Zäunen. Sagen wir einen Streifen von hundert Metern.«
»Schusswaffen kommen nicht infrage.«
»Dann fällt unsere Abmachung flach. Keine Schusswaffen, kein Pedro Alvarez. Zumindest kein lebender.«
Eine lange Pause. Dann: »Einen Moment.«
Die Wartezeit fühlt sich an wie eine Stunde. Schließlich folgt doch noch eine Antwort. »Okay, ihr kriegt eure Schusswaffen.«
»Gut. Und damit meine ich keine abgetakelten, alten Erbsenpistolen. Ich spreche von halb automatischen Knarren mit reichlich Munition. Eine für jeden von uns.« Er macht eine Pause, um nachzuzählen. »Siebzehn insgesamt. Und ihr gebt uns alle Gefangenen zurück, die ihr bei eurem Angriff auf unser Territorium gemacht habt. Die kriegen natürlich auch Pistolen.« Wieder ein kurzes Stocken. Er kommt allmählich auf den Geschmack. »Und legt noch ein Gewehr für jeden dazu. Zwei Handgranaten pro Kopf. Und sieben Panzerfäuste.«
Widerstrebend erklärt sich der Verhandler der Nationalgarde einverstanden. In den nächsten Stunden wagen sich die Insassen hinaus und suchen das Gefängnis nach versteckten Gardisten, Hinterhalten und Sprengfallen ab. Nachdem sie sich davon überzeugt haben, dass alles leer ist, verlassen sie die Wäscherei und nehmen Pedro und mich in die Mitte.
Im Hof haben sich Soldaten hinter einer Barrikade und Truppentransportern aufgebaut. Die anderen Häftlinge sind hinter ihnen zu sehen. Vor der Barrikade wartet ein halbes Dutzend Kisten.
Carl ruft: »Waffendemonstration!«
Ein Nationalgardist mit Streifen an der Schulter marschiert nach vorn und öffnet eine Kiste. Er nimmt ein gefährlich wirkendes Gewehr heraus und feuert einen Schuss in die Luft.
»Kiste ausleeren. Eine Waffe raussuchen. Nein, zwei«, schreit Carl. »Nächste Vorführung!«
Carl hat eindeutig Grips.
Der Soldat schaut nach hinten, um sich eine Bestätigung zu holen. Ein Mann mit einem Silberadlerabzeichen am Helm nickt ihm zu. Der Soldat greift nach einem Gewehr, doch Carl fordert ihn auf, das daneben zu nehmen. Ja, Carl hat Grips. Der Gardist feuert die Waffe ab. Sie funktioniert. Und die danach ebenfalls.
Was für eine Idee, ein Gefängnis mit Waffen zu versorgen. Der reinste Albtraum.
Schockiert verfolge ich den Beginn des Austauschs. Ein Insasse mit einem Messer schiebt Pedro nach vorn bis auf halbe Höhe und wartet, dass die Nationalgardisten die anderen Häftlinge freilassen. Diese schwärmen über den Hof, schnappen sich die Kisten und rennen zu Carls Gruppe. Doch der Typ mit dem Messer hält Pedro weiter fest.
Über Funk brüllt der Einsatzleiter der Nationalgardisten: »Lasst ihn gehen.«
»Gleich«, antwortet Carl. Aber den Befehl dazu gibt er nicht.
Ich spüre den Schweiß in meinen Handflächen. Lasst ihn gehen.
Sie werden doch nicht …
Als die Häftlinge bei Carl angelangt sind, werfen sie die Kisten hin und verteilen die Waffen. Sie halten sie über ihre Köpfe und grölen, als hätten sie den Super Bowl gewonnen. Dann richten sie die Gewehre auf die Reihe von Nationalgardisten.
Carl hebt das Funkgerät an den Mund. »Also gut, lasst unseren Gast frei.«
Erleichterung steigt in mir auf, als Pedro nach vorn stolpert. Kurz vor der Barrikade bleibt er stehen und dreht sich um. Sein Blick gleitet über die Gruppe von Häftlingen und findet meinen. Ich kann erkennen, was in seinem Kopf vorgeht: dass es vielleicht klappen könnte, wenn er jetzt Stärke zeigt und meine Freilassung fordert.
Ich schüttle leicht den Kopf. Sie sind jetzt bewaffnet. Das würde nur zu einem Blutbad führen.
Bevor er etwas tun kann, umringen ihn die Soldaten und schaffen ihn hinter die Linie. Genauso schnell weichen die Häftlinge zurück, die Gewehre auf die Truppen gerichtet. Sie treiben mich zum Tor, und ich laufe im Gleichschritt mit. Damit dürfte mein Schicksal wohl besiegelt sein.
Im Gefängnis sperren sie mich in eine Zelle. Im Hinblick auf die Unterkunft ist das ein Rückschritt. Vorher habe ich zusammen mit zwei Insassen in einer Art Schlafraum mit niedriger Sicherheitsstufe gehaust. Andererseits bin ich fürs Erste noch am Leben. Was will man mehr.
Ich lege mich auf das untere Bett. Der Messerfuchtler, der mich in der Wäscherei bedroht hat, hat sich grinsend vor der Zelle postiert, in einer Hand ein Gewehr, in der anderen einen Becher mit selbst gepanschtem Wein. Er spricht kein Wort, sondern glotzt mich bloß an, als wäre ich ein Tier in einem Streichelzoo.
Ich bin drauf und dran, ihm für seinen Besuch zu danken, doch ich lasse es, weil der Witz sicher nicht gut ankommen würde. Ich bin diesen Kerlen hilflos ausgeliefert, da sollte ich sie nicht noch weiter gegen mich aufbringen.
So starre ich auf die Unterseite des Betts über mir. Eine seltsame Laune des Schicksals hat mich zum letzten Gefangenen in der Bundesvollzugsanstalt Edgefield gemacht, aus der ich schon längst hätte fliehen können. Meine Mithäftlinge werden mich töten, und wenn nicht, dann wird es der Lange Winter tun.
Vielleicht habe ich die Sache mit der menschlichen Natur immer noch nicht ganz heraus.
9
EMMA
Ein Dartspiel, bei dem es um mein Leben geht. Bloß dass ich der Pfeil bin und die Dartscheibe sich bewegt.
Von einer Seite zur anderen pendelnd, hängt die Kapsel in ihrer Position, die ständig von den Schubdüsen korrigiert wird.
Spring, hieß die Nachricht.
Ich soll mich von der ISS abkoppeln und in die Kapsel springen. Die Logik kann ich nachvollziehen. Sie können die Kapsel nicht näher heranbringen, denn wenn sie mit dem Wrackteil der Station zusammenstößt, gerate ich vielleicht dazwischen. Ich könnte in zwei Stücke zerrissen werden. Oder mir das Rückgrat brechen.
Eine Möglichkeit ist, mich von der ISS loszumachen und mich schnell abzustoßen. Nennen wir es die »Dartoption«. Wenn ich nicht treffe, schwebe ich einfach hinaus ins Weltall. Meine Landsleute auf dem Boden haben die Kapsel so positioniert, dass ich mich zwischen ihr und der Erde befinde. Das heißt, wenn ich vorbeifliege, werde ich wenigstens nicht in der Atmosphäre verglühen. Trotzdem bin ich dagegen.
Ich entscheide mich für die Alternative ohne Dart. Nennen wir es die »smarte Option«: der Kapsel auf halbem Weg entgegenkommen, statt einfach loszufliegen.
Ich kopple mich vom Wrack der ISS ab und stoße mich sanft ab, sodass ich mich frei schwebend langsam auf die Kapsel zubewege. Ein verunsicherndes Gefühl der Hilflosigkeit, als müsste ich auf einem Hochseil ohne Netz balancieren.
Zentimeter für Zentimeter rückt die Kapsel heran und bläst auf beiden Seiten weiße Fahnen hinaus wie ein nahender Drache. Die Stöße der Schubdüsen werden schneller. Ich kann mir vorstellen, dass die Person, die das Ganze von der Bodenstation aus steuert, Blut und Wasser schwitzt. So wie ich.
Sechs Meter Abstand.
Auf Kurs.
Vier Meter.
Leichte Linksabweichung.
Drei.
Daneben. Vielleicht bekomme ich den Rand zu fassen und kann mich hineinziehen.
Die Lücke wird immer weiter. Ich werde die Seite streifen.
Die Düsen zünden stärker als zuvor. Die Kapsel rauscht auf mich zu.
Und auf einmal geht es blitzschnell. Der Schlund des Andockrings umfasst mich, und ich purzle in die Kapsel.
Dann liege ich im Crewabteil und schaue auf eine weiß gepolsterte Wand, an der Instrumente hängen, zusammen mit einem großen weißen Schild. Darauf steht in handgeschriebenen Blockbuchstaben:
VON IHREN FREUNDEN
AUF DER ERDE
IN LIEBE
Eine Weile starre ich darauf, dann fange ich an zu weinen. Ich schluchze, bis ich am ganzen Körper bebe. Zum ersten Mal seit dem Auseinanderbrechen der ISS glaube ich an ein Weiterleben.
10
JAMES
In dieser Nacht wurde gefeiert. So hatte ich das Bundesgefängnis Edgefield noch nie erlebt. Plärrende Musik, trinkende, grölende Insassen. Die einen prügelten sich, die anderen spielten Karten oder würfelten. Das Proviantlager wurde leer geräumt. Überall Müll auf dem Boden. Diese Männer, von denen einige fast ihr ganzes Erwachsenenleben in Haft verbracht hatten, tollten unbeschwert herum wie Kinder.
Jetzt am Morgen sind sie alle tot.
Das zumindest schließe ich aus der gespenstischen Stille. Sie hat ungefähr mit dem Einsetzen der Dämmerung begonnen. Ich bin wach geblieben, weil ich damit rechnete, dass die letzte Nacht auf Erden vor mir lag. Und ich wollte im Stehen sterben.
Doch niemand hat mich geholt. Wahrscheinlich dachten sie, dass dafür auch später noch Zeit bleibt. Zum Glück haben sie sich getäuscht.
Inzwischen ist die Sonne herausgekommen, und von meinem Bett aus erkenne ich unten im Gemeinschaftsbereich überall verstreute Leichen. Nicht erschossen oder niedergestreckt. Sie sind einfach umgekippt. Was sie getötet hat, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich nicht betroffen. Noch nicht zumindest.
Schritte hallen durch das Gefängnis, ein leises Trippeln in der Ferne, das zu einem Trampeln anwächst, begleitet von schroffem Gebrüll: »Gesichert!«
Soldaten mit Gummihandschuhen und Schutzkitteln erscheinen vor meiner Zelle. Blitzartig fällt mir ein, wie der Nationalgardist für Carl und seine Aufständischen die Gewehre vorführte. Er trug Handschuhe.
Damit ist alles klar. Die Waffen waren mit Gift besprüht. Ich bin beeindruckt.
Die Soldaten lassen einen hochgewachsenen Mann mit kurz geschorenem Haar durch, unter dessen Kittel ein marineblauer Anzug aufblitzt. Federal Agent, ist mein erster Gedanke.
»Dr. Sinclair, wir würden gern mit Ihnen reden.«
Achselzuckend stehe ich auf. »Da haben Sie Glück, die Praxis hat gerade aufgemacht.«
»Bringt ihn raus«, knurrt er einem Soldaten zu.
Sie werfen mir einen Schutzkittel und Gummihandschuhe in die Zelle.
Ja, eindeutig Gift auf den Waffen. Sie haben Angst, dass sich etwas davon ausgebreitet hat und dass ich damit in Kontakt kommen könnte.
Sie wollen mich also lebend. Immerhin etwas.
Am Morgen nach der Nacht als letzter Gefangener in Edgefield marschiere ich als letzter lebender Häftling hinaus.
Ich schaue mich nach Pedro um, kann ihn aber nirgends entdecken.
Sie bringen mich zu einem Lieferwagen. Dort wartet der Federal Agent neben einem Mann mit Bart, kurzem grauen Haar und warmen Augen. Ein Mann, den ich erkenne und respektiere, ohne ihm je begegnet zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihn hierherführt, und dabei habe ich eine reiche Vorstellungskraft.
»Handschuhe und Kittel runter«, meint der Agent.
Als ich sie abgestreift habe, ruft ein Soldat aus dem Wagen: »Soll ich ihm Handschellen anlegen?«
Der Agent setzt ein trockenes Grinsen auf. »Nein, die Art Krimineller ist er nicht. Oder, Doc?«
»Viele halten mich überhaupt nicht für einen Kriminellen, sondern einfach für einen Mann, der seiner Zeit voraus ist.«
»Und ich bin ein Mann, der nicht viel Zeit hat, also rein mit Ihnen.«
Im Wagen schickt der Agent alle weg bis auf den anderen Mann. Dann stellt er sich vor. »Dr. Sinclair, ich bin Raymond Larson, stellvertretender Justizminister.«
In meinem Kopf befördere ich ihn zum Chefagenten.
Er deutet auf seinen Begleiter. »Das ist Dr. Lawrence Fowler …«
»Direktor der NASA, ich weiß.« Ich wende mich an Fowler. »Freut mich, Sie kennenzulernen … trotz der Umstände. Ich verfolge Ihre Arbeit schon lange, seit Sie am Caltech waren.«
Seine Augen leuchten. »Tatsächlich?«
Die Stimme wirkt verhaltener als bei seinem Vortrag im Rahmen einer Konferenz, über die ich einen Filmbeitrag gesehen habe. Das ist vier Jahre her, und diese Jahre haben offenbar ihren Tribut gefordert. Der Stress und die Zeit haben Spuren bei Dr. Lawrence Fowler hinterlassen.
»Ja. Vor allem Ihre Forschungen zu alternativen Quellen für Düsenantrieb …«
Larson hebt die Hand. »Okay, das reicht. Kommen wir zur Sache.« Er grinst mich an. »Wenn Sie so intelligent sind, wie es immer heißt, dann wissen Sie doch sicher, warum ich hier bin.«