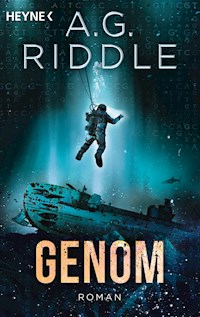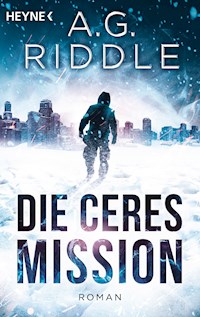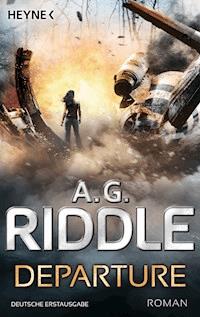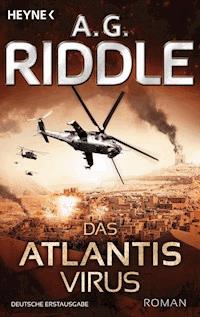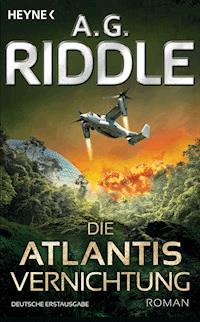9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Extinction-Serie
- Sprache: Deutsch
Mandera, im Nordosten Kenias: Die X1-Mandera-Pandemie breitet sich wie ein Flächenbrand aus – und ist kein biologisch-evolutionärer Zufall.
Berlin: Ein Mann erwacht in seinem Zimmer im Concord Hotel und hat das Gedächtnis verloren. Mit ihm im Raum befinden sich die Leiche eines ihm unbekannten Mannes sowie ein Zettel mit einem seltsamen Code darauf.
Atlanta: Peyton Shaw wird von den kenianischen Behörden kontaktiert, um sich der mysteriösen Seuche anzunehmen. Vor Ort findet sie heraus, dass ein ganzes Kartell geheimnisvoller Firmen, Institutionen und Organisationen die Pandemie mit einer finsteren Absicht steuert: Die Menschheit scheint vor dem Aus zu stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 895
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Mandera, im Nordosten Kenias: In der von Terrorattacken gebeutelten Stadt werden drei Männer (zwei Amerikaner, ein Brite) ins Hospital eingeliefert. Sie zeigen Ebola-ähnliche Symptome: die X1-Mandera-Pandemie ist ausgebrochen …
Berlin: Ein Mann erwacht in seinem Zimmer im Concord Hotel und hat das Gedächtnis verloren. Laut einer Zimmerservice-Quittung lautet sein Name Desmond Hughes. Mit ihm im Raum befinden sich die Leiche eines anderen Mannes sowie ein Zettel mit einem seltsamen Code darauf. Hughes gelingt es, den Code zu entschlüsseln. Es ergibt sich eine amerikanische Telefonnummer, der Anschluss der Epidemiologin Dr. Peyton Shaw …
Atlanta: Peyton Shaw wird kontaktiert, um sich als international renommierte Expertin der mysteriösen, verheerenden Seuche anzunehmen. Vor Ort findet sie heraus, dass eine geheimnisvolle Organisation für den Beginn der Pandemie verantwortlich ist. Der Countdown zum Untergang der Menschheit scheint unaufhaltbar …
Der Autor
A.G. Riddle wuchs in North Carolina auf. Zehn Jahre lang beschäftigte er sich damit, diverse Internetfirmen zu gründen und zu leiten, bevor er sich aus dem Geschäft zurückzog. Seitdem widmet Riddle sich seiner wahren Leidenschaft: dem Schreiben. Seine ebenfalls bei Heyne erschienene Atlantis-Trilogie ist in Amerika schon jetzt ein Phänomen. Riddle lebt in Parkland, Florida.
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe Pandemic erschien 2017 bei Riddle Inc., Raleigh, North Carolina
Vollständige deutsche Erstausgabe 03/2018
Copyright © 2017 by A. G. Riddle
Published in agreement with the author,
c/o Danny Baror International Inc, Armonk, New York, USA
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Lars Zwickies
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagabbildung: Johannes Wiebel
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Peter Gudella, Bildagentur Zoonar GmbH, kzww, I’m friday, Svetlana Turchenick, GCapture, sandyman, d1sk, somkanae sawatdinak)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-22407-3V001
www.heyne.de
Dieser Roman ist einem Kreis von Helden gewidmet, von dem wir selten hören. Nach Hurrikans und anderen Naturkatastrophen gehören sie zu den Ersten, die kommen, und den Letzten, die gehen. Sie arbeiten in Kriegsgebieten überall auf der Welt, und trotzdem tragen sie keine Waffen, um sich zu schützen. Auch jetzt gerade riskieren sie ihr Leben im Kampf gegen Bedrohungen, die jeden Menschen in jedem Land der Erde betreffen.
Sie leben unter uns; sie sind unsere Nachbarn und Freunde und Familienangehörigen. Es sind die Männer und Frauen, die in den USA und anderswo im Gesundheitswesen arbeiten. Ihre Taten zu recherchieren war eine große Inspiration beim Schreiben dieses Romans. Sie sind die wahren Helden einer Geschichte wie Pandemie.
Anmerkung zum Thema Fakten und Fiktion
Pandemie ist ein fiktives Werk, das auf Tatsachen beruht. Ich habe versucht, die Reaktionen des CDC und der WHO auf einen tödlichen Ausbruch in Afrika so genau wie möglich zu schildern. Mehrere Experten auf diesem Gebiet haben dazu beigetragen. Jegliche Fehler sind jedoch mir allein zuzuschreiben.
Die wissenschaftlichen Hintergründe sind größtenteils real. Vor allem die Darstellung der Forschung zum M13-Phage und GP3-Protein entspricht hundertprozentig den Tatsachen. Therapien, die daraus entwickelt wurden, werden gegenwärtig in klinischen Studien getestet und zeigen vielversprechende Ansätze, Alzheimer, Parkinson und Amyloidose zu heilen.
Auf meiner Internetseite (agriddle.com) gibt es eine Rubrik facts vs. fiction und weiteres Bonusmaterial zu Pandemie.
Danke fürs Lesen.
Gerry
A. G. Riddle
PROLOG
Das Schiff der US-Küstenwache hatte seit drei Monaten den Arktischen Ozean durchkämmt, ohne dass die Crew wusste, wonach genau sie suchte. Im letzten Hafen hatte der Eisbrecher ein Team aus dreißig Wissenschaftlern und ein dutzend Kisten mit seltsamen Apparaten an Bord genommen. Die Crew wurde über ihre Gäste und die geheimnisvolle Ausrüstung im Dunkeln gelassen. Tag für Tag pflügte sich der Bug der Healy durchs Eis, während die Männer und Frauen an Bord ihren Pflichten nachgingen und wie befohlen Funkstille hielten.
Die Geheimhaltung und die Eintönigkeit der täglichen Arbeiten lösten einen endlosen Strom von Gerüchten aus. Die Crew spekulierte bei den Mahlzeiten und in ihrer Freizeit, wenn sie Schach, Karten oder Computerspiele spielte. Am wahrscheinlichsten schien es, dass sie ein U-Boot oder ein gesunkenes Kriegsschiff suchten – vermutlich amerikanischer oder russischer Herkunft – oder vielleicht ein Frachtschiff mit gefährlicher Ladung. Einige glaubten, sie sollten Atomsprengköpfe aufspüren, die vor Jahrzehnten im Kalten Krieg abgeschossen worden und in den Arktischen Ozean gestürzt waren.
Um vier Uhr morgens nach Anchorage-Zeit summte das Telefon an der Wand neben der Koje des Kapitäns. Der Mann nahm den Hörer ab, ohne das Licht einzuschalten.
»Miller.«
»Halten Sie das Schiff an, Captain. Wir haben es gefunden.« Dr. Hans Emmerich, der leitende Wissenschaftler des Einsatzes, legte ohne ein weiteres Wort auf.
Nachdem er die Brücke angerufen und den sofortigen Stopp befohlen hatte, zog Miller sich schnell an und begab sich auf den Weg zum größten Forschungsraum des Schiffs. Wie der Rest der Besatzung war er neugierig, was dieses Es war. Aber vor allem wollte er wissen, ob das, was unter ihnen lag, eine Gefahr für die 117 Männer und Frauen darstellte, die auf dem Schiff dienten.
Miller nickte den Wachen an der Luke zu, bückte sich und trat ein. Einige Wissenschaftler diskutierten vor einer Reihe von Monitoren miteinander. Er ging zu ihnen und warf einen Blick auf die grünstichigen Bilder, die den felsigen Meeresgrund zeigten. Auf manchen davon war ein dunkles längliches Objekt in der Mitte zu sehen.
»Captain.« Dr. Emmerichs Stimme war wie eine Leine, die Miller zurückhielt. »Wir sind leider gerade äußerst beschäftigt.« Emmerich trat vor den Offizier der Küstenwache und versuchte, ihn von den Bildschirmen wegzudrängen, aber Miller wich nicht von der Stelle.
»Ich wollte sehen, ob wir Ihnen helfen können«, sagte er.
»Wir kommen sehr gut allein zurecht, Captain. Bitte bleiben Sie auf der momentanen Position – und halten Sie Funkstille.«
Miller zeigte auf die Bildschirme. »Sie haben also nach einem U-Boot gesucht.«
Emmerich entgegnete nichts.
»Ist es amerikanisch? Russisch?«
»Wir glauben, das Boot ist … unter multinationaler Trägerschaft.«
Miller kniff die Augen zusammen und fragte sich, was das bedeuten sollte.
»Sie müssen mich jetzt wirklich entschuldigen, Captain. Wir haben eine Menge Arbeit. Wir lassen bald das Tauchboot zu Wasser.«
Miller nickte. »Verstanden. Viel Glück, Doktor.«
Sobald der Kapitän gegangen war, beauftragte Emmerich zwei der jüngeren Wissenschaftler, sich an der Tür zu postieren. »Lasst niemanden mehr rein.«
An seinem Computerterminal verschickte er eine verschlüsselte E-Mail.
Vermutlich Wrack der RSV Beagle geortet. Setzen Suche fort. Koordinaten und erste Bilder angehängt.
Dreißig Minuten später saßen Dr. Emmerich und drei weitere Wissenschaftler in dem Tauchboot und steuerten auf den Meeresboden zu.
Auf der anderen Seite der Erde fuhr das Frachtschiff Kentaro Maru vor der somalischen Küste durch den Indischen Ozean.
Im Besprechungsraum neben der Brücke hatten zwei Männer den ganzen Nachmittag so heftig gestritten, dass die Besatzung immer wieder unter ihren Schreien zusammenfuhr.
Ein nautischer Offizier klopfte an der Tür und wartete nervös. Sie ignorierten ihn und brüllten sich weiter an.
Er klopfte erneut.
Stille.
Er schluckte und schob die Tür auf.
Ein großer Mann namens Conner McClain stand hinter dem langen Konferenztisch. Durch den wütenden Ausdruck wirkte sein stark vernarbtes Gesicht noch abschreckender. Er redete schnell mit australischem Akzent und in einer Lautstärke, die man fast als Schreien bezeichnen konnte.
»Ich hoffe für Sie, dass mich das jetzt vom Hocker reißt, Lieutenant.«
»Sir, die Amerikaner haben die Beagle gefunden.«
»Wie?«
»Sie setzen eine neue Technik zur Vermessung des Meeresbo …«
»Sind sie auf einem Flugzeug, einem U-Boot oder einem Schiff?«
»Auf einem Schiff. Der Healy. Das ist ein Eisbrecher der Küstenwache. Sie lassen gerade ein Tauchboot zu Wasser.«
»Wissen sie schon, was auf der Beagle ist?«
»Vermutlich nicht.«
»Gut. Versenken Sie den Eisbrecher.«
Der andere Mann im Besprechungsraum meldete sich zum ersten Mal zu Wort. »Tu das nicht, Conner.«
»Wir haben keine Wahl.«
»Doch. Das ist eine Gelegenheit.«
»Eine Gelegenheit wozu?«
»Der Welt zu zeigen, was sich an Bord der Beagle befindet.«
Conner wandte sich dem jungen Offizier zu. »Sie haben Ihre Befehle, Lieutenant. Wegtreten.«
Als sich die Tür schloss, sprach Conner ruhig mit dem anderen Mann. »Wir stehen kurz vor dem wichtigsten Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Wir werden die unzivilisierten Massen nicht darüber abstimmen lassen.«
Dr. Hans Emmerich hielt den Atem an, als sich die äußere Luke des U-Boots öffnete.
Hinter ihm sah Dr. Peter Finch auf den Bildschirm eines Laptops. »Alles klar. Abgedichtet.«
»Strahlung?«, fragte Emmerich.
»Vernachlässigbar.«
Emmerich und die drei Wissenschaftler stiegen die Leiter ins U-Boot hinab. Die LED-Lampen an den Helmen ihrer Anzüge warfen weiße Strahlen in die dunkle Gruft, während sie sich langsam und vorsichtig durch die engen Gänge bewegten, um mit ihren Anzügen nirgendwo hängen zu bleiben. Ein Riss hätte den Tod bedeuten können.
Als sie die Brücke des U-Boots erreichten, richtete Emmerich seine Helmlampe auf eine Bronzeplakette an der Wand. »Prometheus, hier Alpha eins. Empfangen Sie das?«
Ein Wissenschaftler auf der Healy antwortete sofort. »Verstanden, Alpha eins, ich empfange Ton und Bild.«
Auf der Plakette an der Wand stand:
RSV Beagle
Hongkong
1 Mai 1965
Ordo ab Chao
Emmerich verließ die Brücke und begann, die Kabine des Kapitäns zu suchen. Wenn er Glück hatte, befanden sich dort die Logbücher und gaben endlich preis, wo die Beagle gewesen war und was die Besatzung entdeckt hatte. Falls er sich nicht täuschte, enthielt das Schiff Beweise für eine wissenschaftliche Offenbarung, die den Lauf der Menschheitsgeschichte ändern würde.
Dr. Finchs Stimme knisterte in Emmerichs Ohrstöpsel. »Alpha eins, hier Alpha zwei, hören Sie mich?«
»Ich höre, Alpha zwei.«
»Wir haben die Laborebene erreicht. Sollen wir reingehen?«
»Positiv, Alpha zwei. Machen Sie vorsichtig weiter.«
Emmerich wartete in dem dunklen Gang.
»Alpha eins, wir sehen zwei Untersuchungsräume mit Metalltischen, vielleicht drei Meter lang. Die Räume sind gegen den Austritt von biologischen Stoffen gesichert. In dem Rest des Bereichs stehen lange Reihen von Aufbewahrungsboxen. Sie sehen aus wie große Schließfächer in einem Tresorraum. Sollen wir eine aufmachen?«
»Negativ, Alpha zwei«, sagte Emmerich schnell. »Sind sie nummeriert?«
»Positiv«, sagte Finch.
»Wir müssen die Ladeliste finden.«
»Moment. An jedem Behälter ist eine Metallscheibe.« Eine Pause entstand. »Hinter der Scheibe ist ein Guckloch, wie bei einem Türspion. In dem Behälter hier sind Knochen. Menschlich. Nein, warten Sie. Das kann nicht sein.«
Ein anderer Forscher meldete sich. »In diesem hier ist ein Säugetier, katzenartig. Spezies unbekannt. Es muss lebendig eingefroren worden sein. Es liegt immer noch in Eis.«
Emmerich hörte die Metallscheiben klicken wie den Verschluss einer Kamera, als sie vor und zurück geschoben wurden.
»Alpha eins, Sie sollten hier runterkommen. Es ist wie bei der Arche Noah.«
Emmerich schritt durch die engen Gänge. »Prometheus, hier Alpha eins. Zeichnen Sie Bild und Ton von Alpha zwei, drei und vier auf?«
Als niemand antwortete, blieb Emmerich abrupt stehen. »Prometheus, hier ist Alpha eins, hören Sie mich?«
Er rief ihn ein zweites und drittes Mal. Dann hörte er ein lautes Wummern, und der Boden wackelte unter seinen Füßen.
»Prometheus?«
TAG 1
320 Infizierte
0Tote
1
Dr. Elim Kibet saß in seinem weiß gestrichenen Büro und sah zu, wie die Sonne über der felsigen Landschaft des nordöstlichen Kenias aufging. Das Mandera Referral Hospital war ein heruntergekommenes Krankenhaus in einer der ärmsten Gegenden der Welt, und vor Kurzem hatte er die Leitung übernommen. Manche an seiner Stelle hätten das als Bürde betrachtet. Für ihn war es eine Ehre.
Hinter seiner geschlossenen Tür durchdrangen Schreie die Stille. Auf dem Flur waren eilige Schritte zu hören, und eine Schwester rief: »Doktor, kommen Sie schnell!«
Es gab keinen Zweifel, welcher Doktor gemeint war. Elim Kibet war der einzige verbliebene Arzt. Die anderen waren nach den Terroranschlägen abgereist. Viele Schwestern hatten sich ihnen angeschlossen. Die Regierung hatte sich geweigert, bewaffnete Wachmänner zu dem ländlichen Krankenhaus zu schicken. Und sie hatte sich nicht an die Vereinbarung gehalten, das medizinische Personal anständig und pünktlich zu bezahlen. Das hatte dazu geführt, dass eine weitere Welle von Angestellten aus der zerfallenden Einrichtung floh. Das Krankenhaus arbeitete jetzt mit einer Rumpfbesetzung. Die Übriggebliebenen hatten entweder keinen Ort, an den sie gehen konnten, oder waren zu engagiert, um abzureisen. Auf Elim Kibet traf beides zu.
Er legte seinen weißen Kittel an und lief durch den Flur auf die Hilferufe zu.
Mandera war eines der ärmsten Countys in Kenia. Das Pro-Kopf-Einkommen betrug 267 Dollar im Jahr – weniger als 75 Cent am Tag. Die staubige, von unbefestigten Straßen durchzogene Provinzhauptstadt lag nahe dem Dreiländereck von Kenia, Somalia und Äthiopien. Die Menschen in Mandera lebten von dem, was das Land hergab, kamen oft nur mühsam über die Runden und erfreuten sich an dem wenigen, das sie hatten. Es war ein Ort von atemberaubender Schönheit und unfassbarer Brutalität.
Die tödlichsten Krankheiten der Welt waren in der Region verbreitet, aber sie stellten dort bei Weitem nicht die größte Bedrohung dar. Al-Shabaab, eine islamistische Terrorgruppe, die zur al-Qaida gehörte, griff regelmäßig Dörfer und Regierungseinrichtungen an. Ihre Erbarmungslosigkeit war erschütternd. Vor weniger als einem Jahr hatten al-Shabaab-Kämpfer vor Mandera einen Bus angehalten und allen Muslimen befohlen auszusteigen. Sie weigerten sich jedoch und umringten stattdessen die christlichen Passagiere. Daraufhin zerrten die Milizionäre alle aus dem Bus – sowohl Christen als auch Muslime –, stellten sie in einer Reihe auf und erschossen sie. Siebenunddreißig Menschen starben an diesem Tag.
Als Elim den schäbigen Flur entlanglief, war das sein erster Gedanke – wieder ein al-Shabaab-Angriff.
Zu seiner Überraschung fand er zwei junge weiße Männer im Untersuchungszimmer vor. Ihr dunkelbraunes Haar war lang und struppig, und aus den dichten Bärten tropfte Schweiß. Der erste Mann stand an der Tür und hielt eine Videokamera in der Hand. Der zweite lag auf dem Untersuchungstisch und wälzte sich mit geschlossenen Augen von einer Seite auf die andere. Ein überwältigender Gestank von Durchfall und Erbrochenem hing in der Luft.
Zwei Schwestern beugten sich über den Mann und führten die Aufnahmeuntersuchung durch. Eine zog ihm das Fieberthermometer aus dem Mund und wandte sich zu Elim. »Vierzig Grad, Doktor.«
Der junge Mann an der Tür ließ die Videokamera fallen und packte Elim am Oberarm.
»Sie müssen ihm helfen!«
Elim riss sich los und schob ihn in die Ecke, weg vom Untersuchungstisch.
»Ja. Halten Sie bitte Abstand.«
Elims erste Diagnose lautete Malaria. Die Krankheit war in tropischen und subtropischen Regionen weit verbreitet, besonders in verarmten Gegenden wie Mandera, das nur vierhundert Kilometer vom Äquator entfernt lag. Weltweit gab es über zweihundert Millionen Infizierte, und jedes Jahr starben fast eine halbe Millionen Menschen an der Krankheit. Neunzig Prozent dieser Todesfälle ereigneten sich in Afrika, wo jede Minute ein Kind an Malaria verstarb. Auch Besucher aus dem Westen fingen sich in Kenia häufig Malaria ein. Aber die Krankheit war behandelbar, und das machte Elim Hoffnung, als er sich blaue Handschuhe überstülpte und mit der Untersuchung begann.
Der Patient war kaum bei Bewusstsein. Sein Kopf rollte von einer Seite zur anderen, während er vor sich hin murmelte. Als Elim das Hemd des Manns hochzog, änderte er seine Diagnose sofort. Ein Ausschlag überzog Bauch und Brust.
Typhus passte besser zu den Symptomen. Die Krankheit war in der Gegend ebenfalls verbreitet. Sie wurde von einem Bakterium hervorgerufen – Salmonella Typhi –, das in offenen Wasserstellen gedieh. Typhus war heilbar. Fluorchinolon –eines der wenigen Antibiotika, die sie vorrätig hatten – würde helfen.
Elims Hoffnung löste sich auf, als der Mann die Lider aufschlug. Gelbe Augen starrten ihn an. Im linken Augenwinkel sammelte sich Blut und rann dem Mann übers Gesicht.
»Treten Sie zurück.« Elim breitete die Arme aus und schob die Schwestern fort.
»Was ist los mit ihm?«, fragte der Freund des Kranken.
»Verlassen Sie den Raum«, sagte Elim.
Die Schwestern zogen sich sofort zurück, aber der junge Mann wich nicht von der Stelle. »Ich lasse ihn nicht allein.«
»Sie müssen.«
»Nein.«
Elim musterte ihn. Irgendwas stimmte hier nicht. Die Kamera, sein Verhalten, die Tatsache, dass die beiden ausgerechnet hier auftauchten.
»Wie heißen Sie?«
»Lucas. Turner.«
»Was machen Sie hier, Mr. Turner?«
»Er ist krank …«
»Nein, was machen Sie in Kenia? Was wollen Sie hier in Mandera?«
»Ein Geschäft aufziehen.«
»Was?«
»CityForge. Dabei geht es um eine Art Crowdfunding für Stadtregierungen«, sagte Lucas wie auswendig gelernt.
Elim schüttelte den Kopf. Wovon redet er?
»Wissen Sie, was er hat?«, fragte Lucas.
»Vielleicht. Sie müssen den Raum verlassen.«
»Auf keinen Fall.«
»Hören Sie mir zu. Ihr Freund hat eine sehr gefährliche Krankheit. Sie ist wahrscheinlich ansteckend. Sie gehen ein hohes Risiko ein.«
»Was ist es denn?«
»Ich weiß nicht …«
»Sie müssen doch eine Idee haben«, beharrte Lucas.
Elim sah sich um und vergewisserte sich, dass die Schwestern gegangen waren. »Marburg«, sagte er leise. Da Lucas nicht reagierte, fügte er hinzu: »Möglicherweise Ebola.«
Aus Lucas’ verschwitztem Gesicht wich die Farbe, wodurch der Kontrast zwischen seinem dunklen Haar und der hellen Haut noch stärker wurde. Er sah zu seinem Freund auf dem Tisch, dann schlurfte er aus dem Zimmer.
Elim ging zum Untersuchungstisch und sagte: »Ich rufe Hilfe. Ich werde alles für Sie tun, was in meiner Macht steht, Sir.«
Nachdem er die Handschuhe abgestreift und in den Mülleimer geworfen hatte, zog er sein Smartphone hervor. Er fotografierte den Ausschlag, bat den Mann, die Augen zu öffnen, schoss ein weiteres Foto und schickte die Bilder an das kenianische Gesundheitsministerium.
Vor der Tür beauftragte er die Schwester, die auf dem Gang wartete, niemanden außer ihn in den Raum zu lassen. Ein paar Minuten später kehrte er mit einem Schutzkittel, Gesichtsmaske, Schuhüberziehern und Schutzbrille zurück. Außerdem hatte er die einzige Behandlung dabei, die er dem Patienten bieten konnte.
Auf einem schmalen Holztisch in dem schäbigen Zimmer reihte er drei Plastikeimer auf. Jeder Eimer trug einen braunen Klebestreifen, auf dem ein einziges Wort stand: Erbrochenes, Kot, Urin. Elim war nicht optimistisch, dass er bei dem Zustand, in dem der Mann sich befand, die austretenden Körperflüssigkeiten voneinander trennen konnte, aber das war die Standardprozedur bei Ebola und ähnlichen Krankheiten, und er hatte die Absicht, sich daran zu halten. Obwohl er kaum Material und wenig Personal hatte, war der afrikanische Arzt entschlossen, dem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Das war seine Pflicht.
Er reichte dem Mann einen kleinen Pappbecher mit Tabletten – Antibiotika, um Sekundärinfektionen zu bekämpfen – und eine Flasche mit der Aufschrift ORL: orale Rehydratationslösung.
»Schlucken Sie die, bitte.«
Mit zitternder Hand kippte der Mann sich die Tabletten in den Mund und nahm einen kleinen Schluck aus der Flasche. Der Geschmack entlockte ihm ein Stöhnen.
»Ich weiß. Es schmeckt fürchterlich, aber es muss sein. Sie dürfen nicht dehydrieren.«
Im Durchschnitt starb die Hälfte aller Infizierten an Ebola. Selbst wenn das Immunsystem die Krankheit besiegte, führte der Durchfall in der akuten Phase häufig durch Dehydratation zum Tod.
»Ich komme bald zurück«, sagte Elim.
Draußen zog er vorsichtig seine PSA – die Persönliche Schutzkleidung – aus. Er wusste, dass es nicht genügend PSA im Krankenhaus gab, um das ganze Personal, das für die Betreuung des Manns benötigt wurde, zu schützen. Sie brauchten unbedingt mehr Ausrüstung – und Hilfe. In der Zwischenzeit musste Elim den Kranken isolieren und Lucas in Quarantäne halten, bis sie festgestellt hatten, ob er ebenfalls infiziert war.
Der Arzt mittleren Alters erwog gerade seine nächsten Schritte, als die Schwester erneut nach ihm rief.
Er rannte in den Triage-Raum des Krankenhauses, wo er einen weiteren Ausländer vorfand, einen großen weißen Mann, der am Türrahmen lehnte. Er war älter als die anderen beiden, aber wie der Kranke war er blass und verschwitzt und roch nach Durchfall und Erbrochenem.
»Gehört er zu den anderen?«, fragte Elim.
»Weiß ich nicht«, antwortete die Schwester. »Er wurde vom Flughafen hergeschickt.«
»Sir, bitte ziehen Sie Ihr Hemd hoch.«
Der große Mann hob sein Hemd und entblößte einen großflächigen Ausschlag.
Elim machte ein Foto, um es ans Gesundheitsministerium zu schicken. Zu der Aufnahmeschwester sagte er: »Bringen Sie ihn in Untersuchungsraum zwei. Berühren Sie ihn nicht. Halten Sie Abstand. Verlassen Sie den Raum. Niemand darf zu ihm rein.«
Er wählte die Nummer der Notfallzentrale des kenianischen Gesundheitsministeriums. Als die Verbindung zustande kam, sagte er: »Ich rufe aus dem Mandera Referral Hospital an. Wir haben hier ein Problem.«
2
Er war verprügelt worden. Das war sein erster Gedanke beim Aufwachen. Seine Rippen strahlten Schmerz aus. Die Beine taten weh. Er betastete die empfindliche Beule an der linken Seite seines Kopfs und zog schnell die Hand zurück.
Er lag ausgestreckt auf einem frisch gemachten Doppelbett. Die Morgensonne schien durch die dünnen Vorhänge, blendete ihn und fachte den Schmerz in seinem pochenden Kopf weiter an.
Er schloss die Augen und wandte sich ab.
Nach einigen Sekunden öffnete er sie langsam wieder. Neben der silbernen Lampe auf dem Nachttisch lag ein kleiner Schreibblock. Der Briefkopf lautete: Concord Hotel, Berlin.
Er versuchte sich an das Einchecken zu erinnern, aber es gelang ihm nicht. Schlimmer noch, er wusste nicht einmal, welcher Tag es war. Oder warum er in Berlin war. Oder wie er hieß. Was ist passiert?
Er stand auf und humpelte zum Bad. Bei jedem Schritt schmerzten seine Rippen. Er zog sich das blaue Hemd aus der beigefarbenen Hose. Ein Bluterguss bedeckte seine linke Seite; in der Mitte dunkelblau bis schwarz, an den Rändern rot.
Er betrachtete sich im Spiegel. Das Gesicht mit den hohen Wangenknochen war schlank und straff. Dichtes blondes Haar fiel ihm bis auf die Augenbrauen und lockte sich an den Spitzen ein wenig. Er war leicht gebräunt, aber seine Haut und die weichen Hände ließen auf einen Bürojob schließen. Er sah sich die Beule an seinem Kopf an. Sie war groß, aber der Schlag hatte die Haut nicht aufgerissen.
Als er in die Hosentaschen griff, fand er nur einen dünnen Zettel von der Größe einer Visitenkarte. Er zog ihn hervor und untersuchte ihn: eine 20-Prozent-Rabattmarke von einer Trockenreinigung.
Auf die Rückseite hatte er – oder jemand anders – drei Zeilen gekritzelt.
Die erste lautete:
ZDUQH VLH
Die zweite:
7379623618
Die dritte Zeile bestand lediglich aus einer Klammer mit drei Diamanten.
(<><><>)
Irgendein Code.
Sein Kopf tat zu weh, um sich mit Codes zu beschäftigen. Er legte den Zettel auf den Waschtisch und ging durch das Schlafzimmer in den Wohnbereich, wo er abrupt stehen blieb. Ein Mann lag auf dem Boden. Sein Gesicht war blass und grau. Er atmete nicht.
Ein einzelnes weißes Blatt lag neben dem Mann vor der Eingangstür. Es war eine Rechnung für die Suite, die offenbar vor einer Woche angemietet worden war. Darin waren mehrere Lieferungen des Zimmerservice, aber nichts aus der Minibar aufgeführt.
Oben auf der Rechnung stand der Name des Gastes. Desmond Hughes. Er erkannte sofort, dass es sein Name war. Aber die Flut von Erinnerungen blieb aus.
Der Mann auf dem Boden war schlank und groß. Sein kurz geschnittenes graues Haar dünnte sich schon aus. Er trug einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd ohne Krawatte. Um seinen muskulösen Hals verlief ein Ring aus Blutergüssen.
Desmond kniete neben der Leiche nieder und wollte in die Hosentaschen des Manns greifen, doch dann hielt er instinktiv inne. Er zog den kleinen Mülleimer unter dem Schreibtisch hervor, nahm den Plastikbeutel heraus und stülpte ihn sich über die Hand, um keine Fingerabdrücke oder DNS-Spuren zu hinterlassen.
Der Mann hatte ein Portemonnaie und einen Plastikausweis der Firma Rapture Therapeutics in der Tasche. Auf der ID-Karte war keine Berufsbezeichnung angegeben, nur ein Name: Gunter Thorne. Das Foto passte zu dem bleichen Gesicht, das mit der Wange auf dem dünnen Teppich lag. Sein deutscher Personalausweis und die Kreditkarten waren alle auf denselben Namen ausgestellt.
Desmond schob die Gegenstände wieder in die Taschen und schlug vorsichtig das Revers des Anzugs zurück. In einem Schulterholster steckte eine schwarze Pistole.
Als Desmond sich auf den Hintern sinken ließ, verstärkte sich der Schmerz in seinen Beinen. Er stand auf, dehnte sie und sah sich im Zimmer um. Es war makellos sauber. Eindeutig vor Kurzem gereinigt worden. Er durchsuchte es, fand aber keinerlei weitere Hinweise. Es gab kein Gepäck, und im Schrank hingen keine Kleidungsstücke. Der kleine Safe stand offen und war leer. Nicht einmal Toilettenartikel lagen herum.
Er überprüfte noch einmal die Rechnung. Keine Anrufe.
Was hatte das alles zu bedeuten? Es schien, als wäre er nur hergekommen, um zu essen. Oder um sich zu verstecken. Wohnte er in Berlin? Wenn Gunter Thornes Leiche nicht im Wohnzimmer gelegen hätte, hätte Desmond schon den Empfang angerufen und sich ein anständiges Krankenhaus empfehlen lassen. Aber das war jetzt unmöglich, solange er nicht mehr Informationen hatte. Es gab nur einen einzigen Hinweis.
Er ging zurück ins Bad und holte den Coupon mit den Buchstaben und Zahlen auf der Rückseite. Als er ihn ansah, kam ihm ein Gedanke bezüglich der Klammern. In Geschäftsberichten bezeichneten sie eine negative Summe – einen Verlust. Einen Abzug von einer Bilanz.
Woher wusste er das? Arbeitete er im Finanzwesen?
Er setzte sich aufs Bett und nahm den Block vom Nachttisch. Also minus drei. Ja – die untere Zeile musste der Schlüssel sein, die ersten beiden die Nachricht. Plötzlich tauchte der Name des Codes in seinem Kopf auf: eine einfache monoalphabetische Substitution. Und mehr noch, es war eine Caesar-Verschlüsselung, die Methode, die Julius Caesar für seine geheime Korrespondenz verwendet hatte.
Desmond ging bei jedem Buchstaben drei Stellen im Alphabet zurück und zog von den Zahlen jeweils drei ab. Das ergab:
WARNE SIE
4046390385
Er setzte Striche hinter die dritte und sechste Ziffer.
404-639-0385
Warne sie. Und eine Telefonnummer. Wovor sollte sie gewarnt werden? Durch den Durchgang zwischen Schlafzimmer und Wohnbereich betrachtete er Gunter Thornes Leiche. Vielleicht war Rapture Therapeutics – oder wer auch immer Gunter in das Hotelzimmer geschickt hatte – auch hinter »ihr« her. Oder vielleicht gab es gar keinen Zusammenhang. Oder vielleicht hatte Desmond all das arrangiert, um Gunter in die Falle zu locken. Sie könnte eine Komplizin von ihm sein. So oder so wusste sie vielleicht etwas.
Desmond nahm den Hörer ab und wählte.
Beim dritten Klingeln meldete sich eine Frau mit benommener Stimme. »Shaw.«
»Hallo. Hier ist … Desmond. Hughes.«
»Hallo.« Sie klang jetzt wacher.
»Hi.« Er hatte keine Ahnung, wie er anfangen sollte. »Haben Sie … meinen Anruf erwartet?«
Sie seufzte in den Hörer. Er hörte ein Rascheln, vielleicht setzte sie sich auf.
»Was soll das, Desmond?«
»Kennen wir uns?«
Ihr Tonfall war jetzt traurig. »Das ist nicht lustig, Des.«
»Hören Sie, ich … können Sie mir einfach sagen, wer Sie sind? Wo Sie arbeiten? Bitte.«
Eine Pause entstand.
»Peyton Shaw.«
Als er nichts sagte, fügte sie hinzu: »Ich arbeite jetzt beim CDC. Ich bin Epidemiologin.«
Aus dem Wohnzimmer ertönte ein Pochen – jemand klopfte dreimal fest an der Tür.
Desmond dachte nach. Die Uhr auf dem Tisch zeigte 7:34. Zu früh für die Zimmerreinigung.
»Hallo?«, sagte Peyton.
Wieder klopfte es dreimal, dieses Mal lauter, dann sagte eine tiefe Männerstimme auf Deutsch: »Polizei.«
»Hören Sie, Peyton. Ich glaube, Sie sind in Gefahr.«
»Was? Wovon redest du?«
Weiteres beharrliches Klopfen an der Tür, so laut, dass es die Gäste in den Nebenzimmern wecken musste. »Polizei! Herr Hughes, bitte öffnen Sie die Tür.«
»Ich rufe Sie später wieder an.«
Er legte auf und rannte zur Tür, ohne auf den Schmerz in seinem Bein zu achten. Durch den Spion sah er zwei uniformierte Polizeibeamte neben einem Mann in dunklem Anzug – wahrscheinlich vom Sicherheitsdienst des Hotels.
Der Hotelangestellte hielt eine Schlüsselkarte vor das Schloss.
3
In Atlanta setzte sich Dr. Peyton Shaw mit dem schnurlosen Telefon am Ohr im Bett auf. »Desmond?«
Die Verbindung war unterbrochen.
Sie legte auf und wartete, dass Desmond erneut anrief.
Es war 1:34 Uhr am Samstagmorgen, sie war allein zu Hause und hatte seit über drei Stunden geschlafen. Aber jetzt war sie hellwach. Und beunruhigt.
Sie verspürte den Drang, sich in der Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung umzusehen, um sich zu vergewissern, dass wirklich niemand sonst da war. Seit sie mit Mitte zwanzig nach Atlanta gezogen war, hatte sie die ganze Zeit allein gewohnt, und bis auf wenige Ausnahmen hatte sie sich immer sicher gefühlt.
Sie nahm das Handy, stand von dem niedrigen Bett auf und trat wachsam aus ihrem Schlafzimmer. Alle paar Sekunden quietschten die kalten Holzdielen unter ihren nackten Füßen. Die Wohnungstür war geschlossen und der Riegel vorgelegt. Die Tür zum zweiten Zimmer, das sie als Büro benutzte, war ebenfalls zu, sodass man von dem offenen Wohn-Ess-Bereich aus nicht hineinsehen konnte. Sie hatte festgestellt, dass Fotos von Pandemien überall auf der Welt sowohl für ihre Freundinnen als auch für Herrenbesuch ein echter Stimmungskiller waren, deshalb ließ sie die Bürotür immer geschlossen.
Aus dem deckenhohen Fenster im Wohnzimmer sah sie auf die Peachtree Street, die zu dieser Stunde fast verlassen war. Sie fröstelte vor der Scheibe; es war kälter als Ende November üblich.
Sie wartete und hoffte noch immer, dass das Festnetztelefon klingeln würde. Schon oft hatte sie überlegt, den Anschluss zu kündigen, aber ein paar Leute hatten immer noch die Nummer, und aus unerfindlichen Gründen waren Kabelfernsehen und Internet billiger, wenn man einen Festnetzanschluss besaß.
Sie strich sich durch das schulterlange braune Haar. Ihre Mutter war halb Chinesin, halb Deutsche, und Peyton hatte die gleiche porzellanartige Haut. Sie wusste nicht genau, was sie von ihrem englischen Vater geerbt hatte, der gestorben war, als sie sechs war.
Sie ließ sich auf das graue Stoffsofa fallen und zog die kalten Füße unter den Po. Mit ihrem Handy tat sie etwas, das sie schon lang nicht mehr gemacht hatte – und mit dem aufzuhören sie sich geschworen hatte: Sie öffnete Google und suchte nach Desmond Hughes. Desmonds Stimme zu hören hatte sie erschüttert. Seine Warnung – Sie sind in Gefahr – ging ihr nicht aus dem Kopf.
Der erste Treffer war die Website von Icarus Capital, einer Risikokapitalgesellschaft. Desmond war auf der Seite Unser Team als Gründer und geschäftsführender Teilhaber an erster Stelle aufgeführt. Sein Lächeln wirkte selbstsicher, fast arrogant.
Sie klickte auf die Seite Investments und las die Einführung:
Es heißt, die Gegenwart sei das Maß aller Dinge. Wir bei Icarus Capital sind anderer Meinung. Wir glauben, die Zukunft ist das Entscheidende. Das ist es, worin wir investieren: die Zukunft. Genauer gesagt investieren wir in Menschen, die die Zukunft erfinden. Hier ist eine Auswahl dieser Menschen und ihrer Firmen. Wenn Sie die Zukunft erfinden, kontaktieren Sie uns. Wir wollen Ihnen helfen.
Peyton überflog die Liste der Firmen: Rapture Therapeutics, Phaethon Genetics, Rendition Games, Cedar Creek Entertainment, Rook Quantum Sciences, Extinction Parks, Labyrinth Reality, CityForge und Charter Antarctica.
Sie kannte keine davon.
Sie klickte in den Suchergebnissen auf den nächsten Link, der zu einem Video von Desmond bei einer Konferenz führte. Ein Moderator stellte aus dem Off eine Frage: »Icarus hat in einen sehr breit gefächerten Mix von Start-ups investiert, Pharma, Biotechnik, Virtual Reality, Grid-Computing und sogar Extremtourismus an Orten wie der Antarktis. Was ist die Verbindung zwischen all diesen Feldern? Können Sie den Unternehmern im Publikum sagen, was Sie an einem Start-up interessiert?«
Desmond hob in seinem Sessel das Mikrofon und antwortete ruhig, aber mit ansteckender Begeisterung. Seine Mundwinkel waren zu einem leichten Lächeln hochgezogen. Er sah konzentriert und ohne zu blinzeln in die Kamera.
»Nun, wie Sie schon sagen, es ist schwierig, genau zu definieren, nach welcher Art von Firma Icarus sucht. Ich kann Ihnen aber verraten, dass jede Einzelne unserer Investitionen Teil eines größeren, koordinierten Experiments ist.«
Der Moderator zog die Brauen hoch. »Interessant. Was für ein Experiment?«
»Es ist ein wissenschaftliches Experiment – eines, das eine sehr wichtige Frage beantworten soll.«
»Und zwar?«
»Warum existieren wir?«
Der Moderator tat überrascht und wandte sich an die Zuschauer. »Sonst nichts?«
Das Publikum lachte, und Desmond schloss sich an.
Er beugte sich in seinem Sessel vor, warf dem Moderator einen Blick zu, dann sah er wieder in die Kamera. »Okay, ich nehme an, dass viele von Ihnen – im Publikum und zu Hause – sagen würden, die Antwort auf diese Frage ist einfach: Wir existieren, weil die physikalischen Eigenschaften dieses Planeten die Entstehung von Leben begünstigen. Die Umweltbedingungen auf der Erde haben uns sozusagen zwangsläufig hervorgebracht. Das stimmt, aber die eigentliche Frage ist warum? Warum begünstigt das Universum die Entstehung von Leben? Zu welchem Zweck? Was ist die Bestimmung der Menschheit? Ich glaube, darauf gibt es eine Antwort.«
»Wow. Sie klingen fast wie ein gläubiger Mensch.«
»Das bin ich auch. Ich glaube fest daran, dass um uns herum ein gewaltiger Prozess abläuft, dass es ein größeres Bild gibt, von dem wir bisher nur einen winzigen Ausschnitt gesehen haben.«
»Und Sie glauben, die Technologie, die Icarus finanziert, wird diese ultimative Wahrheit hervorbringen?«
»Ich würde mein Leben darauf verwetten.«
Peyton war gerade wieder eingeschlafen, als ein Geräusch vom Nachttisch sie weckte. Sie lauschte starr, aber es endete plötzlich.
Dann setzte es von Neuem ein: Etwas rüttelte am Tisch.
Eine Vibration.
Hinter der Lampe tauchte ein Licht auf, das zur Decke strahlte.
Peyton atmete aus, nahm das summende Handy und sah auf die Uhrzeit – 3:55. Sie erkannte zwar die Nummer nicht, aber die Vorwahl. 41. Die Schweiz.
Sofort meldete sie sich.
»Peyton, Entschuldigung, dass ich dich wecke«, sagte Dr. Jonas Becker.
Der deutsche Epidemiologe leitete ein Notfallteam zur Seuchenbekämpfung für die WHO. Peyton ging bei der amerikanischen Seuchenschutzbehörde einer ähnlichen Tätigkeit nach. Die beiden hatten oft in den Krisengebieten der Welt zusammengearbeitet, und im Laufe der Zeit hatte sich eine besondere Beziehung zwischen ihnen entwickelt.
»Schon gut«, sagte sie. »Was ist passiert?«
»Ich habe dir gerade eine Mail geschickt.«
»Warte kurz.«
Peytons nackte Füße tapsten über den Holzboden, als sie ins Arbeitszimmer lief. Sie setzte sich an den billigen Ikea-Schreibtisch, weckte ihren Laptop auf und startete die VPN-Software, die eine sichere Verbindung zu ihrem Server beim CDC herstellte.
Sie betrachtete die Fotos in der E-Mail und ließ sich kein Detail entgehen.
»Ich sehe es«, sagte sie.
»Das kenianische Gesundheitsministerium hat uns das vor ein paar Stunden geschickt. Ein Arzt in einem Krankenhaus in Mandera hat die Fotos gemacht.«
Peyton hatte noch nie von Mandera gehört. Sie öffnete Google Maps und sah, dass es im äußersten Nordosten Kenias lag, gleich an der Grenze zu Somalia und Äthiopien. Es war der schlimmstmögliche Ort für einen Ausbruch.
»Es ist offensichtlich ein hämorrhagisches Fieber«, sagte Jonas. »Riftalfieber ist in der Gegend verbreitet. Und Ebola und Marburg. Nach dem Ebola-Ausbruch in Westafrika nehmen das hier alle sehr ernst. Ich wurde schon vom Büro des Generaldirektors angerufen.«
»Sind das die einzigen bekannten Fälle?«
»Im Moment ja.«
»Was wissen wir über sie?«, fragte Peyton.
»Nicht viel. Alle drei Männer sagen, sie wären Ausländer, die nur zu Besuch im Land sind.«
Das weckte Peytons Interesse.
»Die beiden jüngeren Männer sind Amerikaner. Sie haben vor Kurzem ihren Abschluss an der UNC-Chapel Hill gemacht. Sie sind als Mitarbeiter eines Start-ups nach Kenia gekommen. Der andere Mann stammt aus London. Er arbeitet für eine englische Firma, die Radarsysteme installiert.«
»Was für Radarsysteme?«
»Zur Luftüberwachung. Er hat am Flughafen von Mandera gearbeitet, als er krank wurde.«
»Da gibt es einen Flughafen?«
»Nichts Besonderes. Bis vor ein paar Monaten war es nur eine Landepiste aus Lehm. Die Regierung hat die Landebahn asphaltieren und neues Equipment anschaffen lassen. Er wurde letzte Woche neu eröffnet.«
Peyton massierte sich die Schläfen. Ein funktionierender Flughafen in einem Seuchengebiet kam einem Albtraum gleich.
»Wir holen Erkundigungen über den Flughafen ein – über den Verkehr, wer bei der Eröffnungsfeier war und welche Ausländer noch an dem Projekt gearbeitet haben. Wir haben auch schon die Gesundheitsbehörden in England kontaktiert, und sie bearbeiten den Fall. Da ist es jetzt acht Uhr vierzig, also werden sie sich bald mit der Familie und den Arbeitskollegen des Manns in Verbindung setzen. Wenn wir wissen, wie lang er schon in Kenia ist, entscheiden wir, ob sie in Quarantäne müssen.«
Peyton überflog die E-Mail und fand die Namen der beiden jüngeren Männer. »Wir fangen an, die Kontakte der Amerikaner zu überprüfen, und stellen einen Plan auf, wann die beiden wo gewesen sind. Was können wir sonst noch tun?«
»Das wär’s erst mal. Die Kenianer haben noch nicht darum gebeten, aber wenn es so läuft wie in Westafrika, kann man davon ausgehen, dass sie eine Menge Hilfe brauchen.«
Hilfe bedeutete Geld und Ausrüstung. Während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika hatte das CDC Hunderte von Leuten entsandt und Equipment zur Verfügung gestellt, unter anderem PSA, Tausende von Leichensäcken und zahllose Testsets.
»Ich rede mit Elliott«, sagte Peyton. »Wir informieren das Außen- und das Entwicklungshilfeministerium.«
»Eine Sache noch. Wir hatten hier gerade unser Sicherheitsbriefing. Mandera County ist ein sehr gefährlicher Ort. In der Gegend operiert eine Terrororganisation namens al-Shabaab. Sie ist genauso brutal wie der IS und kein Freund der Amerikaner. Wenn ihr in der Gegend seid, könnte es noch gefährlicher werden. Wir kommen heute Nacht in Nairobi an, aber ich dachte mir, wir warten auf euer Team. Wir können eine kenianische Militäreskorte nehmen und zusammen nach Norden reisen.«
»Vor Sonntag können wir wahrscheinlich nicht da sein.«
»In Ordnung, wir warten. Es gibt in Nairobi eine Menge für uns zu tun.«
»Gut. Danke, Jonas.«
»Gute Reise.«
Peyton legte das Handy auf den Schreibtisch, stand auf und betrachtete die Weltkarte an der Wand. Bunte Stecknadeln sprenkelten die Kontinente. Jede Nadel markierte einen Ausbruch, bis auf eine. Im Osten Ugandas, an der Grenze zu Kenia, steckte mitten im Mount-Elgon-Nationalpark eine silberne Reversnadel. Sie stellte einen von einer Schlange umwundenen Stab dar – das traditionelle Symbol der Medizin, den Äskulapstab, den man auch im Star of Life auf Krankenwagen sah. Die Nadel hatte Peytons Bruder Andrew gehört. Andrew war derjenige, der sie inspiriert hatte, Epidemiologin zu werden, und sie trug die Nadel auf allen Auslandseinsätzen bei sich. Sie war alles, was ihr von ihm geblieben war.
Sie zog das silberne Andenken aus der Karte, steckte es in die Tasche und markierte das Dreiländereck von Kenia, Äthiopien und Somalia mit einer roten Nadel als Ausbruchsort eines viralen hämorrhagischen Fiebers.
Sie hatte immer zwei gepackte Reisetaschen bereitstehen: eine für die Erste und eine für die Dritte Welt. Sie nahm die Dritte-Welt-Tasche und packte die nötigen Stromadapter für Kenia dazu.
Sobald die Lage sich etwas beruhigte, würde sie ihre Mutter und ihre Schwester anrufen müssen, um ihnen mitzuteilen, dass sie einen Einsatz hatte. In vier Tagen war Thanksgiving, und Peyton hatte das Gefühl, sie würde es verpassen.
Auch wenn sie es nur ungern zugab, war Peyton auf gewisse Weise erleichtert. Außer Madison hatte sie nun keine Geschwister mehr. Durch den Tod ihres Bruders waren sie sich nähergekommen, aber in letzter Zeit hatte jede Unterhaltung mit ihrer Schwester damit geendet, dass Madison sie fragte, warum sie sich nicht mit Männern traf, und darauf herumritt, dass ihre Chancen, eine Familie zu gründen, rapide sanken. Da sie schon achtunddreißig war, musste sie ihr in diesem Punkt recht geben, aber sie war sich nicht einmal sicher, ob sie überhaupt eine Familie wollte. In Wahrheit wusste sie nicht einmal genau, was sie von ihrem Leben neben dem Beruf überhaupt erwartete. Die Arbeit war zu ihrem Leben geworden, und sie glaubte, etwas Wichtiges zu tun. Es gefiel ihr, mitten in der Nacht angerufen zu werden. Sie mochte das Rätsel, das jeder Ausbruch mit sich brachte, und das Wissen, dass sie mit ihrer harten Arbeit Menschenleben rettete, dass jede Sekunde zählte.
Und jetzt tickte wieder die Uhr.
Unten auf der Straße saß ein Mann im Auto und beobachtete, wie Peyton aus der Tiefgarage fuhr.
Während er den Lenker einschlug, sprach er über die offene Leitung. »Zielperson verlässt das Haus. Keine Besuche. Keine SMS. Nur ein Anruf – von ihrem Kontakt bei der WHO.«
4
Desmond sah durch den Spion, wie der Mann vom Sicherheitsdienst des Hotels die Schlüsselkarte vor das Schloss hielt. Die beiden Polizeibeamten neben ihm hatten die Hände auf die Hüften gestützt.
Desmond verriegelte die Tür. »Einen Moment bitte«, sagte er auf Englisch und versuchte, möglichst verärgert zu klingen. »Ich bin nicht angezogen.«
»Beeilen Sie sich bitte, Mr. Hughes«, sagte der Wachmann.
Desmond sah zu dem toten Mann auf dem Boden.
Im Kopf spielte er seine Möglichkeiten durch.
Option eins: aus dem Fenster fliehen. Er ging zu der hohen Scheibe und blickte hinaus. Er befand sich mindestens zehn Stockwerke über dem Boden, und es gab keine Feuerleiter und keine andere Möglichkeit unbeschadet nach unten zu gelangen. Außerdem sah es aus, als ließe sich das Fenster nicht öffnen.
Option zwei: wegrennen. Dabei gingen die Erfolgschancen gegen null. Er war nicht in der Verfassung, sich an den drei Männern vorbeizudrängen, geschweige denn, vor ihnen wegzulaufen.
Damit blieb nur noch Option drei: die Leiche verstecken und die Sache durchstehen.
Aber wo?
Im Wohnzimmer standen ein Schreibtisch, ein Bürostuhl, ein Sofa, ein zusätzlicher Stuhl und ein Fernsehschrank. Unter dem Fenster und den bodenlangen Vorhängen befand sich die Heizung. Ein breiter Durchgang mit Schiebetür führte ins Schlafzimmer, in dem ein Doppelbett mit zwei Nachttischen, ein weiteres Fenster mit Heizkörper darunter und ein Schrank waren. Das kleine Bad konnte man nur vom Schlafzimmer aus erreichen.
Schnell traf Desmond eine Entscheidung.
Als er den Mann vom Boden hob, schoss Schmerz durch seinen Körper. Es fühlte sich an, als bohrten sich Stacheln aus seinen Rippen ins Fleisch, und beinahe hätte er sich übergeben. Der Mann war ungefähr so groß wie Desmond, etwa einen Meter achtzig, und schlank. Wahrscheinlich wog er nur 75 Kilo, aber es fühlte sich an wie 300. Die Leichenstarre war bereits eingetreten. Gunter Thorne musste schon seit Stunden tot sein.
Während er die Leiche über den Boden schleifte, fragte sich Desmond, woher er wusste, wann Leichenstarre einsetzte. Aber am meisten besorgte ihn, dass er nie in Erwägung gezogen hatte, einfach die Tür zu öffnen, die Polizei einzulassen und die Situation zu erklären. Tief im Inneren schien er zu wissen, dass er der Polizei aus dem Weg gehen musste – dass er etwas zu verbergen hatte. Dass es schlecht für ihn wäre, wenn die Wahrheit ans Licht käme. Er musste auf freiem Fuß bleiben. Er musste herausfinden, was geschehen war.
Als es erneut klopfte, war er verschwitzt und außer Atem. Er trocknete sich das Gesicht ab, lief zur Tür, öffnete sie einen Spalt und spähte misstrauisch in den Gang.
»Ja?«
»Dürfen wir reinkommen, Mr. Hughes?«, fragte der Wachmann.
Wenn er ablehnte, würde das Verdacht erregen, und er konnte sie ohnehin nicht daran hindern einzutreten. Wortlos stieß er die Tür auf.
Die drei Männer kamen mit den Händen an den Hüften herein und sahen sich um. Einer der Beamten ging ins Schlafzimmer und näherte sich den geschlossenen Türen des Schranks und des Bads.
»Worum geht es?«, fragte Desmond.
»Jemand hat wegen einer Ruhestörung angerufen«, sagte der Polizeibeamte im Wohnzimmer, ohne ihm in die Augen zu sehen. Der Mann warf erst einen Blick hinter das Sofa, dann zum Fernsehschrank. Er schien das Kommando zu haben.
Durch die Tür zum Schlafzimmer beobachtete Desmond, wie der andere Beamte zum Schrank sah. Er streckte den Arm aus, öffnete die Tür und hielt inne. Sein Blick schweifte vom Boden zur Decke. Schließlich wandte er sich zu Desmond um.
»Kein Gepäck?«
»Ich habe es schon nach unten geschickt«, sagte er in einem Tonfall, der ihnen zu verstehen geben sollte, dass sie seine Zeit verschwendeten. Er musste in die Offensive gehen, um sie aus seinem Zimmer zu befördern. »Was für eine Ruhestörung? Sind Sie sicher, dass Sie im richtigen Zimmer sind?«
Der Beamte im Wohnzimmer schien seine Suche beendet zu haben. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf Desmond.
»Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen in der Stadt, Mr. Hughes?«
»Von beidem ein bisschen.«
»Was machen Sie beruflich?«
»Technologie«, sagte er herablassend. »Hören Sie, bin ich in Gefahr? Soll ich die amerikanische Botschaft anrufen?« Er ließ seine Stimme mit jedem Satz höher klingen, um seine Empörung zu betonen. »Können Sie mir sagen, was hier los ist?«
Der Polizist ließ nicht locker. »Wie lang sind Sie schon in der Stadt?«
»Eine Woche. Was spielt das für eine Rolle?«
Der Polizist blieb unbeeindruckt. Es funktionierte nicht.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie der andere Beamte sich links von der Badezimmertür postierte, eine Hand an der Pistole, die andere an der Türklinke.
Desmond änderte die Strategie. Er konzentrierte sich auf den Wachmann und sagte schnell: »Ihnen ist doch klar, dass ich das in meiner Online-Bewertung erwähne?«
Die Augen des Wachmanns weiteten sich.
»Darauf können Sie sich verlassen«, fuhr Desmond fort. »Die passende Überschrift wäre: Steigen Sie hier ab, wenn Sie auf Gestapo-Verhöre und beschissenes WiFi stehen.«
Der Wachmann sah zu dem Beamten. »Sind Sie fertig?«
Desmond hörte, wie knarrend die Badezimmertür geöffnet wurde. Eine Sekunde später ging das Licht an. Der Polizist sah sich zu seinem Kollegen und dem Wachmann um. Mit der Hand an seiner Pistole schüttelte er den Kopf.
»Ja. Wir sind hier fertig«, sagte der andere Beamte. »Tut mir wirklich leid, dass wir Sie belästigen mussten, Mr. Hughes. Genießen Sie Ihre Zeit in Berlin.«
Die drei Männer versammelten sich an der Tür. Der Wachmann hatte gerade nach der Klinke gegriffen, als ein Geräusch ertönte: Haut, die über Glas rutschte. Das Quietschen endete, und alle drei Männer blieben stehen und wandten sich zu Desmond um. Hinter ihm hatte die Schwerkraft gesiegt und ließ Gunter Thornes Leiche zu Boden sinken. Desmond hatte den Toten in der Ecke gegen das Fenster gelehnt und mit dem Vorhang verdeckt – aber jetzt kam er zum Vorschein. Das Gesicht rutschte noch einmal über die Scheibe, bevor der Leichnam erst auf den Heizkörper und schließlich mit einem Rumpeln zu Boden fiel.
Desmond zögerte nicht. Er stürmte nach vorn und überbrückte die Entfernung zu den drei Männern in weniger als einer Sekunde. Mit aller Kraft schwang er die rechte Faust. Sie traf den rechts stehenden Polizisten am Wangenknochen unter dem linken Auge. Der Kopf des Manns flog nach hinten und prallte gegen den Metalltürrahmen. Er verlor auf der Stelle das Bewusstsein.
Desmond drehte sich und drückte seinen Körper gegen den Wachmann, der zwischen den beiden Polizisten eingeklemmt war. Der verbliebene Polizist zog seine Pistole und hob sie, aber Desmond vollendete schnell seine 180-Grad-Drehung und knallte ihm den Ellbogen gegen die Stirn. Der Mann wurde gegen die Holztür geschleudert, dann taumelte er bewusstlos nach vorn und ließ die Waffe fallen. Desmond schnappte sich die Pistole und richtete sie auf den Wachmann.
»Halt die Hände so, dass ich sie sehen kann. Geh weg von der Tür.«
Die Hände des Wachmanns zitterten, als er sie hob.
»Ich will dich nicht verletzen, aber wenn du schreist, bleibt mir nichts anderes übrig. Verstanden?«
Der Mann nickte.
»Warum ist die Polizei gekommen?«
»Es ist so, wie sie gesagt haben – ein Anruf.«
»Wer hat angerufen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht …«
»Wer?«
»Sie haben gesagt, es wäre ein anonymer Hinweis.«
»Sind da unten noch mehr?«
»Weiß ich nicht …«
»Lüg mich nicht an!«, sagte Desmond und hob die Pistole.
Der Mann schloss die Augen. »Es sind zwei Autos gekommen. Ich weiß nicht, ob sie dageblieben sind oder nicht.«
»Dreh dich um.«
Der Mann rührte sich nicht.
»Los.«
Langsam wandte sich der Wachmann um. Seine Hände zitterten jetzt stark. Desmond drehte die Pistole um und schlug dem Mann mit dem Griff auf den Kopf, sodass er bewusstlos zu Boden sank.
Er schleifte den Wachmann von der Tür weg, zog das Magazin aus der Pistole und vergewisserte sich, dass keine Patrone in der Kammer und die Waffe gesichert war. Er zerrte am Rücken das Hemd aus der Hose und schob sich die Pistole in den Hosenbund, dann sammelte er die Ersatzmagazine beider Polizisten ein. Er nahm den Polizeiausweis des jüngeren Beamten und das Funkgerät des Wachmanns. Nachdem er sich den Hörer ins Ohr gesteckt hatte, lauschte er eine Weile. Es waren knappe Sätze auf Deutsch, aber er verstand das meiste davon.
Er musste sich entscheiden: Treppe oder Aufzug. Vorn oder hinten.
Beide Wege hatten Vor- und Nachteile. Aber wenn er die Treppe hinunterrannte und zum Hinterausgang lief, würde er Verdacht erregen, falls jemand die Überwachungskameras beobachtete. Also entschied er sich für den Aufzug und die Vordertür.
Desmond nahm sämtliches Geld, das die drei Männer bei sich trugen – insgesamt 312 Euro. Er brauchte es für die Flucht, und da man ihm ohnehin schon Widerstand gegen die Festnahme und Angriff auf Polizeibeamte und möglicherweise sogar Mord zur Last legen würde, nahm er an, dass der Raub seine Situation nicht wesentlich verkomplizierte.
Im Flur schlenderte er lässig zum Aufzug und drückte den Knopf. Nach wenigen Sekunden öffnete sich die Tür, und eine weißhaarige Frau, die ihn keines Blicks würdigte, stand vor ihm.
Während er nach unten fuhr, herrschte auf dem Kanal des Sicherheitsdienstes Stille. Die Tür ging wieder auf, und Desmond trat zur Seite, um die Frau zuerst in die Lobby treten zu lassen.
Über Funk sagte eine Stimme auf Deutsch: »Gerhardt, bist du noch in 1207?«
Desmond folgte der Frau.
»Gerhardt, bitte kommen.«
Neben der Glasdrehtür standen zwei uniformierte Polizisten und unterhielten sich grinsend. Sie waren knapp zehn Meter entfernt. Als sie Desmond bemerkten, verstummten sie und sahen ihn an.
5
Peyton kam um kurz vor vier am CDC-Hauptquartier an. Das Gelände, das man allgemein mit Atlanta in Verbindung brachte, lag tatsächlich knapp außerhalb der Stadtgrenze im wohlhabenden Druid Hills im gemeindefreien DeKalb County. Die Vorläuferorganisation des CDC war aus einem einfachen Grund in Atlanta aufgebaut worden: um Malaria zu bekämpfen. Damals, im Juli 1946, war die Krankheit Amerikas größtes Gesundheitsproblem, besonders im heißen und feuchten Südosten. Die Lage mitten in der amerikanischen Brutstätte der Malaria war ein bedeutender Vorteil gewesen.
Als Peyton am CDC anfing, hatte sie nur ihre Karte durch das Lesegerät ziehen müssen, um ins Gebäude zu gelangen. Jetzt war das Verfahren strenger, und jeder wurde durchleuchtet und abgetastet. Sie wusste, dass die Sicherheitsmaßnahmen wichtig waren, aber sie hatte es eilig, ins Gebäude zu gelangen und anzufangen. Jede Sekunde zählte.
Sobald das Wachpersonal sie eingelassen hatte, begab sie sich zum Emergency Operations Center, der Kommandozentrale zur Seuchenbekämpfung. Der Hauptraum des EOC sah aus wie der Kontrollraum der NASA bei einem Raketenstart: Reihen von miteinander verbundenen Schreibtischen, alle mit Flachbildmonitoren ausgestattet. Ein Bildschirm, der die komplette Stirnwand einnahm, zeigte eine Weltkarte und Statistiken zu den aktuellen Operationen. Im EOC konnten 230 Leute in Acht-Stunden-Schichten arbeiten, und bald würde dort Hochbetrieb herrschen. Schon zu dieser frühen Stunde saßen über zehn Angestellte an ihren Schreibtischen, nahmen Anrufe entgegen und tippten an ihren Computern.
Peyton begrüßte die Mitarbeiter, die sie kannte, und fragte, ob es Neuigkeiten gebe. Der große Konferenzraum des EOC war dunkel, aber ein Schild an der Tür kündigte ein Meeting für alle um acht Uhr zum Mandera-Ausbruch an.
Eine farbige Tafel an der Wand zeigte die gegenwärtige Alarmstufe des CDC. Es gab drei verschiedene Level: Rot bedeutete Stufe eins – die höchste und gefährlichste Warnstufe. Gelb war Level zwei, und grün war Level drei. Die Tafel zeigte gelb, was bedeutete, dass das EOC und die Abteilung für Notfalleinsätze des CDC Personal einberiefen und Unterstützung zur Bekämpfung des Ausbruchs anboten. Peyton war froh darüber.
In ihrem Büro begann sie, sich auf den Einsatz vorzubereiten. Ihre Reisetasche enthielt die wichtigsten Dinge für die Erforschung eines Ausbruchs: Kleider, Toilettenartikel, ein GPS-Navigationssystem, Sonnencreme, Kittel, Handschuhe, Schutzbrillen, einen kleinen Beamer und EPas – Einmannpackungen. Die Fertigessen waren bei Ausbrüchen in der Dritten Welt besonders wichtig, denn oft enthielten Nahrungsmittel und Wasser vor Ort genau den Erreger, den sie bekämpften.
Peyton gab Eilbestellungen für die anderen Dinge auf, die das Team in Mandera benötigen würde, unter anderem ortsspezifische Medikamente, Moskitonetze, Insektenschutzmittel und SatSleeves – Adapter, mit deren Hilfe sich Smartphones über Satellit mit dem Internet verbinden konnten. Durch die SatSleeves konnten die Teammitglieder ihre normale Telefonnummer behalten und auf E-Mails und andere Daten zugreifen. Wenn man in der Lage war, während des Einsatzes ein Foto aufzunehmen und sofort hochzuladen, konnte das die Strategie der Seuchenbekämpfung ändern – und Leben retten.
Als Nächstes bereitete sie Pakete für das Team vor. Sie druckte Karten von Mandera und der Umgebung aus und fertigte Listen der Kontaktpersonen beim kenianischen CDC-Büro, der US-Botschaft, dem EOC, der WHO in Kenia und dem kenianischen Gesundheitsministerium und der Hygienebehörde an. Sie rief einen Fragebogen auf, den sie beim Ebola-Ausbruch in Westafrika verwendet hatte, passte ihn ein wenig an die Region an und druckte Hunderte von Exemplaren aus. Manche Epidemiologen drangen darauf, im Feld papierfrei zu arbeiten, aber Peyton bevorzugte die guten alten Ausdrucke; sie stürzten nicht ab, sie hatten keine Akkus, die den Geist aufgaben, und Straßenräuber interessierten sich deutlich weniger für Aktenordner als für Tablets. Papier funktionierte gut.
Danach gab es noch eine wichtige Entscheidung zu treffen: das Personal.
Jemand klopfte sanft an die offene Bürotür, und als sie sich umdrehte, sah sie ihren Vorgesetzten Elliott Shapiro am Türrahmen lehnen.
»Hallo«, sagte sie.
»Wie schaffst du es, immer so schnell hier zu sein?«
»Ich schlafe mit einem offenen Auge.«
Er lächelte. »Klar. Woran arbeitest du?«
»Am Personal.«
»Gut. Hast du die Fotos gesehen?«
»Ja.«
»Sieht schlimm aus.«
»Allerdings. Wir müssen sofort hin«, sagte Peyton. »Wenn es nach Nairobi gelangt, haben wir ein Problem.«
»Das glaube ich auch. Ich mache ein paar Anrufe und sehe, ob ich dich schneller hinschaffen kann.«
»Danke.«
»Ruf mich an, wenn du mich brauchst.« Er trat aus dem Büro.
»Mach ich.«
Peyton suchte im Intranet nach der Nummer eines Kollegen, dem sie noch nie begegnet war. Joseph Ruto leitete die Einsätze des CDC in Kenia. Sie hatten dort 172 Mitarbeiter, eine Mischung aus entsandten Amerikanern und Kenianern. Die meisten befanden sich im CDC-Büro in Nairobi, wo sie eng mit dem kenianischen Gesundheitsministerium zusammenarbeiteten.
Peyton nahm sich Zeit, Rutos interne Lageberichte zu lesen. Sie wollte ihn gerade anrufen, als ihr eine Idee kam, die einem oder beiden Amerikanern das Leben retten könnte. Durch eine kurze Recherche fand sie heraus, dass es möglich war. So könnte sie vielleicht auch die Ausbreitung des Erregers nach Nairobi verhindern.
Elliott tauchte noch einmal an ihrer Tür auf. »Ich hab Glück gehabt. Die Air Force nimmt dich mit nach Nairobi.«
»Seht gut«, sagte Peyton.
»Das ist nicht gerade wie in der Ersten Klasse. Es ist ein Truppen- und Frachttransport, aber er bringt dich hin. Du kannst um ein Uhr dreißig an der Dobbins Air Reserve Base zusteigen. Das ist in Marietta. Nimm einfach die I-75/85, bleib auf der 75, wenn sie sich teilt, und fahr an der Ausfahrt 261 runter. Du kannst es nicht verfehlen.«
Elliott lieferte ihr immer eine Wegbeschreibung, selbst in Zeiten des Smartphones und zu Orten, an denen Peyton schon gewesen war, wie zum Beispiel Dobbins. Sie unterbrach ihn nie; sie nickte nur und machte sich Notizen. Vermutlich war es eine Generationenfrage, und er gehörte eben zu denen, die noch nicht mit einem Handy in der Hand aufgewachsen waren oder jederzeit mit einem Klick Google Maps aufrufen konnten. Es war eine von Elliotts vielen Eigentümlichkeiten, die Peyton erst akzeptiert und dann zu mögen begonnen hatte.
»Apropos Flugzeuge«, sagte sie. »Ich würde gern deine Meinung zu einer Sache hören. Einer der Amerikaner, Lucas Turner, war symptomfrei, als er in Mandera angekommen ist. Wenn man davon ausgeht, dass er mit dem anderen Mann in engem Kontakt stand und es sich um ein virales hämorrhagisches Fieber handelt, wird die Krankheit wahrscheinlich bei ihm ausbrechen.«
»Vermutlich.«
»Ich möchte einen Therapieplan für ihn entwickeln. In Mandera können wir ihn nicht behandeln. Das Dani Beach Hospital und das Kenyatta National in Nairobi wären geeignet, aber ich sehe beide skeptisch – wir würden riskieren, dass die Infektion sich unter dem Personal und in der Region ausbreitet.«
»Du willst ihn hierher zurückholen.«
»Ja.«
Elliott zog die Brauen hoch. »Wie stellst du dir das vor?«
»Ich möchte, dass der Luftrettungsdienst uns nach Nairobi begleitet und dann nach Mandera fliegt und sich dort bereithält. Wenn Turner hohes Fieber hat, will ich ihn ins Emory bringen.«
Das Emory University Hospital befand sich neben dem CDC an der Clifton Road – so nah, dass man zu Fuß hinübergehen konnte. Dort gab es eine spezielle Isolationsabteilung, in der Patienten behandelt werden konnten, die mit Ebola und anderen Pathogenen der biologischen Schutzstufe vier infiziert waren; es war eine von nur vier solcher Einrichtungen in den USA. Bei dem Ebola-Ausbruch 2014 waren infizierte Amerikaner dort mit großem Erfolg behandelt worden.
»Ich weiß nicht, Peyton. Einen Patienten mit einer unidentifizierten tödlichen ansteckenden Krankheit zurück in die USA bringen? Wenn das rauskommt, jagt die Presse den Leuten eine Höllenangst ein.«
»Aber es könnte ihm das Leben retten. Und wir könnten Blut-, Speichel- und Gewebeproben von allen anderen Infizierten mitnehmen. Wir könnten sie hier untersuchen, in unserem BSL-4-Labor. Dann müssten wir die Proben nicht zur Untersuchung nach Nairobi bringen, und die Kenianer hätten die Möglichkeit, den Ausbruch geheim zu halten – was sie garantiert wollen. Wir würden vielleicht ein Menschenleben retten und könnten schneller rausfinden, womit wir es zu tun haben.«
Elliott nickte und atmete tief aus. »Okay, aber ich muss die Zustimmung des Direktors einholen – er muss sich mit den negativen Konsequenzen und der Presse auseinandersetzen, wenn es schiefgeht. Aber ich werde es voll und ganz unterstützen.«
»Danke.«
»Was ist mit dem anderen Amerikaner?«, fragte Elliott.
»Das ist ein schwierigerer Fall. Er kam schon in kritischem Zustand in Mandera an, und ich bin nicht dafür, dass wir ihn zurück in die USA fliegen – wir reden über mindestens achtzehn Stunden in der Luft. Er könnte unterwegs sterben. Vielleicht ist es seine einzige Chance, vor Ort mit der Infektion fertigzuwerden. Ich möchte etwas ZMapp mitnehmen.«
ZMapp war das einzige wirksame Mittel gegen Ebola; es hatte Erfolge bei der Behandlung mehrerer Ärzte gezeigt, die sich 2014 mit der Krankheit infiziert hatten, aber es musste noch in klinischen Studien am Menschen getestet werden. Über seine Wirkung war wenig bekannt.
Elliott nickte. »Soll ich die Zustimmung der gesetzlich Bevollmächtigten einholen?«
»Bitte. Die Patienten sind vielleicht nicht mehr in der Lage, ihr Einverständnis zu erklären.«
»Ich versuche, die Bevollmächtigten zu kontaktieren.« Elliott warf einen Blick auf die über dem Schreibtisch verteilten Papiere. »Hast du dein Team schon zusammengestellt?«
»Bin grad dabei«, sagte Peyton. »Bist du bereit für die Besprechung?«
»So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken.«
6
Als er über den Marmorboden der Lobby ging, begriff Desmond, warum die beiden Uniformierten ihn ansahen: weil er sie ansah. Es war eine normale menschliche Reaktion, jemanden, der einen anstarrte, ebenfalls anzublicken, und bei Polizisten war dieser Instinkt besonders ausgeprägt. Sie hatten beinahe einen sechsten Sinn für Bedrohungen.
Trotz ihres stoischen Benehmens im Aufzug war die weißhaarige Frau ziemlich gebrechlich. Sie schlurfte langsam und schwer atmend durch die Lobby.
Desmond löste den Blick von den Polizisten und überholte sie. Sie steuerte nicht auf die Glasdrehtür zu, sondern auf eine Schwingtür mit silberner Griffstange. Der Page sah zum Schlüsselbrett und nahm seine Gäste gar nicht wahr.
Desmond schwang die Tür auf und stand in der kalten Novemberluft. Ohne die alte Dame anzusehen, die sich langsam näherte, hielt er ihr die Tür auf.
»Vielen Dank«, flüsterte sie im Vorbeigehen.
Er öffnete ihr eine Taxitür und rutschte auf den Rücksitz des nächsten Wagens in der Schlange.
Die Polizisten waren noch im Hotel, aber der Funkverkehr wurde hektisch; bald würde der Sicherheitsdienst jemanden losschicken, um nach Gerhardt zu suchen. Und dann würde er vier Bewusstlose finden, von denen nur drei noch lebten.
Der Fahrer fragte auf Deutsch nach Desmonds Ziel, woraus er schloss, dass das Hotel kein Tummelplatz für ausländische Touristen oder Geschäftsreisende war, sondern hauptsächlich von Deutschen besucht wurde. Es war ein weiterer Hinweis, ein Puzzleteil, das ihm verraten könnte, wer er war und warum er sich in Berlin befand.
Desmond hätte beinahe »zum Bahnhof« gesagt, aber er hielt sich im letzten Moment zurück. Wenn die ohnmächtigen Polizisten und die Leiche gefunden wurden, würde er in der ganzen Stadt gesucht werden. An den Bahnhöfen und Flughäfen und vielleicht auch an den Autobahnen und Flüssen würden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden.
Er musste nachdenken. Er musste mehr über das erfahren, was geschehen war. Die Antworten lagen vielleicht noch in Berlin verborgen.
Er sagte dem Fahrer auf Deutsch, er solle einfach losfahren.
Das Auto rührte sich nicht von der Stelle. Der Fahrer, ein Mann mittleren Alters, musterte ihn im Rückspiegel. »Ich brauche ein Ziel«, sagte er auf Englisch.
»Bitte fahren Sie einfach. Ich hatte gerade Streit mit meiner Freundin, und ich muss eine Weile raus. Ich will mir die Stadt ansehen.«
Desmond stieß erleichtert den Atem aus, als der Fahrer das Taxameter startete und losfuhr.
Jetzt musste er sich allmählich entscheiden, wo er hinwollte. Das Wichtigste war, von den Straßen Berlins wegzukommen. Die Polizei hatte offenbar keine Beschreibung von ihm, als sie ins Hotel geschickt wurde – die Beamten in der Lobby hatten ihn nicht erkannt. Anscheinend war es so, wie der Wachmann gesagt hatte: ein anonymer Hinweis wegen Ruhestörung. Aber wer hatte angerufen? Hatte jemand nach Gunter Thorne sehen wollen? Oder war sein Tod so laut gewesen, dass ein Gast nebenan erschrak und die Polizei rief?