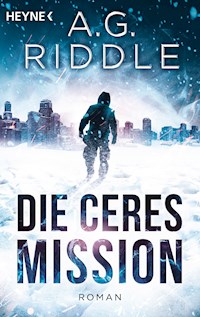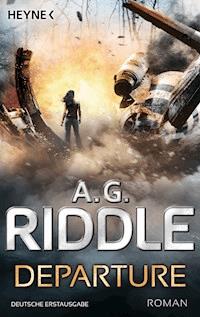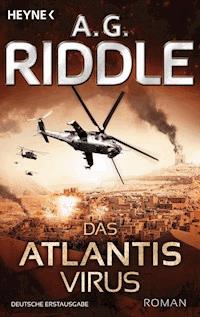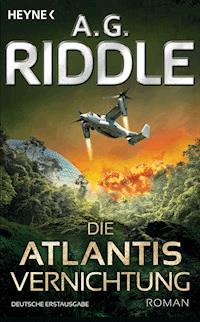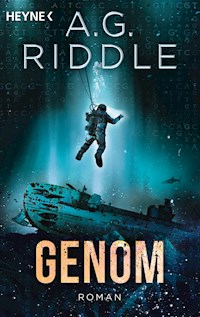
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Extinction-Serie
- Sprache: Deutsch
Der Kampf um die Zukunft der Menschheit geht in die zweite Runde
Im Jahr 2003 wurde das erste menschliche Genom zerlegt und analysiert: Ein historischer Moment. Aber nur ein Wissenschaftler kennt die Wahrheit, die in unserer DNA verschlüsselt ist. Dieses Geheimnis kann alles ändern: Unsere Vergangenheit - und unsere Zukunft! Wer es besitzt, hat Macht über die gesamte Menschheit. Dr. Peyton Shaw, die das Vermächtnis des legendären Wissenschaftlers Paul Kraus erforscht, kommt einer globalen Verschwörung auf die Spur ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Dr. Peyton Shaw sah ihre Mutter an. »Du weißt, wer es geschrieben hat?«
Lin nickte. »Dr. Paul Kraus.«
Peyton betrachtete noch einmal das Blatt. »Darum ging es also: das hier zu finden. Er seine Aufzeichnungen für dich zurückgelassen, oder?«
»Kraus war es gewohnt, seine Forschung zu verstecken. Er war ein deutscher Wissenschaftler und wurde im Rahmen der Operation Paperclip in die USA gebracht. Paperclip war ein Programm, mit dem deutsche Wissenschaftler nach dem Krieg in die USA geholt wurden. Es hatte großen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Kraus erforschte den Ursprung der Menschheit. Eine zweite Evolutionstheorie. Er hat sein Leben lang nach Vorgängern der Menschen gesucht – Hominiden, die vor unserer Entstehung ausstarben. Er glaubte, sie wären der Schlüssel zu dem im menschlichen Genom versteckten Code – dem Code, mit dem man die Zukunft der Menschheit lenken kann.«
Peyton hatte eine Erkenntnis. »Du willst seine Forschung zu Ende bringen.«
Doch ihre Mutter antwortete nicht.
Der Autor
A. G. Riddle wuchs in North Carolina auf. Zehn Jahre lang beschäftigte er sich damit, diverse Internetfirmen zu gründen und zu leiten, bevor er sich aus dem Geschäft zurückzog. Seitdem widmet Riddle sich seiner wahren Leidenschaft: dem Schreiben. Seine ebenfalls bei Heyne erschienene Atlantis-Trilogie ist in Amerika schon jetzt ein Phänomen. Riddle lebt in Parkland, Florida.
A. G.RIDDLE
GENOM
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Marcel Häußler
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe GENOME erschien 2017
bei Riddle Inc., Raleigh, North Carolina
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 03/2020
Copyright © 2017 by A. G. Riddle
Published in agreement with the author,
c/o Danny Baror International Inc, Armonk, New York, USA
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Printed in Germany
Redaktion: Lars Zwickies
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Sergey Nivens, Michael Rosskothen, Afonso Martins, EML, Pogorelova Olga)
ISBN: 978-3-641-22408-0V001
www.heyne.de
Anmerkung zum Thema Fakten und Fiktion
Genom ist ein fiktives Werk, das auf Tatsachen beruht. Besuchen Sie nach dem Lesen meine Internetseite agriddle.com, um sich über den Wahrheitsgehalt zu informieren.
Danke fürs Lesen,
– Gerry
A. G. Riddle
PROLOG
17. Juli 1941
Adelines Familie verließ Berlin mitten in der Nacht. Ihr Vater sagte ihr, sie würden in den Urlaub fahren, aber sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Ihre Eltern waren zu nervös. Ihre Mutter hatte zu viel eingepackt – und die falschen Dinge: Erinnerungsstücke und Unterlagen aus dem Tresor.
Zwei Tage und drei Nächte verbrachten sie im Zug. Sie aßen im Speisewagen. Nachmittags spielten ihre Eltern Karten. Ihr Vater las aus ihrem Lieblingsbuch vor – Alice im Wunderland. In den Waggons drängten sich Soldaten und Verwaltungsangestellte, aber auch einige Familien. Die anderen Erwachsenen wirkten genauso nervös wie Adelines Eltern.
Mehrmals wurde der Zug durchsucht. Soldaten verlangten mit versteinerter Miene ihre Papiere. Adelines Mutter hielt jedes Mal den Atem an, aber der Gesichtsausdruck ihres Vaters spiegelte den der Soldaten wider.
Die Hakenkreuzfahne hing auf dem Dach jedes Bahnhofs in Frankreich, und die Bahnsteige waren voller Soldaten. Die Durchsuchungen wurden häufiger, die Befragungen länger.
An der spanischen Grenze zeigte ihr Vater den Soldaten zu Adelines Überraschung ein Dokument und sagte: »Ich führe Forschung zum Wohle des Reichs durch.«
Der SS-Offizier überflog das Dokument, bevor er Adeline und ihre Mutter beäugte. »Und warum haben Sie Frau und Tochter dabei?«
»Meine Frau assistiert mir, und meine Tochter ist erst fünf.«
»Ich habe nicht nach ihrem Alter gefragt, sondern warum sie hier ist.«
»Sie ist hier, weil es nicht anders geht. Sie konnte ja schlecht allein in Berlin bleiben, und wir haben niemanden gefunden, bei dem wir sie lassen konnten.«
Der Soldat wirkte nicht überzeugt.
Adelines Vater seufzte. »Obersturmführer, wenn Sie meine Tochter zurück nach Berlin bringen und sich einen Monat um sie kümmern möchten, bis ich zurückkomme, nur zu. Das wäre eine große Hilfe für meine Forschung.«
Adeline spürte, wie ihre Augen sich mit Tränen füllten. Sie wandte sich ab, damit es niemand sah.
Der Soldat schnaufte, und Adeline hörte ein paar laute Geräusche. Das Stempeln der Pässe, vermutete sie.
Ihre Mutter entspannte sich, als der Zug wieder anfuhr. Ihr Vater nahm Adeline in die Arme. Seine Lippen strichen über ihr Ohr, als er sagte: »Das war nur eine Geschichte, damit der böse Mann uns in Ruhe lässt. Du bist der einzige Grund für unsere Reise, Schätzchen, wart’s nur ab.«
Er versuchte, sie abzulenken, indem er aus Grimms Märchen vorlas: Schneewittchen und Aschenputtel.
In Spanien wurde der Zug nicht mehr so häufig durchsucht. Schließlich stiegen sie in der kleinen Stadt Santillana del Mar aus, nur wenige Kilometer von der Nordküste entfernt. Auf dem Marktplatz trafen sie sich mit einem Dutzend Männern, die ihrem Vater bei seiner Forschung helfen sollten. Zusammen fuhren sie aus der Stadt und über Land, bis sie schließlich vor dem Eingang einer Höhle ihr Lager aufschlugen.
Adelines Vater sagte, es sei die Höhle von Altamira und ein sehr wichtiger Ort – ein Ort, an dem Botschaften für sie hinterlassen worden seien. Er und seine Männer verbrachten jede Minute in der Höhle und kamen nur zum Essen und Schlafen heraus, oder wenn sie sich erleichtern mussten.
Sie hatten seit einer Woche dort kampiert, als Adeline kurz vor Sonnenaufgang von ihrem Vater geweckt wurde. Ihre Mutter schlief noch neben ihr in dem Zelt, das sie sich zu dritt teilten.
»Sei leise, Schätzchen«, flüsterte ihr Vater.
Er führte sie durch das Lager, wo zwei Männer am Feuer Kaffee aufwärmten. Mit einer batteriebetriebenen Laterne leuchtete er ihnen den Weg.
Am Eingang der Höhle blieb er stehen und zog die Augenbrauen hoch. »Bereit?«
Adeline nickte aufgeregt.
Die Höhle war anders, als sie erwartet hatte. In einem Moment war der Gang breit und hoch, im nächsten so niedrig, dass ihr Vater sich bücken und manchmal sogar kriechen musste. Die Höhle wand und verzweigte sich wie die Wurzeln eines riesigen Baums. Aber ihr Vater schien den Weg zu kennen, als hätte er eine Karte im Kopf. Adeline kam sich vor wie Alice, nachdem sie in den Kaninchenbau gestiegen war. Sie war groß und die Welt um sie herum klein und beengt.
Ihr Vater blieb stehen und leuchtete mit der Laterne auf eine Wand. Adeline schnappte nach Luft. Rote Handabdrücke bedeckten den Fels. Manche zeigten auch nur die Umrisse, als hätte der Künstler seine Hand aufgelegt und die Wand besprüht.
»Das ist eine Botschaft«, flüsterte ihr Vater. »Sie teilen uns mit: ›Wir waren hier. Und wir denken so wie ihr. Ihr seid am richtigen Ort.‹«
Adeline streckte die Hand aus, um die Wand zu berühren, aber ihr Vater hielt sie zurück. »Nicht anfassen. Die Malerei ist zu empfindlich. Komm, es gibt noch mehr.«
Ein paar Minuten später blieb ihr Vater erneut stehen und ging in die Hocke, sodass sein Gesicht dicht neben ihrem war. »Sieh nach oben.«
Er richtete die Laterne zur Decke, wo ein Wandgemälde auftauchte, eine Herde dunkelroter Tiere, so groß wie Kühe, aber mit dunklem Fell an Rücken und Beinen.
Adeline war sprachlos. Sie ging umher und betrachtete die Malerei, die sich endlos zu erstrecken schien. Die Tiere waren detailreich dargestellt. Durch die gewellte Decke wirkten einige von ihnen dreidimensional. Als ihr Vater zurücktrat und den Lichtstrahl über die Decke gleiten ließ, schien sich die Herde zu bewegen.
»Was sind das für Tiere?«, fragte Adeline.
»Steppenbisons.«
Adeline hatte noch nie davon gehört.
»Sie sind jetzt alle tot«, sagte ihr Vater. »Das sind sie schon sehr lange. Weißt du, wie man es nennt, wenn alle Exemplare einer Art tot sind?«
Adeline schüttelte den Kopf.
»Sie sind ausgestorben. Das ist eine weitere Botschaft. Kannst du sie erraten?«
Adeline überlegte kurz. »Sie haben Bisons gejagt?«
»Ja. Aber noch mehr. Es verrät uns wann. Sie haben sie vor sehr, sehr langer Zeit gejagt. Sie haben vor sehr langer Zeit gelebt. Alles zusammengefasst, teilen die Künstler uns mit: ›Wir waren hier. Wir denken so wie ihr. Und wir haben vor sehr, sehr langer Zeit gelebt.‹«
Er führte sie tiefer in die Höhle, zu einer weiteren Malerei an der Wand. Es war eine Hirschkuh, die allein und majestätisch dastand. »Wunderschön, oder?«, flüsterte er.
Sie nickte.
»Nicht halb so schön wie du.«
Einige Schritte weiter blieben sie vor einer kleinen Nische stehen, wo mehrere Löcher gegraben worden waren. Daneben stand ein Stapel Metallkisten.
Er öffnete eine, in der lange Knochen lagen. Beine, dachte Adeline. In einer anderen befand sich der Teil eines Schädels.
»Sind das die Maler?«, fragte sie.
»Vielleicht. Oder jemand wie sie. Aber diese Knochen sind noch viel mehr. Sie sind Teil einer größeren Botschaft, die durch die Zeit geschickt wurde und darauf wartet, dass wir sie finden und untersuchen, wenn wir so weit sind.«
Adeline zog die Brauen zusammen.
Ihr Vater schien ihre Verwirrung zu bemerken. »Die Knochen sind wie Hänsel und Gretels Brotkrumen.«
Adelina kannte das Märchen gut. Als die Not der armen Holzfäller zu groß wird, setzen sie ihre Kinder Hänsel und Gretel im Wald aus, damit sie zwei Münder weniger zu stopfen haben. Hänsel und Gretel streuen Brotkrumen, um den Heimweg zu markieren. Aber die Brotkrumen werden von Vögeln aufgepickt, sodass die beiden Kinder sich in der Wildnis verirren.
Adeline dachte über die Geschichte nach, verstand aber nicht, was sie mit den Knochen zu tun haben sollte. »Wohin führen die Brotkrumen denn, Papa?«
»Zur Wahrheit. Eines Tages werden wir all diese Knochen finden. Sie markieren einen Weg, genau wie die Brotkrumen von Hänsel und Gretel, und wir werden endlich erfahren, wie wir zu dem wurden, was wir sind … und was unsere Bestimmung ist.«
Er ging in die Hocke, um ihr in die Augen zu sehen. »Die Knochen sind Teile eines Puzzles, die zurückgelassen wurden, damit wir sie irgendwann finden – wenn wir bereit sind, sie zusammenzusetzen, wenn unsere Technologie das Rätsel lösen kann. Es wird die größte Entdeckung aller Zeiten. Wir müssen nur die Teile finden. Möchtest du mir helfen, sie zu suchen?«
Adeline nickte.
»Eines Tages werden wir das tun. Aber im Moment ist die Welt wie der Wald in Hänsel und Gretel. Gefährlich. Du hast die bösen Menschen gesehen.«
Sie zog die Brauen zusammen.
Er lächelte. »Der Soldat im Zug.« Er strich ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr. »Aber sie werden dir nichts tun. Wenn deine Mutter aufwacht, bringt sie dich zu einer Stadt im Meer, und du wirst davonsegeln, zu einer anderen Stadt im Meer, an einem fernen Ort, den deine Mutter gut kennt.«
Er griff nach ihren Schultern. »Du kommst zurück, wenn es sicher ist.«
»Und du kommst mit uns.«
Er sagte nichts.
Sie schüttelte den Kopf.
Er packte sie fester. »Ich kann nicht.«
»Warum nicht, Papa?«
»Sie sind hinter meiner Arbeit her. Sie würden mich deswegen bis zum Ende der Welt verfolgen. Ich gehe zurück nach Berlin und verstecke, was ich gefunden habe. Und warte ab. Du und deine Mutter, ihr kommt zurück, sobald die Welt aus dem Wald herausgefunden hat. Und dann ziehen wir los und finden die restlichen Brotkrumen. Zusammen.«
1
Dr. Peyton Shaw wurde von lauten Stimmen geweckt. Sie wickelte sich enger in die dicke Wolldecke. Ein Heizlüfter brummte neben ihr, aber in dem kleinen Büro war es trotzdem eiskalt.
Hinter der geschlossenen Tür gingen die Rufe in eine aufgeregte Unterhaltung über. Peyton schnappte nur einzelne Bruchstücke auf.
»Keine genetische Übereinstimmung.«
»Definitiv kein Neandertaler.«
»… eine neue menschliche Spezies.«
Das einzige Fenster im Büro bestand aus einer breiten Glasscheibe, durch die man auf den Laderaum des Schiffs blickte. In der riesigen Halle, die für diesen Einsatz zu einem Forschungslabor umgebaut worden war, herrschte immer rege Geschäftigkeit. Der Schein der Leuchtstoffröhren drang in das Büro und tauchte es in ein fahles Licht, wie die Straßen Londons in einer nebligen Nacht. Peyton wollte hinübergehen und nachsehen, was die Unruhe ausgelöst hatte, aber sie war noch immer erschöpft von ihrem letzten Tauchgang zum Schiffswrack. Also blieb sie im Bett liegen und lauschte, während ihr Blick über die Fotos von Knochen und Leichen schweifte, die an den Wänden hingen. Es sah aus wie bei einer Mordermittlung.
Peyton war unbequeme Quartiere bei ihren Forschungsarbeiten gewohnt. Sie hatte ihr halbes Leben lang Seuchenausbrüche in den betroffenen Regionen untersucht. Die größte Herausforderung hatte sie letzten Monat erlebt, als die X1-Pandemie die Welt verwüstete. Milliarden waren infiziert worden. Dreißig Millionen waren gestorben, darunter viele von Peytons Kollegen beim CDC und Studenten ihres EIS-Programms. Es war ein schwerer Schlag gewesen, besonders als sie die Wahrheit über die tödliche Seuche erfuhr.
Peyton hatte herausgefunden, dass es sich bei dem Ausbruch um einen Terroranschlag handelte. Yuri Pachenko und seine Organisation, Kition, hatten den Erreger nur aus einem Grund auf die Welt losgelassen: um ein Heilmittel anbieten zu können. Aber das Heilmittel war mehr, als es schien. Es bekämpfte den Erreger, enthielt jedoch auch eine Nanotechnologie namens Rapture.
Über Rapture war nicht viel bekannt, außer dass es zu einem größeren Vorhaben gehörte, das als Spiegel-Projekt bezeichnet wurde. In Kombination mit zwei anderen Technologien, Rook und Rendition, würde Yuri mit Rapture und dem Spiegel-Projekt jeden Menschen auf der Erde kontrollieren können.
Die Regierungen sämtlicher Staaten, die schon durch die Millionen Toten der Pandemie ins Wanken geraten waren, versuchten nun verzweifelt, die Vollendung des Spiegel-Projekts zu verhindern. Sie suchten auf der ganzen Welt nach Kition, aber da es kaum Spuren gab, hatten sie bisher keinen Erfolg.
Lin Shaw, Peytons Mutter, hatte eine andere Lösung vorgeschlagen. Ihrer Meinung nach boten die Forschungsergebnisse eines konkurrierenden Kition-Projekts die einzige Hoffnung, Yuri aufzuhalten. Dieses Material befand sich an Bord der Beagle, eines U-Boots von Kition, das Yuri vor dreißig Jahren versenkt hatte. Lin hatte auf der Beagle gearbeitet und wusste mehr über das U-Boot als jeder andere lebende Mensch. Sie glaubte, die Daten und Proben an Bord würden einen im menschlichen Genom verborgenen Code enthüllen und zu einer Entdeckung führen, die die Geschichte der Menschheit neu schrieb.
Viele zweifelten an Lins Behauptungen, und das aus gutem Grund: Bis vor Kurzem war sie Kition-Mitglied gewesen. Außerdem gab sie sich geheimnisvoll und weigerte sich, ihr Wissen preiszugeben. Aber Peyton genügte ihr Versprechen. Wenn auch nur die Chance bestand, dass die Forschungsergebnisse auf der Beagle Yuri und das Spiegel-Projekt aufhielten, würde Peyton bis ans Ende der Welt gehen, um sie zu finden. Und auf gewisse Weise hatte sie das getan.
Vor zwei Wochen war sie mit ihrer Mutter in Alaska an Bord des russischen Eisbrechers Arktika gegangen und Richtung Polarkreis gefahren. Nach vier Tagen hatten sich alle an Deck versammelt, um die Sonne ein letztes Mal über dem Horizont auftauchen zu sehen. Danach arbeiteten sie in ständiger Dunkelheit. Es fühlte sich an, als befänden sie sich in einer anderen, zeitlosen Dimension, wo die Gesetze des Planeten nicht galten. Die einzige natürliche Helligkeit stammte von den Polarlichtern, die die Umgebung noch fremder wirken ließen. Die phosphoreszierenden grünen, blauen und orangefarbenen Streifen erinnerten Peyton an die Shetlandinseln, wo sie vor drei Wochen zum ersten Mal eine solche Erscheinung gesehen hatte. Dort hatte sie sich mit ihrem Vater wiedervereint. Und hatte nach dreizehn Jahren wieder mit Desmond Hughes Zeit verbracht. Jetzt kam es ihr vor wie ein anderes Leben. Ein Traum, und zwar ein guter.
Für die Forscher auf der Arktika ging es bei diesem Einsatz darum, Kition aufzuhalten und eine wissenschaftliche Entdeckung historischen Ausmaßes zu machen. Für Peyton ging es um viel mehr. Yuri und Kition hatten ihr ihren Vater, ihren Bruder und Desmond genommen. Ihren Vater hatten sie getötet, Desmond entführt. Die Beagle war der Schlüssel, um Kition zu stoppen, aber sie hoffte, sie würde sie auch zu Desmond führen. Ihre Mutter hatte es ihr versprochen.
Peyton drehte sich auf die Seite und sah zur breitesten Wand des Büros, die zur Hälfte von einem Plan des U-Boots eingenommen wurde. Die Bereiche, die sie erkundet hatten, waren markiert, und obwohl sie schon seit zehn Tagen von der Arktika zur Beagle tauchten und alle Funde katalogisierten, hatten sie das riesige Atom-U-Boot nicht einmal zur Hälfte erkundet.
Unter der Karte stand die altersschwache Kaffeemaschine. Peyton hätte gern eine Tasse getrunken, aber sie traute sich nicht, das laute Gerät einzuschalten. Ihre Mutter lag nur ein paar Schritte entfernt in dem anderen schmalen Bett und schlief fest. In letzter Zeit hatte Lin sehr wenig Schlaf bekommen – und ihn auch niemand anderem zugestanden.
Peyton streifte die Decke ab und zog einen dicken Pullover an. Sie schlüpfte in die Hose und steckte ein kleines gläsernes Herz in die Tasche. Es war der einzige persönliche Gegenstand, den sie aus Atlanta mitgebracht hatte, das Einzige, was ihr von Desmond geblieben war. Sie trug es mit sich, um sich daran zu erinnern, warum sie hier war – und warum sie weitermachen würde, um jeden Preis.
Leise öffnete sie die Tür und trat in den Frachtraum. Sie blinzelte im grellen Licht. An den vor dem Büro aufgereihten Computerarbeitsplätzen blickten mindestens zehn Techniker auf die großen Bildschirme, tippten, schlürften Kaffee und lehnten sich gelegentlich auf ihren Drehstühlen zurück. Fünf Forschungsassistenten standen hinter ihnen und zeigten auf die Bilder und Texte auf den Monitoren.
»Könnte sich vor dem anatomisch modernen Menschen abgespalten haben.«
»Oder es ist eine isolierte Bevölkerungsgruppe wie der Homo floresiensis.«
»Wir könnten ihn Homo beagalis nennen …«
»Wir geben ihm noch gar keinen Namen, meine Damen und Herren. Es ist Probe 1644 – so haben die Forscher auf der Beagle ihn bezeichnet, und dabei bleibt es vorläufig.«
Peyton erkannte die letzte Stimme: Dr. Nigel Greene. Er war ein Evolutionsbiologe, der das Team leitete, das die Proben von der Beagle analysierte.
Als er Peytons Schritte vor der Metalltür hörte und sich zu ihr umdrehte, lächelte er sofort.
»Klingt, als hätten Sie alle den Super Bowl gewonnen.«
Der englische Wissenschaftler legte den Kopf schräg. »Was ist das?«
»Nichts.« Sie nickte zu den Bildschirmen. »Irgendwas gefunden?«
Er zog die Brauen hoch. »Allerdings.«
Nigel beauftragte die anderen Wissenschaftler und Techniker großspurig »weiterzumachen«, dann legte er Peyton sanft die Hand auf den Rücken und schob sie zu einem freien Computerterminal. Er sprach mit gedämpfter Stimme, als verriete er ihr ein gut gehütetes Geheimnis.
»Wir haben gerade die ersten Daten von Rubicon zurückbekommen. Die Proben aus Gruppe eins stammen alle von ausgestorbenen Arten – wie Ihre Mutter vorhergesagt hat.« Er beugte sich vor und rief auf dem Computer das Bild eines langen Knochens in einer Metallkiste auf. »Wir haben vermutet, dass Probe 1642 der Oberschenkelknochen eines Tiers aus der Familie der Canoidea ist. Wir hatten recht.«
Das Bild, das jetzt auf dem Monitor erschien, erinnerte an einen großen Wolf.
»Er stammt von einem Canis dirus. Die Tiere haben Nordamerika von vor 125 000 Jahren bis zu ihrem Aussterben vor 10 000 Jahren bewohnt. Einige der besten Fossilien wurden in den La Brea Tar Pits bei Los Angeles gefunden.« Nigel betrachtete die Darstellungen. »Es waren prächtige Tiere. Stellen Sie sich einen Wolf vor, der über fünfzig Kilo wiegt und ein riesiges Gebiss hat. Die Art ist mit der Megafauna des Pleistozäns ausgestorben, am Ende der letzten Kaltzeit. Dachten wir jedenfalls.«
Er rief eine Grafik auf, die Peyton als Radiokarbondatierung erkannte.
»Die Probe, die von der Beagle geborgen wurde, ist ungefähr 9.500 Jahre alt«, sagte er. »Das bedeutet, sie stammt von einem Tier, das 800 Jahre nach dem jüngsten bekannten Canis dirus gelebt hat. Die zeitliche Einordnung der Spezies muss korrigiert werden.«
Nigel klickte mit der Maus. »Und das ist noch nicht alles.«
Ein Foto von vier Rippenknochen erschien.
»Irgendeine Vermutung?«
Peyton schnaufte. Jetzt hätte sie wirklich einen Kaffee gebrauchen können.
Sie hatte darum gebeten, dass Nigel und sein Team sie auf dem Laufenden hielten. Es gehörte nicht zu ihrem Fachgebiet, aber es lag in ihrer Natur, sich auf die Arbeit zu stürzen, und sie war schon immer neugierig gewesen, vor allem wenn es um wissenschaftliche Fragen ging. Und tief im Inneren hegte sie die Hoffnung, ihre Chancen, Yuri aufzuhalten und Desmond zurückzubekommen, würden steigen, wenn sie wüsste, was dort unten war. Jetzt spürte sie, dass Nigel noch einen anderen Grund hatte, ihr von den Entdeckungen zu berichten, auch wenn sie nicht wusste welchen.
»Ich vermute, es sind Knochen einer ausgestorbenen Art.«
»Ha. Ja, aber welcher …«
»Nigel, ich habe keine Ahnung.«
»Wirklich nicht?«
»Ich bin Epidemiologin. Meine Kompetenz besteht darin, zu verhindern, dass wir aussterben.«
Ihre Zurechtweisung dämpfte seine Begeisterung nicht. »Natürlich. Nun, die Fossilien stammen jedenfalls von einem Amerikanischen Löwen.«
Auch von dieser Art hatte Peyton noch nie gehört. Sie fragte sich erneut, worauf er hinauswollte.
Eine Rekonstruktion des Tiers erschien auf dem Bildschirm. In Peytons Augen sah es aus wie ein afrikanischer Löwe, nur viel größer.
Nigel schlug einen professionellen Tonfall an, als zitiere er nur für Peyton einen National Geographic-Artikel. »Der Amerikanische Löwe entwickelte sich vor etwa 340 000 Jahren. Vermutlich spaltete er sich irgendwann vom eurasischen Höhlenlöwen ab und gelangte über die Beringbrücke nach Nordamerika, wo er sich in eine andere Richtung entwickelte. Er war riesig. Er gehört immer noch zu den größten Katzen, die je existiert haben – ungefähr 25 Prozent größer als der moderne afrikanische Löwe.«
Er verkleinerte das Bildschirmfenster und wandte sich zu Peyton um. »Wie der Canis dirus und viele andere große Säugetiere starb er am Ende des Pleistozäns aus. Die jüngsten Fossilien werden auf 11 355 Jahre in der Vergangenheit datiert. Bisher. Diese Knochen sind viel jünger – ungefähr 9.500 Jahre alt, wie die des Canis dirus. Wir vermuten, dass sie aus derselben Fundstelle stammen, den La Brea Tar Pits, die die ergiebigste Quelle für Fossilien des Amerikanischen Löwen sind.«
Er hielt inne. »Zusammengenommen deuten die Fossilien auf ein Interesse an der quartären Aussterbewelle hin.«
Peyton kniff die Augen zusammen. Sie konnte ihm nicht folgen.
»Ah, das ist das Aussterben vor allem großer Tiere zum Ende der letzten Kaltzeit. Es ist wahrscheinlich eines der größten wissenschaftlichen Rätsel – jedenfalls für Evolutionsbiologen wie mich.« Nigel streckte die Hände aus. »Stellen Sie sich die Welt vor, wie sie vor 12 000 Jahren war – ein Land der Riesen. Mastodonten. Säbelzahnkatzen. Gigantische Kondore. Riesenfaultiere. Säbelzahnlachse. Zur selben Zeit, als Menschen die Stadt Jericho gründeten, streiften riesige Tiere über die Erde, flogen am Himmel und schwammen in den Meeren. Manche waren schon viel länger da als wir – mehrere zehn Millionen Jahre. Dann, innerhalb eines Wimpernschlags nach evolutionären Maßstäben, waren sie verschwunden.«
Nigel legte eine dramatische Pause ein.
»Jahrelang haben Wissenschaftler versucht, den Grund dafür zu finden. Wurde das an Bord der Beagle untersucht? Haben sie die Ursache für die quartäre Aussterbewelle gefunden?«
Peyton rutschte unbehaglich hin und her. »Schwer zu sagen, Nigel.«
»Weil Sie es nicht wissen?«
Lin hatte das Forschungsteam größtenteils im Dunkeln gelassen. Peyton hatte sie ein wenig mehr erzählt, aber nicht viel mehr. Nur dass die Wissenschaftler auf der Beagle etwas getestet hatten, das sie eine »zweite Evolutionstheorie« genannt hatten – eine revolutionäre Hypothese, die unser Verständnis der Menschheit dramatisch verändern würde, so bedeutend wie die Entdeckung der Schwerkraft. Aus irgendeinem Grund hatte Lin diese Informationen nicht an Nigel und die anderen Forscher weitergegeben.
Jetzt begriff Peyton, warum Nigel das alles mit ihr besprach. Er wollte wissen, was Lin ihr gesagt hatte. Er hoffte zu erfahren, was die Forscher auf der Beagle untersuchten. Das brachte sie in eine unmögliche Lage. Sie musste mit ihrer Mutter sprechen.
»Ist das alles, Nigel?«
Der dickliche Biologe setzte sich wieder in Bewegung. Er wandte sich dem Computer zu und rief das Foto eines kleinen menschlichen Schädels auf. »Das Beste habe ich für den Schluss aufbewahrt. Wir konnten aus einem Zahn eine DNS-Probe extrahieren. Sie ist menschlich, aber das Genom stimmt nicht mit unserem überein.«
»Jeder hat ein anderes Genom.«
»Stimmt, aber jede Spezies – und Subspezies – hat eine unterschiedliche … Schablone, wenn Sie so wollen. Unser Genom gleicht zu 98,8 Prozent dem der Schimpansen. Jeder Mensch und jeder Schimpanse hat unterschiedliche Werte in den Sequenzen, aber das Gerüst ist gleich: dreiundzwanzig Chromosomen. Neandertaler haben sogar noch größere Ähnlichkeit mit uns: Ihr Genom stimmt zu 99,5 Prozent mit unserem überein.«
Nigel zeigte auf das Foto des Schädels. »Und dieser mysteriöse Mensch ist noch enger mit uns verwandt. Eine 99,6-prozentige Übereinstimmung. Das ist außergewöhnlich. Ein Genom, das wir noch nie gesehen haben. Und dieser Mensch ist vor rund 9.000 Jahren gestorben. Er gehörte vielleicht zu unseren engsten Vorfahren – oder Cousins. Wir wissen nicht, ob die Spezies sich von dem menschlichen Stammbaum abgespalten hat, bevor wir uns entwickelt haben oder danach.«
Er betrachtete das Bild. »Wir vermuten, dass der Schädel an derselben Stelle gefunden wurde wie der Löwe und der Wolf, oder in der Nähe dieser Stelle. Aber das ist reine Spekulation.« Er warf einen Blick zu dem Büro, das Peyton sich mit ihrer Mutter teilte. »Es wäre sehr hilfreich zu wissen, was Sie alles in den Büros gefunden haben – sämtliche Aufzeichnungen bezüglich der Knochen. Karten der Fundstellen …«
»Das ist nicht meine Entscheidung, Nigel.«
»Mag sein, aber sie hört auf Sie. Diese Knochen waren da unten, seit die Beagle vor dreißig Jahren gesunken ist. Wer weiß, wann sie gefunden wurden – und was sonst noch entdeckt wurde. Wir müssen mehr über die Umstände wissen, um rauszufinden, womit wir es zu tun haben.«
Peyton schüttelte den Kopf.
»Bitte, Peyton. Das ist wirklich wichtig. Ich bin nicht sicher, ob Ihnen die Tragweite dieser Entdeckung bewusst ist. Wir schreiben buchstäblich die Geschichte um.«
Eine scharfe Stimme erschreckte Peyton. »Wir schreiben nicht die Geschichte um.«
Lin Shaw stand nur wenige Schritte hinter ihnen. Sie wirkte ausgezehrt, aber ihrer Stimme war keinerlei Erschöpfung anzumerken. Sie sah auf den Schädel und wandte dann den Blick ab, als fände sie ihn uninteressant. »Geschichte ist Geschichte, Dr. Greene. Sie wird nur vergessen und wiederentdeckt. In unserem Fall retten wir nur, was die mutige Besatzung der Beagle wiederentdeckt hat.«
»Und was genau ist das?«
»Das erfahren Sie, wenn wir alle Teile beisammenhaben. Und es wird Zeit, dass wir weitere bergen. Lassen Sie die Russen das Tauchboot vorbereiten.«
Nigel sah auf die Uhr. »Der letzte Tauchgang ist erst sechs Stunden her.«
»Soll heißen?«
»Die Besatzung ist erschöpft und …«
»Ich kümmere mich schon um die Moral der Besatzung. Legen Sie los, Dr. Greene.«
Er nickte und sah zu Boden. »Ja, Ma’am.«
Lin wandte sich Peyton zu. »Kaffee?«
***
Im Büro schaltete Lin die alte Kaffeemaschine an.
»Er stellt Fragen, Mom.«
Lin strich mit dem Finger über den Plan der Beagle, als ginge sie im Geiste durch das Wrack des U-Boots und überlegte, welcher Bereich als Nächstes erkundet werden sollte.
»Was wirst du ihm sagen?«
»Nichts«, flüsterte Lin, ohne den Blick von der Karte abzuwenden.
»Sie wollen genau wissen, was da unten ist. Worum es bei den Experimenten ging. Und ich ehrlich gesagt auch.« Peyton sah zum Fenster, um sich zu vergewissern, dass niemand vor dem Büro lauschte. »Dieser … Code im menschlichen Genom – was ist das? Was bewirkt er? Wie kann er Kition aufhalten?«
Lin wich ihrem Blick aus. »Vertraust du mir?«
»Ja.« Peyton zögerte. »Aber offenbar ist da draußen jemand, dem du nicht traust.«
»Du irrst dich.«
»Wobei?«
»Da draußen ist nicht jemand, dem ich nicht traue. Da draußen ist niemand, dem ich traue. Der einzige Mensch, dem ich traue, steht in diesem Raum.«
2
Desmond hasste das Gefängnis, aber er musste zugeben, dass es seinen Zweck gut erfüllte. Seine Zelle war ein Freilandgehege mit einem hohen Elektrozaun. Der Boden bestand aus harter staubiger Erde, aus der einige Grasbüschel sprießten. Ein zweiter Elektrozaun stand drei Meter hinter dem ersten. Alle zwei Stunden marschierten Wärter vorbei, und in der Zwischenzeit wurde er durch Kameras beobachtet, die auf Stangen montiert waren. Große Planen mit Tarnmuster schützten ihn ein wenig vor der Sonne des Südpazifiks, verbargen ihn aber vor allem vor den Satelliten, die nach ihm und Kition suchten.
In der Mitte des Geheges lag Desmond auf einer Pritsche und versuchte, nicht an Peyton zu denken. Vergeblich. Zu viel war zwischen ihnen unausgesprochen geblieben. Aber das war nicht der einzige Grund. Er machte sich Sorgen um sie. Er hätte sich bereit erklärt, nie wieder mit ihr zu sprechen, wenn er dafür gewusst hätte, dass sie das Blutbad auf der Kition-Insel überlebt hatte und es ihr gut ging. Desmond hatte sich an diesem Morgen geopfert – hatte seine Gefangennahme in der Hoffnung zugelassen, dass Avery ihre Mission zu Ende bringen und ein Heilmittel gegen die Pandemie verteilen konnte. Er fragte sich, ob Avery erfolgreich gewesen war, ob die Milliarden von Infizierten gerettet worden waren. Oder ob die Welt zusammengebrochen war. Oder beides.
Jeden Tag bei Sonnenuntergang bekam er Besuch von seinem Bruder. Conner McClain setzte sich zwischen den beiden Zäunen auf einen Klappstuhl. Manchmal redete er mit ihm, manchmal las er, und manchmal saß er einfach nur schweigend da. Desmond beachtete ihn nicht. Er starrte nur auf den Strand weiter unten.
Als die Sonne wieder einmal hinter dem blauen Horizont versank, fragte er sich, worauf sie warteten.
***
Einen Kilometer entfernt ging Conner zu der silbernen Doppeltür und schob seine Hand in das Lesegerät an der Wand. Als der Apparat piepste, beugte er sich vor und sah in den Irisscanner.
Die Türen öffneten sich, und er trat in einen kleinen Raum mit Wänden aus gebürstetem Metall. Vor ihm befand sich eine weitere geschlossene Doppeltür. Conner wartete, während die Scanner in der Decke und den Wänden ihn auf Waffen, Sprengstoff und unbekannte Gegenstände durchsuchten.
Schließlich glitten die Türen zur Seite und gaben den Blick auf einen Raum frei, der von beleuchteten Kunststofffliesen an Boden und Decke in gleichmäßiges weißes Licht getaucht wurde. Reihen von Servern und Überwachungsgeräten erstreckten sich vor ihm, und Lämpchen blinkten rot, grün, gelb und blau wie eine Lichtorgel. Techniker schwirrten umher, überprüften die Geräte und beugten sich in die Racks, um Fehler zu beheben. Hinter dem Maschendraht wirkten ihre Gesichter wie die von Büßern im Beichtstuhl.
Conner fand den Vergleich passend. Dieser Raum war ein Heiligtum. Ein Ort der Ehrfurcht und Wiedergeburt. Ein neuer Anfang für ihn und die gesamte Menschheit.
Er ging an den Servern vorbei zu der Glaswand auf der anderen Seite. Dahinter lag eine riesige dunkle Kammer, eine Grotte mit metallisch-graublauen Wänden und einem See am Boden, über dem weißer Dunst schwebte. Hundert schwarze Türme ragten aus dem Dunst auf wie Wolkenkratzer ohne Fenster, das Modell einer Stadt der Zukunft.
Conner bewunderte sein Werk. Bald würde Rook in Betrieb genommen werden, und er wäre frei.
***
Draußen marschierte Conner einen Feldweg entlang. Tarnplanen schützten ihn vor der drückenden Hitze und verbargen die Kition-Basis. Amerikanische, russische und japanische Schiffe und Drohnen suchten den Südpazifik ab, um Yuri und Conner zu finden. Sie kamen allmählich näher.
Conner hielt vor dem äußeren Tor von Desmonds Gefängnis inne und hoffte, sein Bruder würde eine Reaktion zeigen. Aber er starrte nur auf die Plane über ihm.
Conner öffnete das Tor. Desmond rührte sich noch immer nicht.
Seit Conner ihn vor zwei Wochen hergebracht hatte, hatte Desmond kein Wort gesprochen. Er hatte weder nach Essen noch nach Schutz vor den Elementen verlangt.
Gestern war er verhört worden – gegen Conners Wunsch. Es war ein Akt der Verzweiflung gewesen, dessen Anblick Conner geschmerzt hatte. Aber sie mussten es tun. Die Zeit lief ihnen davon, und es stand zu viel auf dem Spiel.
Unter dem Einfluss der chemischen Droge hatte Desmond preisgegeben, dass die Erinnerung an das, was er mit Rendition getan hatte, noch nicht zurückgekehrt war. Er hatte die Information irgendwo versteckt – für den Zeitpunkt, wenn er bereit war, sie zu verwenden.
Conner wollte unbedingt zu seinem Bruder vordringen und ihn zurück zu Kition holen. Ihr Vorhaben hing von ihm ab. Aber es steckte noch mehr dahinter. Desmond war der Einzige, zu dem er eine echte Verbindung verspürte; ohne ihn war Conner einsam. Er fühlte sich wie damals, bevor Desmond ihn in Australien gefunden hatte: hilflos und isoliert.
Desmond war in dem gleichen Zustand gewesen, ehe sie wiedervereint waren. Bücher waren in dieser Zeit sein einziger Trost. Sie halfen ihm, seiner Kindheit zu entfliehen. Und eines seiner Lieblingsbücher war Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson.
Conner schlug einen anderen Klassiker von Stevenson auf – Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde – und begann zu lesen.
***
Als die Sonne untergangen und das Mondlicht zu schwach zum Lesen war, stand Conner auf, schloss das Tor hinter sich und schlenderte zurück über den Pfad. Wie gewöhnlich hatte Desmond weder etwas gesagt noch sich gerührt oder sich anmerken lassen, dass er die Anwesenheit seines Bruders bemerkte. Das tat am meisten weh.
In dem getarnten Gebäude ging Conner zum Raum des Programmierteams. Wie immer sah es dort aus wie im Schweinestall. Der Mülleimer quoll über vor zerquetschten Dosen von Energiedrinks und Verpackungen von Mikrowellengerichten. Computer, aus deren aufgeschraubten Gehäusen Kabel quollen, standen auf einem langen Tisch. Der Boden war mit zusammengeknüllten Papierkugeln übersät.
Conner wusste, was auf einem dieser Blätter war. Als er den Raum zum ersten Mal betreten hatte, hatte ein ausgedrucktes Bild von seinem Gesicht an der Wand gehangen. Die Narben, welche Stirn, linke Wange und Kinn verunstalteten, waren teilweise mit Borg-Implantaten bedeckt. Unter dem Bild standen die Worte »Widerstand ist zwecklos«. Er war sich nicht sicher, ob sie sich auf seinen Führungsstil oder seinen Plan für die Menschheit bezogen, und es war ihm auch egal. Sein ganzes Leben lang war er verspottet worden. Er war es gewohnt.
Aber bald würde es enden. Das Bild an der Wand hatte bestätigt, dass die Programmierer über seine Entschlossenheit im Bilde waren.
Dass sie es abgenommen hatten, zeigte ihre Angst vor ihm.
Der leitende Entwickler sah Conners Spiegelbild in der Fensterscheibe. Byron riss den Kopfhörer herunter, wirbelte mit seinem Drehstuhl herum und stand auf. Er war schlaksig und hatte teigige weiße Haut.
»Wie weit sind wir?«, verlangte Conner zu wissen.
»Womit?«, fragte Byron.
»Hughes. Dem Labyrinth.«
Der Programmierer schluckte. »Es ist unmöglich.«
»Ihre Aufgabe ist es, das Unmögliche möglich zu machen«, fuhr Conner ihn an.
»Hören Sie, das ist wie eine Blackbox in einer Blackbox.«
»Soll heißen?«
»Das heißt, es ist wie …«
»Ich will nicht wissen, womit man es vergleichen kann. Drücken Sie sich genauer aus. Was ist das Problem?«
»Das Problem ist, wir haben keine Ahnung, wie die Labyrinth-Reality-App funktioniert.«
»Dann tun Sie, was man so macht – bauen Sie sie nach. Entschlüsseln Sie sie.«
»Haben wir schon. Vor fünf Tagen. Das ist nicht das Problem.«
»Was dann?«
»Die Standorterkennung.«
»Ich kann Ihnen nicht folgen.«
Byron massierte sich den Nasenrücken, als hätte er Angst, es zu erklären. »Die App sendet einen Code an Hughes’ Gehirn, um die Erinnerungen freizugeben, aber nur an bestimmten Standorten. Zuerst dachten wir, sie würde die im Handy eingebaute Standorterkennung verwenden, aber jetzt wissen wir, dass sie es mithilfe eines externen Servers verifiziert. Vielleicht benutzt sie Mobilfunk-Sendemasten oder wahrscheinlicher private Satelliten, um …«
»Dann hacken Sie den Server. Hacken Sie den Satelliten. Sorgen Sie dafür, dass es funktioniert.«
»So einfach ist das nicht. Der Server schickt einen Code an das Implantat im Gehirn – das ist die zweite Blackbox. Der Code ist mit einem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Wir wissen nicht mal, wo wir ansetzen sollen. Es ist wie eine Prüfsumme, die sicherstellt, dass der Rest gültig ist. Einen syntaktisch falschen Code zu senden könnte unerwartete Folgen haben.«
»Zum Beispiel?«
»Wer weiß.«
»Spekulieren Sie.«
Byron schnaufte. »Wenn die Prüfsumme nicht stimmt, bemerkt das System, dass es gehackt wird, und schaltet sich im besten Fall komplett ab. Dann könnten wir ihm nie ermöglichen, seine Erinnerungen zurückzufinden.«
»Und im schlimmsten Fall?«
»Gehirnschaden. Der fehlerhafte Code zerstört die Erinnerungen oder löst einen zu starken Impuls aus. Er könnte nur noch vor sich hin vegetieren oder sterben.«
Conner schloss die Augen. »Was bleibt uns dann noch übrig?«
»Das Gleiche wie auf der Kentaro Maru.«
Die Erwähnung des gewaltigen Frachtschiffs, auf dem Conner seinen Bruder gefangen gehalten hatte, rief schlechte Erinnerungen hervor. Damals hatte er einen Fehler begangen. Er hatte nicht vor, ihn zu wiederholen.
»Wir lassen ihn nicht wieder laufen. Damals hätten wir ihn beinahe nicht wiedergefunden.«
»Stimmt, aber eine Sache ist dieses Mal anders.« Byron hielt das Handy hoch und öffnete die Labyrinth-Reality-App. »Auf dem Schiff hatten wir keinen Ort.«
Eine Nachricht erschien auf dem Display.
1 Eingang gefunden
Als Byron darauf tippte, tauchten die GPS-Koordinaten auf. Conner prägte sie sich ein.
»Wir müssen ihn nicht gehen lassen«, sagte der Programmierer. »Wir brauchen ihn bloß da hinzubringen.«
Conner gefiel das nicht, aber es war immerhin eine Möglichkeit. Im Moment die einzige Möglichkeit.
»Gut. Ich kümmere mich um Hughes. Wie weit sind wir mit der Wiederherstellung der Rapture-Steuerungssoftware?«
»Dabei haben wir Fortschritte gemacht.«
»Wie große?«
»Schwer zu sagen. Vielleicht sind wir bei 15 Prozent.«
Conner schüttelte den Kopf. »Sie müssen schneller arbeiten.«
»Wir können nicht …«
»Doch. Die Zeit läuft uns davon. Die Schiffe, die nach uns suchen, werden uns innerhalb einer Woche finden. Dann greifen sie uns an, genau wie auf der Kition-Insel. Sie werden die meisten von uns töten. Der Rest wird lebenslänglich eingesperrt oder hingerichtet.« Conner ließ seine Worte wirken. »Rapture Control ist unsere einzige Überlebenschance.«
Byron nickte. »Wir werden es schaffen, Sir.«
Conner sah ihn einen Moment lang an, dann drehte er sich um und verließ den Raum.
Er ging direkt zur Einsatzzentrale. Ein großer Bildschirm nahm die hintere Wand ein und zeigte Satellitenbilder und Echtzeitstatistiken. Fast jeder Arbeitsplatz an den langen Reihen von Schreibtischen war besetzt. Es war die entscheidende Phase, und alle waren auf ihren Posten.
Conner blieb vor dem Schreibtisch der Operationskoordinatorin stehen. Die rothaarige Melissa Whitmeyer war die beste Datenanalystin, die noch übrig war.
Conner schrieb die GPS-Koordinaten auf einen Zettel auf dem Schreibtisch. »Ich muss wissen, wo das ist.«
Whitmeyer warf einen Blick auf die Zahlen und rief eine Karte auf. Der Ort befand sich bei San Francisco an einer Straße, die aus den Bergen zur Küste führte. Conner wusste ihren Namen, bevor sie ihn nannte: Sand Hill Road. Im Jahr 2000, während der Dotcom-Blase, waren die Büromieten in dieser einsamen Gegend in den sanften Hügeln Kaliforniens die höchsten der Welt gewesen. Der leuchtende Punkt in der Mitte der Karte markierte das Gebäude, in dem Desmonds Firma Icarus Capital ihren Sitz gehabt hatte. Es könnte ein Problem sein, dort hinzukommen.
»Wie ist die Sicherheitslage in den USA?«
»Der Luftraum ist geschlossen, und die Küsten werden scharf bewacht. Angesichts ihrer verringerten militärischen Schlagkraft befürchten sie einen Angriff mit konventionellen Waffen.«
»Landgrenzen?«
»Etwas durchlässiger. An der Grenze zu Mexiko in Texas, Arizona und New Mexico wurden Truppen zusammengezogen.«
»Was ist mit Kalifornien?«
»Auf den Hauptstraßen wurden die Kontrollpunkte verstärkt, aber sonst nicht viel.«
»Und die Lage in Mexiko?«
»Bürgerkrieg.«
»Wer?«
»Kartelle und organisiertes Verbrechen gegen die neue Regierung. Die Kartelle gewinnen. Sie betrachten es als Gelegenheit, das Land in einen Drogenstaat zu verwandeln.«
»Okay. Lassen Sie eines der Flugzeuge startklar machen. In dreißig Minuten muss ein Einsatztrupp bereitstehen. Sieben Leute. Ich will die besten.«
Conner weihte sie in den Rest seines Plans ein, und sie begann, auf der Karte nach einem geeigneten Ort zu suchen.
***
Conner informierte Yuri in seinem Büro. Der Russe saß so teilnahmslos da, als läse Conner ihm den Wetterbericht vor. Conner fragte sich, ob seine Kindheit in Stalingrad während des Angriffs der Wehrmacht ihn für immer geprägt hatte. Oder vielleicht wusste Yuri bereits, was vorging … oder hatte es erwartet. Manchmal beunruhigten seine grauen Augen und der unbewegte Ausdruck sogar Conner.
Yuris Stimme war kaum lauter als ein Flüstern. »Dein Bruder ist außerordentlich clever, Conner. Er könnte diese Eventualität eingeplant haben. An die Orte gebracht zu werden, wo er seine Erinnerungen versteckt hat, könnte die nächste Phase seines Plans sein, den wir immer noch nicht durchschauen.«
»Wir haben keine Wahl. Ich passe auf ihn auf.«
»Und wenn er Rendition nicht übergibt?«
»Er wird es tun.«
Yuri sah zur Seite. »Er hat uns schon mal verraten. Wenn er die Gelegenheit bekommt, wird er es wieder tun. Denk an das, was auf dem Spiel steht. Und dass wir ihn mit dem Spiegel-Projekt wieder hinkriegen, egal was passiert.«
»Er ist nicht der Einzige, der uns verraten hat. Lin Shaw hat bei dem Angriff mit den Amerikanern kooperiert. Sie hat unseren Soldaten befohlen, sich zu ergeben.«
»Anscheinend hatte sie größere Pläne.«
»Welche Pläne?«
»Lin ist das letzte lebende Mitglied der ursprünglichen Kition-Zelle. Wahre Gläubige, die sich der Suche nach der höchsten Wahrheit verschrieben haben. Der Bestimmung der Menschheit. Wir können davon ausgehen, dass sie all die Jahre heimlich an ihrem eigenen Spiegel-Projekt gearbeitet hat.«
Das könnte ein Problem sein. »Warum hat sie es dann noch nicht fertiggestellt?«
»Ich kann mir mehrere Möglichkeiten vorstellen. Wir hatten ihren Sohn. Und ich habe ihre Töchter bedroht. Aber ich glaube, der wahrscheinlichste Grund ist, dass ihr die notwendigen Forschungsergebnisse fehlten.«
»Die Beagle«, flüsterte Conner.
»Ja. Vor fünfzehn Tagen haben Taucher begonnen, Fundstücke und Dokumente zu bergen.«
»Was haben sie entdeckt?«
»Weiß ich nicht. Wenn es das ist, was Lin zu ihrem Spiegel-Projekt gefehlt hat, hat sie es offenbar noch nicht verwendet.«
»Was heißt das für uns?«
»Ich weiß es nicht genau. Wir sollten davon ausgehen, dass ihre Arbeit ein Problem darstellt – wenn sie sie zu Ende bringt. Aber das wird nicht passieren. Dafür sorge ich.«
3
In dem Büro neben dem Frachtraum des Schiffs begann ein Funkgerät zu knistern. Windgeräusche und statisches Rauschen übertönten Dr. Nigel Greenes Stimme. Beim zweiten Versuch konnte Peyton ihn verstehen.
»Dr. Shaw, bitte kommen.«
Lin stand von ihrem schmalen Bett auf und schnappte sich das Funkgerät. »Hier Shaw.«
»Ma’am, Sie werden an Deck gebraucht.«
Lin warf Peyton einen vielsagenden Blick zu.
»Bin unterwegs.«
Die beiden Frauen kippten ihren Kaffee hinunter und zogen die Reißverschlüsse ihrer Thermo-Overalls hoch. Vor dem Büro drängte sich das Biologenteam noch immer vor den Computern und sichtete die Daten von Rubicon. Gleich dahinter befand sich zu beiden Seiten eines breiten Gangs jeweils eine Reihe von Kabinen, die mit weißer Plastikplane abgetrennt waren. In ihrem Inneren beugten sich Archäologen über Metalltische mit den Knochen von der Beagle. Das schrille Geräusch ihrer Bohrer orchestrierte ihre penible Arbeit.
Das Biologenteam ärgerte sich ständig über die Langsamkeit der Archäologen. Es wollte, dass die Proben schnell entnommen und analysiert wurden, während es für die Archäologen das Wichtigste war, die Fundstücke nicht zu beschädigen. Lin hatte einen Mittelweg gefunden und für einen fragilen Waffenstillstand gesorgt, aber das hielt die Biologen nicht davon ab, Spitznamen zu erfinden. Sie nannten die Archäologen »Eisbären« oder einfach »Bären«. Ihre Labore wurden als »Bärenkäfige« bezeichnet, Streitigkeiten als »Bärenangriffe« und das Abliefern der Fundstücke als »Bärenfüttern«.
Peyton bekam den Bärenvergleich nicht aus dem Kopf, während sie durch den Mittelgang ging und zusah, wie die weiß gekleideten Gestalten in den Kabinen die Knochen begutachteten und dann tiefer hineinbohrten.
Hinter dem Frachtraum kletterten Peyton und Lin schweigend die Leitern zu den Decks hinauf. Lin drehte das Rad der Luke und stieg ins Freie. Peyton biss die Zähne zusammen, als ihr die arktische Luft entgegenschlug.
Das Deck des russischen Eisbrechers wimmelte von Seeleuten. Das Forschungspersonal, das für den Einsatz des Tauchboots benötigt wurde, stand hinter ihnen am Heck des Schiffs. Die Wissenschaftler bestimmten, was getan wurde, aber die russische Marine war dafür verantwortlich, wie es getan wurde. Wie bei den Biologen und Archäologen gab es ständig Spannungen zwischen den beiden Gruppen.
An diesem Morgen war es nicht anders. Der befehlshabende Offizier, Kapitän Alexei Wasiliew, brüllte die um das Tauchboot versammelten Forscher an, sie hätten unrealistische Erwartungen. Die Besatzung hatte sich hinter dem kräftigen Russen versammelt wie eine Straßengang, die ihre Stärke demonstriert.
Lins schlanke Gestalt bildete einen scharfen Kontrast zu den stämmigen Seeleuten, als sie sich durch die Menge drängte wie ein Kind, das einen Lynchmob durchquert. Peyton blieb ihr dicht auf den Fersen, weil sie befürchtete, die Lücke könnte sich hinter ihr schließen und sie wäre dann in der Meute gefangen.
Wasiliew hörte auf zu schreien, als er sie sah.
Lins Stimme durchschnitt die eisige Luft. »Kapitän, kann Ihre Mannschaft unseren Tauchplan einhalten oder nicht?«
Wasiliew warf die Hände in die Luft und fing wieder an zu brüllen. Weiße Dampfwolken begleiteten seine Worte, und er erinnerte Peyton an einen beschleunigenden Motor, der immer lauter wurde und immer mehr Abgase ausstieß.
Lin wandte sich an das Forschungsteam. »Dr. Greene, informieren Sie die Allianz, dass die Besatzung der Arktika nicht in der Lage ist, unseren Tauchplan einzuhalten, und wir deshalb unseren Auftrag nicht mit der gebotenen Eile ausführen können.«
Nigel nickte und löste sich aus der Gruppe, aber Wasiliew streckte seine fleischige Hand aus, um ihn aufzuhalten. Er wandte sich an seine eigenen Männer und murmelte etwas auf Russisch. Bevor er das Deck verließ, sprach er ein paar Worte mit Nigel.
Nigel sagte zu Lin: »Sie sind in fünfzehn Minuten bereit.«
»Gut.«
Peyton sah zu, wie auf dem Deck hektische Betriebsamkeit ausbrach. Die Forscher und die russischen Besatzungsmitglieder rempelten sich an und stritten miteinander.
Nigel trat näher zu Lin. Sein englischer Akzent kam stärker hervor, als er mit gedämpfter Stimme zu ihr sprach. »Dr. Shaw, ich muss Sie erneut bitten, auf dem Schiff zu bleiben.«
»Nein.« Lin wandte den Blick ab und beobachtete die Vorbereitungen.
»Sie sind unersetzlich.« Nigel schnaufte. »Es ist ein unnötiges Risiko.«
»Niemand kennt die Beagle so gut wie ich.«
»Vielleicht. Aber wir haben das Boot komplett kartiert. Unser Bergungspersonal ist ausgebildet …«
»Ihre Einwände wurden zur Kenntnis genommen, Dr. Greene. Ich habe meine Entscheidung getroffen.«
Nigel sah zu Peyton, die mit den Achseln zuckte, als wollte sie sagen: Ich hab’s auch schon versucht.
Peyton fragte sich, ob es in dem Wrack etwas gab, das ihre Mutter unbedingt selber finden wollte. Sie konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass Lin etwas verbarg. Deshalb hatte sie darauf bestanden, sie bei jedem Tauchgang zu begleiten. Wenn es etwas gab, das Menschleben retten konnte – oder ihr helfen konnte, Desmond zu finden –, wollte sie darüber Bescheid wissen.
Sie fragte sich auch, ob Nigel etwas ahnte. Wenn ja, dann ließ er sich nichts anmerken. Er nickte nur und ging davon. Peyton und Lin standen allein in dem Chaos wie Statuen inmitten eines Mardi-Gras-Umzugs.
Oben auf dem Deck wurden Peyton die Ausmaße des russischen Schiffs bewusst. Mit knapp dreißig Meter Breite und hundertfünfzig Meter Länge war die Arktika der größte Eisbrecher der Welt. Die beiden Kernreaktoren ermöglichten ihm, vier Meter dickes Eis zu durchbrechen, ebenfalls ein Weltrekord. Die Decks waren in einem Grünton gestrichen, der Peyton an Minigolfplätze erinnerte, und die Außenwände und Luken waren rostrot. Vielleicht hatten die Konstrukteure gedacht, die Farbkombination würde im arktischen Eis besonders hervorstechen, aber Peyton erinnerte sie an Weihnachten, das nur noch knapp eine Woche entfernt war. Und sie konnte nicht an Weihnachten denken, ohne an Desmond zu denken – an die Nacht, die sie in der Half Moon Bay verbracht hatten, und an den Moment, in dem er die Schachtel mit dem gläsernen Herz geöffnet hatte. Unwillkürlich tastete sie in ihrer Hosentasche danach.
Sie ließ ihre Mutter zurück und ging zum Rand des Decks. Die Eisschicht schien sich in der Dunkelheit endlos über den Arktischen Ozean zu erstrecken. Die Scheinwerfer bildeten einen Lichtkreis um das Schiff, sodass Peyton sich vorkam wie auf einem Spielzeugschiff in einer Schneekugel, abgeschnitten von der Außenwelt.
Von der Reling aus konnte sie den Hubschrauber der US-Navy sehen, der auf dem Landplatz weiter oben thronte. Ihre Mutter hatte sie schon zweimal gefragt, ob sie in den Helikopter steigen und das Schiff verlassen wollte. Peyton hatte abgelehnt. Sie würde nicht gehen, ohne mehr erfahren zu haben.
Schritte hallten hinter ihr über das Deck. Lins Stimme war jetzt leiser und weniger gebieterisch. »Es wird Zeit, Peyton.«
Wenige Minuten später tauchten sie zu dem U-Boot-Wrack hinab.
***
Während Peyton und Lins Forschungs-Tauchboot an dem U-Boot am Meeresboden andockte, näherte sich ein anderes Tauchboot dem russischen Eisbrecher. An Bord befand sich ein Team aus fünf Männern, die alle speziell für ihren Auftrag ausgebildet worden waren.
Statt an der Anlegestelle der Arktika aufzutauchen, bewegte sich das Boot langsam am Rumpf entlang. Es suchte nach einer Öffnung im Eis, die groß genug und vom Achtern- und Vordeck aus schlecht zu sehen war.
Das Tauchboot kehrte den Schub um, setzte zurück und trieb zur Oberfläche, bis es auf die Eisschicht traf. Ein weißes Rohr wurde ausgefahren und hob sich dicht am Rumpf aus dem Wasser. Eine Pumpe entwässerte das Rohr, die Luke an der Oberseite öffnete sich, und Lieutenant Stockton, der Zweite Kommandant des Einsatzes, kletterte die Leiter hoch.
Oben angekommen hielt er das Roboterfahrzeug an den Rumpf der Arktika. Er zog eine Fernsteuerung hervor und schaltete den Magneten an. Der Roboter heftete sich an den Eisbrecher und begann, mit seinen Gummiketten lautlos den Rumpf zu erklimmen.
Als er das Deck erreicht hatte, fuhr er zwei kleine Arme aus und klammerte sich an der Metallkante fest. Eine fingerlange Antenne mit einer Glasspitze erhob sich knapp über den Schiffsrand.
Im Tauchboot sah Captain Furst, der Kommandant, auf seine Uhr und merkte sich die Zeit.
Stockton stieg die Leiter hinab, und das Rohr wurde wieder eingefahren. In den nächsten zwanzig Minuten sahen sich die fünf Männer schweigend die Videoaufnahmen an und hielten Ausschau nach Wachen und anderen Details, die ihrer Mission dienlich sein konnten.
Stockton wandte sich zu Furst und tippte auf seine Luminox-Uhr.
Furst nickte.
Stockton und ein zweiter Mann legten ihre Körperpanzerung an und zogen russische Marineuniformen darüber. Das Roboterfahrzeug ließ ein hochbelastbares Seil herab. Wieder wurde das weiße Rohr ausgefahren, das Wasser abgepumpt und die Luke geöffnet. Die beiden Spezialisten benötigten weniger als eine Minute, um den Rumpf der Arktika zu erklimmen.
An Deck mischten sie sich unter die hundertvierzig Besatzungsmitglieder, um ihren Auftrag auszuführen: die Arktika zu versenken und Lin und Peyton Shaw gefangen zu nehmen oder zu töten.
4
Um Mitternacht verließ Conner das Gebäude und folgte dem Pfad über die Insel. Der Mond leuchtete ihm den Weg. Drei Söldner in Tarnkleidung folgten ihm. Insekten zirpten wie ein aus dem Takt geratenes Orchester, das ihren Marsch begleitete.
Er blieb vor dem Zaun des Geheges stehen. Desmond lag mit geschlossenen Augen auf seiner Pritsche und atmete flach. Leise öffnete Conner das äußere Tor. Er griff in die Tasche, zog eine Spritze heraus und entfernte die Plastikkappe. Jetzt kam es auf Schnelligkeit an.
Er riss das innere Tor auf und stürmte zu seinem Bruder.
Zu seiner Verblüffung rollte sich Desmond von der Pritsche und sprang aus der Hocke nach vorn. Er traf Conner mit der Schulter knapp oberhalb der Knie. Conner flog über seinen Rücken. Desmond traf den ersten Soldaten mit einem heftigen Schlag im Gesicht. Der Mann wurde rückwärts gegen den Zaun geworfen und zuckte unter den knisternden Stromstößen zusammen.
Die beiden anderen Söldner gingen auf Desmond los und rangen ihn zu Boden. Desmond versuchte, sie abzuschütteln, aber Conner kam mit der Spritze in der Hand wieder auf die Beine. Er drückte den Kopf seines Bruders auf die Erde und rammte ihm die Nadel in den Hals.
Tut mir leid, Des. Du hast mir keine Wahl gelassen.
***
Die beiden Söldner, die Desmond bezwungen hatten, trugen ihn auf seiner Pritsche den Hang hinab. Conner ließ den bewusstlosen Soldaten zurück und ersetzte ihn durch einen anderen. Fünf weitere Söldner warteten bei dem Jet im getarnten Hangar. Major Goins, der Teamleiter, informierte Conner, dass die Fracht eingeladen sei und sie bereit zum Abflug waren.
Die Startbahn war grasbewachsen und leicht kurvig. Ruckelnd nahm der Jet Fahrt auf und hob schließlich ab.
Conner ließ sich auf den Sitz neben Desmond sinken, der betäubt und intubiert war. Das letzte Mitglied von Conners Team, ein Anästhesist namens Dr. Simon Park, setzte sich Desmond gegenüber und überwachte seine Vitalfunktionen. Der Arzt hatte sich ausgiebig über den Plan beschwert und genug medizinisches Gerät und Medikamente mitgebracht, um ein kleines Krankenhaus auszustatten. Seine Miene drückte ständig Besorgnis aus.
Conner betrachtete das als gutes Zeichen. Menschen, die sich keine Sorgen machten, begingen mehr Fehler. Deshalb hatte er Park auch klargemacht, dass sein Schicksal eng mit dem von Desmond verknüpft war.
***
Sechs Stunden später stand Conner im Cockpit und sah zu, wie die Sonne über den Bergen des mexikanischen Bundesstaats Baja California aufging. Bald wichen die Hügel der Wüste, dann erreichten sie die Küste. Zwischen dem Gebirge und dem Golf von Kalifornien wirkte die Stadt San Felipe winzig.
Einige Kilometer landeinwärts lag ein Flughafen mit einer einzigen Landebahn. Ihre Satellitenaufnahmen waren eine Woche alt, aber beim ersten Überflug stellten sie fest, dass der Regionalflughafen noch immer verlassen war. Oder zumindest so aussah.
Das Flugzeug wirbelte eine große Staubwolke auf, als es landete. Conner und sein Team warteten, während das weiße Flugzeug wie von einem Sandsturm eingehüllt wurde. Die Soldaten entluden zuerst zwei Geländemotorräder, und neue milchige Staubwolken stieben auf, als vier der Söldner der aufgehenden Sonne entgegen zur Stadt fuhren.
Dr. Park injizierte irgendetwas in Desmonds Tropf.
»Wie ist sein Zustand?«, fragte Conner.
»Stabil.« Park sah nicht auf. Er war kein Mann großer Worte. Conner gefiel das.
Wie geplant, kehrten die Soldaten mit vier gestohlenen Lieferwagen zurück, alle fensterlos und ziemlich zerbeult.
Sie luden die Motorräder und den Großteil der Fracht in eines der Fahrzeuge. Die medizinische Ausrüstung und Desmond wurden in den Wagen gebracht, in dem Dr. Park, Conner und seine drei besten Männer saßen. Die anderen Soldaten stiegen mit der restlichen Fracht, zu der auch mehrere große Benzinkanister gehörten, in die beiden letzten Fahrzeuge. Jeder Wagen war mit Proviant, Wasser und Munition ausgestattet – für den Fall, dass sie getrennt wurden.
Sie verschlossen das Flugzeug, versteckten es unter einer Plane und fuhren nach Norden durch San Felipe. Die Touristenstadt wirkte unbewohnt. Conner fragte sich, ob die Bewohner gestorben waren oder in einer größeren Stadt Schutz gesucht hatten.
Sie konnten unmöglich wissen, wie lang die Fahrt zur Sand Hill Road dauern würde. Unter normalen Umständen wären zwölf Stunden eine realistische Schätzung – vorausgesetzt, die Straßen waren passierbar. Aber sie würden nicht die direkte Route nehmen, sondern über Nebenstraßen fahren und die großen Städte meiden. Wahrscheinlich würden sie doppelt so lang brauchen, aber auf diese Weise gingen sie Banditen und Kontrollpunkten der Regierung aus dem Weg, die ihre Mission vorzeitig beenden könnten.
In der Nähe der Grenze zu den USA bogen sie von der Straße ab und fuhren durch die Wüste. Irgendwo zwischen Mexicali und Tijuana überquerten sie die unmarkierte Grenze. Sie hätten sich genauso gut in der Sahara befinden können – es gab weder Menschen noch sonstiges Leben, bis auf ein paar Kakteen und Büsche. Die Lieferwagen schossen nach Norden, alle vier nebeneinander, damit die Staubwolke ihnen nicht die Sicht nahm.
Erst als sie auf den California Highway 98 stießen, hatten sie wieder Asphalt unter den Rädern. Sie fuhren nach Westen und hielten nach verlassenen Autos Ausschau, aber auf der langen flachen Straße, die in der Mittagssonne glühte, fanden sie keine.
Bei der kleinen Gemeinde Coyote Wells, die nicht viel mehr als ein Rastplatz für Lastwagen war, verließen sie den Highway. Dort fanden sie, was sie brauchten: kalifornische Kennzeichen. Die Beschreibung der Fahrzeuge würde nicht zu den Lieferwagen passen, wenn die Nummernschilder mit der Verkehrsdatei abgeglichen würden, aber es würde genügen, bis sie welche von ähnlicheren Autos gefunden hatten.
Sie fuhren nach Osten, weg von der Küste, wo es mehr Menschen und Soldaten gab. Die Wüste verwandelte sich langsam in bewässertes, grünes Ackerland. Kurz darauf bogen sie nach Norden ab und passierten Salton Sea, den Joshua-Tree-Nationalpark und Yucca Valley.
Der Wagen mit den meisten Soldaten fuhr jetzt einige Kilometer voraus, um Ausschau nach Kontrollpunkten oder anderen Problemen zu halten. Sie mussten einige umgekippte Bäume und einen Steinschlag aus dem Weg räumen, aber ansonsten hatten sie keine Schwierigkeiten.
Und von Stunde zu Stunde wurde Conner entspannter.
Einen Kilometer vor Barstow fanden sie Nummernschilder an Lieferwagen, die mit ihren eigenen Modellen übereinstimmten. Bei Mariposa bogen sie Richtung Küste ab. Conner wollte keinen der großen Highways benutzen, die in die Bay Area führten, deshalb fuhren sie über Nebenstraßen, die sich durch die Naturparks und geschützten Wälder zwischen San Jose und Santa Cruz schlängelten.
Irgendwo auf ihrem Weg, Stunden nachdem die Sonne untergegangen war, glitt Conner in den Schlaf. Das leise rhythmische Piepsen des Herzschlagmonitors seines Bruders war das Letzte, was er hörte.
***
Eine Hand packte ihn an der Schulter. Conner griff nach der Pistole in seinem Holster und riss die Augen auf. Captain Goins’ Gesicht wurde von der Deckenbeleuchtung des Lieferwagens angestrahlt.
»Lagebericht«, fuhr Conner ihn an.
»Das Spähfahrzeug ist gerade von der Portola Road auf die Sand Hill gefahren.«
»Anhalten.« Conner setzte sich auf. »Der Späher soll warten.«
Er schaltete das Satellitentelefon ein und rief Yuri an.
»Wie ist die Lage?«, fragte der Russe.
»Wir sind in Position.«
»Widerstand?«
»Keiner.«
»Gut. Dann starten wir den Angriff. Hoffentlich bietet er euch Deckung.«
»Verstanden.«
»Vergiss nicht, warum du da bist, Conner.«
Conner warf einen Blick auf seinen Bruder, der neben ihm im Koma lag. »Bestimmt nicht.«
***
Yuri trennte die Verbindung und ging in die Einsatzzentrale. Zum Wachleiter sagte er: »Pearl Harbor?«
»Wir sind bereit, Sir.«
»Anfangen.«
Der große Bildschirm am hinteren Ende des Raums zeigte eine Weltkarte voller grüner Punkte. Ein Punkt nach dem anderen wurde rot – Router, die abgeschaltet wurden. Kition hatte die Firmware schon vor Jahren gehackt und als Vorbereitung auf diesen Moment Trojaner installiert. Jetzt waren die Geräte nur noch Klötze aus Plastik, Silizium und Metall – bis Kition beschloss, sie zu reaktivieren.
Satelliten, die Daten für das Internet übertrugen, wurden ebenfalls aus dem Verkehr gezogen. Die einzigen, die noch funktionierten, gehörten Kition oder einigen privaten Firmen.
Die Welt hatte sich vom Internet abhängig gemacht.
Und jetzt war es weg.
***
Conner wartete, bis eine Nachricht auf seinem Laptop erschien:
Internet weltweit deaktiviert
Er schaltete auf die Videoübertragung des Spähfahrzeugs um und sprach ins Funkgerät.
»Weiter.«
Der Wagen fuhr zurück auf die Straße und hielt sich knapp unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Fahrer trug wie alle Zivilkleidung, aber Conner wusste, dass sie bei jedem Kontrollpunkt Verdacht erregen würden. Die kurz geschorenen Haare, die kantigen Gesichter und die harten Augen verrieten sie.
Die Straße war leer. Desmonds Bürogebäude lag gleich hinter der Ausfahrt Sand Hill Road der Interstate 280. Nichts rührte sich, weder Autos noch Fußgänger noch sonst etwas.
»Fahren Sie rein«, sagte Conner. »Und sagen Sie den anderen, sie sollen ausschwärmen.« Vier Lieferwagen, die auf einem Parkplatz standen und weißen Rauch in den Dezembermorgen spuckten, würden auffallen. Trotzdem wollte er sie in der Nähe haben, damit sie im Notfall eingreifen konnten. »Aber alle Einheiten sollen in Sichtweite bleiben.«
Als sein Wagen auf den Parkplatz bog, zog Conner das Handy aus der Tasche und öffnete die Labyrinth-Reality-App.
»Müssen wir in Desmonds Büro sein, damit es funktioniert?«, fragte er den Arzt.
»Ich weiß nicht, aber ich möchte ihn möglichst wenig bewegen.«
»Gut. Versuchen wir es hier.«
Die App fragte Conner, wie er das Labyrinth betreten wolle: als Minotaurus oder Held. Conner grinste. Er war der Held des großen Spiels, das die Welt im Griff hielt, aber für die Unwissenden war er der Minotaurus – ein Monster mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Stiers. Mit seinem entstellten Gesicht war er eine gute Besetzung für diese Rolle.
Trotzdem klickte er auf »Held«, weil er wusste, dass sein fehlgeleiteter älterer Bruder sich als solcher betrachtete. Er würde es so programmiert haben, als Erinnerung für sich selbst, nachdem er sein Gedächtnis verloren hatte. Hatte Desmond die Frage in das Programm eingebaut, um seinen Glauben an die Mission wiederherzustellen? Es gab immer noch so vieles, das Conner über seinen Bruder nicht wusste.
Eine weitere Meldung erschien:
Suche nach Eingang …
Und nach wenigen Sekunden:
1 Eingang gefunden
Conner tippte erneut auf das Display, und ein Ladebalken mit dem Wort Downloading tauchte auf.
Nach zehn Minuten summte das Handy.
Download abgeschlossen.
Im selben Moment bog Desmond den Rücken durch, als würde sein improvisiertes Krankenbett brennen. Dann fiel er zurück auf die Trage und zuckte. Das gleichmäßige Piepsen des Herzschlagmonitors ging in einen schrillen Warnton über. Desmonds Hände zerrten an den gepolsterten Gurten, mit denen sie an der Trage fixiert waren.
»Was ist los?«, fragte Conner.
Dr. Park ignorierte ihn. Er zog eins von Desmonds Augenlidern hoch und leuchtete mit einer Stiftlampe hinein.
Conner packte ihn an der Schulter. »Hey.«
Park schüttelte seine Hand ab. »Ich weiß es nicht.«
Plötzlich fühlte sich Conner hilflos. Er stirbt. Und ich habe ihn getötet.
5
Peyton gab acht, dass sie ihren Anzug nicht zerriss, als sie ihrer Mutter und zwei Navy SEALs durch das gesunkene U-Boot folgte. Sie hatten die Luft auf Giftstoffe getestet und keine entdeckt, aber Lin Shaw hatte sie daran erinnert, dass auf der Beagle seltsame Experimente durchgeführt worden waren, und bei jedem Labor und Büro, das sie öffneten, riskierten sie, sich Toxinen auszusetzen. Also behielten sie die Anzüge ständig an.