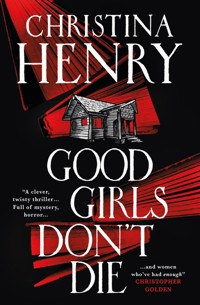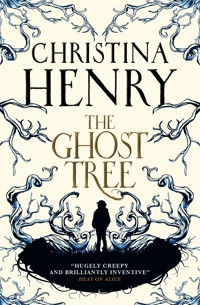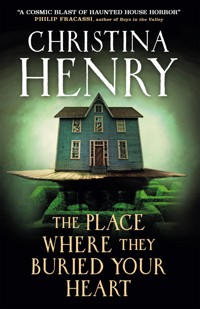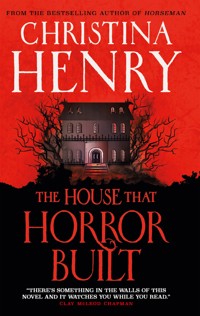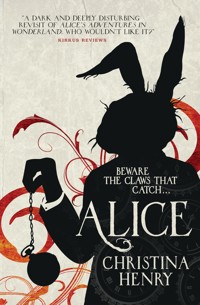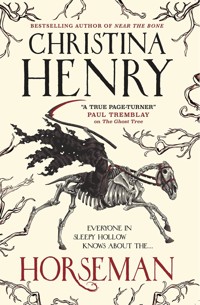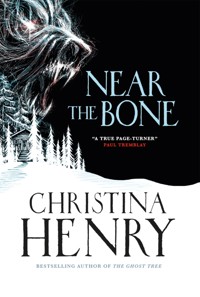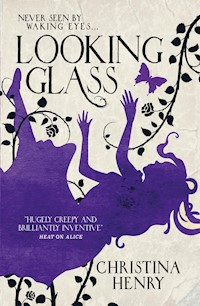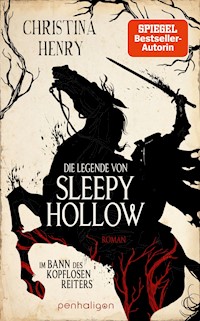Die Chroniken von Alice Band 1-3: Finsternis im Wunderland / Die Schwarze Königin / Dunkelheit im Spiegelland (3in1-Bundle) E-Book
Christina Henry
29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Alice-Bücher von Christina Henry in einem Bundle
Nichts für schwache Nerven: Bestsellerautorin Christina Henry erzählt »Alice im Wunderland« auf unnachahmliche Weise: originell, düster und brutal – gleichzeitig aber unglaublich packend.
Seit zehn Jahren ist Alice in einem düsteren Hospital gefangen. Alle halten sie für verrückt, während sie selbst sich an nichts erinnert. Weder, warum sie sich an diesem grausamen Ort befindet, noch, warum sie jede Nacht Albträume von einem Mann mit Kaninchenohren quälen. Als ein Feuer im Hospital ausbricht, gelingt Alice endlich die Flucht. An ihrer Seite ist ihr einziger Freund: Hatcher, der geisteskranke Axtmörder aus der Nachbarzelle. Doch nicht nur Alice und Hatcher sind frei. Ein dunkles Wesen, das in den Tiefen des Irrenhauses eingesperrt war, ist ebenfalls entkommen und jagt die beiden. Erst wenn Alice dieses Ungeheuer besiegt, wird sie die Wahrheit über sich herausfinden – und was das weiße Kaninchen ihr angetan hat …
Enthält die Bände:
Band 1: Finsternis im Wunderland
Band 2: Die Schwarze Königin
Band 3: Dunkelheit im Spiegelland
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1186
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Die Autorin
Die Amerikanerin Christina Henry ist als Fantasy-Autorin bekannt für ihre finsteren Neuerzählungen von literarischen Klassikern wie »Alice im Wunderland«, »Peter Pan« oder »Die kleine Meerjungfrau«. Im deutschsprachigen Raum wurden diese unter dem Titel »Die Dunklen Chroniken« bekannt und gehören zu den erfolgreichsten Fantasy-Büchern der letzten Jahre. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin liebt Langstreckenläufe, Bücher sowie Samurai- und Zombiefilme. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Chicago.
Finsternis im Wunderland
Seit zehn Jahren ist Alice in einem düsteren Hospital gefangen. Alle halten sie für verrückt, während sie selbst sich an nichts erinnert. Weder, warum sie sich an diesem grausamen Ort befindet, noch, warum sie jede Nacht Albträume von einem Mann mit Kaninchenohren quälen. Als ein Feuer im Hospital ausbricht, gelingt Alice endlich die Flucht. An ihrer Seite ist ihr einziger Freund: Hatcher, der geisteskranke Axtmörder aus der Nachbarzelle. Doch nicht nur Alice und Hatcher sind frei. Ein dunkles Wesen, das in den Tiefen des Irrenhauses eingesperrt war, ist ebenfalls entkommen und jagt die beiden. Erst wenn Alice dieses Ungeheuer besiegt, wird sie die Wahrheit über sich herausfinden – und was das weiße Kaninchen ihr angetan hat …
Die Schwarze Königin
Alice hat den Kampf gegen den Wahnsinn gewonnen – vorerst. Sie hat die Schandtaten des Kaninchens sowie den Blutdurst des Jabberwocks überlebt und will nun ein Versprechen einlösen: Jenny, die Tochter ihres Freundes Hatcher, zu finden. Doch Alice und Hatcher erwartet der nächste Albtraum. Sie müssen in das Reich der verrückten Weißen Königin vordringen, wo das wahre Spiel um das finstere Wunderland bereits begonnen hat. Jeder Zug führt Alice näher an ihre Bestimmung. Aber damit sie als Siegerin hervorgeht, muss sie nicht nur ihre neuen Kräfte zu beherrschen lernen, sondern herausfinden, was mit der rätselhaften Schwarzen Königin geschehen ist ...
Dunkelheit im Spiegelland
Alice und der Axtmörder Hatcher haben schrecklichen Gefahren getrotzt – jetzt erfahren die Fans, wie es mit den beiden weitergeht, und sie dürfen zudem tief in das Innerste von Henrys beliebtesten Figuren blicken: In einer von vier Kurzgeschichten berichtet Hatcher aus der Zeit, als er selbst noch Nicholas hieß und der beste Kämpfer der Alten Stadt war. In zwei anderen erzählt Alice von einer gruseligen Nacht in einem Schloss sowie von einem dunklen Geheimnis, das sie sogar vor Hatcher geheimhält. Und der Leser lernt Alice' Schwester Elizabeth kennen, die sich vom Jabberwock finstere Gedanken einflüstern lässt ...
Christina Henry
Die Chroniken von Alice
Band 1-3
Finsternis im WunderlandDie Schwarze KöniginDunkelheit im Spiegelland
Deutsch von Sigrun Zühlke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgaben © 2015, 2016, 2020 by Tina Raffaele
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Berkley, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgaben »Finsternis im Wunderland (Alice)« 2020, »Die Schwarze Königin (Red Queen)« 2020 und »Dunkelheit im Spiegelland (Looking Glass)« 2021 by Penhaligon Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
»Finsternis im Wunderland«: Covergestaltung: Melanie Korte, Inkcraft, nach einer Originalvorlage von Titan Books. Coverdesign: Julia Lloyd
»Die Schwarze Königin«: Covergestaltung: Melanie Korte, Inkcraft, nach einer Originalvorlage von Titan Books. Coverdesign: Julia Lloyd
»Dunkelheit im Spiegelland«: Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, nach einer Originalvorlage von Titan Books. Coverdesign: Julia Lloyd unter Verwendung von Bildern von Shutterstock.com (Nattle; Natasha Koltsova; tati._.9)
ISBN 978-3-641-30227-6V002
www.penhaligon.de
Christina Henry
Die Chroniken von Alice
Finsternis im Wunderland
Roman
Für Danielle Stockley,weil du an Maddy und Alice und mich geglaubt hast
Kapitel1
Wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, sich bis ganz nach oben streckte, die Wange an die Wand legte und den Kopf nach links drehte, konnte sie durch die Gitterstäbe gerade so den Rand des Monds sehen. Eine Scheibe Käse, eine Scheibe Kuchen, eine Tasse Tee, um der Höflichkeit Genüge zu tun. Einmal hatte ihr jemand eine Tasse Tee angeboten, jemand mit blaugrünen Augen und langen Ohren. Komisch, dass sie sich nicht an sein Gesicht erinnern konnte. Dieser Teil ihrer Erinnerung war neblig, wie in Rauch gehüllt, abgesehen von den Augen und Ohren. Und die Ohren waren lang und pelzig gewesen.
Als man sie gefunden hatte, hatte sie nichts anderes gesagt als: »Das Kaninchen. Das Kaninchen. Das Kaninchen.« Wieder und wieder. Immer wieder. Und jedes Mal wurde sie für verrückt erklärt. Alice wusste, dass sie nicht verrückt war. Vielleicht. Nicht richtig. Doch die Pulver, die sie ihr gaben, machten die ganze Welt unscharf und schräg, und manchmal fühlte sie sich tatsächlich verrückt.
Alles war genau so passiert, wie sie es erzählt hatte, als sie wieder mehr sagen konnte als nur »das Kaninchen«. Dor und sie waren zu Dors Geburtstag in die Alte Stadt gegangen. Sechzehnter Geburtstag. Sechzehn Kerzen auf deinem Kuchen, eine Scheibe Kuchen und eine Tasse Tee für dich, meine Liebe. Sie waren beide hineingegangen, doch nur Alice war wieder herausgekommen. Zwei Wochen später war sie blutüberströmt wieder aufgetaucht und hatte von Tee und einem Kaninchen gefaselt und ein Kleid getragen, das nicht ihres war. Rot lief es an den Innenseiten ihrer Beine entlang, und blau waren die Flecken an ihren Oberschenkeln, wo Finger sie gepackt hatten.
Ihre Hand berührte unwillkürlich ihre linke Wange und befühlte die lange, wulstige Narbe, die vom Haaransatz am Wangenknochen entlang bis zu ihrer Oberlippe verlief. Ihr Gesicht war aufgerissen gewesen, als man sie gefunden hatte, und sie hatte nicht sagen können, wie das geschehen war oder warum. Es war eine ganze Weile aufgerissen geblieben, das Blut, das aus der Wunde quoll, wurde schwarz und brackig und die Haut an den Wundrändern rissig. Die Ärzte sagten ihren Eltern, sie hätten ihr Bestes gegeben, aber ihre frühere Schönheit würde sie nie zurückbekommen.
Ihre Schwester sagte, sie sei selbst schuld. Hätte sie sich von der Alten Stadt ferngehalten, wie es ihr immer gesagt worden sei, dann wäre nichts von dem je geschehen. Sie lebten nicht ohne Grund in der Neuen Stadt, diesem Ring aus schönen, glänzenden Gebäuden, der die Alte Stadt umgab. Die Alte Stadt war nicht für Leute wie sie. Sie war für den Abschaum, für das, was man wegwarf. Alle Kinder wurden vor den Gefahren gewarnt, die ihnen drohten, wenn sie sich in die Alte Stadt wagten. Alice gehörte dort nicht hin.
Das Krankenhaus, in dem Alice die letzten zehn Jahre gelebt hatte, stand in der Alten Stadt, also hatte ihre Schwester unrecht gehabt. Alice gehörte sehr wohl dorthin.
Manchmal besuchten ihre Eltern sie, pflichtschuldig; sie rümpften die Nasen, als rieche sie irgendwie schlecht, sogar dann, wenn die Pfleger sie vorher nach draußen gezerrt und ihr ein Bad verpasst hatten. Sie hasste die Bäder. Sie waren eiskalt und bedeuteten raues Schrubben, und nie wurde ihr erlaubt, sich selbst zu waschen. Wenn sie sich wehrte oder schrie, bekam sie eins mit der Badebürste übergezogen oder wurde so fest gekniffen, dass ein Abdruck zurückblieb, immer an einer Stelle, an der man es nicht sehen konnte, an der Unterseite ihrer Brust oder am weichen Teil ihres Bauchs, immer mit dem Versprechen, dass »da, wo das herkommt, noch mehr ist«, wenn sie sich nicht benehme.
In letzter Zeit kamen ihre Eltern nicht mehr so oft zu Besuch. Alice wusste nicht mehr genau, wann sie zum letzten Mal da gewesen waren, aber sie wusste, dass es schon lange her war. In ihrem Zimmer flossen die Tage ineinander, keine Bücher zu lesen, nichts zu tun. Hatcher sagte, sie sollte turnen, damit sie fit wäre, wenn sie herauskämen, aber irgendwo tief in ihrem Herzen wusste Alice, dass sie nie wieder hier herauskommen würde. Sie war kaputt, und die Neue Stadt mochte Kaputtes nicht. Sie mochte das Neue und das Heile. Alice konnte sich kaum noch daran erinnern, wie sie neu und heil gewesen war. Dieses Mädchen von damals erschien ihr wie jemand anderes, den sie mal gekannt hatte, vor langer Zeit und weit, weit weg.
»Alice?« Eine Stimme durch das Mauseloch.
Vor vielen Jahren war eine Maus in die Wand eingedrungen und hatte sich durch die Dämmung zwischen ihrer und Hatchers Zelle geknabbert. Alice wusste nicht, was aus der Maus geworden war. Wahrscheinlich war sie in der Küche in einer Falle gefangen worden oder an der Flussseite herausgekommen und ertrunken. Aber die Maus hatte sie zu Hatcher geführt, einer rauen Stimme, die durch die Wand kam. Anfangs hatte sie wirklich gedacht, jetzt sei sie endgültig durchgedreht, dass sie Stimmen hörte.
»Hey, du«, hatte die Stimme gesagt.
Erschreckt hatte sie wild um sich geblickt und sich in eine Ecke auf der anderen Seite gedrückt, unter das Fenster, weit weg von der Tür.
»Hey, du. Hier unten«, sagte die Stimme.
Alice steckte sich entschlossen die Finger in die Ohren. Jeder wusste, dass Stimmenhören ein Anzeichen von Wahnsinn war, und sie hatte sich selbst versprochen, nicht wahnsinnig zu werden, ganz egal, was sie ihr einredeten, ganz egal, wie sie sich fühlte. Nach einigen Momenten glückseliger Stille löste sie ihre Finger und sah sich erleichtert im Zimmer um.
Aus der Wand drang ein tiefer Seufzer: »Das Mauseloch, du Dummkopf.«
Hektisch starrte Alice auf das kleine Loch an der gegenüberliegenden Ecke. Irgendwie fand sie eine sprechende Maus noch schlimmer als die Stimmen in ihrem Kopf. Wenn Mäuse sprechen konnten, dann gab es auch Männer mit blaugrünen Augen und langen pelzigen Ohren. Auch wenn sie sich nicht an sein Gesicht erinnern konnte, so erinnerte sie sich doch nur allzu gut, welch schreckliche Angst sie gehabt hatte.
Sie starrte auf das Mauseloch, als erwarte sie, dass jeden Augenblick etwas Furchtbares daraus hervorkröche, als könnte jederzeit das Kaninchen aus diesem kleinen Loch herauskommen und sich zu voller Größe aufrichten und zu Ende bringen, was es begonnen hatte.
Noch ein Seufzen, dieses Mal kürzer und ungeduldiger. »Du hörst keine verdammten Stimmen, und es spricht auch keine Maus zu dir. Ich bin in der Zelle neben dir, und ich kann dich durch das Mauseloch sehen. Du bist nicht verrückt, und es ist auch keine Zauberei im Spiel, also würdest du jetzt bitte mal herkommen und mit mir reden, bevor ich noch verrückter werde, als ich es sowieso schon bin?«
»Wenn du nicht in meinem Kopf bist und keine Zauberei im Spiel ist, woher weißt du dann, was ich denke?«, fragte Alice misstrauisch. Sie fing an sich zu fragen, ob irgendein Trick der Ärzte dahintersteckte, um sie auf irgendeine perfide Art in eine Falle zu locken.
Die Pfleger gaben ihr Pulver mit dem Frühstück und dem Abendessen, um sie »zu beruhigen«, wie es hieß. Aber sie wusste, dass dieses Pulver es ihr noch in einem gewissen Maß erlaubten, Alice zu bleiben, zu denken und zu träumen und zu versuchen, sich an die verlorenen Teile ihres Lebens zu erinnern. Wenn sie sie zu einem Bad oder für einen Besuch aus ihrer Zelle holten, sah sie manchmal andere Patienten, Leute, die mit totem Blick reglos dastanden, während ihnen der Sabber übers Kinn lief, Leute, die noch am Leben waren, ohne davon zu wissen. Diese Leute waren »schwierig.« Sie bekamen Spritzen statt Pulver. Alice wollte keine Spritzen, also versuchte sie, nichts zu sagen oder zu tun, was die Ärzte beunruhigen könnte. Ärzte, die versuchen könnten, sie mit Stimmen aus der Wand hereinzulegen.
»Ich weiß, was du denkst, weil ich das auch denken würde, wenn ich du wäre«, sagte die Stimme. »Immerhin sind wir hier im Irrenhaus, stimmt’s? Also, komm jetzt rüber und guck durch das Mauseloch, dann siehst du’s.«
Vorsichtig stand sie auf, immer noch unsicher, ob sie nicht auf einen Streich hereinfiel, den ihr entweder ihr eigener Verstand oder die Ärzte spielten. Sie huschte unter dem Fenster entlang und kniete sich vor das Mauseloch.
»Jetzt seh ich nur deine Knie«, beschwerte sich die Stimme. »Komm doch mal ganz runter, ja?«
Alice legte sich auf den Bauch, wobei sie darauf achtete, den Kopf weit von der Öffnung entfernt zu halten. Nicht dass plötzlich eine Nadel durch das Loch geschossen kam und sich in ihr Auge bohrte.
Als ihre Wange auf dem Boden lag, konnte sie durch die winzige Öffnung sehen. Auf der anderen Seite waren ein eisengraues Auge und der Teil einer Nase. Genau da, wo die Nase aus dem Blickfeld verschwand, war ein Knick, als sei sie mal gebrochen gewesen. Sie sah nicht nach einem der Ärzte aus, die sie kannte, aber Alice ging kein Risiko ein. »Lass mich dein ganzes Gesicht sehen«, sagte sie.
»Gut«, antwortete das graue Auge. »Du denkst. Das ist gut. Also mehr als nur ein hübsches Gesicht.«
Unwillkürlich fuhr ihre Hand nach oben, um die Narbe zu verdecken. Dann fiel ihr ein, dass sie auf dieser Seite ihres Gesichts lag und er sie sowieso nicht richtig sehen konnte. Sollte er doch denken, dass sie hübsch war, wenn er unbedingt wollte. Wäre doch schön, zur Abwechslung mal wieder hübsch für jemanden zu sein, auch wenn ihr blondes Haar ganz verfilzt war und sie außer ihrem wollenen Kittel nichts zum Anziehen hatte. Sie hörte Wolle auf einer Matratze entlangstreichen, als das graue Auge sich von dem Mauseloch entfernte und zu zwei grauen Augen wurde, einer langen, früher mal gebrochenen Nase und einem buschigen schwarzen Bart mit grauen Flecken darin.
»So besser?«, fragte die Stimme. »Ich bin Hatcher.«
Und so hatten sie sich kennengelernt. Hatcher war zehn Jahre älter als Alice und bekam nie Besuch.
»Warum bist du hier?«, fragte sie ihn eines Tages, lange nachdem sie Freunde geworden waren oder zumindest Freunde, die sich nie wirklich sahen.
»Ich habe ein ganze Menge Leute mit einer Axt umgebracht«, sagte er.
»Wie hast du denn vorher geheißen?«, fragte Alice. Überraschenderweise verstörte es sie überhaupt nicht zu erfahren, dass ihr neuer Freund ein Axtmörder war. Es schien nichts damit zu tun zu haben, was er jetzt war, eine raue Stimme und graue Augen durch ein Loch in der Wand.
»Das weiß ich nicht mehr«, sagte er. »Ich erinnere mich an überhaupt nichts von davor, um ehrlich zu sein. Sie haben mich mit einer blutigen Axt in der Hand gefunden, und fünf Leute lagen tot um mich herum, alle in Stücke gehackt. Ich hab versucht, dasselbe mit der Polizei zu machen, als sie mich holen wollten, also muss ich diese Leute wohl umgebracht haben.«
»Warum hast du das denn getan?«
»Weiß ich nicht mehr«, sagte er, und seine Stimme veränderte sich ein wenig, wurde härter. »Es ist, als wäre da ein Nebel vor meinen Augen, schwarzer Rauch, der alles ausfüllt. Ich erinnere mich an das Gewicht der Axt in meiner Hand und an das heiße Blut auf meinem Gesicht und in meinem Mund. Ich erinnere mich an das Geräusch der Axt in weichem Fleisch.«
»Daran erinnere ich mich auch«, sagte Alice, ohne zu wissen, warum sie das sagte. Einen Augenblick lang war es wahr gewesen. Sie konnte hören, wie ein Messer durch Haut drang, dieses gleitende, schneidende Geräusch, und jemand schrie.
»Hast du auch eine Menge Leute umgebracht?«, fragte Hatcher.
»Weiß ich nicht«, antwortete Alice. »Könnte sein.«
»Ist in Ordnung, falls du’s gemacht hast«, sagte Hatcher. »Ich würd’s verstehen.«
»Ich weiß es wirklich nicht«, sagte Alice. »Ich erinnere mich an davor, und ich erinnere mich an danach, aber die zwei Wochen dazwischen sind weg, abgesehen von ein paar Schlaglichtern.«
»Der Mann mit den langen Ohren.«
»Ja«, sagte Alice. Der Mann, der sie gejagt hatte, gesichtslos, durch ihre Albträume.
»Wenn wir rauskommen, finden wir ihn, und dann wirst du erfahren, was mit dir passiert ist«, sagte Hatcher.
Das war vor acht Jahren gewesen, und sie waren beide immer noch hier, in nebeneinanderliegenden Zellen in einem Irrenhaus, das keinerlei Anstalten machte, sie jemals freizulassen.
»Alice?«, fragte Hatcher wieder. »Ich kann nicht schlafen.«
Sie blinzelte die Erinnerung fort, die der Mond und seine Stimme heraufbeschworen hatten.
»Ich kann auch nicht schlafen, Hatch«, sagte sie und kroch über den Boden zum Mauseloch. Hier unten war es viel dunkler. Kein Licht drang in ihre Zellen, abgesehen vom silbernen Mondlicht durch die Gitterstäbe und hin und wieder dem Schein einer Lampe des wachhabenden Pflegers, der die Gänge abschritt. Sie konnte die Farbe seines Auges nicht erkennen, nur den feuchten Glanz.
»Der Jabberwock ist aufgewacht, Alice«, sagte Hatcher.
Da fiel ihr auf, wie dünn und verzagt seine Stimme klang. Hatcher hatte nicht oft Angst. Meistens wirkte er stark, beinahe erbarmungslos stark. Den ganzen Tag hatte sie ihn nebenan vor Anstrengung stöhnen hören, während er seine Kraftübungen machte. Wenn die Pfleger kamen, um Hatcher zum Baden abzuholen, wurde es immer ziemlich laut, es wurde geschlagen und getreten und herumgeschrien. Mehr als einmal hatte Alice das Knirschen eines brechenden Knochens und den wütenden Fluch eines Pflegers gehört.
Einmal hatte sie ihn gefragt, wieso er keine Spritzen bekam wie die anderen Störenfriede. Er hatte nur gegrinst, Fältchen hatten sich rund um seine Augen gebildet, und er hatte gesagt, dass die Spritzen ihn wild gemacht hätten, wilder als sowieso schon, weshalb sie ihn damit in Ruhe ließen. Er bekam nicht mal Pulver in sein Essen.
Hatcher hatte nie Angst, außer wenn er vom Jabberwock redete.
»Es gibt keinen Jabberwock, Hatcher«, sagte Alice mit leiser und beruhigender Stimme. Sie kannte die Geschichten über das Ungeheuer, hatte sie schon gehört. Nicht oft, auch wenn er in letzter Zeit häufiger daran zu denken schien.
»Ich weiß, du glaubst nicht an ihn. Aber er ist hier, Alice. Sie halten ihn unten gefangen, im Keller. Und wenn er aufwacht, kann ich ihn spüren«, sagte Hatcher.
In der Angst schwang etwas Flehendes mit, und Alice gab nach. Immerhin glaubte sie an einen Mann mit Kaninchenohren, und Hatcher akzeptierte das fraglos.
»Was kannst du spüren?«, fragte sie.
»Ich spüre, wie die Nacht überall hochkriecht und den Mond auslöscht. Ich spüre Blut, das an den Wänden herunterrinnt, Ströme aus Blut in den Straßen unten. Und ich spüre, wie sich seine Zähne um mich herum schließen. Das wird er tun, Alice, wenn er jemals rauskommt. Er ist schon lange hier eingesperrt, viel länger als du oder ich.«
»Wie sollte denn irgendwer ein solches Ungeheuer einsperren können?«, überlegte Alice laut.
Hatcher rutschte unruhig auf dem Fußboden herum. Sie konnte hören, wie er sich wand. »Ich weiß es nicht genau«, sagte er, und seine Stimme klang leiser, sodass sie sich anstrengen musste, um ihn zu hören. »Es muss wohl ein Zauberer gewesen sein.«
»Ein Zauberer?«, fragte Alice. Das war sogar für Hatcher weit hergeholt. »Es gibt keine Zauberer mehr, sie sind alle weg. Entweder verjagt oder getötet, vor Jahrhunderten schon, während der Großen Reinigung. So alt ist dieses Gebäude hier nicht. Wie sollte ein Zauberer den Jabberwock gefangen und hier eingesperrt haben?«
»Nur ein Zauberer wäre dazu fähig«, beharrte Hatcher. »Kein normaler Mensch würde eine Begegnung mit dem Jabberwock überleben.«
Mit der Geschichte vom Monster im Keller wollte Alice gern mitgehen, aber seine Einbildungen von Zauberern konnte sie wirklich nicht bestärken. Allerdings erschien es ihr auch nicht ratsam, ihm zu widersprechen. Hatcher nahm keine Pulver und bekam keine Spritzen und konnte sich ziemlich doll aufregen. Wenn er sich aufregte, heulte er manchmal stundenlang oder schlug mit den Fäusten gegen die Wand, bis sie blutig waren, trotz der Polsterung.
Also sagte sie nichts, sondern lauschte nur seinem flachen Atem und den Schreien der anderen Insassen, die durch das Gebäude hallten.
»Ich wünschte, ich könnte deine Hand halten«, sagte Hatcher. »Ich habe dich noch nie ganz gesehen, weißt du. Immer nur Teile durch das Loch. Ich versuche, alle die Teile in meinem Kopf zusammenzusetzen, damit ich dich ganz sehen kann, aber es will nicht so recht passen.«
»Du bist in meinem Kopf auch nur graue Augen und ein Bart«, sagte Alice.
Hatcher lachte leise, aber es klang keine Freude darin. »Wie das Kaninchen, nur Augen und Fell. Was wäre gewesen, wenn wir uns auf der Straße begegnet wären, Alice? Hätten wir uns gegrüßt?«
Sie zögerte. Sie wollte ihn nicht verletzen, aber sie wollte auch nicht lügen. Ihre Eltern logen. Sie sagten Sachen wie »Gut siehst du aus« und »Bestimmt kannst du bald nach Hause kommen«. Alice wusste, dass es nicht die Wahrheit war.
»Alice?«, fragte Hatcher wieder und holte sie zu ihm zurück.
»Ich weiß nicht, ob wir uns gegrüßt hätten«, sagte sie vorsichtig. »Ich habe in der Neuen Stadt gewohnt, und ich glaube … Du machst mehr den Eindruck, als kämst du aus der Alten Stadt.«
»Vornehm, vornehm«, sagte Hatcher, und seine Stimme klang hart. »Das edle Fräulein würde sich ihr Kleidchen nicht in der Alten Stadt schmutzig machen. Nur dass du das getan hast. Und zwar gründlich, und auch mehr als nur das Kleidchen. Und jetzt bist du hier, genau wie ich.«
Seine Worte fühlten sich an wie geballte Fäuste, die ihr in den Magen schlugen, und einen Moment lang schienen sie ihr den Atem aus der Lunge zu treiben. Aber sie waren wahr, und sie würde nicht so tun, als sei es anders. Die Wahrheit war alles, was ihr noch geblieben war. Die Wahrheit und Hatcher.
»Ja«, sagte sie. »Wir sind beide hier.«
Danach schwiegen sie lange. Alice wartete in der Dunkelheit, während das Mondlicht über den Boden wanderte. Hatcher schien heute Abend auf Messers Schneide zu balancieren, und sie würde nicht diejenige sein, die ihn in den Abgrund stieß.
»Es tut mir leid, Alice«, sagte er schließlich und klang schon mehr nach dem Hatcher, den sie kannte.
»Lass …«, fing sie an, doch er fiel ihr ins Wort.
»Nein, ich sollte so etwas nicht sagen. Du bist mein einziger Lichtblick, Alice. Ohne dich hätte ich mich längst dem allen hier ergeben. Aber der Jabberwock ist wach und lässt mich an Dinge denken, an die ich nicht denken sollte.«
»Das Geräusch eines Beils, das in Fleisch dringt«, sagte sie.
»Und warmes Blut auf meinen Händen«, ergänzte Hatcher. »Ich fühle mich beinahe wie ich selbst, wenn ich so was denke. Als wäre es das, was ich wirklich bin.«
»Immerhin hast du eine Ahnung davon«, sagte Alice. »Ich hatte nie die Chance zu werden, wer ich wirklich bin. Ich hab mich schon vorher verlaufen.«
Sie hörte, wie er wieder auf dem Boden herumrutschte.
»Das fühlt sich an, als hätte ich Käfer unter der Haut«, sagte er. »Sing mir was vor.«
»Ich kenne keine Lieder«, sagte sie überrascht.
»Klar kennst du welche«, sagte er. »Du singst den ganzen Tag, und wenn du nicht singst, dann summst du vor dich hin. Irgendwas über einen Schmetterling.«
»Einen Schmetterling?«, fragte sie, aber sobald sie es ausgesprochen hatte, fiel es ihr wieder ein, und sie hörte die Stimme ihrer Mutter. Es schmerzte, tat so weh, dass es ihr einen Stich ins Herz versetzte, diese Erinnerung an eine Liebe, die für sie auf immer verloren war. Sie begann laut zu singen, um die Erinnerung mit ihrer eigenen Stimme zu überdecken.
Schlaf, kleiner Schmetterling, schlaf
Schlaf, kleiner Schmetterling, schlaf
Nun wo der Tag vergangen ist
Schlaf, kleiner Schmetterling, schlaf
Bis bald der Morgen kommen wird.
Schließ nun die kleinen Äugelein
Und lass die Nacht um dich herein
So wirst du warm und sicher sein
Schlaf, kleiner Schmetterling, schlaf
Bis bald der Morgen kommen wird.
Ihre Stimme verklang, Liebe und Verlust und Schmerz schnürten ihr die Kehle zu. Hatcher sagte nichts, aber sie hörte, wie sein Atem tiefer und gleichmäßiger wurde, und so ließ sie selbst die Augen zufallen. Sie passte ihren Atem seinem Rhythmus an, und es war fast, als hielte sie seine Hand, während die Nacht sie beide einhüllte.
Alice träumte von Blut. Blut auf ihren Händen und unter ihren Füßen, Blut in ihrem Mund und Blut, das aus ihren Augen strömte. Der ganze Raum war voll damit. Vor der Tür stand Hatcher Hand in Hand mit etwas Dunklem und Abscheulichem, einem Ding aus Schatten mit silbern blitzenden Zähnen.
»Nimm ihn mir nicht weg«, sagte sie, oder besser, versuchte sie zu sagen, denn sie konnte nicht sprechen durch das ganze Blut in ihrem Mund, das sie erstickte. Dann verschleierte Rauch ihren Blick, und sie konnte weder Hatcher noch das Ungeheuer mehr erkennen. Hitze umhüllte ihren Körper, und dann war da nichts mehr außer Feuer.
Feuer. Feuer.
»Alice, wach auf! Es brennt!«
Alice öffnete die Augen. Hatchers graues Auge war an das Mauseloch gepresst, und es blickte wild vor Angst und Erwartung.
»Endlich!«, rief er. »Bleib am Boden, weg vom Rauch, und kriech zur Tür, aber nicht direkt davor.«
Alice blinzelte, als er verschwand. Der Traum hing noch in ihrem Gehirn, und ihr Mund war ganz trocken. Ihr Kittel klebte an ihrem Körper, und ihr Gesicht war schweißnass. Als der Rauchgeruch endlich durch ihre Nase in ihren benebelten Kopf drang, brachte er noch einen anderen Geruch mit sich, den Geruch von bratendem Fleisch. Sie wollte nicht darüber nachdenken, woher der kam.
Alice drehte sich um, sodass sie flach auf dem Rücken lag, und sah wenige Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt eine dichte Rauchdecke hängen. Der Boden unter ihr war so heiß, dass es wehtat, darauf zu liegen, aber es gab keine Möglichkeit, diesem quälenden Schmerz zu entkommen.
Dann drangen Geräusche zu ihr durch. Das Knistern der Flammen, schwere Gegenstände, die krachend zusammenbrachen. Schreckliche, schreckliche Schreie. Und ganz in der Nähe rhythmisches Stöhnen und Grunzen, als würde sich jemand mit dem ganzen Körper gegen die Wand werfen. Hatch versuchte, die Tür zu seiner Zelle aufzubrechen.
Es hörte sich furchtbar an. Alice glaubte nicht, dass er es schaffen konnte. Die Wände mochten weich gepolstert sein, aber die Türen waren aus Eisen. Er würde sich umbringen.
»Hatcher, nein!«, schrie sie, doch er konnte sie nicht hören.
Dann knirschte etwas, aber Hatcher schrie nicht auf, und dann wurde es noch lauter.
»Hatcher«, sagte sie, und ihre Stimme klang sanft und traurig. Aus jedem ihrer Augenwinkel quoll eine Träne. Es hatte keinen Sinn mehr, aufstehen zu wollen – Hatcher war tot. Der Rauch und der schreckliche Lärm verrieten Alice, dass draußen das Feuer wütete. Die Pfleger und die Ärzte würden sich nicht damit aufhalten, die Patienten zu befreien, ganz besonders nicht, wenn die meisten Familien froh darüber wären, ihre verrückten Verwandten, diese Bürde, endlich los zu sein. Und so würden sie alle hier verbrennen.
Alice merkte, dass es sie nicht so berührte, wie es sollte. Vielleicht war es das Pulver im Abendessen oder der Rauch, der allmählich ihre Lunge füllte. Sie fühlte sich sehr ruhig. Sie würde einfach hier liegen bleiben und auf das Feuer warten.
Ihre Augen schlossen sich wieder, und dann trieb sie davon, weit weg zu einem Ort, an dem sie in Wirklichkeit noch nie gewesen war, einem silbernen See in einem grünen Tal mit Wildblumenwiesen an den Ufern. Dort roch es nicht nach Medizin oder der brennenden Seife. Da waren kein Rauch und kein Schmerz, kein Kummer und kein Blut. Es war die Zuflucht, die sie immer aufsuchte, der Ort, an dem sie sich versteckte, wenn die Ärzte ihr Fragen stellten, die sie nicht beantworten wollte, oder ihre Eltern vor Enttäuschung seufzten.
Etwas packte sie an den Schultern, und sie riss entsetzt die Augen auf. Es war Jahre her, seit jemand sie berührt hatte, außer um sie ins Bad zu zerren. Hatchers Gesicht war dicht über ihrem, verzerrt vor Zorn, Blut rann aus einer Schnittwunde an seiner Schläfe.
»Ich hab dir gesagt, du sollst zur Tür gehen, du Dummkopf«, sagte er und zerrte ihren Oberkörper hoch, um sie herumzudrehen und mit dem Bauch nach unten auf den Boden zu stoßen.
»Folge mir«, sagte er und kroch zur Tür.
Zur offenen Tür.
Ohne nachzudenken, kroch sie ihm hinterher, den Blick starr auf seine schmutzigen Fersen gerichtet. Sie wollte ihn fragen, wie er herausgekommen war, wieso er sich nicht den Kopf eingeschlagen hatte und tot war. Aber er bewegte sich mit überraschender Schnelligkeit in den Korridor hinaus, bevor er kurz wartete, damit sie zu ihm aufschließen konnte. Sie waren allein mit dem verzweifelten Hämmern der anderen Patienten, die in ihren Zellen eingesperrt waren.
Erst da fiel ihr auf, dass sein rechter Arm seltsam verdreht an seinem Körper baumelte und er nur den linken benutzte, um sich voranzuziehen. »Hatch, was ist passiert?«, fragte sie, schon von dieser kleinen Anstrengung atemlos.
»Er ist ausgekugelt, als ich den Türrahmen rausgebrochen hab«, sagte er. »Ich kümmere mich später darum. Jetzt müssen wir hier weg. Der Boden wird immer heißer, und er ist bald draußen.«
»Wer?«, fragte Alice.
Er kroch wieder los. »Der Jabberwock.«
»Hatch«, sagte sie und versuchte, mit ihm mitzuhalten. Ihre Lunge und ihre Kehle brannten. »Wir gehen in die falsche Richtung. Die Treppe ist hinter uns.«
»Das Treppenhaus steht in Flammen«, sagte Hatch. »Wir müssen hier lang.«
»Aber Hatch«, sagte Alice und schüttelte den Kopf, um ihn klar zu bekommen. Der Rauch machte sie benommen. »Wir sind im dritten Stockwerk.«
»Wir gehen hinten zum Fluss raus. Komm einfach mit, Alice.«
»Zum Fluss?«, fragte sie, und in ihrem Kopf meldete sich leise Besorgnis. Irgendetwas war mit dem Fluss, aber sie konnte sich nicht wirklich erinnern, was es war.
Sie kamen an der Zelle eines Patienten vorbei, der sich immer wieder schreiend gegen die eiserne Tür warf. Die Rauchwolke über ihren Köpfen verhüllte das kleine Fenster, sodass Alice sich ziemlich sicher war, dass der Mann sie nicht entkommen sehen konnte. Trotzdem fühlte sie sich schuldig, weil sie nicht anhielten.
»Was ist mit den anderen?«, fragte Alice. »Sollten wir sie nicht rauslassen?«
»Die Zeit reicht nicht«, sagte Hatcher. »Sie würden uns nur aufhalten. Sie können nicht selbstständig denken. Wir müssten sie wie Kinder hier herausführen. Und was dann? Würden wir sie mitnehmen? Nein, Alice, es ist am besten, sie hierzulassen. Wir müssen hier weg, bevor er freikommt.«
Es war kaltherzig, aber es stimmte. Nicht das über den Jabberwock, der freikommen würde, sondern das andere. Sie und Hatcher würden die anderen nicht sicher in die Freiheit führen können, ohne ihr eigenes Leben zu riskieren.
Hatcher erreichte das Ende des Korridors vor Alice. Er schob sich auf die Knie, und sie sah, dass er einen kleinen Schlüsselbund in der linken Hand hielt.
»Woher hast du den denn?«, fragte sie.
»Von dem Pfleger oben an der Treppe. Was glaubst du denn, wie ich deine Tür aufgekriegt habe?«, gab er zurück, während er den ersten Schlüssel ins Schloss steckte und dann systematisch einen nach dem anderen ausprobierte.
»Da war niemand im Korridor, als wir rauskamen«, sagte sie.
»Ich hab ihm die Schlüssel abgenommen und ihn die Treppe runtergeworfen. Daher wusste ich, dass das Treppenhaus in Flammen steht.«
Der fünfte Schlüssel passte, Hatcher stieß die Tür auf und winkte sie in den Raum hinein.
Eine Rauchwolke folgte ihnen, bevor Hatcher die Tür wieder zuwerfen konnte, aber sie löste sich rasch auf, weil auf der gegenüberliegenden Seite ein Fenster offen stand. Die schwere, brodelnde Luft der Stadt, schwerlich frisch zu nennen, quoll herein. Und dennoch, es war Jahre her, seit Alice irgendetwas anderes gerochen hatte als den widerlichen Gestank des Irrenhauses – ungewaschene Körper, Laudanum, Chloroform, Erbrochenes und Blut und über alledem brennende Seife. Im Vergleich dazu wirkte die nach Ruß und Abfall stinkende Luft der Stadt, die von draußen hereinkam, wie eine frische Brise Landluft.
Plötzlich tauchte draußen vor dem Fenster ein Kopf auf. Es war einer der Pfleger, ein rothaariger Mann mit nur noch einer halben Nase. Er riss die Augen auf, als er Hatcher und Alice erblickte, und machte Anstalten hereinzuklettern.
Bevor der Mann mehr tun konnte, als ein Bein über das Fensterbrett zu schwingen, war Hatcher über ihm. Er schlug den Mann mit der Linken hart ins Gesicht, zwei Mal, drei Mal. Dann versetzte er ihm einen so heftigen Tritt in die Seite, dass Alice Rippen brechen hörte. Und dann stieß er den inzwischen bewusstlosen Pfleger aus dem Fenster und blickte ihm nach, während er nach unten in den Fluss stürzte.
Er nickte zufrieden, bevor er sich zu Alice umdrehte. »Ich war es, der ihm die halbe Nase abgebissen hat. Er wollte verhindern, dass wir rauskommen – verstehst du? Er hätte uns niemals gehen lassen.«
Kapitel2
Alice nickte. Sie verstand. Der Rauch musste ihr das Hirn vernebelt haben, denn an den Rändern sah alles irgendwie weich aus.
»Hier draußen ist ein Sims«, sagte Hatcher.
Er trat an die Wand neben dem Fenster, packte sein rechtes Handgelenk mit der linken Hand, drückte seinen herunterbaumelnden Arm gegen die Wand und vollzog eine Drehung, während Alice zusah. Als er sich wieder zu ihr umdrehte, sah sein Arm wieder normal aus. Er streckte die Finger, als wollte er ausprobieren, ob sie noch funktionierten. Während des gesamten Manövers hatte er keinen Laut von sich gegeben, sich nichts anmerken lassen, auch wenn Alice sicher war, dass es sehr schmerzhaft gewesen sein musste. Er streckte die Hand aus, damit sie zu ihm ans Fenster kam.
Sie trat zu ihm und holte erschreckt Luft, als sich seine Hand um ihre schloss. Es fühlte sich an, als liefe ein elektrischer Strom von ihren verbundenen Händen direkt in ihr Herz, das in ihrer Brust hämmerte. Seine grauen Augen funkelten, und er drückte einen Moment lang ihre Hand etwas fester. Wenn man im Irrenhaus ist, fasst einen keiner jemals freundlich an, und Alice wusste, dass auch für ihn der Schock groß war.
Er sagte nichts, als er ihre Hand wieder losließ. Er kletterte aus dem Fenster und stellte sich auf das Sims, und Alice folgte ihm, weil es das war, was sie tun sollte.
Sie schwang das linke Bein durch das Fenster. Ihr Kittel rutschte hoch und gab ihre Haut der Morgenkälte preis, und sie schauderte. Wahrscheinlich war es gar nicht so furchtbar kalt, aber nach der Gluthitze des brennenden Krankenhauses fühlte sich die Luft im Freien eiskalt an.
Alice duckte sich mit dem Kopf durch die Fensteröffnung und sah das Sims, auf das sie sich stellen sollte. Unten, sehr viel weiter unten, als es angenehm war, wälzte sich der Fluss in seinem Bett, grau und faulig. Jetzt, da sie ihn erblickte, fiel ihr wieder ein, was sie vergessen hatte.
Hatcher schob sich hinter sie, seine Hände legten sich um ihre Taille und geleiteten sie nach draußen, bis sie mit den Rücken an die Backsteinwand des Krankenhauses gedrückt nebeneinander standen. Das Sims war gerade breit genug, damit Alice’ Füße Platz darauf fanden. Hatchers Zehen krümmten sich um die Kante, als könnte ihr Griff verhindern, dass er abstürzte.
Seine Miene war grimmig und wild. »Wir sind draußen, Alice«, sagte er jubelnd. »Wir sinddraußen!«
»Ja«, antwortete sie, und ihre Freude angesichts dieser Tatsache wurde schwer gedämpft durch den Anblick des Flusses. Jetzt, da sie aus dem Rauch heraus war, konnte sie klarer denken, und dieser Plan erschien ihr mit einem Mal sehr viel riskanter, als durch ein brennendes Treppenhaus zu rennen. Dann erreichte der Gestank des Wassers sie, und sie würgte.
Hatcher packte ihre Hand, damit sie nicht nach vorn in die leere Luft taumelte. »Wir springen in den Fluss«, sagte er, »und schwimmen ans gegenüberliegende Ufer. Danach können wir in der Alten Stadt untertauchen. Da wird niemand nach uns suchen. Sie werden denken, wir wären tot.«
»Ja«, sagte sie wieder. »Aber wir dürfen nicht in den Fluss. Er wird uns umbringen. Die ganzen Fabriken leiten ihre Abwässer hinein. Ich weiß noch, dass Vater mir davon erzählt hat. Er hat gesagt, es sei ein Skandal.«
»Aber hier können wir auch nicht bleiben«, erwiderte Hatcher. »Wenn uns das Feuer nicht auffrisst, dann fangen sie uns in ihren Netzen und stecken uns zurück in unsere Käfige. Ich kann nicht zurück, Alice. Ich kann nicht den Rest meines Lebens als Motte verbringen, die mit den Flügeln gegen ein Glas schlägt. Lieber würde ich im Maul des Jabberwock krepieren als das.«
Alice erkannte die Wahrheit in seinen Worten und spürte sie in ihrem Herzen. Sie wollte auch nicht wieder zurück in die Zelle, die sie für sie gemacht hatten. Aber der Fluss war so weit unten und schäumte giftig. Was, wenn er ihnen die Haut vom Körper ätzte? Was, wenn sie das Flusswasser schluckten und unter Krämpfen am Ufer starben, während das Gift in ihrem Blut wütete?
Während ihr diese Gedanken kamen, explodierte in der Nähe ein Fenster, und eine Stichflamme schoss daraus hervor. Ein Schwarm rußgeschwärzter Tauben flog auf, die so dumm gewesen waren, auf demselben Sims Zuflucht zu suchen, auf dem Alice und Hatcher balancierten. Während sich die Vögel unter lautstarkem Protest in die Luft erhoben, blickte Alice Hatcher an und wusste, dass er die Angst in ihren Augen sehen konnte.
»Jetzt müssen wir fliegen«, sagte er. »Vertrau mir.«
Sie tat es. Sie hatte es von Anfang an getan, auch wenn sie nicht wusste, warum. Er drückte ihre Hand, und dann fiel Alice, fiel hinab, tief hinab in ein Kaninchenloch.
»Lass nicht los«, brüllte Hatcher, kurz bevor sie auf dem Wasser aufkamen.
Seine Hand drückte ihre Finger so fest, dass es wehtat. Sie schrie auf, aber er ließ nicht los. Was sehr gut war, denn sobald die schreckliche Brühe über ihrem Kopf zusammenschlug, ließ sie unwillkürlich los, und wenn Hatcher ihre Hand nicht so fest gehalten hätte, wäre sie ertrunken.
Hustend und würgend riss er sie an die Oberfläche zurück, schlang einen Arm unter ihre Rippen und begann, auf das Ufer zuzupaddeln. »Schlag mit den Füßen.«
Sie wedelte kraftlos mit den Knöcheln im Wasser. Es fühlte sich seltsam zäh an, keine Spur von jener Glätte und Schlüpfrigkeit, die Wasser eigentlich haben sollte. Träge schwappte es dahin, die Strömung so schwach, dass sie es kaum schaffte, sie ein paar Zentimeter vom Kurs abzubringen. Giftige Dämpfe stiegen von der Oberfläche auf, die ihre Augen tränen und ihre Nase brennen ließen.
Aufgrund der Art, wie Hatcher sie gepackt hatte, konnte sie weder sein Gesicht sehen noch das Ufer, das sie erreichen wollten. Sein Atem ging ruhig und gleichmäßig, als würde ihn der Gestank, der von der Wasseroberfläche aufstieg, gar nicht berühren. Mit kräftigen, sicheren Bewegungen zog er sie beide voran, während Alice irgendwie mitdümpelte und versuchte, sie nicht beide zum Kentern zu bringen.
Hinter ihnen sah sie das brennende Irrenhaus, sah Flammen aus den geborstenen Fenstern schlagen. Das Brüllen des Feuers übertönte die Schreie der Insassen. Rundherum liefen Leute und versuchten zu verhindern, dass sich der Brand auf die umliegenden Gebäude ausbreitete. Bis jetzt hatte sie noch nie über die Umgebung des Krankenhauses nachgedacht.
Auf einer Seite duckte sich ein lang gestrecktes, niedriges Gebäude wie eine Schildkröte ans Flussufer. Das musste die Seite sein, auf der Alice’ Zelle gewesen war, andernfalls hätte sie den Mond nicht sehen können. Das Gebäude auf der anderen Seite war riesig, überragte das Krankenhaus deutlich, und der Rauch, der aus seinen Schornsteinen quoll, schien genauso dick und gefährlich zu sein wie der, der aus ihrem ehemaligen Zuhause drang.
»Nimm die Füße nach unten«, sagte Hatcher plötzlich, und Alice erkannte, dass er jetzt watete, statt zu schwimmen.
Ihre Zehen sanken im weichen Schlamm ein, und das Wasser reichte ihr immer noch bis zum Hals, aber sie hatten es fast geschafft. Etwas weiter flussabwärts drängte sich ein Grüppchen Menschen an einem Anlegesteg, sie riefen sich etwas zu und zeigten zu dem zusammenfallenden Irrenhaus hinüber.
»Ich sehe sie«, sagte Hatcher leise. »Komm hier rüber.«
Er führte sie zu einer Stelle, die trotz der aufgehenden Sonne tief im Schatten lag, abseits der flackernden Gaslaternen, die in regelmäßigen Abständen am Ufer standen, um den Dunst, der vom Fluss und von den Fabriken aufstieg, zu erhellen. Alice fiel auf Hände und Knie, kaum dass sie aus dem Wasser war, und rang keuchend nach Luft. Sogar so wenige Meter vom Fluss entfernt war die Luft merklich sauberer, auch wenn wohl kaum jemand auf die Idee kommen würde, sie »sauber« zu nennen.
Überall war der faulige Geruch des Wassers, der beißende Geruch des Rauchs und der Flammen, der ätzende Gestank der Abgase aus den Schloten der Fabriken und darunter die morgendlichen Kochgerüche aus den Behausungen direkt vor ihnen.
Hatcher hatte sehr viel mehr als Alice dazu beigetragen, sie aus dem brennenden Krankenhaus heraus und durch den widerlichen Fluss zu bringen, und doch war er nicht erschöpft zusammengebrochen wie sie, kaum dass sie aus dem Wasser heraus waren. Er stand neben ihr, ruhig und still.
Alice drehte sich um, setzte sich auf und sah zu ihm hoch. Gebannt starrte er übers Wasser hinweg auf das lodernde Gebäude am anderen Ufer. Er stand so reglos da, dass sie anfing, sich Sorgen zu machen, und sich aufrappelte.
»Hatcher?«, fragte sie und berührte ihn am Arm.
Sein Haar und seine Kleidung dampften, und er war bedeckt von dem Schmutz, den sie gerade durchschwommen hatten. Seine grauen Augen glühten, weil sich das Feuer darin spiegelte wie höllische Kohlen, und als er diese Augen auf sie richtete, bekam sie zum ersten Mal ein bisschen Angst vor ihm. Das war nicht Hatch, ihr verlässlicher Gefährte durch das Mauseloch. Und auch nicht der Mann, der sie klug und überlegt aus einem brennenden Gebäude gerettet hatte. Das hier war Hatcher, der Axtmörder, der Mann, der blutüberströmt und inmitten von Leichen aufgefunden worden war.
Aber er würde dir niemals wehtun,sprach sich Alice Mut zu.Er ist immer noch Hatch, irgendwo da drin. Er hat sich nur mal kurz verloren.
Sie legte die Hand auf seine Schulter, zaghaft, und sagte noch einmal seinen Namen, doch er starrte sie nur an, schien sie nicht zu sehen. Dann packten seine Hände plötzlich ihre Handgelenke, und seine eisengrauen Augen blickten wild.
»Er ist raus, er ist raus«, verfiel er in einen heulenden Singsang. »Jetzt wird die Welt zerbrechen und verbrennen und verbluten … Alle werden bluten.«
»Der Jabberwock?«, fragte Alice.
»Sein Maul wird er weit aufreißen, und wir werden alle hineinfallen, hineinfallen und verschlungen werden!«, heulte Hatcher. »Wir müssen weg, weg, bevor er mich findet! Er weiß, dass ich ihn hören kann. Er weiß, dass ich weiß, was er Böses tun wird.«
Mit ohrenbetäubendem Lärm brach am gegenüberliegenden Flussufer das Krankenhaus in sich zusammen. Alice und Hatcher drehten sich um und beobachteten, wie die Wände einstürzten wie bei einer schmelzenden Sandburg. Sie schienen nur noch aus Feuer zu bestehen, und Feuer schoss unvorstellbar hoch in den Himmel hinauf, weit über den Punkt hinaus, an dem es noch irgendetwas zu verbrennen gegeben hätte. Es füllte den gesamten Himmel aus wie die ausgebreiteten Schwingen eines Drachen.
Und hinter den Flammen war eine Dunkelheit, ein gigantischer Schatten, der sich ausbreitete, als sei etwas Gefangenes befreit worden, das nun seine Arme nach der Sonne ausstreckte.
»Ist das … ist er das?«, fragte Alice. Sie hatte nie an den Jabberwock geglaubt, nicht wirklich. Und vielleicht war da drüben auch gar kein Schatten. Sie war erschöpft und hatte Rauch und giftige Dämpfe eingeatmet. Vielleicht redete ihr Hirn ihr nur ein, dass da ein Schatten war, wo sich in Wirklichkeit gar nichts befand. Das war das Problem, wenn man nicht ganz richtig im Kopf war. Man wusste oft nicht, ob einem die eigenen Augen die Wahrheit sagten.
Hatcher antwortete nicht. Er starrte noch einen Moment lang auf den Flammenturm, dann packte er Alice’rechtes Handgelenk wieder und zerrte sie die Uferböschung hinauf. Der Schlamm zog schmatzend an ihren Füßen, sodass sie nur langsam vorankamen, aber irgendwann hatten sie es auf den schmalen gepflasterten Weg geschafft, der um und in das Gewirr aus schief aneinanderlehnenden und gefährlich aufeinandergetürmten Gebäuden hineinführte.
Die Alte Stadt schien keinen Anfang und kein Ende zu haben, ein spiralförmiges Labyrinth aus schmalen Gassen, Treppen und Leitern, die seit Jahrhunderten auf bröckelnden Ruinen errichtete, immer wieder angebaute und ausgebesserte Gebäude miteinander verbanden. Da war nichts Glänzendes oder Neues, nicht einmal in den Augen der Kinder, die bereits mit heimgesuchten Blicken auf die Welt zu kommen schienen.
Hatcher duckte sich in die nächste Gasse und zog Alice mit sich. Der raue Stein scheuerte ihre nackten Fußsohlen auf, aber sie verstand, dass sie so schnell wie möglich untertauchen mussten. Abgesehen von der Frage, ob der Jabberwock hinter ihnen her war oder nicht, hatte Alice auch das unverwechselbar glänzende Messing einer Polizeiuniform erspäht. Auch wenn das Irrenhaus jetzt nur noch ein Haufen Asche und Schlacke war, wenn man sie in ihrer Krankenhauskleidung erwischte, würde die Polizei sie wegschleppen. Und Alice ahnte, dass Hatcher sich nicht so einfach würde wegschleppen lassen.
Also huschten und tauchten sie zwischen Mädchen hindurch, die mit ihren Kunden an Hauswände gepresst standen, oder alten Männern, die sich um ein Hütchenspiel oder einen Hahnenkampf scharten. Hatcher führte sie immer tiefer in die Alte Stadt hinein, bis die aufgehende Sonne durch die engstehenden Häuser verdeckt wurde und die Luft mit dem Dunst aus den Fabriken gesättigt war. Dampf stieg vom Kopfsteinpflaster auf und verbarg die sich nähernden Gestalten, bis sie beinahe bei ihnen waren.
Und so kam es, dass die Männer sie umzingeln konnten.
Hatcher blieb kurz stehen, sah, dass Alice außer Atem war und Schmerzen hatte. Er tätschelte oder tröstete sie nicht, sondern wartete. In dem Augenblick, als sie stehen blieben, löste sich ein riesiger Oger aus den Schatten und schwang eine Keule in Hatchers Richtung. Alice machte den Mund auf, um zu schreien, doch bevor sie einen Laut herausbringen konnte, legte sich eine dreckige Hand darauf, und eine andere griff ihr an die Brust und kniff sie so fest, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen.
»Was haben wir denn hier?«, säuselte eine Stimme in ihr Ohr. »Ein kleines Lämmchen, das sich verlaufen hat?«
Sie trat um sich, versuchte sich seinem Griff zu entwinden, während Hatcher und der Oger – jetzt erkannte sie, dass es ein Mann war, aber der größte, den sie je gesehen hatte – im Nebel verschwanden. Ihre Mühe war vergeblich, ihr Gegner viel zu stark für sie, und so zerrte er sie mit sich.
Seine freie Hand wanderte von ihrer Brust zum Saum ihres Kittels, schob ihn bis zur Hüfte hoch, seine Finger betatschten ihre Oberschenkel, da drehte sie durch und biss in die Hand, die ihren Mund zuhielt, weil sie sich erinnerte – sich an einen Mann erinnerte, der über ihr war, in flackerndem Licht, der sich zwischen ihre Beine drängte, und es tat weh, sie schrie, weil es so wehtat, aber er machte weiter, bis sie blutete.
Der Mann, der sie jetzt festhielt, fluchte, als er ihre Zähne zu spüren bekam, ließ aber nicht locker. »Kleines Teufelchen«, knurrte er und schlug ihre Stirn gegen eine Backsteinmauer.
Sie war für einen Moment benommen und erschlaffte, während etwas Feuchtes und Klebriges über ihre Augen gezogen wurde. Dann lag sie am Boden auf dem Bauch, schürfte sich die nackten Oberschenkel am Pflaster auf, und seine Hände waren auf ihrem Po und drückten ihr die Beine auseinander.
Geh einfach weg,sagte sie sich.Du bist nicht hier. Du bist auf einer grünen Wiese in einem Tal, und die Sonne scheint vom Himmel, und sieh mal an, da kommt dir jemand lächelnd entgegen, jemand, der dich liebhat.
Dann waren die Hände plötzlich weg, und sie hörte das Geräusch von Fleisch, das auf Fleisch trifft. Sie rollte sich auf die Seite, den Kittel immer noch um die Taille gerafft, und wischte sich die Klebrigkeit aus den Augen.
Hatcher prügelte mit beiden Fäusten auf ihren Angreifer ein. Er hatte den Mann mit dem Rücken gegen eine Wand getrieben und schlug das Gesicht des Mannes systematisch zu Brei. Als Hatcher von ihm abließ, sackte der Mann schlaff zu Boden. Es sah nicht aus, als würde er noch atmen.
Keuchend drehte sich Hatcher zu Alice um. Er war über und über mit Blut bedeckt, Hände, Oberkörper und Gesicht waren blutbespritzt. Sein Blick wanderte von dem Schnitt an ihrer Schläfe zu ihrem nackten Unterkörper und verweilte dort einen Augenblick. Dann sagte er: »Zieh dich an«, und drehte sich weg, um die Taschen des Mannes zu durchsuchen.
Alice zog den Kittel wieder bis über die Knie und stützte sich an der Wand ab, um aufzustehen. Einen Moment lang lehnte sie dort, dann begann sie am ganzen Körper zu zittern. Als Hatcher sich wieder umdrehte, klapperten ihre Zähne. Er hielt einen kleinen Beutel in der Hand.
»Voller Gold«, sagte er und stieß den leblosen Körper mit dem Zeh an. »Wahrscheinlich ein Sklavenhändler. Er hätte dich benutzt und dann verkauft.«
»Ich g-g-glaube, ich b-b-bin schon mal verkauft worden«, sagte sie. Sie erinnerte sich an Geld, das von Hand zu Hand ging, an eine kleinere Hand, die von einer größeren mit Gold gefüllt wurde.
»Von dem Mann mit den langen Ohren oder an ihn?«, fragte Hatcher.
Sie schüttelte den Kopf. Es war nur ein kurzes Aufblitzen des Schreckens gewesen, eine Erinnerung, die man besser vergaß. Da war ein Mann gewesen, aber sie konnte sich nicht an sein Gesicht erinnern. Dann übernahm ihr Verstand wieder die Führung und brachte sie in Sicherheit.
Er blieb kurz vor ihr stehen, ein Wilder, bespritzt mit dem Blut ihres Angreifers, aber in seiner Miene lag etwas seltsam Verletzliches.
»Darf ich …?«, fragte er und deutete an, dass er ihr den Arm um die Schulter legen wollte.
Alles in ihr krampfte sich zusammen und schrieNein! Dann verging der Moment, und ihr fiel wieder ein, wie er auf ihre nackten Beine gestarrt, sich dann aber abgewandt hatte, statt wie ein hungriger Wolf über sie herzufallen. Sie nickte und sah Erleichterung in seinem Gesicht.
Sein Arm reichte um sie herum und zog sie kurz eng an seinen Körper, sodass sie seine gebündelte Kraft spüren konnte. Dann lockerte er seinen Griff gerade so, dass sie gehen konnte, ohne sie loszulassen. Sie kehrten zu der Stelle zurück, an der sie der Oger angegriffen hatte. Alice sah den Körper des sehr riesigen Mannes dort liegen. Er atmete noch flach durch das zerschlagene Fleisch, wo einst sein Mund gewesen war. Neben ihm lag der Knüppel, mit dem er Hatcher angegriffen hatte. Es war nur eine stabile Holzstange mit einem etwas verdickten Ende. Sie war in zwei Stücke zerbrochen.
»Wir müssen irgendwo rein«, sagte Hatcher.
»Weißt du, wohin?«, fragte Alice. »Kommt dir irgendwas hier bekannt vor?«
»Allerdings«, gestand er. »Auch wenn ich keine Ahnung habe, woher. Seit wir die Alte Stadt betreten haben, haben uns meine Füße irgendwohin geführt.«
»Wo es sicher ist?«, fragte sie. Die Kälte war ihr inzwischen in die Knochen gekrochen und ließ sie schon wieder zittern, trotz der Wärme, die von Hatchers Körper ausstrahlte, der sie noch immer dicht bei sich hielt. Sie war hungrig und müde und hatte mehr Angst, als sie wohl jemals im Leben gehabt hatte. Einen flüchtigen Augenblick lang sehnte sie sich nach der Berechenbarkeit des Krankenhauses, der Sicherheit, die vier solide Wände boten.
»Ich weiß nicht«, sagte er. »Es ist lange her, dass ich hier war. Manche Orte sehen noch genauso aus. Mehr, als man erwarten sollte. Und andere sehen ganz anders aus, auch wenn ich nicht genau sagen kann, warum.«
»Ich glaube nicht, dass du so viel von deiner Erinnerung verloren hast, wie du meinst«, sagte Alice. »Du erinnerst dich an Sachen wie das Zeitalter der Zauberer. Und dass Männer wie der da Mädchen wie mich verkaufen. Und du kennst die Stadt. Du hast nur vergessen, wer du bist.«
»Nein«, antwortete Hatcher. »Ich weiß genau, wer ich bin. Ich hab vergessen, wer ich davor war. Ist wahrscheinlich auch besser so. Du würdest vielleicht nicht mögen, wer ich damals war. Ich vielleicht auch nicht.«
Alice wusste noch, wer sie davor gewesen war. Sie wusste nur nicht mehr ganz, was jenem Mädchen passiert war, dass es zu diesem hier geworden war. Und angesichts der Erinnerungsblitze, die ihr eben gekommen waren, war das wahrscheinlich auch besser so. Hatcher hatte recht. Vielleicht war es besser, sich nicht zu erinnern.
Sie zitterte unter seinem Arm. Er rieb ihre Schulter, damit ihr warm wurde.
»Mir wird nicht warm«, sagte sie.
»Wir sind fast da.«
»Fast wo?«
»Keine Ahnung. Dort, wo meine Füße uns hinführen. Da ist es sicher.«
Sie waren aus dem Gewirr der Gassen getreten und auf einem Marktplatz herausgekommen. Er war nicht voll, aber es gingen doch einige Leute ihren morgendlichen Geschäften nach. Frauen mit Schals und Tüchern um die Köpfe gegen die Kälte, die Körbe mit Eiern und Kohl und in Papier eingewickelten Fisch in der Armbeuge trugen. Männer, die mit Eseln am Strick umherzogen, die mit Kohlen oder Feuerholz beladen waren, oder heimlich stille Geschäfte miteinander machten. Kleine Jungen mit zerschlissenen Mützen und nackten Füßen, die sich Äpfel von den Wagen klauten, wenn deren Besitzer gerade nicht hinsahen.
Alle, die Alice und Hatcher erblickten, wandten den Blick ab und wichen ihnen aus, schienen sie jedoch nicht für verdächtig genug zu halten, um die Polizei zu rufen, wofür Alice dankbar war. Niemand von diesen Leuten wollte anscheinend, dass die Obrigkeit anfing, in ihren Angelegenheiten herumzuschnüffeln, denn von diesen Karren wurden mit Sicherheit nicht nur Obst, Gemüse und Kohlen verkauft. Alle zeigten sehr deutlich, dass von ihnen keine Hilfe zu erhoffen war, aber auch keine Behinderung zu befürchten.
»Wenn wir da sind, wird da eine alte Frau warten, und die wird wissen, wer ich bin, und sie wird uns hereinlassen.«
Alice fragte sich, wer diese alte Frau wohl sein mochte und warum Hatcher sich so sicher war, dass sie ihnen helfen würde. Sie wollte ihn fragen, aber Hatcher kannte die Antwort wahrscheinlich auch nicht. Und ihr Magen begann sich umzudrehen, obwohl gar nichts darin war. Wenn sie noch in ihren Zellen wären, würde schon vor Stunden der Morgenbrei gebracht worden sein. Alice hustete und schmeckte etwas Fauliges hinten in der Kehle.
»Mir ist schlecht«, klagte sie.
»Wir sind fast da«, sagte Hatcher und schob sie um die Ecke eines Ladengeschäfts, das heilende Tränke verkaufte.
»Ich kann nicht mehr«, sagte Alice, riss sich von Hatcher los und erbrach sich gegen eine Mauer.
Ihr Magen drehte sich um, ihre Kehle brannte, aber es kam nicht mehr hoch als ein dünner Faden Galle. Alice lehnte die schmerzende Stirn gegen die kühlen Backsteine und zuckte zusammen, als die raue Wand an die aufgeschürfte Beule geriet, die ihr der Mann verpasst hatte, der sie beinahe vergewaltigt hätte. Die Übelkeit war keinen Deut besser geworden. Sie fühlte sich noch schlechter als vorher.
»Nur noch ein klein wenig weiter«, sagte Hatcher und zog an ihrer Hand, an ihrer Schulter. »Das ist das Pulver, das dich krank macht.«
»Ich hatte heute gar kein Pulver«, wandte Alice ein.
»Eben«, sagte Hatcher. »Wie viele Jahre hast du morgens und abends Pulver bekommen?«
»Seit ich ins Krankenhaus gekommen bin«, sagte sie.
Es war schrecklich mühsam, einen Fuß vor den anderen zu setzen, sie konnte kaum das Bein heben. Ihre Zehen schliffen über den Stein, die Haut an der Oberseite wurde mit jedem Schritt wunder.
Hatcher schob und zog sie die letzten paar Meter weiter. Als sie endlich vor der einfachen Holztür standen, die sich in eine Nische schmiegte, konnte sich Alice kaum noch auf den Beinen halten.
Hatcher hämmerte mit der Faust gegen die Tür, während sein anderer Arm Alice davon abhielt, auf dem Boden zu einem Häufchen Elend zusammenzusacken. Die Tür ging auf, und eine sehr kleine Frau, hutzelig und alt, erschien in der Öffnung. Sie trug ein blaues Kleid mit einem verblichenen roten Schultertuch darüber. Ihr Haar war weiß, und ihre Augen waren so grau wie Hatchers. Sie blickte ihn lange an, und Alice war, als hörte sie einen leisen Seufzer.
Dann sagte die Frau: »Nicolas. Ich warte schon seit drei Tagen auf dich.«
Kapitel3
Sie trat beiseite, um sie hereinzulassen. Hatcher ließ sich nicht anmerken, ob er seinen Namen wiedererkannt hatte, aber er trat über die Schwelle, als gehöre er hierher.
»Was ist dem Mädchen passiert?«, fragte die Frau, während sie zur Feuerstelle ging, um das Feuer zu schüren.
Alice schüttelte Hatchers Arm ab, taumelte auf das Feuer zu, diese wunderschöne Wärme, und fiel mit dem Gesicht nach unten auf den Teppich. Sie hörte Hatchers Antwort nicht mehr, gesegnete Dunkelheit hüllte sie ein.
Als sie wieder aufwachte, lag sie in einem weichen Bett auf einem Federkissen unter einer kratzigen Wolldecke. Es war Jahre her, dass sie in einem Bett geschlafen oder eine Decke gehabt hatte, und eine Weile lang genoss sie einfach nur das luxuriöse Gefühl, es zur Abwechslung mal gemütlich zu haben.
Eine Kerze flackerte auf einem kleinen Tischchen auf der anderen Seite des Zimmers. Der Raum hatte keine Fenster. Ein Krug und eine Schüssel standen neben der Kerze. Alice hatte Schmerzen am ganzen Körper, fühlte sich aber sauber, und ihr Kopf war seltsam leicht. Sie legte ihre Hand daran und erschrak, als sie feststellte, dass ihre langen Haare weg waren. Ihre Finger wanderten vom Nacken hinauf zum Scheitel. Die verfilzte Masse war gleichmäßig abgeschnitten, die seidigen Strähnen, die noch übrig waren, kaum zwei Fingerbreit lang.
Sie fasste an ihre Stirn, an die Stelle, von wo der Schmerz in ihren ganzen Schädel ausstrahlte. Jemand hatte die Wunde gesäubert und vernäht. Sie konnte die ordentlichen kleinen Stiche ertasten. Alice war froh, dass sie das verschlafen hatte.
Sie hob die Decke und sah ein etwas abgetragenes, aber sauberes Musselin-Nachthemd. Der Dreck und das Blut waren abgewaschen. Sie zog die Ärmel des Nachthemds hoch und sah rote Abdrücke an ihren Handgelenken.
»Der Junge hat gesagt, er sei das gewesen, aber es war keine Absicht«, sagte eine Stimme.
Alice blickte über die rechte Schulter und sah, dass die alte Frau den Vorhang im Eingang beiseitegezogen hatte. In einer Hand hielt sie einen Teller, als hätte sie gewusst, dass Alice gerade jetzt erwachen und Hunger haben würde.
Sie ging langsam, wie mit steifen Gelenken, zu Alice’Bett und reichte ihr den Teller. Es gab braunes Brot und ein Stück krümeligen gelben Käse. Alice nahm den Teller und murmelte: »Vielen Dank.«
»Iss langsam«, riet die alte Frau. »Nicolas hat gesagt, du seist krank gewesen.«
Alice lachte auf, ein kurzes bellendes Geräusch, das sie selbst überraschte. Sie wusste nicht mehr, wann sie zum letzten Mal gelacht hatte.
»Ja, das könnte man so sagen, dass ich krank war«, sagte sie und weinte plötzlich, schluchzte, wie sie nicht mehr geschluchzt hatte, seit sie ein kleines Kind gewesen war.
All die Jahre, die sie nur an den vier Wänden ihrer Zelle entlanggewandert war, wo man sie nur herumgestoßen und herumgezerrt hatte, diese Wärter, für die sie nur eine abzuleistende Pflicht war. All die Nächte, in denen sie verängstigt aus einem Albtraum hochgeschreckt war, der sie einfach nicht in Ruhe lassen wollte, all die Nächte war niemand da gewesen, um sie zu trösten oder diese Angst zu besänftigen. Alles, was geschehen war, seit das Krankenhaus in Flammen aufgegangen war – der Rauch und die Angst und die Männerhände, die sich zwischen ihre Beine drängten. All diese Dinge hatten sich in ihrem Inneren aufgetürmt, zugedeckt durch den tröstlichen Nebel der Pulver, die jeden Morgen und jeden Abend in ihr Essen gekippt wurden. Jetzt sah die Welt scharf aus und klar, zu klar und zu lebendig. Es war unsagbar schrecklich.
Die alte Frau nahm sie nicht in den Arm und bot auch keinen falschen Trost an. Sie wartete geduldig und blickte sie mitfühlend an, bis Alice sich ausgeweint hatte. Dann gab sie ihr ein fadenscheiniges Taschentuch, mit dem sich Alice das Gesicht trocknete. Ihre Hände hielten über der linken Wange inne, als ihr voller Schrecken klar wurde, dass die Narbe jetzt gut sichtbar war und von dem kurz geschnittenen Haar nicht mehr verdeckt wurde.
»Warum hast du mir die Haare geschnitten?«, fragte Alice. Sie hatte das nicht sagen wollen. Eigentlich hatte sie sagen wollen: »Vielen Dank, dass du mich gewaschen hast und mir zu essen gibst und meine Wunden verbunden hast«, aber es war anders herausgekommen, als sie es vorgehabt hatte.