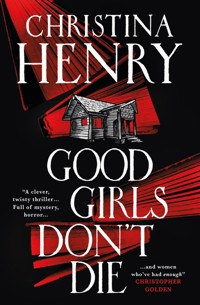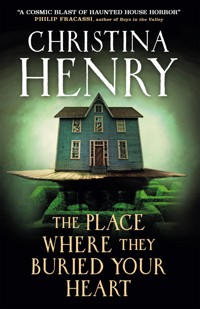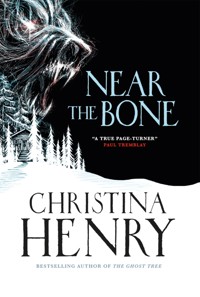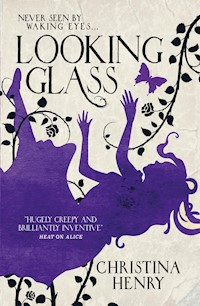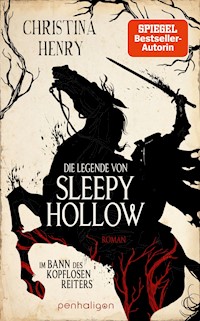12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dunklen Chroniken
- Sprache: Deutsch
Christina Henrys düstere Neuinterpretation des Meerjungfrauen-Mythos: die berühmte Legende verwoben mit gruseliger Realität.
Einst zog ein einsamer Fischer sein Netz an Land und fand darin eine Frau. Eine Frau mit schwarzem Haar und Augen, in denen sich der Sturm des Meeres widerspiegelte. Anstelle von Beinen hatte sie einen Fischschwanz, und obwohl sie die Worte des Fischers nicht verstand, rührte sie seine Einsamkeit, und sie blieb bei ihm. Ihre Liebe dauerte an, bis sein Tod ihn von der unsterblichen Meerjungfrau trennte.
Doch Gerüchte über dieses rätselhafte Wesen sind längst laut geworden – und haben die Aufmerksamkeit eines Mannes erregt, der mit seinem Zirkus durch das Land zieht und den Menschen ihre schlimmsten Albträume hinter Gittern vorführt. Sein Name ist P.T. Barnum, und er sucht eine Meerjungfrau ...
Alle Bücher von Christina Henry:
Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland
Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin
Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland
Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland
Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen
Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald
Die Bände (außer Alice) sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Einst zog ein einsamer Fischer sein Netz an Land und fand darin eine Frau. Eine Frau mit schwarzem Haar und Augen, in denen sich der Sturm des Meeres widerspiegelte. Anstelle von Beinen hatte sie einen Fischschwanz, und obwohl sie die Worte des Fischers nicht verstand, rührte sie seine Einsamkeit, und sie blieb bei ihm. Ihre Liebe dauerte an, bis sein Tod ihn von der unsterblichen Meerjungfrau trennte.
Doch Gerüchte über dieses rätselhafte Wesen sind längst laut geworden – und haben die Aufmerksamkeit eines Mannes erregt, der mit seinem Zirkus durch das Land zieht und den Menschen ihre schlimmsten Albträume hinter Gittern vorführt. Sein Name ist P.T. Barnum, und er sucht eine Meerjungfrau …
Autorin
Die Amerikanerin Christina Henry ist als Fantasyautorin bekannt für ihre finsteren Neuerzählungen von literarischen Klassikern wie »Alice im Wunderland«, »Peter Pan« oder »Die kleine Meerjungfrau«. Im deutschsprachigen Raum wurden diese unter dem Titel »Die Dunklen Chroniken« bekannt und gehören zu den erfolgreichsten Fantasybüchern des Jahres 2020. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin liebt Langstreckenläufe, Bücher sowie Samurai- und Zombiefilme. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Chicago.
Alle Bücher von Christina Henry:
Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland
Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin
Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland
Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland
Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen
Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald
Besuchen Sie uns auch aufwww.instagram.com/blanvalet.verlag undwww.facebook.com/blanvalet.
CHRISTINA HENRY
DIE CHRONIKEN DER
MEERJUNG-FRAU
DER FLUCH DER WELLEN
Roman
Deutsch von Sigrun Zühlke
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Mermaid« bei Berkley, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Tina Raffaele
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition is published by arrangement with Berkley, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: Melanie Korte, Inkcraft, nach einer Originalvorlage von Titan Books
Umschlagdesign: Julia Lloyd
Umschlagmotiv: © Shutterstock.com
BL · Herstellung: MR
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-25636-4V001
www.penhaligon.de
Für Cora – zu Land und zu Wasser
TEIL I
DER FISCHER UND DIE MEERJUNGFRAU
Kapitel 1
Es war einmal ein Fischer, ein einsamer Mann, der an einer kalten, rauen Küste lebte und keine Frau davon überzeugen konnte, ihre Heimat zu verlassen, um mit ihm an diesem unwirtlichen Ort zu leben. Er liebte das Meer mehr als jeden Menschen, und so gelang es ihm nicht, eine Frau zu finden, denn Frauen sehen klarer ins Herz eines Mannes, als Männer sich das vielleicht wünschen.
So sehr er die eiskalte Gischt im Gesicht liebte und den Anblick der sich am Horizont auftürmenden Wolken, so sehr wünschte er sich doch eine Frau, um sie zu lieben.
Eines Abends, als er nach einem langen Arbeitstag sein Netz einholte, fand der Fischer eine Frau darin – oder zumindest ein Wesen, das einer Frau ähnelte, mit schwarzem Haar und Augen so grau wie die stürmische See und einem glänzenden Fischschwanz.
Es tat ihm leid, dass er sie gefangen hatte, und das sagte er ihr auch, während der Sturm in ihrem Blick direkt in sein Herz blies.
Als sie seine Stimme vernahm, hörte sie auf, sich wie wild in seinem Netz herumzuwerfen, auch wenn sie seine Worte nicht verstehen konnte. Der Fischer gab sie frei, und sie tauchte zurück ins Wasser – ein wildes Wesen, das in seinen wilden Lebensraum zurückkehrte –, und er sah ihr nach, wie sie davonschwamm.
Doch sie hatte mit ihren Augen in ihn hineingeblickt, wie es nur Frauen vermögen, und seine Einsamkeit schlich sich in ihr Herz, und er tat ihr leid. So nahm diese Einsamkeit sie mehr gefangen, als es das Netz je hätte tun können. Während sie von dem Boot wegschwamm, so schnell sie nur konnte, zog sie seine Einsamkeit hinter sich her wie eine Reepschnur. Aber sie wollte nicht, dass seine Gefühle sie banden und sie zu ihm zurückzogen, also ließ sie ihren Schwanz silbrig im Wasser blitzen und richtete den Blick entschlossen nach vorn.
Doch auch ohne zurückzublicken, fühlte sie, wie er ihr nachsah, und sie merkte sich die Form seines Boots und den Schwung der nahegelegenen felsigen Küste und die Fältchen um seine Augen, Augen, so dunkel wie das tiefe Meer unter dem Mond.
Ihr Name bedeutete »Die durch die Meeresoberfläche bricht«, denn sie hatte es sehr eilig gehabt, zur Welt zu kommen, und war viel früher geboren worden als ihre sechs älteren Geschwister. Den größten Teil ihrer Kindheit hatten ihre Mutter, ihr Vater und ihre Geschwister damit verbracht, nach ihr zu suchen, denn sie war nie dort zu finden gewesen, wo sie hätte sein sollen. Immer wieder warnte man sie vor den Gefahren der Oberfläche und den Menschen, die dort ihre Netze auswarfen, vor ihrer Grausamkeit gegenüber den Bewohnern des Meeres.
Sie hätten ihr nie davon erzählen dürfen, denn nun wollte sie mehr wissen, und ihr Wissensdurst führte sie immer weiter in die Ferne.
Ihre Heimat lag tief unter dem Meer, weit weg von den Landmassen, die auf jeder Seite gegen den Ozean drückten, weil ihr Volk die Menschen fürchtete, mit ihren Haken und Netzen und Booten, die auf der Oberfläche der Wellen trieben. Die Geschichtenerzähler sprachen von silbernen Walen, die, von grausamem Metall durchspießt, an Bord der Schiffe gehievt wurden, wo das Blut aus ihnen rann, ins Wasser zurückspritzte und alles anlockte, was im Ozean auf der Suche nach sterbenden Kreaturen war.
Manchmal gab es einen Sturm, der ein Schiff in Stücke riss, und dann fielen die Menschen ins Wasser und sanken, sanken, sanken bis auf den Grund – jedenfalls die Glücklichen. Die Unglücklichen wurden von den umherstreifenden Jägern gefressen, die mit den silbergrauen Körpern und den schwarzen Augen und den weißen, weißen Zähnen.
Wenn die Schiffe versunken waren, schwamm die neugierige Meerjungfrau zu den Wracks und erforschte sie, nahm hier und da etwas von den Dingen an sich, die die Menschen benutzten, und bestaunte sie. Und wenn einer ihrer Brüder oder ihre Eltern sie dabei erwischten, dann schalten sie sie für ihre Torheit und zogen sie am Handgelenk zurück nach Hause, während sie die ganze Zeit sehnsüchtig zurückblickte.
Eines Tages, als sie dicht unter der Oberfläche schwamm – viel zu dicht unter der Oberfläche, hätte ihre Familie gesagt –, entdeckte sie ein großes, großes Schiff, wie sie noch nie eines gesehen hatte. Und am Bug des Schiffs erblickte sie etwas ganz Außergewöhnliches.
Es sah aus wie sie – wie eine Meerjungfrau, aber erstarrt und an das Schiff gefesselt.
Lange schwamm sie neben dem Schiff her und versuchte herauszufinden, wie die Seeleute diese Meerjungfrau an ihr Gefährt gefesselt hatten. Das war gar nicht so einfach, denn sie durfte sich von den Menschen nicht sehen lassen. Immer wieder schoss sie kurz über die Wasseroberfläche hinaus, um einen Blick auf die andere Meerjungfrau zu erhaschen, und tauchte sogleich wieder unter Wasser, bevor jemand sie entdecken konnte.
Es wehte ein hübscher Wind, und die Segel waren voll, und das Schiff flog durch die Wellen, sodass die Meerjungfrau schon bald müde wurde. Doch sie wollte unbedingt sehen, sie wollte unbedingt wissen, und so folgte sie dem Schiff auch dann noch, als sie nicht mehr mithalten konnte. Sie wurde immer müder und immer langsamer, und plötzlich war das Schiff zu weit voraus, um es noch einzuholen, und verschwand hinter dem Horizont.
Plötzlich war die Meerjungfrau ganz allein, weit weg von zu Hause, und wusste nicht, wie sie zurückfinden sollte.
Es hätte sie traurig machen müssen oder ängstlich oder ihr eines der anderen qualvollen Gefühle bereiten sollen. Doch auch wenn es ihr leidtat, dass sie ihre Familie vielleicht nie mehr wiedersehen würde, so war sie doch nicht so aufgewühlt, wie sie es hätte sein sollen.
Das Gefühl der Freiheit war stärker. Von nun an würde sie schwimmen können, wohin sie wollte, und tun und lassen dürfen, was immer ihr gefiel. Ja, es würde Folgen haben (so dumm war sie nicht, dass sie damit nicht rechnete), aber es würden ihre Entscheidungen und ihre Folgen sein und nicht die, die irgendjemand anders für sie bestimmt hatte.
Freiheit war wesentlich berauschender, als es Sicherheit je sein könnte.
Sie wollte mehr sehen und mehr erfahren, als sie am Grund des Ozeans je erfahren konnte. Also schwamm sie dem Schiff nach, weil das Schiff irgendwann zum Land fahren würde und die Meerjungfrau noch nie in ihrem Leben Land gesehen hatte.
Und so überquerte sie den Ozean, bis sie dorthin gelangte, wo das Land anfing.
Die Meerjungfrau verbrachte sehr viel Zeit damit, die Menschen an der Küste zu beobachten und die, die mit Booten aufs Meer hinauskamen. Immer, immer achtete sie sorgfältig darauf, ihren Haken und Leinen und Käfigen und Netzen auszuweichen, weil sie ihre Freiheit liebte und niemals mehr dem Willen eines anderen unterworfen sein wollte.
Bis zu dem Tag, an dem sie damit beschäftigt war, einen Fisch zu befreien, der sich an einem Haken festgebissen hatte. Der Fisch zappelte und wand sich und kämpfte wild, war so in Todesangst, dass er sich von ihr nicht helfen lassen konnte. Sie sah das Netz nicht, das von oben kam, und dann war sie darin gefangen.
Da geriet auch sie in Todesangst, genau wie der Fisch, dem sie versucht hatte zu helfen. Sie schlug mit dem Schwanz um sich, wand sich und zappelte, doch all ihr Toben sorgte nur dafür, dass sich das Netz immer enger um sie herumschlang, bis sie schließlich aus dem Wasser gehievt wurde, wütend und triefend.
Seine Augen waren dunkel und voller Überraschung, als er sah, was er da in seinem Netz hatte. Überraschung und Erstaunen und dann ein wenig Traurigkeit, die sie beinahe übersehen hätte. Als er das Messer hob, war sie sicher, dass er sie töten würde, doch er sprach nur ein paar leise Worte, die sie nicht verstand, und schnitt alles weg, was sie fesselte.
Sie schwamm davon und dachte staunend über den Mann nach, der sie freigelassen hatte.
An jenem Abend blickte der Fischer aufs Meer hinaus. Er stand vor seinem Haus, das auf den Klippen hoch über der kleinen Bucht stand, in der er sein Boot festgemacht hatte. Es war kalt, denn der Winter nahte, aber im Grunde war es sowieso nie sonderlich warm am Nordatlantik. Er vergrub die Hände tief in den Taschen seines Mantels, starrte auf das aufgewühlte Wasser hinaus und hielt unter dem Mond Ausschau nach ihr. Doch auch wenn er jedes Mal den Kopf drehte, wenn er nur das leiseste Platschen hörte, sah er nie, wonach sich sein Herz sehnte – den Umriss ihrer Schwanzflosse, die sich gegen das Mondlicht abhob.
Wahrscheinlich war er ein Narr gewesen, dass er sie hatte schwimmen lassen. Niemand würde ihm glauben, wenn er diese Geschichte erzählte, und er wollte sich unten im Dorf am Tresen nicht zum Narren machen. Er war alt genug, um den prahlerischen Drang der Jugend hinter sich zu haben, aber doch nicht so alt, dass er nicht doch gern das Erstaunen in ihren Augen glänzen gesehen hätte, wenn sie hörten, dass er eine Meerjungfrau gefangen hatte.
Doch sie zu behalten hätte er nicht übers Herz gebracht. Das wusste er ganz sicher. Er hätte dieses wilde, freie Wesen, das ihm aus dem Netz entgegengeblickt hatte, niemals gefangen nehmen und zwingen können, bei ihm zu bleiben, sie zu einer Gefangenen zu machen und aus ihrem Leid Gewinn zu schlagen.
Sie hatte anders ausgesehen, als er erwartet hatte. Ganz anders als die Meerjungfrauen, von denen er als kleiner Junge in den Geschichten gehört hatte. Die erzählten von weißhäutigen, barbusigen Frauen mit langem fließenden Haar, von Frauen, die in allem menschlich waren, bis auf den Fischschwanz.
Was er gefangen hatte, hatte sehr viel fremdartiger ausgesehen, eine Kreatur, die am ganzen Körper mit silbrigen Schuppen bedeckt war, mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern und Zähnen, die sehr viel spitzer und schärfer waren als die eines Menschen. Aber ihre Augen waren die einer Frau gewesen, und wie die Augen einer Frau hatten sie direkt in sein Herz geblickt und die ganze Einsamkeit darin gesehen.
Er hatte das Gefühl gehabt, als hätte sie mit diesen langen geschuppten Fingern jederzeit sein Herz greifen und mitnehmen können, wenn sie nur gewollt hätte.
Dann war er zur Besinnung gekommen und hatte sie freigelassen, weil er wusste, dass es das Richtige war und dass der Zustand seines Herzens keine Meerjungfrau interessierte.
Doch nun blickte er noch immer hoffnungsvoll aufs Wasser hinaus, denn es ist der Herzenswunsch aller Fischer, einmal im Leben eine Meerjungfrau zu sehen, etwas Magischem zu begegnen, in der Hoffnung, dass ein Teil der Magie für immer bei ihm bleibt.
Als dann schließlich der Mond seinen Zenith überschritten hatte, verabschiedete sich der Fischer von seinen Träumen und ging ins Haus, um zu schlafen. Er wusste, dass er sie nie wiedersehen würde, und auf die ihm eigene praktische Art gab er sich damit zufrieden, sie wenigstens einmal gesehen zu haben. Das war schon mehr, als den meisten beschieden war. Er hatte etwas Magisches berührt, und ihn sollte es nicht nach mehr verlangen.
Er konnte sie nicht sehen, aber sie hatte sich seinem Häuschen genähert und beobachtete ihn aus dem Wasser heraus, und sie wusste, dass er nach ihr Ausschau hielt. Sie vermochte nicht zu sagen, woher sie das wusste, sie hatte ja nur den traurigen Blick in seinen Augen gesehen, als er sie freiließ. Doch seine Einsamkeit hatte sich tief und brennend in ihr Herz gegraben.
Die Meerjungfrau kannte die alten Geschichten, die man sich flüsternd erzählte, über diejenigen ihrer Art, die die Tiefe verlassen hatten und an Land gegangen waren.
Es lag keine besondere Magie darin – es sei denn, man hielt Meerjungfrauen an sich für magisch –, aber sie selbst hielt sich und ihre Art nicht für etwas Besonderes, denn sie waren ihr natürlich von Geburt an vertraut.
In diesen Geschichten, diesen geheimen Geschichten, musste die Meerjungfrau lediglich trockenes Land berühren, damit sich ihr Fischschwanz in Beine verwandelte, mit denen sie herumlaufen konnte. Und um ihn zurückzubekommen, musste sie erneut ins Meerwasser eintauchen.
Die Meerjungfrau hatte nie auch nur darüber nachgedacht, wie es wäre, an Land zu gehen, doch mit einem Mal wünschte sie sich nichts sehnlicher. Sie wollte all die schönen Dinge sehen, die hinter dieser Küste lagen und die sie nie zu sehen bekommen hatte: all die Menschen und all die Dinge, für die sie nicht einmal einen Namen hatte, die sie gern benennen wollte, damit sie sie in ihre Erinnerungen aufnehmen und für sich behalten konnte.
Es war dunkel, auch wenn der Mond am Himmel stand, und in der kleinen Bucht, in der der Fischer über Nacht sein Boot festmachte, gab es einen Streifen sandigen Strand.
Die Meerjungfrau beschloss, dorthin zu schwimmen und den trockenen Sand zu berühren, um zu sehen, ob die Geschichten wahr waren. Ihr Herz barst vor Vorfreude – wie wundervoll würde es sein, wie perfekt, wie frei würde sie sich fühlen, wenn sie zwischen der Küste und dem Meer hin- und herwechseln könnte. Nicht wie die Menschen es taten – Menschen, die im Wasser schwammen, wirkten immer sehr unbeholfen, wenn sie mit ihren Gliedern in alle Richtungen strampelten und Schaum schlugen.
Nein, sie würde so elegant wie ein Fisch im Wasser sein und so anmutig wie ein Mensch an Land, und die ganze Welt würde ihr offenstehen. Die ganze Welt und all ihre Wunder, und sie würde sie alle sehen, jedes einzelne.
Sie schwamm in die Bucht hinein, und als sie mit dem Kopf durch die Wasseroberfläche stieß, sah sie die kantigen Felsen sich um sie herum erheben und den kurzen Strand, an dessen Ende eine Treppe hinauf zum Häuschen des Fischers führte.
Es brannte kein Licht im Häuschen, und die Meerjungfrau war sich sicher, dass der Fischer darin schlief und sie nicht sehen würde. Doch selbst wenn, überlegte sie, würde er nur einen Schatten vor anderen Schatten erkennen können – das Mondlicht reichte nicht bis an den Strand.
Sie schwamm weiter, bis sie den feuchten Sand an ihrem Bauch spüren und mit dem Schwanz nicht länger auf und ab schlagen konnte, weil das Wasser nicht mehr tief genug dafür war. Sie streckte sich nach dem trockenen Land direkt hinter den brandenden Wellen – streckte sich und hielt dann inne.
Was, wenn es nicht funktionierte? Was, wenn diese Geschichten, diese ewig geflüsterten Geschichten, nicht wahr waren? Was, wenn ihr Herz sich immer nach dem Land und dem Mann mit den dunklen Augen und seinem einsamen Blick sehnen würde und sie niemals bekäme, was sie sich wünschte?
Die Möglichkeit des Scheiterns wäre für manche ein Grund gewesen, aufzuhören und in das vertraute Element zurückzukehren. Doch nicht für die Meerjungfrau. Sie musste es einfach wissen, und der einzige Weg, es zu erfahren, bestand darin, sich auszustrecken und mit den Händen nach der Küste zu greifen.
Ihre Finger streiften den trockenen Sand, und sie schwelgte in dem vollkommen neuen Gefühl, jedem Sandkorn nachzuspüren, das durch ihre Finger glitt, frei und nicht mehr durch Wasser gebremst. Es brachte sie zum Lachen, etwas zu berühren, das sie noch nie berührt hatte.
Und dann spürte sie ein schreckliches Reißen in ihren Gedärmen und ein Zerren an ihrem Schwanz. Sie versuchte zu schreien, doch der Schrei blieb ihr in der Kehle stecken. Das war schrecklich, einfach schrecklich, kein Wunder – es gab nur Schmerz und dann Kälte, die bitterste Kälte, die sie je erfahren hatte.
Die Wellen klatschten gegen ihre nackten Beine, und sie spürte die Kälte des Ozeans, die sie noch nie empfunden hatte. Sie drang tief in ihren Körper ein, ins Blut und in die Knochen, und strahlte dann bis hinaus auf die zarte Haut, die ihren Körper jetzt statt der Schuppen bedeckte.
Wie leben Menschen mit dieser Kälte?, dachte sie. Alles an ihr fühlte sich brüchig an, als könnte es jederzeit in tausend Stücke zerspringen, wenn jemand sie nur mit der Fingerspitze antippte. Der Sand, so wundervoll er eben noch gewesen war, schürfte ihre Haut auf, wo immer er sie berührte, und sie zitterte am ganzen Körper vor Kälte.
Ihre Zähne klapperten in ihrem Mund, und sie betastete sie mit sandigen Fingern, weil sie sich ungewohnt anfühlten, flacher. Und das waren sie in der Tat – nicht mehr spitz wie zuvor und mehr wie die der Menschen.
Fort waren ihre Schuppen und Zähne, und stattdessen hatte sie diese Dinger bekommen, diese Beine, die sich nicht frei und leicht anfühlten wie ihr Fischschwanz, sondern eher schwer wie Gewichte, die sie an die Erde fesselten.
Hatte sie gedacht, ein Mensch zu sein, wäre wunderbar? Hatte sie gedacht, die Welt würde ihr offenstehen? Die Welt stand ihr nicht offen. Diese Beine ware wie ein Netz, ein Netz, dass sie gefangen hielt und daran hinderte, frei zu schwimmen.
Da hätte sie beinahe aufgegeben, zitternd vor Kälte und Angst, wäre ins Wasser zurückgekehrt und hätte ihren Körper wieder mit Schuppen überziehen lassen, um den ganzen Weg zurück in den tiefen, tiefen Ozean zu schwimmen, wo ihre Familie auf sie wartete.
Doch sie wollte nicht beschämt nach Hause zurückkehren und riskieren, dass sie die Köpfe über sie schüttelten und sagten, dass sie von Anfang an nicht hätte davonschwimmen dürfen. Sie wollte wissen, wie es war, ein Mensch zu sein. Menschen gingen auf ihren Beinen. Also musste sie als Erstes aufstehen.
Aber wie? Nichts an ihrem Körper erschien ihr vertraut. Sie wusste nicht, wie die einzelnen Teile zusammenhingen, wie man sie dazu bringen könnte zu tun, was sie wollte.
Zuerst musste sie vermutlich aus dem Wasser heraus. Ihr menschlicher Körper war nicht dafür geschaffen, im Wasser zu liegen. Die Meerjungfrau stemmte die Arme in den Sand und zog den Rest ihres Körpers aus dem Wasser – langsam, so langsam – und biss die Zähne zusammen, als der Sand ihre Haut aufschürfte.
Als sie es endlich aus dem Wasser herausgeschafft hatte, entdeckte sie, dass die Nachtluft, die durch die Bucht wirbelte, fast genauso kalt war. Sie kühlte das Wasser ab, das immer noch an ihr hing, und sorgte dafür, dass die Haut unzählige kleine Hügelchen bildete.
Deswegen hüllen sich die Menschen in die Haut anderer Lebewesen, dachte sie. Sie hatte sie in Pelze gehüllt gesehen oder in Stiefeln aus Seehundfell und hatte das für barbarisch gehalten. Doch nun wurde ihr klar, dass sie selbst solche Bedeckungen brauchen würde, wenn sie nicht vor Kälte sterben wollte.
Kälte. Ihr war so kalt.
Sie reckte den Hals, um das Häuschen des Fischers zu sehen. Darin würde es nicht kalt sein. Er würde sie in einen Pelz einhüllen und das Wasser abtrocknen, damit ihr warm, warm, warm würde. Und dann würde er sie anlächeln, weil sie für ihn aus dem Meer gekommen war, damit er nicht mehr einsam war.
Der Fischer. Sie musste zu ihm. Und um zu ihm zu gelangen, musste sie gehen. Um zu gehen, musste sie stehen, und es spielte keine Rolle, dass sie nicht wusste, wie sie das anstellen sollte.
Ihre Beine hatten ein Gelenk in der Mitte. Sie konnte spüren, wo das Bein geteilt war. Es bestand aus zwei miteinander verbundenen Teilen, genau wie ihre Arme.
Sie stemmte sich auf die Hände, beugte die Beine, bis ihre Knie im Sand waren, und stieß den Atem in die kalte Luft aus, weil das alles so viel schwieriger war, als sie erwartet hatte. Wie schafften es die Menschen nur, einfach so auf diesen steifen Schwanzfinnen am Ende ihrer Beine zu stehen und zu gehen?
Die Meerjungfrau ließ versuchsweise die Knöchel kreisen, zog die Zehen an und streckte sie, und fand ganz allmählich heraus, wie sie auf ihren neuen Füßen stehen – oder eher schwanken – konnte.
Sie hatte Menschen an Bord ihrer Schiffe umhergehen sehen und wusste, dass deren Füße sich dabei abwechselnd hoben, während der jeweils gegenüberliegende Fuß am Boden blieb. Dies erschien ihr beinahe unmöglich zu erreichen, während sie, am ganzen Körper zitternd, dastand und schwankte und jederzeit wieder der Länge nach im Sand landen konnte.
Doch der Fischer war oben an der Treppe. Also musste sie dort hinaufsteigen.
Die Meerjungfrau hob einen ihrer Füße, und das Wunder, dass sie dazu überhaupt fähig war, beeindruckte sie. Sie starrte auf ihre Beine hinunter, auf den Fuß, der im Sand stand, und den anderen, den sie in die Luft hielt, und lachte laut auf.
Und dann kippte sie nach vorn und fiel hin, landete auf Knien und Ellbogen und musste noch einmal ganz von vorne anfangen.
Sie mühte sich auf die Beine. Nachdem sie endlich wieder festen Stand gefunden hatte, schob sie sehr vorsichtig einen Fuß vor den anderen und wiederholte die Bewegung mit dem anderen Fuß – einen nach dem anderen, schschschsch über den Sand.
Dabei umklammerte sie mit den Armen ihren Oberkörper – sie erschienen ihr so dünn und zerbrechlich, so unfähig, sie vor der eiskalten Luft zu schützen, die durch ihre Haut hindurch biss und bis ins Blut reichte.
Als sie die Treppe erreichte und nach oben sah, kam ihr die schreckliche Erkenntnis, dass sie da hinauf nicht schlurfen konnte. Die hölzernen Stufen waren hoch, und es gab nichts zum Festhalten außer den Felsen.
Mit einem Mal war die Meerjungfrau sehr müde und wollte alles andere, als diese Stufen hinaufzuklettern. Doch sie kletterte sie nichtsdestotrotz hinauf und wusste später nicht mehr, wie sie es geschafft hatte. Sie wusste nur noch, dass es sehr lange gedauert hatte.
Als sie oben ankam, war der Mond beinahe verschwunden. Ihre Hände und Beine waren mit blutigen Schrammen übersät, überall hatte sie Splitter von den unzähligen Malen, wo sie auf der Treppe gestürzt war, und ihre Zähne klapperten so heftig, dass sie schon fürchtete, sie würden brechen.
Nachdem sie oben angekommen war, stolperte sie auf die Tür des Häuschens zu und streckte die Hand nach der Klinke aus, wie sie es bei dem Fischer gesehen hatte, wenn sie ihn vom Meer aus beobachtete.
Die Tür schwang auf, und sie klammerte sich an den Türrahmen. Im Inneren des Hauses befanden sich viele Dinge, die ihr fremd waren – Dinge, deren Namen sie der Fischer lehren würde, wie ein Kessel, eine Pfanne und Mehl in einem Glas und Tee in einer Holzkiste und ein Tisch und ein Stuhl (schon bald würden sie zwei Stühle brauchen, einen für jeden von ihnen) – und hinter dem Raum mit den vielen seltsamen Gegenständen befand sich ein Durchgang ohne Tür. Sie hörte die Geräusche, die Menschen im Schlaf von sich geben, und wusste, dass der Fischer dort sein musste.
Der Durchgang schien ihr sehr weit entfernt zu sein, und das raue Holz der Bodendielen würde ihren Füßen wehtun, wenn sie versuchte, sie darüber gleiten zu lassen, wie sie es auf dem Sand getan hatte – das wusste sie von der Holztreppe, auf der sich immer wieder unvorhersehbare Splitter in ihre zarte neue Haut gebohrt hatten.
Sie brauchte lange, um den Raum zu durchqueren. Als sie den Fischer erreichte, sah sie ihn schlafend im Bett liegen, die Decken bis unters Kinn gezogen. Er lag auf der Seite, nur die Augenlider und der schwarze Haarschopf waren zu sehen.
Dieser Raum fühlte sich wärmer an als der andere, erwärmt durch den Atem des Fischers, und sie wollte so gern dorthin, wo es warm war. Sie kniete sich neben sein Bett, strich mit ihren Fingern über sein Haar und beobachtete, wie seine schwarzen Augen sich öffneten. Sie sah Erkennen darin und fragte sich nie, woher er wusste, dass sie es war, dieselbe Meerjungfrau, die er in seinem Netz gefangen hatte.
Lange Zeit später erzählte er ihr, dass es ihre Augen waren, die er wiedererkannt hatte, dass ihre Augen immer dieselben blieben, ganz egal welche Form sie annahm, und dass er, als er sie erblickte, wusste, dass sie zu ihm zurückgekehrt war.
Er hob die Decke hoch, und sie sah, dass er darunter nackt war, sein männlicher Körper ohne die Bedeckungen, die Menschen normalerweise trugen. Da kroch sie zu ihm unter die Decke, und seine Wärme hüllte sie ein, und seine Liebe füllte ihr Herz und sorgte dafür, dass sie für immer bei ihm bleiben wollte.
Er lehrte sie seine Menschensprache und sagte ihr, sein Name sei Jack. Ihren Namen konnte man nicht in Menschensprache aussprechen, also nannte er ihr viele Tage lang viele verschiedene Namen, bis er denjenigen aussprach, der ihr gefiel, und von da an wurde sie Amelia genannt.
Amelia liebte Jack, doch sie konnte das Meer nicht ganz vergessen. Nachts übte sie, sich von einer Frau in eine Meerjungfrau zu verwandeln, bis sie ohne den Schmerz, der sie beim ersten Mal erfasst hatte, leicht zwischen beiden Formen hin- und herwechseln konnte.
Sie blieb bei ihm und liebte ihn und lebte viele Jahre als Frau an Land und als Meerjungfrau im Meer. Nachts, wenn keine anderen Fischer draußen waren und ihr Mann schlafend in ihrem gemeinsamen Bett lag, ging sie hinaus auf die Felsen, legte ihr Menschenkleid ab, tauchte in das schwarze Wasser und blieb dort, bis ihrem Herz wieder die Augen des Mannes einfielen, den sie liebte, und sie zu ihm zurückkehrte.
Sie liebte ihn beinahe so sehr, wie sie das Meer liebte, und so passten sie wunderbar zusammen, denn er liebte das Meer beinahe so sehr, wie er sie liebte.
Er hätte nie gedacht, dass irgendjemand ihn mal stärker anziehen könnte als der Ozean, aber er sah die donnernden Wellen in ihren Augen und schmeckte das Salz der Gischt auf ihrer Haut, und dazu fand er in ihr noch etwas, das die See ihm niemals geben konnte: Der Ozean liebte ihn nicht zurück, Amelia schon.
Viele Jahre vergingen, und sie waren glücklich und zufrieden, auch wenn sie keine Kinder bekamen. Sie sprachen nicht über ihre geheimen Hoffnungen oder ihren geheimen Schmerz, aber manchmal saßen sie nebeneinander vor ihrem Haus und beobachteten die Wellen, die sich unten an den Felsen brachen, und er nahm ihre Hand, und sie wusste, dass er an die Kinder dachte, die sie nie bekommen würden.
Sie lebten in der Nähe eines Dorfs – nahe genug, um sie mit allem zu versorgen, was sie sich nicht selbst beschaffen konnten, doch nicht so nah, um nachbarschaftliche Beziehungen pflegen zu müssen, die sie nicht wollten. Jack liebte Amelia und das Meer, und Amelia liebte das Meer und Jack, doch sie mochten die Fragen nicht, die die allzu neugierigen Nachbarn stellen konnten. Fragen nach Amelias Herkunft und wo ihre Familie war und wann sie geheiratet hatten und oh, die beiden hatten es aber eilig gehabt, nicht wahr?
Doch die Nachbarn gewöhnten sich mit der Zeit an Amelia, wie sich die Menschen nun einmal an alles gewöhnen. Es waren gute Leute, wenn auch ein wenig misstrauisch, denn die Augen der Meerjungfrau waren immer etwas zu schön und blickten sie immer etwas zu direkt an. Und wo Beunruhigung ist, ist manchmal Neugier und manchmal auch Neid, und all das ergab auf den Zungen der Dorfbewohner einen Geschmack, an den sich die Leute rasch gewöhnten.
»Diese Frau vom alten Jack, sagt man, geht im Mondschein raus und tanzt mit dem Teufel, und deshalb bleibt sie so jung und hübsch«, munkelten die einen.
»Das ist doch Unsinn«, erwiderten die anderen. »Wo sollte sie da oben auf der Klippe denn tanzen? Das Haus klammert sich doch gerade so ans Land, dass ein anständiger Nordostwind es jederzeit herunterfegen könnte, und Waldlichtungen gibt es da weit und breit auch nicht. Wo sollte sie da tanzen?«
Doch es gab noch mehr als nur einen Hauch Neuengland-Aberglauben, genug, dass einige Leute die Geschichten vom Mondenschein und vom Tanz mit dem Teufel glaubten. Auch wenn viele von ihnen Amelia behandelten wie alle anderen, gab es auch immer ein paar, die es nie tun würden.
Die Jahre vergingen, wie die Jahre vergehen. Jack wurde alt, aber Amelia nicht, und nach einiger Zeit begannen die Dorfbewohner darüber zu reden – sogar diejenigen, die nicht gleich das Schlimmste von ihr glauben wollten.
Sie hatten es nicht gewusst, Jack und Amelia, als sie aus dem Ozean kroch, um an seiner Seite zu leben, dass sie nicht zusammen alt werden würden. Meerjungfrauen leben sehr lange, auch wenn sie die Zeit nicht auf dieselbe Weise messen wie Menschen. Amelia sah zu, wie ihr junger, starker Mann gebrechlich wurde, sein Gesicht so grau und wettergegerbt wie der Bug eines Schiffs.
Sie liebte ihn trotzdem und liebte ihn umso mehr, weil sie sein Herz kannte, und nach vielen, vielen Jahren merkte sie, dass sie ihn sogar noch mehr liebte als das Meer.
Und so holte sich das Meer, das ebenfalls bitter und eifersüchtig sein kann, eines Tages ihren Jack – vielleicht in der Hoffnung, dass Amelia das Meer dann wieder am meisten lieben würde.
Es war ein ganz normaler Tag, überwiegend grau, aber die Sonne lugte hier und da durch die Wolken, und der Wind ging leicht und leise. Jack küsste sie zum Abschied, wie er es immer tat, und machte sich auf den Weg – langsam inzwischen, so langsam –, die vielen Treppenstufen hinunter zur Bucht.
Amelia sah ihm von der Haustür nach, während er aus der Bucht hinausruderte. Er winkte ihr, als er sie da stehen sah, und sie winkte zurück. Da überkam sie das Gefühl, es könnte das letzte Mal sein, dass er ihr zuwinkte, und dieses Gefühl wurde so heftig, dass sie losrannte, die Stufen hinunter zur Bucht, um ihn zurückzurufen.
Es war zu spät, viel zu spät, als sie unten ankam, denn der Wind blies in die Bucht hinein und riss ihr die Stimme von den Lippen und warf sie gegen die Felsen, statt sie aufs Meer hinaus an die Ohren ihres Geliebten zu tragen.
Sie sah ihn hinausrudern, immer weiter und weiter aufs Meer hinaus, zu all den anderen Booten derjenigen, die ihr Leben auf See verdienten.
Einen wilden Moment lang dachte sie darüber nach, sich zu verwandeln und ihm zu folgen, um ihn nach Hause zu holen. Doch die Anwesenheit der anderen Boote hielt sie davon ab.
Da waren Netze und Haken und Schnüre. Das eine Mal, bei dem sie gefangen worden war, hatte sie zu Jack geführt, aber sie wollte nicht noch einmal gefangen werden. Was, wenn der Fischer, der sie fing, ihr nicht glaubte, dass sie Jacks Frau Amelia war? Was, wenn er sie mit seinem Messer tötete, um sie auf dem Markt zu verkaufen?
Sie schämte sich ein wenig für diese Angst, denn sie war eigentlich immer mutig gewesen, doch es war leicht, mutig zu sein, wenn man nichts zu verlieren hatte. Und jetzt hatte sie etwas zu verlieren: ihr Zuhause, ihr Leben, ihr Glück.
Und was, wenn dieses Gefühl nur war, was es war – ein Gefühl? Würde sie ihr Geheimnis für nichts aufs Spiel setzen? Und was sollte Jack schon zustoßen? Es war ein schöner Tag ohne jegliche Anzeichen eines Unwetters.
Sie machte sich nur Sorgen, weil er in letzter Zeit so gebrechlich wirkte, überlegte sie. Aber wenn er heute Abend nach Hause kam, würde sie ihm sagen, dass er von nun an nicht mehr allein so weit aufs Meer hinausfahren solle.
Den ganzen Tag versuchte sie, ihre Arbeit zu erledigen wie sonst auch. Doch sie ertappte sich immer wieder dabei, wie sie zum Fenster hinaussah, Ausschau hielt und hoffte, aber die Sonne nahm ihren üblichen Lauf, und das Fischerboot erschien nicht am Horizont.
Als die Nacht hereinbrach, ging sie auf die Felsen hinaus und wartete. Die Kälte biss ihr in die Knochen, wie sie es in jener ersten Nacht getan hatte, in der sie als Mensch an Land gegangen war, vor so langer Zeit. Amelia kehrte nicht nach drinnen zurück, um am Feuer zu warten oder einen Mantel zu holen. Sie starrte auf den Ozean hinaus, als könnte ihr Starren dafür sorgen, dass Jack dort erschien, müde und erschöpft, aber sicher – vor allem, vor allem anderen lass ihn in Sicherheit sein.
Doch sie konnte ihn nicht herbeizaubern, ganz egal wie heftig sie es sich auch wünschte, sodass sie schließlich, nachdem die anderen Fischer zurück waren, ihre Boote vertäut hatten und nach Hause gegangen waren, nach unten in die Bucht ging, ihr Kleid ablegte und das Wasser des Ozeans berührte.
Wie ein silberner Blitz tauchte sie ins Wasser ein und schwamm schneller, als je ein Mensch hätte schwimmen können.
Sie schwamm und schwamm. Es war dunkel, allmählich verschwand das Land hinter ihr, und immer wieder tauchte sie auf, um nach dem Boot Ausschau zu halten, nach seinem lieben Gesicht. Wenn sie ihn fand, würde er sie verlegen ansehen und sagen, dass er die Zeit vergessen habe.
Schließlich erblickte sie es – sein Boot, das ihren Namen an seiner Seite trug. Still und leer lag es da, der Ozean schaukelte es hin und her, und nirgendwo war eine Spur von Jack zu sehen.
Amelia schwamm zu dem Boot und stemmte sich an der Bordwand hoch, während ihr Schwanz noch im Wasser blieb, sicher, dass er nur darin schlief. Doch da waren kein Jack und auch keine Netze oder Fische, die er gefangen haben könnte. Nur ein leeres Boot, die Ruder sauber im Boot angelegt.
Mit einem entsetzten Aufschrei tauchte sie zurück ins Wasser und hinunter in die Tiefe. Meerjungfrauen können durch die Dunkelheit des Ozeans blicken. Doch sie fand ihn nicht, so sehr sie auch nach ihm suchte. Lange Zeit später kehrte sie an die Oberfläche zurück und fand sein Boot erneut. Sie suchte es nach irgendeinem Hinweis ab, irgendeinem Zeichen dafür, was ihm zugestoßen sein könnte.
Es gab nichts, nur das leere Boot und die angelegten Ruder und keine Spur davon, dass Jack überhaupt jemals hier gewesen war.
Da wusste Amelia, dass der Ozean ihn ihr entrissen und ihn verschluckt hatte, und große Bitterkeit erfüllte ihr Herz. Sie hasste das Meer, sie hasste die ausgedehnte, herzlose Weite, die ihr Jack fortgenommen hatte.
Sie wollte nur noch raus aus dem Wasser, weg von den am Boot schmatzenden Wellen, weg von dem Boot, das ihre Liebe fortgetragen und ihn der grausamen Tiefe überantwortet hatte.
Meerjungfrauen weinen nicht, aber Amelia hatte zu lange als Mensch gelebt, also strömten die Tränen aus ihren Augen, während sie zurück an die Küste schwamm, über die Schuppen auf ihrem Gesicht und mischten sich mit dem Salz des Meeres.
Nachdem sie den Sand der Bucht berührt hatte, legte sie ihr menschliches Kleid wieder an und stieg die Treppe zu dem leeren Haus hinauf. Dort setzte sie sich neben die erkaltete Asche und weinte bitterliche Tränen, bis sie keine mehr hatte.
Jacks Boot kam nie zurück in die Bucht, und als die anderen Fischer den leeren Anleger bemerkten, erzählten sie ihren Nachbarn, dass sie Jacks seltsame Frau jeden Tag auf den Klippen stehen und auf die See hinausstarren sahen.
Sie nahmen an, dass sich der Ozean den guten alten Jack geholt hatte, wie es nicht unüblich war, und einige von ihnen dachten mitfühlend an seine Frau, die Tag um Tag nach ihm Ausschau hielt. Aber vor allem fragten sie sich, wann sie wohl aufgeben und fortgehen würde, denn sie stammte nicht aus diesem Teil der Welt, und jetzt, da Jack fort war, dachten sie, dass sie ebenfalls fortgehen würde.
Doch Amelia ging nicht fort. Sie blieb in dem kleinen Haus auf den Klippen, Jahr um Jahr. Das Holz des Häuschens wurde weiß vom Wind und der salzigen Gischt, und Amelias Kleider wurden dünn, genau wie ihr Gesicht, aber sie zog nicht fort.
Und sie wurde auch nicht älter.
Die Menschen im Dorf redeten über sie. Sie konnten nicht anders, denn die Winter waren lang und hart, und ein Rätsel ist immer gut für endlos dunkle Winternächte. Sie fragten sich, was sie auf diesen Klippen hielt und wo sie wohl hergekommen war und ob sie, vielleicht, nicht doch aus dem Meer stammte.
Diese Vorstellung weckte weniger Spott als die von Amelia, die im Mondlicht mit dem Teufel tanzte. Sie waren Menschen, die aufs Meer hinausfuhren, und jeder wusste, dass es Meerjungfrauen gab. Jeder wusste, dass eine Meerjungfrau sich in einen Menschen verlieben konnte.
Doch statt den Menschen Angst zu machen, schien dieses Wissen sie zu beruhigen, denn es bedeutete, dass Amelia auf ihre Weise zu ihnen gehörte. Sie gehörte ebenfalls zum Ozean, der ihnen alles gab und alles nahm.
Und weil sie eine von ihnen war, beschützten sie sie, und wenn sie ins Dorf kam (immer seltener nun), dann wurden ihre Augen und ihre Stimmen weicher als früher. Sie war ihre Amelia, ihr Wunder, ihre Meerjungfrau.
Doch die Gerüchte über die rätselhafte und außergewöhnliche Frau, die nicht älter wurde und möglicherweise eine Meerjungfrau war, reisten von Dorf zu Dorf, wie Gerüchte es tun, bis sie die Ohren eines Mannes erreichten, dessen Geschäft es war, das Seltsame und Außergewöhnliche zu verkaufen.
Sein Name war P. T. Barnum, und er war schon lange auf der Suche nach einer Meerjungfrau.
TEIL II
DAS MUSEUM
Kapitel 2
New York City, April 1842
Diese Meerjungfrau sah ganz und gar nicht aus, wie eine Meerjungfrau auszusehen hatte, fand Barnum. Er hatte mehr erwartet. Er hatte erwartet, dass sie deutlich mehr wie eine Frau aussah, so wie auf diesen italienischen Gemälden, die sie barbusig mit ausladenden Hüften und langem wallenden Haar zeigten. Barnum kannte ziemlich viele gottesfürchtige Menschen, die diese Gemälde missbilligten. Doch Missbilligung bedeutete auch Kontroversen, und Kontroversen verkauften schneller Eintrittskarten als alle sieben Weltwunder zusammen. Barnum hatte nichts gegen Kontroversen, solange er Eintrittskarten verkaufen konnte, weil die Leute eine echte Meerjungfrau sehen wollten.
Dieses Ding, das Moses da angeschleppt hatte, ähnelte nicht im Geringsten diesen Gemälden.
Zwei Männer standen mit ihm um den Tisch herum. Sie starrten auf das Objekt, das dort lag – der eine voller Begeisterung, der andere versuchte seine Bestürzung hinter einer Maske tastender Neutralität zu verbergen.
»Levi«, sagte Barnum.
Levi war früher Anwalt gewesen, und er konnte immer noch diese Anwaltsmiene aufsetzen, der man nichts ansah, was er nicht wollte.
»Ja, Taylor?«, antwortete Levi. Er war einer der wenigen, denen Barnum es gestattete, ihn Taylor zu nennen. Niemand nannte Barnum »Phineas«. Er war nach seinem Großvater benannt worden, doch sein Großvater war Phin, und Barnum war für alle immer nur Barnum, außer für seine Frau, Levi und die Familie zu Hause in Bethel.
»Sieht das für dich aus wie eine Meerjungfrau?«, fragte Barnum, während er den dritten Mann mit leicht zusammengekniffenen Augen ansah. Dieser, Moses Kimball, trat von einem Fuß auf den anderen und blickte Levi hoffnungsvoll an.
Levi hielt nicht viel von der Meerjungfrau, das sah Barnum ihm an. Moses würde gleich eine Enttäuschung erleben.
»Nun, Taylor«, sagte Levi bedächtig. »Ich bin Anwalt, kein Naturforscher, aber ich würde sagen, das Ding sieht aus wie ein Affe, dem man einen Fischschwanz angenäht hat.«
Und das war eine ziemlich genaue Beschreibung. Es war einen knappen Meter lang, mit dürren Ärmchen, einem verschrumpelten Gesicht und hängenden Brüsten, am ganzen Körper mit schwarzgrauer Haut bedeckt, die aussah, als könnte sie jeden Moment abblättern. Die untere Hälfte erinnerte nicht an den koketten silbrig glänzenden Schwanz aus den Legenden, sondern sah definitiv aus wie bei einem ganz ordinären Speisefisch. Und es wirkte nicht mal besonders gut erhalten.
Barnum nickte zufrieden. Er hatte gern recht, und mit seiner Einschätzung, dass dieses Ding da keine Meerjungfrau war, hatte er recht gehabt, ebenso wie mit der Vermutung, dass Levi nicht viel davon hielt. »Also keine Meerjungfrau.«
Levi schüttelte den Kopf. »Ich würde sagen: nein.«
Da ergriff Moses Kimball das Wort, und seine Miene verriet, dass er seinen Ruf als Museumsinhaber gefährdet sah. Sein dicker, buschiger Bart bewegte sich auf und ab, während er sprach.
»Der Mann, von dem ich es gekauft habe, Eades, sagt, sein Vater habe es in England mit großem Erfolg ausgestellt.«
»Das mag ja sein«, sagte Barnum und betrachtete weiter nachdenklich die angebliche Meerjungfrau. »Das mag ja sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das hier nichts als ein Schwindel ist.«
Moses wirkte geknickt. Barnum ahnte, dass er sich anstrengen musste, um die Fassung zu wahren.
»Ich könnte es hier ebenfalls mit großem Erfolg ausstellen«, versuchte er es ein weiteres Mal, nun mit einem Hauch von Verzweiflung in der Stimme; er wollte die weite Reise aus Boston nicht vergebens unternommen haben. »Die Leute wollen an Meerjungfrauen glauben.«
Barnum wusste das besser als alle anderen. Er wusste, dass Menschen gern etwas glauben und etwas Außergewöhnliches sehen wollten. Er wusste sogar, dass sie es manchmal auch genossen, beschwindelt zu werden. Diese ganzen Geschichten in den New Yorker Zeitungen über geflügelte Menschen auf dem Mond, die man durch ein Teleskop beobachtet hatte! Alle hatten das geglaubt, und niemand hatte sich wirklich daran gestört, als es sich als unwahr herausgestellt hatte.
Es lag daran, dass die Leute bei aller Entschlossenheit, glauben zu wollen, doch stets auch zweifelten. Mit einer Mischung aus Glauben und etwas Skeptizismus konnte man nie vollkommen danebenliegen. Niemand lag gern vollkommen daneben. Die meisten Leute zogen es vor, beschwindelt statt dreist belogen zu werden. Wenn sie hereingelegt wurden, war es nicht ihr Fehler, und sie konnten immer sagen, dass sie sowieso nie wirklich daran geglaubt hatten.
Wahrscheinlich könnte er sogar irgendetwas aus diesem ausgestopften Affen herausholen, den ihm Moses da gebracht hatte – es wäre nicht das erste Mal, dass er aus nichts etwas machte –, aber er konnte doch eine gewisse Enttäuschung nicht verhehlen.
Er hatte etwas Spektakuläres gewollt. Das hier war nicht spektakulär. Es war mickrig.
»Was, wenn wir ein Mädchen mit einem Fischkostüm in ein Aquarium setzen?«, fragte Barnum Levi. »Wir könnten sie zusammen mit Fischen und den Walskeletten präsentieren. Wenn man sie da mit alldem sieht, muss man einfach an Meerjungfrauen glauben.«
Levi dachte eine Weile über den Vorschlag nach, bevor er bedauernd den Kopf schüttelte. »Mit einem barbusigen Mädchen in einem Aquarium forderst du mit Sicherheit ein paar Kirchgänger heraus.«
Barnum tat den Einwand mit einer Geste ab. »Wir können ihr Muscheln oder so was anziehen. Das wird den Kirchenladys genügen.«
»Und was ist jetzt mit meiner Meerjungfrau?«, fragte Moses. Die Enttäuschung hatte sich schwer wie ein Umhang um seine Schultern gelegt.
Barnum wusste, dass Moses an die lange Reise von seinem Museum in Boston dachte, die vergebens gewesen wäre, wenn Barnum den Affenfisch nicht in New York ausstellen wollte.
»Ich denke darüber nach«, sagte Barnum. »Vielleicht können wir sie zusammen mit dem Mädchen im Aquarium zeigen. Als Körper eines ihrer Vorfahren oder so.«
Moses Gesicht hellte sich ein wenig auf.
»Wenn du ein Mädchen in ein Aquarium setzen willst«, sagte Moses, sichtlich besser gelaunt, »solltest du eins von weit weg nehmen. Nicht dass die Familie sich noch beschwert und an die Zeitungen geht, um dich zu entlarven.«
»Selbst dann bin ich nicht sicher, dass es funktionieren würde«, wandte Levi ein. »Wie lange kann so ein Mädchen unter Wasser den Atem anhalten? Und du brauchst schon viel Glück, um eine zu finden, die auch schwimmen kann. Die meisten Frauen können es nicht, weißt du. Die meisten Männer übrigens auch nicht.«
»Du machst heute alle meine Pläne nieder«, murrte Barnum und sah ihn stirnrunzelnd an.
»Ein Mädchen in einem Becken mit Meerwasser schwimmen zu lassen ist nicht dasselbe, wie ein verschrumpeltes altes Waschweib in ein Zimmer zu setzen und zu behaupten, sie sei Washingtons Kindermädchen. Es ist sehr viel aufwändiger. Erst mal musst du ein passendes Mädchen finden, und ich bin sicher, dass die Sorte, die bereit ist, halb nackt in einem Aquarium herumzuschwimmen, nicht von der Sorte ist, die du mit einer Zeitung reden lassen willst«, erklärte Levi. Seine Miene war ruhig, aber seine Stimme klang verärgert. »Und beim letzten Mal sind wir am Ende aufgeflogen. Sie werden leicht bereit sein zu behaupten, dass Barnum ihnen wieder einen Bären aufbinden will.«
Barnum ließ sich nur ungern daran erinnern, wie die Ausstellung mit Joice Heth ausgegangen war. Sie hatten sie als Washingtons Kindermädchen verkauft, und am Ende war sie anscheinend doch nicht so alt gewesen, wie sie angepriesen worden war, aber das war nun wirklich nicht Barnums Fehler gewesen. Schließlich war er ja der Erste gewesen, den man belogen hatte. Ganz abgesehen davon hätte Levi das niemals in Moses’ Gegenwart zur Sprache bringen dürfen.
»Überlass die Details nur mir«, sagte Barnum und bedachte Levi mit einem finsteren Blick. »Erst mal müssen wir ein Mädchen finden, das aussieht, als käme es aus dem Meer.«