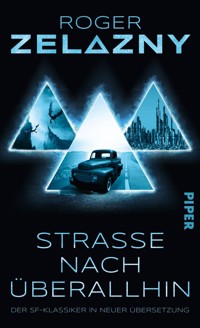19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von Amber
- Sprache: Deutsch
»Das Farbigste, Exotischste und Unvergesslichste, was unser Genre je gesehen hat.« George R. R. Martin Die Hobbit Presse Gold Edition umfasst alle fünf Teile der »Chroniken von Amber« von Roger Zelazny und gibt einen Einblick in die Machenschaften und Intrigen des Königshauses von Amber. Die Limited Edition mit mehr als 1300 Seiten ist nur für begrenzte Zeit lieferbar. Als Corwin nach einem Autounfall in einer Klinik in New York aufwacht, kann er sich an nichts erinnern. Schnell findet er heraus, dass er eigentlich Mitglied der großen Königsfamilie von Amber ist. Corwin setzt alles daran, nach Amber zurückzukehren. Dabei lernt er, dass die Erde Teil der Schattenwelten ist und nur Nachfahren der Königsfamilie zwischen den Welten der Erde und Amber hin und her reisen können. In Amber selbst bereitet sich alles auf einen Krieg vor, denn König Oberon, Corwins Vater, ist verschwunden und der Thron verwaist. Corwins Bruder Eric will um jeden Preis die Macht über Amber erlangen, doch auch seine anderen Geschwister haben dasselbe Ziel. Der fesselnde Kampf um die Thronfolge, voller Intrigen und Hass, wird über die Zukunft von Amber und der Geschwister entscheiden. Dieses E-Book enthält: - Die neun Prinzen von Amber - Die Gewehre von Avalon - Im Zeichen des Einhorns - Die Hand Oberons - Die Burgen des Chaos
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1454
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ROGER ZELAZNY
DIE CHRONIKEN VON AMBER
GOLDEDITION
DIE GESAMTE SAGA
Inhalt
Dieses E-Book enthält die folgenden Bände aus der Reihe „Die Chroniken von Amber“:
Die neun Prinzen von Amber (Band 1)
Die Gewehre von Avalon (Band 2)
Im Zeichen des Einhorns (Band 3)
Die Hand Oberons (Band 4)
Die Burgen des Chaos (Band 5)
Roger Zelazny
Die Chroniken von Amber
1
DIE NEUN PRINZEN VON AMBER
Aus dem Englischen von Thomas Schlück
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Übersetzung wurde für diese Neuausgabe vollständig überarbeitet.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Nine Princes in Amber« im Verlag Gollancz, London
© 1970 by The Amber Corporation
Für die deutsche Ausgabe
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Birgit Gitschner, Augsburg
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98127-8
E-Book: ISBN 978-3-608-10981-8
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1.
Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, zeichnete sich das Ende ab.
Ich versuchte, die Zehen zu bewegen, erfolgreich. Ich lag in einem Krankenhausbett, und meine Beine waren von Gipsverbänden umschlossen, doch sie gehörten immer noch mir.
Ich kniff dreimal die Augen zusammen und öffnete sie wieder.
Das Zimmer hörte auf zu schwanken.
Wo zum Teufel war ich?
Dann verzog sich der Nebel allmählich, und etwas von dem, was Gedächtnis genannt wird, kehrte zurück. Ich erinnerte mich an Nächte, Nachtschwestern und Nadeln. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen klarer im Kopf wurde, kam jemand herein und stach mich. So war es bisher gewesen. Doch nun fühlte ich mich wieder einigermaßen. Sie würden jetzt damit aufhören.
Oder etwa nicht?
Blitzartig kam mir der Gedanke: Vielleicht nicht.
Mich beschlich eine natürliche Skepsis hinsichtlich der Reinheit menschlicher Motive und legte sich mir schwer auf die Brust. Plötzlich wurde mir klar, dass ich Überdosen von Beruhigungsmitteln erhalten hatte. So wie ich mich fühlte, war das ohne guten Grund geschehen, und es gab auch keinen Grund, jetzt damit aufzuhören, falls sie dafür bezahlt worden waren. Also ruhig bleiben und sich schlafend stellen, sagte eine Stimme, die mein schlimmstes, aber auch schlaueres Ich vertrat.
Danach handelte ich.
Etwa zehn Minuten später steckte eine Schwester den Kopf durch den Türspalt, während ich – natürlich – laut schnarchte. Sie verschwand wieder.
Inzwischen hatte ich einige Bruchstücke der Ereignisse rekonstruiert.
Ich erinnerte mich vage, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Was danach geschehen war, konnte ich noch nicht recht erfassen, und die Ereignisse davor waren mir völlig entfallen. Aber ich war zuerst in einem Krankenhaus gewesen und dann an diesen Ort gebracht worden. Warum? Ich wusste es nicht.
Meine Beine fühlten sich jedenfalls ganz brauchbar an. Ich konnte notfalls darauf stehen, wenn ich auch nicht wusste, wie alt die Brüche waren – und ich war sicher, dass sie gebrochen gewesen waren.
Ich richtete mich also auf. Da meine Muskeln erschlafft waren, kostete mich das große Anstrengung. Draußen war es dunkel, und eine Handvoll Sterne schien klar vor meinem Fenster. Ich erwiderte ihr Blinzeln und schob die Beine über die Bettkante.
Zuerst wurde mir schwindlig, doch nach einer Weile beruhigte ich mich und stand auf, wobei ich mich am Kopfende des Bettes festhielt. Dann machte ich meine ersten Schritte.
Gut. Ich stand wieder.
Theoretisch war ich also in der Verfassung, diesen Ort zu verlassen.
Ich tastete mich zum Bett zurück, legte mich hin und dachte nach, schwitzend und zitternd. Mit Visionen von kandierten Pflaumen.
Etwas war faul im Staate Dänemark … Es musste ein Autounfall gewesen sein, fiel mir wieder ein. Ein ziemlich schwerer …
Im nächsten Augenblick öffnete sich die Tür, Licht schien herein. Durch die gesenkten Wimpern sah ich eine Schwester mit einer Injektionsspritze in der Hand.
Sie näherte sich dem Bett, ein gutgebautes Mädchen mit dunklem Haar und kräftigen Armen.
Als sie bei mir war, richtete ich mich auf.
»Guten Abend«, sagte ich.
»Oh – guten Abend«, erwiderte sie.
»Wann komme ich hier raus?«, wollte ich wissen.
»Das muss ich den Arzt fragen.«
»Tun Sie das.«
»Bitte rollen Sie den Ärmel hoch.«
»Nein, danke.«
»Ich muss Ihnen eine Injektion geben.«
»Nein. Brauche ich nicht.«
»Ich fürchte, das muss der Arzt entscheiden.«
»Dann schicken Sie ihn her, damit er’s entscheiden kann. Aber bis dahin werde ich es nicht zulassen.«
»Ich habe leider meine Anweisungen.«
»Die hatte Eichmann auch – und Sie wissen ja, was mit dem passiert ist.« Ich schüttelte langsam den Kopf.
»Also gut«, sagte sie. »Ich muss das natürlich melden …«
»Bitte tun Sie das«, erwiderte ich, »und sagen Sie ihm auch gleich, dass ich beschlossen habe, Sie morgen früh zu verlassen.«
»Unmöglich! Sie können ja nicht mal gehen – und Sie haben innere Verletzungen …«
»Das werden wir sehen. Gute Nacht.«
Sie verschwand wortlos.
Ich lag in meinem Bett und überlegte. Offenbar befand ich mich in einer Art Privatklinik – es musste also jemanden geben, der für die Pflege aufkam. Wen kannte ich? Ich konnte mich an keine Verwandten erinnern. Auch nicht an Freunde. Was blieb dann noch? Feinde?
Ich dachte eine Zeitlang nach.
Nichts.
Niemand, der mir so wohlgesonnen war.
Plötzlich fiel mir ein, dass ich mit dem Wagen über einen Steilhang in einen See gerast war. Aber an mehr erinnerte ich mich nicht.
Ich war …
Ich strengte mich an und begann von neuem zu schwitzen.
Ich wusste nicht, wer ich war.
Um mich zu beschäftigen, richtete ich mich auf und wickelte alle Bandagen ab. Darunter schien alles in Ordnung zu sein; offenbar tat ich das Richtige. Den Gips an meinem rechten Bein zerbrach ich mit einer Metallstange, die ich vom Kopfteil des Bettes löste. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass ich mich beeilen musste, dass es etwas zu erledigen gab.
Ich bewegte mein rechtes Bein. Alles in Ordnung.
Ich zerschlug auch den Gipsverband am anderen Bein, stand auf und ging zum Schrank.
Keine Kleidung drin.
Dann hörte ich die Schritte. Ich kehrte zum Bett zurück und deckte die zerbrochenen Gipsstücke und abgelegten Bandagen zu.
Wieder schwang die Tür auf.
Im nächsten Augenblick war ich in Licht gebadet, und ein stämmiger Bursche in einer weißen Jacke stand vor mir, die Hand am Schalter.
»Was höre ich da, Sie machen der Schwester das Leben schwer?«, fragte er und ich wusste, dass es sinnlos war, mich weiter schlafend zu stellen.
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Was haben Sie denn gehört?«
Das beschäftigte ihn für einen Moment, wie sein Stirnrunzeln andeutete. Dann: »Es ist Zeit für Ihre Spritze.«
»Sind Sie Arzt?«, fragte ich.
»Nein, aber ich bin befugt, Ihnen eine Spritze zu geben.«
»Und ich lehne das ab, wie es mir dem Gesetz nach zusteht. Was nun?«
»Sie bekommen Ihre Spritze«, sagte er und ging zur linken Seite des Bettes hinüber. In der Hand hielt er eine Spritze, die er bislang hinter sich versteckt hatte.
Es war ein gemeiner Tritt, vier Zoll unter der Gürtellinie, würde ich schätzen. Er ging sofort in die Knie.
»…!«, sagte er nach einer Weile.
»Wenn Sie mir noch einmal zu nahe kommen«, erwiderte ich, »können Sie sich auf was gefasst machen.«
»Wir wissen, wie man mit Patienten wie Ihnen umgeht«, keuchte er.
Ich wusste also, dass ich handeln musste.
»Wo sind meine Kleider?«, fragte ich.
»…!«, wiederholte er.
»Dann muss ich wohl Ihre Sachen nehmen. Ziehen Sie sich aus.«
Da es beim dritten Mal schon etwas langweilig wurde, warf ich ihm einfach das Bettzeug über den Kopf und schlug ihn mit der Metallstange bewusstlos.
Nach etwa zwei Minuten war ich von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet, eine Mischung aus Moby Dick und Vanilleeis. Hässlich.
Ich schob den Burschen in den Schrank und blickte durch das vergitterte Fenster. Vollmond über einer Pappelreihe. Das Gras funkelte silbrig. Die Nacht kämpfte ein Rückzugsgefecht gegen die Sonne. Es gab keinen Hinweis darauf, wo die Klinik lag. Ich schien mich allerdings im zweiten Stock des Gebäudes zu befinden. Weiter unten zu meiner Linken leuchtete ein helles Viereck im Erdgeschoss, wo offensichtlich noch jemand wach war.
Ich verließ also das Zimmer und schaute mir den Flur an. Links endete der Gang an einer Wand mit einem Gitterfenster, davor waren vier weitere Türen zu sehen, zwei auf jeder Seite. Wahrscheinlich weitere Zimmer wie meins. Ich ging nach links, blickte aus dem Fenster und sah noch mehr Grasflächen und Bäume, noch mehr Nacht – nichts Neues. Schließlich machte ich kehrt und lief in die andere Richtung.
Zahlreiche Türen und kein Licht darunter zu sehen, das einzige Geräusch kam von meinen zu großen geborgten Schuhen.
Die Armbanduhr des lustigen Burschen verriet mir, dass es Viertel vor sechs war. Die Metallstange, die ich unter der weißen Jacke in den Gürtel gesteckt hatte, scheuerte mir beim Gehen am Hüftknochen. Etwa alle zwanzig Fuß leuchtete eine schwache Deckenlampe.
Ich erreichte eine Treppe, die zur Rechten nach unten führte. Ich ging hinab. Die Stufen waren mit Teppichboden ausgelegt.
Die erste Etage sah aus wie meine – reihenweise Zimmer, also ging ich weiter.
Als ich das Erdgeschoss erreichte, wandte ich mich nach rechts und suchte nach der Tür mit dem Lichtstreifen.
Ich fand sie fast am Ende des Korridors und machte mir nicht die Mühe anzuklopfen.
Ein Mann saß in einem schreiend bunten Morgenmantel an einem großen polierten Tisch und blätterte eine Art Register durch. Dies war kein Stationszimmer. Er sah mich an, seine Lippen öffneten sich zu einem Schrei, der nicht kam, was wohl an meinem entschlossenen Gesichtsausdruck lag. Hastig stand er auf.
Ich schloss die Tür hinter mir und trat vor.
»Guten Morgen«, sagte ich. »Machen Sie sich auf Schwierigkeiten gefasst.«
Wenn es um Schwierigkeiten geht, sind die Leute immer neugierig; nach den drei Sekunden, die ich benötigte, um das Zimmer zu durchqueren, wollte er wissen: »Was meinen Sie?«
»Ich meine«, fuhr ich fort, »dass Sie einen Prozess an den Hals bekommen, weil Sie mich meiner Freiheit beraubt haben, einen zweiten Prozess wegen unsachgemäßer Führung der Klinik, insbesondere wegen des Mißbrauchs von Betäubungsmitteln. Ich habe bereits Entzugserscheinungen und wäre durchaus fähig, gewalttätig zu werden …«
Er stand auf. »Verschwinden Sie!«
Ich entdeckte eine Packung Zigaretten auf seinem Tisch und griff zu. »Setzen Sie sich und seien Sie still. Wir haben einiges zu besprechen.«
Er setzte sich, war aber immer noch nicht still.
»Sie übertreten gerade mehrere Vorschriften«, sagte er.
»Dann sollten wir das Gericht entscheiden lassen, wer dafür zu belangen ist«, erwiderte ich. »Ich möchte meine Kleidung und meine persönlichen Wertsachen zurückhaben. Ich verlasse die Klinik.«
»Ihr Zustand erlaubt es nicht –«
»Niemand hat Sie um Ihre Meinung gebeten. Tun Sie, was ich Ihnen sage – oder verantworten Sie sich vor dem Gesetz!«
Er versuchte, einen Knopf auf dem Tisch zu drücken, doch ich schlug seine Hand zur Seite.
»Also wirklich!«, sagte ich. »Den hätten Sie drücken sollen, als ich hereinkam. Jetzt ist es zu spät.«
»Mr. Corey, Sie sind höchst widerspenstig …
Corey?
»Ich habe mich hier nicht eingeliefert«, bemerkte ich, »aber ich habe verdammt nochmal das Recht, mich zu entlassen. Und jetzt ist der richtige Moment dafür. Also los!«
»Ihr Zustand erlaubt es nicht, diese Klinik zu verlassen«, sagte er. »Ich kann das nicht gestatten. Ich werde jetzt jemanden rufen, der Sie auf Ihr Zimmer zurückbegleitet und ins Bett bringt.«
»Versuchen Sie das lieber nicht, sonst bekommen Sie gleich zu spüren, in welchem Zustand ich bin! Doch bevor ich gehe, habe ich noch ein paar Fragen: Wer hat mich hier eingeliefert, und wer zahlt für mich?«
»Also gut«, seufzte er, und sein winziger, sandfarbener Schnurrbart senkte sich bedrückt herab.
Er öffnete eine Schublade und steckte die Hand hinein, doch ich war auf der Hut.
Ich schlug seinen Arm zur Seite, bevor er die Waffe entsichert hatte – eine .32 Automatik, sehr hübsch, ein Colt. Ich nahm ihn in die Hand, legte die Sicherung um, zielte auf seine Nasenspitze und sagte: »Beantworten Sie gefälligst meine Fragen. Offensichtlich halten Sie mich für gefährlich. Da könnten Sie durchaus recht haben.«
Er lächelte schwach und zündete sich ebenfalls eine Zigarette an, was ein Fehler war, wenn er damit Gelassenheit demonstrieren wollte. Seine Hände zitterten.
»Also gut, Mr. Corey, wenn Sie dann zufrieden sind«, sagte er. »Sie wurden von Ihrer Schwester hier angemeldet.«
In meinem Kopf bildete sich ein großes Fragezeichen.
»Welche Schwester?«
»Evelyn.«
Bei mir klingelte nichts. »Das ist lächerlich. Ich habe Evelyn seit Jahren nicht mehr gesehen. Sie wusste nicht einmal, dass ich in der Gegend war.«
Er zuckte mit den Schultern. »Nichtsdestotrotz …«
»Wo ist sie jetzt? Ich will sie anrufen«, forderte ich.
»Ich habe ihre Anschrift nicht griffbereit.«
»Holen Sie sie.«
Er stand auf, ging zu einem Aktenschrank, öffnete ihn, blätterte und zog eine Karte heraus.
Ich sah mir die Eintragung an. Mrs. Evelyn Flaumel … Die New Yorker Adresse sagte mir ebenfalls nichts, doch ich merkte sie mir. Aus der Karte ging noch hervor, dass mein Vorname Carl lautete. Gut. Weitere Informationen.
Ich sicherte die Waffe und steckte sie neben die Stange in meinen Gürtel.
»Also gut. Wo sind meine Kleider, und was werden Sie mir zahlen?«
»Ihre Kleidung wurde bei dem Unfall zerstört, und ich muss Ihnen außerdem sagen, dass beide Beine gebrochen waren – das linke sogar doppelt. Offen gesagt ist mir schleierhaft, wie Sie überhaupt stehen können. Sie sind erst vor zwei Wochen –«
»Meine Wunden heilen eben schnell. Aber jetzt zum Geld …«
»Was für Geld?«
»Die außergerichtliche Erledigung der Klage wegen Behandlungsfehlern und das andere.«
»Sie sind wohl verrückt!«
»Wer ist hier verrückt? Ich bin mit tausend in bar zufrieden, zahlbar sofort.«
»Vergessen Sie’s.«
»Nun, ich rate Ihnen, sich die Sache lieber noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen – überlegen Sie nur, was das für den Ruf Ihrer Klinik bedeutet, wenn ich vor dem Prozess genug Presse bekomme. Ich werde mich an die Amerikanische Ärztevereinigung wenden, an die Zeitungen, die –«
»Das ist Erpressung. Darauf lasse ich mich nicht ein.«
»Zahlen Sie jetzt oder später, auf Gerichtsbeschluss. Mir ist das egal. Aber so ist es billiger.«
Wenn er jetzt mitmachte, waren meine Vermutungen nicht ganz aus der Luft gegriffen und hier war tatsächlich etwas faul.
Er starrte mich finster an.
»Tausend habe ich nicht hier«, sagte er schließlich.
»Schlagen Sie einen Kompromiss vor.«
»Das ist Diebstahl«, sagte er nach einer weiteren Pause.
»Nicht, wenn ich’s selbst abhole, Idiot. Also her damit.«
»Kann sein, dass ich fünfhundert im Safe habe.«
»Holen Sie’s.«
Nachdem er den Inhalt eines kleinen Wandsafes inspiziert hatte, verkündete er, er habe vierhundertdreißig Dollar. Da ich keine Fingerabdrücke auf dem Safe hinterlassen wollte, akzeptierte ich den Betrag und stopfte mir die Scheine in die Jackentasche.
»Wie heißt die Taxigesellschaft hier?«
Er nannte einen Namen, und ich suchte im Telefonbuch danach. Anscheinend befanden wir uns im Norden des Staates New York.
Ich ließ ihn das Taxi rufen, denn ich hatte keine Ahnung, wie die Klinik hieß, und wollte ihm nicht zeigen, wie wenig ich wusste. Schließlich hatte ich eine Bandage um den Kopf gehabt.
Als er den Wagen bestellte, nannte er den Namen der Klinik: Greenwood Private Hospital.
Ich drückte meine Zigarette aus, nahm eine zweite und entlastete meine Füße von gut neunzig Kilo, indem ich mich in einen braunen Sessel neben seinem Bücherregal sinken ließ.
»Wir warten hier. Sie bringen mich dann zur Tür«, sagte ich.
Er redete kein Wort mehr mit mir.
2.
Es war ungefähr acht Uhr, als mich das Taxi an irgendeiner Straßenecke der nächstgelegenen Stadt absetzte. Ich bezahlte den Fahrer und wanderte zwanzig Minuten lang ziellos umher. Dann machte ich in einem Schnellrestaurant Halt, bestellte Saft, Eier, Toast, Speck und drei Tassen Kaffee. Der Speck war zu fett.
Nachdem ich meine Frühstückspause auf über eine Stunde ausgedehnt hatte, machte ich mich wieder auf den Weg, fand ein Kleidergeschäft und wartete, bis es um halb zehn Uhr öffnete.
Ich kaufte ein paar Hosen, drei Sporthemden, einen Gürtel, etwas Unterwäsche und ein Paar passende Schuhe. Außerdem suchte ich mir ein Stofftaschentuch, eine Brieftasche und einen Taschenkamm aus.
Anschließend ging ich zur Greyhound-Station und stieg in einen Bus nach New York City. Niemand versuchte mich aufzuhalten. Niemand schien nach mir zu suchen.
Während ich die vorbeirauschende Landschaft betrachtete, die in bunten Herbstfarben leuchtete und unter einem hellen, kalten Himmel von frischen Windböen durchweht wurde, ließ ich mir all die Dinge, die ich über mich und meine Lage wusste, durch den Kopf gehen.
Ich war von meiner Schwester Evelyn Flaumel als Carl Corey in Greenwood eingeliefert worden. Dies war als Folge eines Autounfalls geschehen, der etwa zwei Wochen zurücklag und bei dem ich mir angeblich Knochenbrüche zugezogen hatte, die mir aber keine Schwierigkeiten mehr machten. Ich hatte keinerlei Erinnerung an eine Schwester namens Evelyn. Die Leute in Greenwood waren angewiesen worden, mich ruhig zu halten, fürchteten aber rechtliche Konsequenzen, als ich mich befreien konnte und ihnen damit drohte. Also gut. Irgendjemand hatte Angst vor mir – aus irgendeinem Grund. An diesem Punkt wollte ich einhaken.
Ich zwang mich, an den Unfall zu denken, konzentrierte mich darauf, bis ich Kopfschmerzen bekam. Es war kein Unfall gewesen. Diesen Eindruck hatte ich, obwohl ich den Grund nicht kannte. Aber ich würde es herausfinden, und jemand würde dafür büßen. Gewaltig büßen! Ein ungeheurer Zorn flammte in mir auf. Jeder, der mir Schaden zufügen wollte, der mich für seine Zwecke einspannen wollte, handelte auf eigene Gefahr und würde seine gerechte Strafe erhalten, wer auch immer dahinterstecken mochte. Ich fühlte ein starkes Verlangen zu töten, die Verantwortlichen zu vernichten, und ich wusste, dass ich diese Gefühle nicht zum ersten Mal hatte, dass ich diesem Impuls in der Vergangenheit schon nachgegeben hatte. Mehr als einmal.
Ich starrte aus dem Fenster und sah zu, wie die toten Blätter von den Bäumen fielen.
Als ich New York erreichte, suchte ich als erstes den nächsten Frisiersalon auf und ließ mich rasieren und mir die Haare schneiden; anschließend wechselte ich auf der Toilette Hemd und Unterhemd, denn ich mag es nicht, Haarreste auf dem Rücken zu haben. Die .32 Automatik, die dem namenlosen Individuum in Greenwood gehörte, ruhte in meiner rechten Jackentasche. Wenn Greenwood oder meine Schwester mich wieder schnappen wollten, würde ihnen eine Übertretung des Waffengesetzes gerade recht kommen. Dennoch beschloss ich, die Waffe zu behalten. Sie müssten mich zuerst einmal finden, und ich wollte gewappnet sein. Ich aß kurz zu Mittag, fuhr eine Stunde lang mit Subway und Bussen herum, und nahm schließlich ein Taxi, das mich zu der Adresse in Westchester brachte, zu Evelyn, meiner angeblichen Schwester, die hoffentlich mein Gedächtnis etwas auftauen würde.
Schon vor meiner Ankunft hatte ich mir eine Taktik zurechtgelegt.
Als die Tür des großen Hauses dreißig Sekunden nach meinem Klopfen aufschwang, wusste ich also, was ich sagen wollte. Ich hatte darüber nachgedacht, während ich die gewundene weiße Kiesauffahrt hinaufging, zwischen dunklen Eichen und hellschimmernden Ahornbäumen, während unter meinen Füßen das Laub raschelte und mir der Wind kühl um den frischgeschorenen Hals im hochgeschlagenen Jackenkragen strich. Der Duft meines Haarwassers vermischte sich dabei mit dem dumpfen Geruch der Efeuranken, die sich an den Mauern des alten Gebäudes hochzogen. Nichts kam mir vertraut vor. Ich hatte den Eindruck, noch nie hier gewesen zu sein.
Als ich klopfte, hatte es ein Echo gegeben.
Dann hatte ich die Hände in die Taschen gesteckt und gewartet.
Als die Tür aufging, lächelte ich und nickte dem Hausmädchen entgegen; sie hatte zahlreiche Leberflecken, dunkle Haut und einen puertoricanischen Akzent.
»Ja?«, fragte sie.
»Ich möchte bitte Mrs. Evelyn Flaumel sprechen.«
»Wen darf ich anmelden?«
»Ihren Bruder Carl.«
»Oh, kommen Sie doch bitte herein«, forderte sie mich auf.
Ich betrat den Flur. Der Boden war ein Mosaik aus winzigen lachs- und türkisfarbenen Kacheln, die Wände waren mahagoniverkleidet, in einem Raumteiler zu meiner Linken stand eine Wanne voll großblättriger Gewächse. Von oben spendete ein Würfel aus Glas und Emaille ein gelbliches Licht.
Das Mädchen verschwand, und ich suchte die Umgebung nach vertrauten Dingen ab.
Nichts.
Also wartete ich.
Schließlich kehrte das Hausmädchen zurück, nickte freundlich und sagte: »Bitte folgen Sie mir. Sie wird Sie in der Bibliothek empfangen.«
Ich folgte ihr drei Stufen hinauf und an zwei geschlossenen Türen vorbei durch einen Korridor. Die dritte Tür zur Linken war offen, und das Mädchen bedeutete mir einzutreten. Ich blieb auf der Schwelle stehen.
Wie alle Bibliotheken war der Raum voller Bücher. Drei Gemälde hingen an den Wänden, zwei ruhige Landschaften und ein friedlicher Meerblick. Der Boden war mit dickem grünem Teppich ausgelegt. Neben dem großen Schreibtisch stand ein riesiger alter Globus, Afrika war mir zugewendet; dahinter erstreckte sich ein zimmerbreites Fenster, in kleine Glasfelder unterteilt. Doch nicht deswegen hielt ich auf der Schwelle an.
Die Frau hinter dem Schreibtisch trug ein blaugrünes Kleid mit breitem Kragen und V-Ausschnitt, hatte langes Haar und einen ins Gesicht hängenden Pony in einer Farbe zwischen Sonnenuntergangswolken und der Außenseite einer Kerzenflamme in einem abgedunkelten Raum; es war ihre natürliche Haarfarbe, wie ich instinktiv wusste. Die Augen hinter ihrer Brille, die sie meinem Gefühl nach nicht brauchte, waren so blau wie der Lake Erie um drei Uhr an einem wolkenlosen Sommernachmittag, und die Tönung ihres gezwungenen Lächelns passte zu ihrem Haar. Doch nicht deswegen hielt ich auf der Schwelle an.
Ich kannte sie von irgendwoher, auch wenn ich nicht wusste, woher.
Lächelnd trat ich vor.
»Hallo«, sagte ich.
»Setz dich, bitte«, sagte sie und deutete auf einen Sessel mit hoher Lehne und breiten Armstützen, weich und orangefarben gepolstert und genau in dem Winkel zurückgeklappt, den ich bevorzugte, um es mir bequem zu machen.
Ich kam der Aufforderung nach, und sie musterte mich.
»Freut mich, dass du wieder auf den Beinen bist.«
»Mich auch. Wie ist es dir ergangen?«
»Gut, danke der Nachfrage. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet habe, dich hier zu sehen.«
»Ich weiß«, flunkerte ich. »Aber hier bin ich, um dir für deine schwesterliche Fürsorge zu danken.« Ich legte einen leicht ironischen Ton in meine Worte, weil mich ihre Reaktion interessierte.
In diesem Augenblick kam ein riesiger Hund ins Zimmer – ein irischer Wolfshund – und rollte sich vor dem Tisch zusammen. Ein zweiter folgte und kreiste zweimal um den Globus, ehe er sich ebenfalls hinlegte.
»Nun«, sagte sie genauso ironisch, »das war das Mindeste, was ich für dich tun konnte. Du musst eben vorsichtiger fahren.«
»In Zukunft werde ich vorsichtiger sein, versprochen.« Ich wusste nicht, welche Rolle ich hier eigentlich spielte, aber da sie nicht wusste, dass ich es nicht wusste, beschloss ich, sie gründlich auszuhorchen. »Ich hatte mir gedacht, es würde dich interessieren, wie es mir geht, und ich bin gekommen, damit du es mit deinen eigenen Augen sehen kannst.«
»Neugierig war ich tatsächlich – und bin es immer noch«, antwortete sie. »Hast du schon gegessen?«
»Eine Kleinigkeit vor mehreren Stunden.«
Sie klingelte nach dem Mädchen und bestellte etwas zu essen. Dann sagte sie: »Ich hatte mir schon gedacht, dass du Greenwood verlassen würdest, sobald du dazu in der Lage wärst. Allerdings hatte ich nicht angenommen, dass es so schnell gehen würde – geschweigen denn, dass du hierherkommen würdest!«
»Ich weiß«, erwiderte ich, »deshalb bin ich hier.«
Sie bot mir eine Zigarette an, ich nahm sie und gab uns beiden Feuer. »Du warst schon immer unberechenbar«, sagte sie schließlich. »Aber auch wenn dir das bisher oft geholfen hat, würde ich mich gerade lieber nicht mehr darauf verlassen.«
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Für einen Bluff ist die Gefahr viel zu groß, und für genau das halte ich deinen Auftritt hier. Ich habe deinen Mut stets bewundert, Corwin, aber sei kein Dummkopf. Du weißt doch, was auf dem Spiel steht.«
Corwin? Speichern unter »Corey«.
»Vielleicht weiß ich das nicht. Vergiss nicht, dass ich eine Weile geschlafen habe.«
»Soll das heißen, du hast keinen Kontakt mehr gehabt?«
»Seit meinem Erwachen hatte ich keine Gelegenheit dazu.«
Sie legte den Kopf auf die Seite und kniff ihre schönen Augen zusammen.
»Unwahrscheinlich«, sagte sie, »aber möglich. Immerhin möglich. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Bei dir wäre das denkbar. Ich will das einfach mal annehmen. Du hast möglicherweise sogar klug und vorsichtig gehandelt. Lass mich darüber nachdenken.«
Ich zog an meiner Zigarette und hoffte, dass sie noch mehr sagen würde. Aber da sie schwieg, wollte ich den möglichen Vorteil nutzen, den ich in diesem unverständlichen Spiel herausgeholt hatte – ein Spiel mit Spielern, die ich nicht kannte, und um Einsätze, von denen ich keine Ahnung hatte.
»Die Tatsache, dass ich hier bin, bedeutet etwas«, meinte ich.
»Ja«, erwiderte sie. »Ich weiß. Aber du bist schlau, also könnte dein Auftauchen viele Gründe haben. Warten wir’s ab, dann sehen wir klarer.«
Warten worauf? Um was zu sehen? Welche Gründe?
In diesem Augenblick wurden Steaks und ein großer Krug Bier gebracht. Dadurch war ich vorübergehend davon befreit, geheimnisvolle und allgemeingültige Äußerungen zu machen, die sie für raffiniert oder bedeutsam halten konnte. Mein Steak war sehr gut, innen rosa und sehr saftig. Ich zerriss mit den Zähnen hungrig das hartgeröstete Brot und schluckte durstig das Bier. Sie lachte, während sie kleine Bissen von ihrem Steak abschnitt.
»Mir gefällt es, wie du dein Leben genießt, Corwin. Das ist einer der Gründe, warum ich es schade fände, wenn du es verlieren würdest.«
»Ich auch«, murmelte ich.
Während des Essens dachte ich über sie nach. Ich sah sie in ihrem tief ausgeschnittenen Kleid, das so grün war wie das Grün des Meeres und sich unten schwungvoll weitete. Musik ertönte, es wurde getanzt, Stimmen murmelten hinter uns. Ich trug Schwarz und Silber, und … Die Vision verschwand. Aber es war ein wahres Stück aus meiner Erinnerung, davon war ich überzeugt; ich fluchte innerlich, dass mir das Gesamtbild fehlte. Was hatte sie mir damals nur gesagt, sie in ihrem Grün, ich in Schwarz und Silber, in jener Nacht, beim Klang der Musik und der Stimmen?
Ich schenkte Bier aus dem Krug nach und beschloss, die Vision auf die Probe zu stellen.
»Ich erinnere mich an einen Abend, als du von Kopf bis Fuß in Grün gekleidet warst, und ich trug meine Farben. Wie schön mir damals alles vorkam – und die Musik …«
Ihr Gesicht nahm einen sehnsüchtigen Ausdruck an, die Wangenmuskeln entspannten sich.
»Ja, war das nicht eine großartige Zeit? … Du hattest wirklich keinen Kontakt?«
»Ehrenwort«, sagte ich, was auch immer mein Wort wert sein mochte.
»Die Dinge sind viel schlimmer geworden, und die Schatten enthalten mehr Grauen, als man sich hat träumen lassen …«
»Und …?«, fragte ich.
»Er hat noch immer seine Sorgen«, endete sie.
»Oh.«
»Ja«, fuhr sie fort, »und er wird natürlich wissen wollen, wo du stehst.«
»Genau hier.«
»Soll das heißen …?«
»Wenigstens im Augenblick«, sagte ich, vielleicht ein wenig zu hastig, denn sie riss ihre Augen weit auf. »Schließlich habe ich noch keinen rechten Überblick.« Was immer das bedeuten mochte.
»Oh.«
Und wir aßen unsere Steaks auf und leerten die Biergläser und warfen den Hunden die Knochen zu.
Hinterher tranken wir Kaffee, und ich hatte vage brüderliche Gefühle, die ich unterdrückte. »Was ist mit den anderen?«, fragte ich. Das konnte alles bedeuten, klang aber ungefährlich.
Kurz fürchtete ich, sie könnte mich fragen, was ich meinte. Stattdessen lehnte sie sich in ihrem Sessel zurück, blickte zur Decke und sagte: »Wie immer hat man von keinem Neuen gehört. Vielleicht war deine Entscheidung doch die klügste. Ich habe ja selbst Spaß daran. Aber wie könnte man je die Pracht vergessen?«
Ich senkte den Blick, weil ich nicht sicher war, was ich hätte hineinlegen sollen. »Das kann man nicht«, sagte ich. »Niemals.«
Es folgte ein langes unbehagliches Schweigen. »Hasst du mich?«, fragte sie schließlich.
»Natürlich nicht«, erwiderte ich. »Wie könnte ich – nach allem, was geschehen ist?«
Diese Antwort schien sie zu freuen, und sie ließ ihre weißen Zähne blitzen.
»Gut, und vielen Dank. Was auch immer sonst sein mag, du bist auf jeden Fall ein Gentleman.«
Ich grinste und verbeugte mich.
»Du verdrehst mir noch den Kopf.«
»Sicher nicht«, meinte sie, »nach allem, was geschehen ist.«
Mir wurde unbehaglich zumute.
Der Zorn brannte nach wie vor in mir, und ich fragte mich, ob sie wusste, gegen wen er sich richten müsste. Ich hatte das Gefühl, dass sie es wusste. Ich kämpfte mit dem Wunsch, sie geradeheraus danach zu fragen, unterdrückte ihn aber.
»Und was gedenkst du zu tun?«, fragte sie schließlich, und damit war ich an der Reihe zu antworten.
»Natürlich vertraust du mir nicht …«
»Wie könnten wir?«
Das wir musste ich mir merken.
»Nun denn. Zunächst bin ich bereit, mich unter deine Fürsorge zu begeben. Ich würde gern hierbleiben, wo du mich im Auge behalten kannst.«
»Und später?«
»Später? Wir werden sehen.«
»Clever, sehr clever. Damit bringst du mich in eine unangenehme Lage.« (Ich hatte das vorgeschlagen, weil ich nicht wusste, wo ich sonst unterkommen sollte und das erpresste Geld mich nicht lange über Wasser halten würde.) »Natürlich darfst du bleiben. Aber ich möchte dich warnen« – bei diesen Worten betastete sie etwas an ihrer Halskette, das ich für eine Art Schmuckstück gehalten hatte – »das hier ist eine Ultraschallpfeife. Blitz und Donner haben vier Brüder, die darauf abgerichtet sind, sich um Störenfriede zu kümmern, und sie reagieren auf meine Pfeife. Versuch also nicht, irgendwohin zu gehen, wo du nicht erwünscht bist. Ein kleiner Pfiff, und sogar du bist erledigt. Diese Hunderasse ist der Grund, warum es in Irland keine Wölfe mehr gibt.«
»Ich weiß«, sagte ich und erkannte dabei, dass ich es tatsächlich wusste.
»Ja«, fuhr sie fort. »Es wird Eric gefallen, dass du mein Gast bist. Diese Tatsache müsste ihn dazu bringen, dich in Ruhe zu lassen, und darum geht es dir doch, n’est-ce pas?«
»Oui«, antwortete ich.
Eric! Der Name sagte mir etwas! Ich hatte tatsächlich einen Eric gekannt, und dies war einmal sehr wichtig gewesen. Allerdings nicht in letzter Zeit. Aber der Eric, den ich kannte, war noch immer da, und das war wichtig.
Warum?
Ich hasste ihn, das war einer der Gründe. Hasste ihn so sehr, dass ich mit dem Gedanken gespielt hatte, ihn umzubringen. Vielleicht hatte ich es sogar schon versucht.
Es gab außerdem eine Bindung zwischen uns, das wusste ich.
Waren wir verwandt?
Ja, das war’s! Keinem von uns gefiel es, dass wir – Brüder waren … ich erinnerte mich, ich erinnerte mich …
Der große, starke Eric mit seinem gekräuselten Bart und seinen Augen – die denen von Evelyn ähnlich sahen!
Eine neue Woge der Erinnerung durchfuhr mich, während meine Schläfen zu schmerzen begannen und mein Nacken sich plötzlich heiß anfühlte.
Ich ließ mir nichts anmerken und zwang mich, an meiner Zigarette zu ziehen und nach meinem Bier zu greifen. Dann wurde mir bewusst, dass Evelyn tatsächlich meine Schwester war! Nur hieß sie nicht Evelyn. Ihr richtiger Name wollte mir nicht einfallen, sie hieß jedenfalls nicht Evelyn. Ich beschloss, vorsichtig zu sein. Wenn ich sie anredete, würde ich lieber keinen Namen benutzen, bis mir der richtige einfiel.
Und was war mit mir? Was ging hier eigentlich vor?
Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass Eric etwas mit meinem Unfall zu tun hatte. Er hätte tödlich sein sollen, doch ich war durchgekommen. Er war derjenige, den ich suchte, oder? Ja, sagte mein Gefühl. Es musste Eric sein. Und Evelyn arbeitete mit ihm zusammen, hatte Greenwood bezahlt, um mich im Koma zu halten. Besser als tot zu sein, aber …
Mir dämmerte, dass ich mich irgendwie in Erics Gewalt begeben hatte, indem ich zu Evelyn kam, und dass ich, wenn ich blieb, sein Gefangener sein würde, einem neuen Angriff schutzlos ausgeliefert.
Doch Evelyn hatte angedeutet, dass mein Aufenthalt hier Eric dazu bringen würde, mich in Ruhe zu lassen. War das möglich? Im Grunde durfte ich niemandem vertrauen. Ich musste ständig auf der Hut sein. Vielleicht wäre es besser, wenn ich einfach verschwände und meine Erinnerungen langsam zurückkehren ließe.
Allerdings hatte ich ein beunruhigendes Gefühl der Dringlichkeit. Ich musste schnellstmöglich die ganze Geschichte in Erfahrung bringen und dann sofort handeln. Dieser Gedanke beherrschte mich. Wenn ich meine Erinnerungen nur unter Gefahr auffrischen konnte, wenn ich die richtige Gelegenheit nur im Risiko finden konnte, dann sollte es so sein. Ich würde bleiben.
»Und ich erinnere mich«, sagte Evelyn, und mir wurde bewusst, dass sie schon eine Weile gesprochen hatte, ohne dass ich ihr gefolgt war, was vermutlich an der Nachdenklichkeit in ihrer Stimme lag, die keine Reaktion erforderte, und daran, dass ich ganz in meinen Gedanken gefangen gewesen war.
»Und ich erinnere mich an den Tag, als du Julian bei seinem Lieblingsspiel besiegt hast und er ein Glas Wein nach dir schleuderte und dich verwünschte. Du nahmst den Preis trotzdem entgegen. Und er hatte auf einmal Angst, zu weit gegangen zu sein. Aber du hast nur gelacht und ein Glas mit ihm getrunken. Ich glaube, ihm tat sein Wutausbruch hinterher leid, wo er doch sonst so beherrscht ist, und ich glaube, er war an jenem Tag neidisch auf dich. Weißt du noch? Ich glaube, er hat dir seither vieles nachgemacht. Aber ich hasse ihn noch immer und hoffe, dass es ihn bald erwischt. Ich habe so ein Gefühl, als ob das gar nicht mehr lange dauern wird …«
Julian, Julian, Julian. Ja und nein. Die vage Erinnerung an ein Spiel, an die Verärgerung eines Mannes, dessen geradezu legendäre Selbstbeherrschung ich zerstört hatte. Ja, das alles war mir irgendwie vertraut; und nein, ich vermochte nicht zu sagen, worum es dabei genau gegangen war.
»Und Caine, den hast du richtig reingelegt! Er hasst dich immer noch, weißt du …«
Ich erkannte, dass ich nicht besonders beliebt war. Irgendwie gefiel mir diese Vorstellung.
Und Caine hörte sich ebenfalls vertraut an. Sehr sogar.
Eric, Julian, Caine, Corwin. Die Namen wirbelten mir im Kopf herum, und all das war zu viel für mich, um an mich zu halten.
»Es ist so lange her …«, sagte ich fast widerwillig, was aber zu stimmen schien.
»Corwin, reden wir nicht um den heißen Brei herum. Du willst mehr als Sicherheit, das weiß ich. Und du bist immer noch stark genug, etwas herauszuholen, wenn du deine Trümpfe richtig ausspielst. Ich habe keine Ahnung, was du im Schilde führst, aber vielleicht können wir mit Eric zu einem Arrangement kommen.« Die Bedeutung des wir hatte sich offenbar verändert. Sie war zu einem Urteil über meinen Wert gelangt, worum auch immer es ging. Sie sah eine Chance, etwas für sich selbst herauszuholen, das spürte ich. Ich lächelte, aber nicht zu sehr. »Bist du deshalb hergekommen?«, fuhr sie fort. »Hast du einen Vorschlag für Eric, etwas, das einen Mittler erfordert?«
»Kann durchaus sein«, antwortete ich, »wenn ich noch ein bisschen gründlicher darüber nachgedacht habe. Ich bin erst seit so kurzer Zeit wieder auf den Beinen, dass ich mir erstmal einiges durch den Kopf gehen lassen muss. Dabei möchte ich an dem Ort sein, wo ich am schnellsten handeln könnte, wenn ich zu dem Schluss käme, dass mir auf Erics Seite am besten gedient wäre.«
»Sieh dich vor. Du weißt, dass ich ihm jedes Wort weitererzähle.«
»Natürlich«, erwiderte ich, ohne zu wissen, worum es ging; ich musste nur schnell parieren. »Es sei denn, deine Interessen würden mit meinen übereinstimmen.«
Ihre Augenbrauen rückten enger zusammen, und dazwischen erschienen einige winzige Falten.
»Ich verstehe nicht ganz, was du mir vorschlägst.«
»Ich schlage dir gar nichts vor, noch nicht. Ich bin nur offen und ehrlich mit dir und sage, dass ich es noch nicht weiß. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ich mich mit Eric arrangieren möchte. Schließlich …« Ich ließ das Wort bewusst in der Luft hängen, denn ich hatte nichts zu ergänzen, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, ich müsste weitersprechen.
»Hat man dir eine Alternative geboten?« Sie stand plötzlich auf und ergriff ihre Pfeife. »Natürlich steckt Bleys dahinter!«
»Setz dich, und mach dich nicht lächerlich. Würde ich mich so bereitwillig in deine Hand begeben, nur um als Hundefutter zu enden, weil du zufällig an Bleys denkst?«
Sie entspannte sich, sank vielleicht sogar etwas in sich zusammen, und nahm dann wieder Platz.
»Vielleicht nicht«, sagte sie schließlich. »Aber ich weiß, dass du ein Spieler bist und hinterlistig sein kannst. Wenn du gekommen bist, um einen Gegner loszuwerden, solltest du das lieber seinlassen. So wichtig bin ich nicht, wie du inzwischen selbst wissen müsstest. Außerdem hatte ich bisher immer angenommen, dass du mich magst.«
»Das war und ist durchaus richtig und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber es ist interessant, dass du Bleys erwähnst.«
Ich musste Köder legen, mehr Köder! Es gab noch so viel zu erfahren!
»Warum? Hat er sich mit dir in Verbindung gesetzt?«
»Das möchte ich lieber nicht beantworten«, sagte ich in der Hoffnung, mir damit einen Vorteil zu verschaffen. Jedenfalls wusste ich nun Bleys’ Geschlecht. »Wenn er zu mir gekommen wäre, hätte ich ihm dasselbe gesagt wie Eric: Ich werde darüber nachdenken.«
»Bleys«, sagte sie noch einmal, und ich wiederholte im Geiste: Bleys. – Ich mag dich. Ich habe vergessen warum, und ich weiß, dass es Gründe gibt, warum ich dich nicht gernhaben sollte – aber ich mag dich, so viel ist klar.
Wir saßen uns eine Zeit lang stumm gegenüber, und ich fühlte eine große Müdigkeit in mir aufsteigen, die ich aber nicht zeigen wollte. Ich sollte stark sein. Ich wusste, dass ich stark sein musste.
Ich saß da, lächelte und sagte: »Hübsche Bibliothek hast du hier«, und sie erwiderte: »Vielen Dank.«
»Bleys«, wiederholte sie nach einer Weile. »Glaubst du wirklich, er hat eine Chance?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Wer weiß? Ich jedenfalls nicht. Vielleicht hat er eine. Vielleicht auch nicht.«
Daraufhin starrte sie mich mit leicht aufgerissenen Augen an, und ihr Mund öffnete sich.
»Was ist mit dir?«, fragte sie. »Du willst es doch nicht selbst versuchen, oder?«
Ich lachte, aber nur, um ihr etwas entgegenzusetzen.
»Sei doch kein Dummkopf«, sagte ich. »Ich?«
Doch schon als ihr die Worte über die Lippen kamen, wusste ich, dass sie eine besondere Saite berührt hatte, etwas in mir Vergrabenes, das mit einem kräftigen Warum denn nicht? antwortete.
Plötzlich hatte ich Angst.
Sie allerdings schien erleichtert über meine Ablehnung dieser Sache, über die ich nichts Näheres wusste. Sie lächelte und deutete auf eine eingebaute Bar zu meiner Linken.
»Ich hätte gern einen Irish Mist.«
»Ich auch, wenn wir schon dabei sind«, sagte ich, stand auf und mixte zwei Drinks.
»Weißt du«, fuhr ich fort, als ich mich wieder gesetzt hatte, »es ist angenehm, auf diese Weise mit dir zusammen zu sein, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Es weckt Erinnerungen.«
Und sie lächelte und war wunderschön.
»Du hast recht«, sagte sie und trank aus ihrem Glas. »In deiner Gesellschaft habe ich fast das Gefühl, in Amber zu sein.«
Ich ließ fast mein Getränk fallen.
Amber! Das Wort jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken.
Im nächsten Augenblick begann sie zu weinen, und ich stand auf und legte ihr tröstend den Arm um die Schultern.
»Weine nicht, kleine Schwester, bitte nicht. Das macht mich auch traurig.« Amber! Dieser Ort hatte etwas Besonderes, etwas Magisches und Machtvolles. »Es wird wieder gute Zeiten geben«, sagte ich leise.
»Glaubst du wirklich?«, fragte sie.
»Ja!«, sagte ich wieder laut. »Ja, das glaube ich.«
»Du bist verrückt. Vielleicht warst du deshalb immer mein Lieblingsbruder. Ich glaube dir fast alles, auch wenn ich weiß, dass du verrückt bist.«
Dann weinte sie noch ein Weilchen und beruhigte sich schließlich.
»Corwin«, sagte sie, »wenn du es doch schaffst – wenn dir eine unglaubliche, unvorstellbare Chance den Weg aus den Schatten ebnet – wirst du dann an deine kleine Schwester Florimel denken?«
»Ja«, sagte ich und begriff dabei, dass sie so hieß. »Ja, ich werde an dich denken.«
»Danke. Ich werde Eric nur das Wesentliche mitteilen und Bleys überhaupt nicht erwähnen, ebensowenig wie meinen neuesten Verdacht.«
»Vielen Dank, Flora.«
»Aber ich traue dir kein verdammtes bisschen«, fügte sie hinzu. »Daran solltest du auch denken.«
»Das versteht sich von selbst.«
Dann rief sie das Mädchen, das mir mein Zimmer zeigen sollte, und ich zog mich mühsam aus, sank ins Bett und schlief elf Stunden am Stück.
3.
Am nächsten Morgen war sie fort, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Das Hausmädchen servierte mir das Frühstück in der Küche und zog sich dann zurück, um ihren Pflichten nachzukommen. Ich hatte den Impuls unterdrückt, die Frau auszuhorchen, da sie die Dinge, die ich wissen wollte, entweder nicht verraten würde oder gar nicht wusste, und den Versuch zweifelsohne Flora gemeldet hätte. Da ich mich anscheinend im Haus frei bewegen konnte, beschloss ich stattdessen, in die Bibliothek zurückzukehren. Vielleicht konnte ich dort etwas in Erfahrung bringen. Außerdem mag ich Bibliotheken. Wände aus schönen und weisen Worten ringsum geben mir ein Gefühl von Behaglichkeit und Sicherheit. Mir ist immer viel wohler, wenn ich sehe, dass es etwas gibt, mit dem sich die Schatten zurückhalten lassen.
Donner oder Blitz – oder einer ihrer Verwandten – erschien von irgendwoher und folgte mir mit steifen Beinen durch den Flur und beschnüffelte meine Fährte. Ich versuchte mich mit ihm anzufreunden, kam mir dabei jedoch vor, als spräche ich mit einem Motorradpolizisten, der mich eben rausgewunken hatte. Unterwegs warf ich auch einen Blick in einige andere Zimmer, die aber einfach nur Zimmer waren, ganz harmlos.
Ich betrat also die Bibliothek, wo mir noch immer Afrika entgegenblickte. Ich schloss die Tür hinter mir, um die Hunde draußen zu halten, und schlenderte durch den Raum, während ich die Titel auf den Regalen studierte.
Es gab viele Geschichtsbücher. Diese schienen in ihrer Sammlung zu überwiegen. Daneben entdeckte ich zahlreiche Kunstbücher der großformatigen, teuren Sorte und blätterte einige durch. Ich kann am besten nachdenken, wenn ich mich mit etwas anderem beschäftige.
Ich fragte mich, woher Floras offensichtlicher Reichtum stammte. Wenn wir verwandt waren, bedeutete das, dass auch ich über irgendeine Form von Wohlstand verfügte? Ich dachte über meinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Status, über meinen Beruf und meine Herkunft nach. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir um Geld nie viel Sorgen gemacht und dass es immer genug gegeben hatte, oder Möglichkeiten es aufzutreiben, um mich zufriedenzustellen. Besaß ich ein großes Haus wie dieses? Ich konnte mich nicht erinnern.
Was machte ich beruflich?
Ich saß hinter ihrem Schreibtisch und durchforstete mein Gehirn nach besonderen Kenntnissen. Es ist schwierig, sich selbst auf diese Weise zu erkunden, als Fremden. Vielleicht war das der Grund, warum ich nichts fand. Was zu einem Menschen gehört, gehört eben ihm, ist ein Teil von ihm und scheint einfach dorthin zu gehören, ins Innere. Das ist alles.
Arzt? Der Gedanke kam mir, während ich einige anatomische Zeichnungen Da Vincis betrachtete. Fast automatisch war ich im Geiste die Schritte verschiedener chirurgischer Operationen durchgegangen. Mir wurde klar, dass ich in der Vergangenheit schon operiert hatte.
Doch das war es nicht. Während ich realisierte, dass ich eine medizinische Ausbildung hatte, wurde mir bewusst, dass diese zu etwas anderem gehörte. Irgendwie wusste ich, dass ich kein praktizierender Chirurg war. Was dann? Was spielte da noch hinein?
Etwas lenkte meinen Blick auf sich.
Vom Tisch aus hatte ich freien Blick auf die gegenüberliegende Wand, an der unter anderem ein antiker Kavalleriesäbel hing, den ich bei meinem ersten Rundgang durch den Raum übersehen hatte. Ich stand auf, ging hinüber und nahm ihn von den Haken.
Im Geiste schüttelte ich den Kopf über den Zustand des Säbels. Ich wünschte mir Öllappen und Wetzstein, um ihn so wieder in Stand zu setzen, wie es sich gehörte. Ich kannte mich mit antiken Waffen aus, besonders mit Hiebwaffen.
Der Säbel fühlte sich leicht und handlich an. Ich schlug en garde, parierte und stieß ein paarmal zu. Ja, ich konnte mit dem Ding umgehen.
In welchem Elternhaus lernte man sowas? Ich sah mich nach weiteren Gedächtnishilfen um.
Da mir nichts anderes auffiel, hängte ich den Säbel wieder an die Wand und kehrte zum Tisch zurück. Als ich mich gesetzt hatte, beschloss ich, ihn zu durchsuchen.
Ich begann in der Mitte, arbeitete mich auf der linken Seite hoch und auf der anderen wieder runter, Schublade für Schublade.
Schreibpapier, Umschläge, Briefmarken, Büroklammern, Bleistiftstümpfe, Gummibänder – all die üblichen Sachen.
Ich zog jede Schublade ganz heraus und nahm sie auf den Schoß, während ich den Inhalt untersuchte. Das war nicht bloß ein Instinkt. Das gehörte vielmehr zu einer Ausbildung, die ich einmal erhalten hatte, eine Ausbildung, die mich veranlasste, auch die Außenkanten und Unterseiten der Schubladen zu untersuchen.
Eine Kleinigkeit wäre mir dabei fast entgangen, fiel mir aber im letzten Augenblick noch auf: Die Rückwand der rechten unteren Schublade war nicht so hoch wie die der anderen.
Dies musste etwas bedeuten, und als ich mich niederkniete und in den Leerraum blickte, entdeckte ich ein kleines kastenförmiges Gebilde, das an der Oberseite festgemacht war.
Eine weitere kleine Schublade, ganz hinten und verschlossen.
Ich musste etwa eine Minute lang mit Büroklammern, Stecknadeln und einem metallenen Schuhanzieher herumfummeln, die ich in einer anderen Schublade entdeckt hatte. Mit dem Schuhanzieher kam ich schließlich zum Ziel.
Die kleine Schublade enthielt eine Schachtel mit Spielkarten.
Und die Schachtel trug ein Bild, das mich in meiner knienden Position erstarren und meinen Atem schneller gehen ließ, während mir der Schweiß auf die Stirn trat.
Es zeigte ein weißes Einhorn auf grünem Feld, auf den Hinterbeinen stehend, nach rechts gewandt.
Ich kannte dieses Bild, und es schmerzte mich, dass ich keinen Namen dafür wusste.
Ich öffnete die Schachtel und zog die Karten heraus. Es waren Tarotkarten mit Zauberstäben, Pentagrammen, Kelchen und Schwertern, doch die Großen Trümpfe sahen ungewohnt aus.
Ich schob beide Schubladen wieder zu, wobei ich darauf bedacht war, die kleinere nicht zu verschließen. Dann erst setzte ich meine Inspektion fort.
Die Großen Trümpfe wirkten fast lebensecht, bereit, durch die schimmernde Oberfläche zu treten. Die Karten fühlten sich ziemlich kalt an, und es machte mir besondere Freude, sie in der Hand zu halten. Plötzlich wusste ich, dass auch ich einst ein solches Spiel besessen hatte.
Ich begann die Karten auf der Schreibunterlage vor mir auszubreiten.
Eine zeigte einen listig aussehenden kleinen Mann mit schmaler Nase, lachendem Mund und struppigem, strohfarbenem Haar. Er war in eine Art Renaissance-Kostüm in den Farben Orange, Rot und Braun gekleidet. Er trug eine lange weite Hose und ein enggeschnittenes besticktes Wams. Und ich kannte ihn. Er hieß Random.
Als Nächstes war da das ruhige Antlitz Julians mit dunkelbraunem Haar, dessen blaue Augen weder Leidenschaft noch Mitleid zeigten. Er war ganz in eine geschuppte weiße Rüstung gekleidet, nicht silbern oder metallisch, sondern an Emaille erinnernd. Ich wusste allerdings, dass sie sehr hart war und jedem Aufprall widerstand, trotz ihres dekorativen und herausgeputzten Aussehens. Julian war der Mann, den ich bei seinem Lieblingsspiel besiegt hatte, woraufhin er ein Glas Wein nach mir geworfen hatte. Ich kannte ihn und hasste ihn.
Dann kam das dunkelhäutige, dunkeläugige Gesicht Caines, von Kopf bis Fuß in schwarzen und grünen Satin gehüllt, darüber ein verwegen aufgesetzter Dreispitz, von dem ein grüner Federbusch zum Rücken herabhing. Er stand im Profil, einen Arm in die Hüfte gestemmt, und die Spitzen seiner Schnabelschuhe waren aufgebogen. An seinem Gürtel blitzte ein smaragdbesetzter Dolch. Mein Herz war von zwiespältigen Gefühlen erfüllt.
Dann kam Eric. Nach allgemeinem Standard gutaussehend, das Haar so dunkel, dass es fast blau wirkte. Der Bart kräuselte sich um den Mund, der immer lächelte, und er war schlicht in Lederjackett, enge Hosen und hohe schwarze Stiefel gekleidet, darüber ein einfacher Umhang. Er trug einen roten Schwertgurt mit einem langen silbernen Säbel, ein Rubin diente als Gürtelschnalle, und der hohe Kragen des Umhangs um seinen Kopf war rot eingefasst, ebenso die passenden Ärmel. Seine Hände, deren Daumen in den Gürtel gehakt waren, sahen ausgesprochen kräftig und groß aus. Ein Paar schwarzer Handschuhe steckte im Gürtel an der rechten Hüfte. Ich war sicher, dass er es war, der mich an jenem schicksalhaften Tag zu töten versucht hatte. Ich musterte ihn und fürchtete ihn ein wenig.
Und schließlich Benedict, mürrisch, groß und hager; mit schmalem Körper und schmalem Gesicht, aber einem weiten Geist. Er trug die Farben Orange, Gelb und Braun und ließ mich an Heuhaufen, Kürbisse, Vogelscheuchen und an die Sage vom kopflosen Reiter denken. Er hatte ein langes, kräftiges Kinn, haselnussbraune Augen und brünettes Haar, das sich niemals lockte. Er stand neben einem lohfarbenen Pferd und stützte sich auf eine Lanze, um die eine Blumengirlande gewunden war. Er lachte selten. Ich mochte ihn.
Als ich die nächste Karte aufdeckte, hielt ich inne, mein Herz machte einen Sprung und prallte gegen meinen Brustkasten und wäre am liebsten ins Freie gehüpft.
Das war ich.
Ich kannte mein rasiertes Ich und dies war der Kerl hinter dem Spiegel. Grüne Augen, schwarzes Haar, in Schwarz und Silber gekleidet, ja! Ich trug einen Mantel, der sich leicht im Wind bewegte. Wie Eric hatte ich schwarze Stiefel an und einen Säbel, nur war meiner schwerer, allerdings nicht ganz so lang. Die Handschuhe, die ich trug, waren silberfarben und geschuppt. Die Spange an meinem Hals hatte die Form einer silbernen Rose.
Ich, Corwin.
Von der nächsten Karte blickte mir ein großer, kräftiger Mann entgegen. Er hatte große Ähnlichkeit mit mir, nur war sein Kinn stärker ausgeprägt, und ich wusste, dass er massiger war als ich, aber auch langsamer. Seine Kraft war legendär. Er trug ein weites Gewand aus blaugrauem Stoff, das in der Mitte von einem breiten schwarzen Gürtel zusammengehalten wurde, und er lachte. Um seinen Hals hing an einer starken Kordel ein silbernes Jagdhorn. Bart und Schnurrbart waren fransig und dünn. In der rechten Hand hielt er einen Krug mit Wein. Ich empfand eine plötzliche Zuneigung für ihn, und schon fiel mir sein Name ein. Er hieß Gérard.
Dann kam ein wild aussehender Mann mit mächtigem Bart und flammendem Haarschopf, ganz in Rot und Orange gekleidet, zumeist Seide. Er hielt ein Schwert in der Rechten und ein Glas Wein in der Linken, und aus seinen Augen, die so blau waren wie Floras, schien der Teufel selbst zu funkeln. Er hatte ein leicht fliehendes Kinn, was jedoch vom Bart verdeckt wurde. Sein Schwert schmückten kunstvolle, goldfarbene Ornamente. Er trug zwei große Ringe an der rechten Hand und einen an der linken: einen Smaragd, einen Rubin und einen Saphir. Dieser Mann, das wusste ich, war Bleys.
Danach kam eine Gestalt, die mir und Bleys ähnlich sah. Meine Gesichtszüge, wenn auch zarter, und meine Augen; Bleys’ Haar, bartlos. Der junge Mann trug einen grünen Reitanzug und saß auf einem Schimmel, der rechten Seite der Karte zugewandt. Das Bild strahlte Stärke und Schwäche zugleich aus, Entschlossenheit und Verlorenheit. Ich fand ihn sympathisch und unsympathisch zugleich; ich mochte ihn und fühlte mich doch abgestoßen. Ich wusste, dass er Brand hieß. Ich wusste es in dem Moment, als mein Blick auf ihn fiel.
Mir wurde in der Tat klar, dass ich all diese Männer gut kannte, dass ich mich ausnahmslos an sie erinnerte, an ihre Stärken und Schwächen, ihre Siege und Niederlagen.
Denn sie waren meine Brüder.
Ich zündete mir eine Zigarette aus Floras Schreibtischvorrat an, lehnte mich zurück und überdachte alles, woran ich mich erinnert hatte.
Sie waren meine Brüder, diese acht seltsamen Männer in ihren seltsamen Kostümen. Und ich wusste, dass es nur recht und billig war, wenn sie sich nach eigenem Belieben kleideten, so wie es für mich richtig war, Schwarz und Silber anzulegen. Dann lachte ich leise; mir war bewusst geworden, was ich gerade anhatte, was ich in dem Kleiderladen in der kleinen Stadt gekauft hatte, den ich nach meiner Abreise aus Greenwood aufgesucht hatte.
Ich trug schwarze Hosen, und die drei Hemden, die ich gekauft hatte, waren von grauer, silbriger Farbe. Mein Jackett war ebenfalls schwarz.
Wieder wandte ich mich den Karten zu, und da war Flora in einem Gewand, das so grün war wie das Meer, so wie ich sie mir gestern Abend vorgestellt hatte; dann ein schwarzhaariges Mädchen mit denselben blauen Augen, langem Haar und ganz in Schwarz gekleidet, ein Silbergürtel um ihre Hüften. Ohne zu wissen, warum, füllten sich meine Augen mit Tränen. Sie hieß Deirdre. Dann kam Fiona, deren Haar mich an Bleys oder Brand denken ließ und die meine Augen und einen perlmuttfarbenen Teint hatte. Ich hasste sie, sobald ich die Karte umgedreht hatte. Die Nächste war Llewella, das Haar zu den jadegrünen Augen passend; sie trug ein schimmerndes graugrünes Gewand mit einem lavendelfarbenen Gürtel und sah tränenverhangen und traurig aus. Aus irgendeinem Grund wusste ich, dass sie nicht so war wie die anderen. Aber auch sie war meine Schwester.
Ich fühlte eine furchtbare Distanz, Welten lagen zwischen mir und all diesen Menschen. Trotzdem schienen sie mir alle körperlich nahe zu sein.
Die Karten fühlten sich dermaßen kalt an, dass ich sie wieder hinlegte, wenn auch mit gewissem Widerwillen, auf die Berührung verzichten zu müssen.
Es gab ohnehin keine weiteren mehr. Die anderen Karten zeigten unbedeutende Symbole. Und ich wusste irgendwie – wieder dieses irgendwie, ah, irgendwie! –, dass mehrere Karten fehlten.
Doch ich hätte um alles in der Welt nicht sagen können, was auf den fehlenden Trümpfen dargestellt war.
Diese Erkenntnis bedrückte mich seltsamerweise, und ich griff nach meiner Zigarette und überlegte.
Warum kamen all diese Erinnerungen so schnell zurück, wenn ich die Karten betrachtete – warum fluteten sie mir in den Kopf, ohne den größeren Zusammenhang gleich mitzubringen? Natürlich wusste ich jetzt mehr als zuvor, zumindest im Hinblick auf Namen und Gesichter. Aber das war so ziemlich alles.
Ich konnte die Bedeutung der Tatsache nicht ergründen, warum wir alle auf diesen Karten festgehalten worden waren. Ich verspürte allerdings den starken Wunsch, ein solches Kartenspiel zu besitzen. Doch wenn ich Floras nähme, würde sie sofort merken, dass sie fehlten, und das könnte Ärger geben. Ich legte sie also wieder in die kleine hinter der großen Schublade zurück und schloss sie ein. Und danach, mein Gott, wie ich mir das Hirn zermarterte! Aber ich kam nicht weiter.
Bis ich mich an das Zauberwort erinnerte.
Amber.
Gestern Abend hatte mich dieses Wort vollkommen erschüttert, so sehr, dass ich der Erinnerung bisher bewusst aus dem Weg gegangen war. Doch jetzt bemühte ich mich. Jetzt bewegte ich das Wort im Geiste hin und her und wog alle Assoziationen ab, die mir dabei kamen.
In dem Wort knisterte eine starke Sehnsucht und eine gewaltige Nostalgie. Ganz im Innern umschloss es Begriffe wie verlorene Schönheit, große Taten und ein Machtgefühl, das geradezu allumfassend war. Irgendwie gehörte dieses Wort zu meinem Sprachschatz. Irgendwie war ich Teil davon, und es war Teil von mir. Es war der Name eines Ortes, das begriff ich nun. Es war der Name eines Ortes, der mir einmal sehr vertraut gewesen war. Doch das Wort beschwor keine Bilder herauf, nur Gefühle.
Wie lange ich so dasaß, weiß ich nicht. Meine Tagträume hatten mich von der Zeit gelöst.
Aus dem innersten Kern meiner Gedanken stieg die Erkenntnis auf, dass es leise geklopft hatte. Dann drehte sich langsam der Türknauf, und das Hausmädchen – Carmella – trat ein und erkundigte sich, ob ich zu Mittag essen wolle.
Das schien mir eine gute Idee zu sein, und ich folgte ihr in die Küche und aß ein halbes Hähnchen und trank ein großes Glas Milch.
Schließlich nahm ich eine Kanne Kaffee mit in die Bibliothek, wobei ich den Hunden aus dem Weg ging. Ich war gerade bei meiner zweiten Tasse, als das Telefon klingelte.
Es kribbelte mir in den Fingern, den Hörer abzunehmen, doch ich vermutete, dass es überall im Haus Nebenstellen gab und Carmella sich bestimmt melden würde.
Aber das war ein Irrtum. Es klingelte weiter.
Schließlich konnte ich nicht mehr widerstehen.
»Hallo«, sagte ich. »Hier bei Flaumel.«
»Könnte ich bitte Mrs. Flaumel sprechen?«
Es war die Stimme eines Mannes, hastig und etwas nervös. Er schien außer Atem zu sein, und seine Worte kamen gedämpft durch das schwache Surren und die Geisterstimmen, die auf ein Ferngespräch hindeuten.
»Tut mir leid. Sie ist im Augenblick nicht hier. Kann ich ihr etwas ausrichten, oder soll sie zurückrufen?«
»Mit wem spreche ich denn?«, wollte er wissen.
Ich zögerte. »Corwin«, sagte ich schließlich.
»Mein Gott!«, rief er, und ein langes Schweigen folgte.
Ich dachte schon, er hätte aufgelegt. »Hallo?«, fragte ich noch einmal, als er wieder zu sprechen begann.
»Lebt sie noch?«, wollte er wissen.
»Natürlich! Mit wem zum Teufel spreche ich überhaupt?«
»Erkennst du meine Stimme nicht, Corwin? Hier ist Random. Hör zu, ich bin in Kalifornien und habe Ärger. Ich wollte Flora eigentlich nur bitten, mir Zuflucht zu gewähren. Hast du dich mit ihr zusammengetan?«
»Vorübergehend.«
»Ich verstehe. Gewährst du mir deinen Schutz, Corwin?« Pause. Dann: »Bitte!«
»Soweit ich kann«, antwortete ich. »Aber ich kann Flora zu nichts verpflichten, ohne mich mit ihr abzustimmen.«
»Wirst du mich vor ihr beschützen?«
»Ja.«
»Dann genügt mir das völlig, Mann. Ich werde jetzt versuchen, es nach New York zu schaffen. Dabei muss ich etliche Umwege in Kauf nehmen, ich weiß also nicht, wie lange es dauert. Wenn ich den falschen Schatten aus dem Weg gehen kann, sehen wir uns dann. Wünsch mir Glück.«
»Glück«, sagte ich.
Dann ertönte ein Klicken, und ich lauschte noch eine Zeitlang dem fernen Summen und den Geisterstimmen.
Der freche kleine Random war also in Schwierigkeiten! Ich hatte das Gefühl, dass mir das eigentlich kein besonderes Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Aber in meiner jetzigen Lage war er einer der Schlüssel zu meiner Vergangenheit und wahrscheinlich auch zu meiner Zukunft. Ich würde also versuchen, ihm nach besten Kräften zu helfen, bis ich erfahren hatte, was ich von ihm wissen wollte. Ich wusste, dass es zwischen uns nicht gerade die stärkste Bruderliebe gab. Aber ich wusste auch, dass er kein Dummkopf war; er war einfallsreich, scharfsinnig und reagierte auf die verrücktesten Dinge seltsam sentimental; andererseits war sein Wort nicht die Spucke wert, die er dabei verbrauchte, und er hätte meine Leiche vermutlich an die nächste Universität verkauft, wenn er genug dafür bekommen konnte. Ich erinnerte mich gut an den kleinen Schwindler – mit einem schwachen Hauch von Zuneigung, vielleicht wegen ein paar hübscher Stunden, die wir zusammen verbracht hatten. Aber ihm vertrauen? Niemals! Ich beschloss, Flora erst im letzten Augenblick zu sagen, dass er im Anmarsch war. Er mochte mir als Ass im Ärmel nützlich sein.
Ich goss noch etwas heißen Kaffee zu dem Rest in meiner Tasse und trank ihn langsam.
Vor wem lief er davon?
Gewiss nicht vor Eric, sonst hätte er nicht hier angerufen. Ich wunderte mich über Randoms Frage, ob Flora tot sei, nur weil ich zufällig hier war. War sie wirklich so sehr mit dem von mir gehassten Bruder verbündet, dass in der Familie das Gerücht umging, ich würde sie ebenfalls umbringen, wenn ich könnte? Das erschien mir seltsam, aber er hatte schließlich gefragt.
Und weswegen hatten sie sich eigentlich verbündet? Was war die Ursache dieser Spannung, dieser Feindschaft? Wie kam es, dass Random auf der Flucht war?
Amber.
Das war die Antwort.
Amber. Irgendwie lag der Schlüssel zu allem in Amber. Das Geheimnis des Durcheinanders war in Amber zu finden, in etwas, das sich dort abgespielt hatte – vor gar nicht allzu langer Zeit, wie ich vermutete. Ich musste mich in Acht nehmen. Ich musste ein Wissen vortäuschen, das ich nicht besaß, während ich mir die Kenntnisse Stück um Stück von jenen holte, die Bescheid wussten. Ich war zuversichtlich, dass ich es schaffen konnte. Es herrschte so viel Misstrauen, dass jeder vorsichtig war. Das wollte ich mir zunutze machen. Ich würde mir holen, was ich brauchte, und nehmen, was ich wollte; und ich würde mir jene merken, die mir halfen, und die anderen übergehen. Denn dies, das wurde mir klar, war das Gesetz, nach dem unsere Familie lebte, und ich war ein echter Sohn meines Vaters …
Plötzlich machten sich meine Kopfschmerzen wieder bemerkbar, so hämmernd, als wollte mir der Schädel zerspringen.
Der Gedanke an meinen Vater musste diesen Anfall ausgelöst haben, dachte, vermutete, fühlte ich … Aber ich war mir nicht sicher, warum oder wie.
Nach einiger Zeit ließen die Schmerzen nach, und ich schlief im Stuhl ein. Und nach einer viel längeren Zeit ging die Tür auf, und Flora trat ein. Wieder war es draußen Nacht.
Sie trug eine grüne Seidenbluse und einen langen grauen Wollrock. Ihre Füße steckten in Straßenschuhen und dicken Strümpfen. Das Haar hatte sie am Hinterkopf zusammengesteckt, und sie sah ein wenig bleich aus. Wie zuvor hatte sie ihre Hundepfeife bei sich.
»Guten Abend«, sagte ich und stand auf.
Sie antwortete jedoch nicht. Stattdessen ging sie durch den Raum zur Bar, schenkte sich einen Shot Jack Daniel’s ein und kippte ihn hinunter wie ein Mann. Dann goss sie sich einen zweiten Drink ein, den sie mit zu dem großen Sessel nahm.