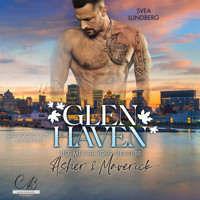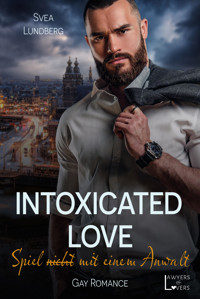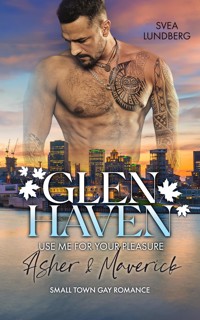4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Traumtänzer-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Unfalltod seiner Eltern trifft Roman die drei mutigsten Entscheidungen seines Lebens: Er verkauft das teure Anwesen seines Vaters, kündigt seinen sicheren Job als Steuerfachangestellter und wandert nach Island aus. Dort will er sich endlich seiner großen Leidenschaft, dem Schreiben, widmen und zu sich selbst finden. Dabei gibt es nur zwei winzige Probleme: Er kennt weder Land und Leute, noch hat er den Mut, dies aktiv zu ändern. Denn Roman hat das Tourette-Syndrom und fühlt sich in Gesellschaft von anderen Menschen vollkommen hilflos und deplatziert. Nicht umsonst verbirgt er sein schriftstellerisches Selbst seit Jahren hinter einem geschlossenen Pseudonym. Eigentlich würde er am liebsten nie wieder unter Leute gehen, wenn da nur nicht diese Erinnerungen an eine flüchtige Begegnung und an ein paar stechend blaue Augen wären …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Aus dem Verlagsprogramm
TITEL
Die Clifton-Lüge
Ein Roman von Svea Lundberg
Impressum
Copyright © 2018 Traumtänzer-Verlag
Lysander Schretzlmeier
Ostenweg 5
93358 Train
www.traumtaenzer-verlag.de
© 2018 Svea Lundberg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und
Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden
oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht
beabsichtigt.
ISBN: 978-3-947031-17-7 (Taschenbuch)
ISBN: 978-3-947031-18-4 (E-Book mobi)
ISBN: 978-3-947031-19-1 (E-Book ePub)
Autorin: Svea Lundberg
Covergestaltung: Yvonne Less, Art4Artists
www.art4artists.com.au
Prolog
~~~ Roman ~~~
Ich hatte noch nicht viele Beerdigungen erlebt. Genau genommen erst eine einzige und als meine Tante Emmi starb, war ich gerade einmal dreizehn Monate alt gewesen. Dementsprechend konnte ich mich an diesen Tag nicht mehr erinnern. Dennoch hatte ich in den letzten Jahren durch Daily-Soaps und Reportagen genug Wissen über Beerdigungen angehäuft, um mit Sicherheit sagen zu können, dass es sich nicht gehörte, in dem Moment, in dem der Sarg in das Grab hinabgelassen wurde, den Pfarrer und alle anwesenden Gäste als Fotzen zu beschimpfen. Trotzdem tat ich es – wenn auch nicht mit Absicht.
Just in dem Moment, in dem ein dumpfer Laut das Auftreffen des Sarges auf dem feuchten Grabboden verkündete, rutschte es mir heraus: »Fotzen ... alle ... scheiß Fotzen!« Wie zur Bekräftigung meiner Worte schlug mein rechter Arm heftig aus. Carolin, die schniefend neben mir stand, konnte gerade noch rechtzeitig einen halben Schritt zurückweichen, um nicht mitten ins blasse Gesicht getroffen zu werden.
Doch gleich darauf war sie wieder neben mir. Ihre Hand streifte beruhigend meinen Arm, legte sich darauf, sodass ich ihre Wärme selbst durch den dicken Stoff meines Mantels spüren konnte. Ich biss mir so heftig auf die Lippen, dass es schmerzte. Aber sicher war es nicht fest genug, um den nächsten Wortschwall zu unterdrücken. Wenn ich so aufgewühlt war wie heute, hatte ich keinerlei Kontrolle über meine Tics. Schlimmer noch: Je nervöser und emotionaler ich wurde, desto heftiger entluden sie sich.
Ich hielt den Atem an, wartete von Furcht und Scham erfüllt auf den nächsten Ausbruch. Um mich herum war es still. Keiner sagte ein Wort, was sicher nicht nur an der gedrückten Stimmung lag, sondern vielmehr daran, dass alle anwesenden Trauergäste auf meinen nächsten Fauxpas warteten. Niemand schien zu atmen. Nur der Regen trommelte leise auf uns nieder, sodass mich wenigstens niemand weinen sah.
Noch vor wenigen Jahren hatte ich regelmäßig auf dem Parkplatz hinter der Universität gehockt und geheult – wütend und beschämt, weil ich nicht verstand, warum ich urplötzlich und in den unmöglichsten Situationen die übelsten Schimpfwörter ausstieß oder laut zu bellen begann wie ein Straßenköter. Es hatte über ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich traute, mit meinen Beschwerden zum Arzt zu gehen. Monatelang hatte ich in der Angst gelebt, für verrückt erklärt und eingewiesen zu werden. Und dann ... plötzlich ... bekamen meine unkontrollierten Lautausbrüche einen Namen: Tourette-Syndrom.
Von da an hatte es eine Möglichkeit gegeben, meine Aussetzer zu benennen und mit ihnen umzugehen. Aber an Tagen wie diesem hasste ich sie noch immer wie die Pest. Weil sie mich aus dem Schatten ins Licht zogen. Mich in den Mittelpunkt stellten und mich zum Beschauungsobjekt der Leute machten. Zum Ziel ihrer Abscheu und Belustigung.
Doch wenigstens heute lachte niemand über mich. Alle waren viel zu sehr damit beschäftigt, in Taschentücher zu schniefen und sich nach dem Warum zu fragen. Warum ausgerechnet diese beiden Menschen? Warum war der Wagen von der Straße abgekommen? Warum hatte mein Vater die Kontrolle über das Auto verloren? Warum waren sie gegen einen Baum gekracht? Und warum ... WARUM ... waren beide tot?
»Roman ...« Caro strich mit ihrer Hand über meinen Arm und drückte sanft zu. Flüsternd fragte sie: »Willst du die erste Schaufel Erde ins Grab werfen oder soll ich?«
Mein Kopf ruckte empor. Mit einem Mal stand ich wieder im Scheinwerferlicht dieses verregneten Septembertages. Die Trauergäste starrten mich an und warteten darauf, dass ich etwas tat. Das Grab zuschaufeln oder ausrasten. Beides schien möglich.
»Ich ... Fotze ... F... mach das ...« In einer trotzig-ruppigen Bewegung entzog ich Caro meinen Arm und stolperte die wenigen Schritte bis zum Rand des ausgehobenen Grabes. Der Blick in die nur einen Meter andauernde Tiefe ließ mich schwindeln. Mein rechter Arm schlug unkontrolliert aus, als ich nach der Schaufel tasten wollte. Caro folgte meiner Bewegung, gab mir den Spaten in die Hand. All das tat sie kommentarlos. Wie selbstverständlich. An Tagen wie diesen wäre ich ohne meine Cousine zu Grunde gegangen. Hätte mich direkt neben meinen Eltern ins Grab legen können.
Ein Schluchzen verließ meinen Mund, gepaart mit einer unartikulierten Beschimpfung. Ich grub die Zähne in meine Unterlippe, umfasste den Spaten fester. Versuchte verzweifelt gegen das altbekannte Kribbeln in meinem Solarplexus anzuatmen, das den nächsten Ausbruch ankündigte.
Ich schaffte es kaum, Erde auf die Schaufel zu häufen. Immer wieder zuckten meine Arme im entscheidenden Moment, sodass nach vier gescheiterten Versuchen mehr dunkle Graberde auf dem Wiesenstück vor dem Grab lag als darin. Gepresste Schluchzer verließen meinen Mund. Wut, Schmerz und Scham ließen mich vollkommen unkontrollierbar ticcen.
»Roman ...« Caro trat einen Schritt auf mich zu.
»Nein ... lass ... Fuck ... Fotze!« Das vorletzte Schimpfwort war nicht Tourette geschuldet. Das letzte schon. Niemals würde ich meine kleine Cousine absichtlich beschimpfen. Aber heute ... Das Kribbeln im Solarplexus wurde unerträglich.
Ich warf den Spaten einfach von mir, drehte mich um und lief. Hinter mir hörte ich Rufe, meinen Namen, aber ich würde einen Teufel tun und stehenbleiben. Stattdessen rannte ich quer über den Friedhof, über den angrenzen Parkplatz und über zwei Querstraßen, bis hinein in den Stadtpark. Meine Lungen brannten, dicke Regentropfen trommelten auf mich nieder. Bei jedem keuchenden Atemzug schmeckte ich das Salz auf meinen Lippen.
Hinter einer Baumgruppe blieb ich stehen. Hinter meiner Baumgruppe. Wie oft hatte ich mich hier versteckt, wenn mich beim Joggen plötzliche Tics überfielen und mich die Leute anstarrten als sei ich vollkommen verrückt, eine Gefahr für ihre Kinder und Hunde, die auf den Wiesen im Park tobten.
Wie damals kauerte ich mich hinter den Tannen zusammen, schimpfte und bellte, was das Zeug hielt. Ich ticcte so lange, bis mein Rachen schmerzte. Dann endlich ... endlich ... ließ das Kribbeln in meiner Körpermitte nach. Vollkommen erschöpft sank ich mit dem Rücken an einen Baumstamm gelehnt zu Boden. Binnen kürzester Zeit waren Mantel und Hose komplett durchweicht. Kalte Nässe kroch in meine Glieder, aber es war mir egal. Ich tat nichts, um ins Trockene zu kommen, sondern hockte einfach nur auf dem regendurchtränkten Boden und heulte wie ein kleines Kind. Die gepressten Schluchzer erschütterten meinen Körper und brachten ihn wie die Tics zuvor zum Beben.
»Roman ... hey, da bist du ja.«
Wieder war es Caro, deren sanfte Stimme mich aufblicken ließ. Sie stand direkt vor mir, beinahe ebenso durchnässt wie ich. Das blonde Haar klebte ihr in Strähnen an Stirn und Wangen und ihre geröteten Augen verrieten überdeutlich, dass auch sie geweint hatte. Die Erkenntnis entlockte mir ein schwaches Lächeln. Natürlich weinte Caro um meine Eltern, besonders um meine Mutter. So oft hatte meine Cousine Zeit bei uns verbracht. Als Kinder waren wir gemeinsam im Pool geschwommen und über den akkurat gestutzten Rasen getobt. So lange bis meine Mutter uns hineinrief, uns heiße Schokolade und Butterkekse servierte und uns bat, meinem Vater nicht zu verraten, dass wir wieder Fangen im Garten gespielt hatten. Am zerwühlten Rasen würde er es natürlich erkennen ...
Ungeachtet ihres schicken schwarzen Minikleides und ihrer dünnen Strumpfhose ging Caro neben mir in die Knie. In ihrem weichen Blick lag kein Mitleid, sondern tiefes Verständnis und Mitgefühl.
»Tut mir leid, dass ich einfach abgehauen bin«, murmelte ich, meine Stimme wurde dabei vom Prasseln des Regens weichgespült. Jetzt, nachdem die Anspannung langsam von mir abfiel, konnte ich wieder ganze Sätze bilden, ohne irgendeinen Kraftausdruck darunterzumischen.
»Mach dir keinen Kopf. Niemand macht dir einen Vorwurf, dass du ...«
»Caro!« Halb lachte, halb weinte ich. »Jeder von denen macht mir die bittersten Vorwürfe.«
Sie verdrehte die Augen, grinste schief. »Okay, manche von ihnen. Aber du solltest nichts drauf geben, was sie denken und ...«
»Mann, ich bin weggerannt wie ein kleiner Junge und jetzt hocke ich hier und heule und ...«
»Roman!« In Caros Stimme mischte sich ein zorniger Unterton. »Deine Eltern wurden gerade beerdigt. Du hast jedes Recht der Welt, neben der Spur zu sein. Und überhaupt ...« Sie stockte und schlug den Blick nieder.
»Was, und überhaupt?«
»Keine Ahnung. Egal. Komm, wir sollten fahren, sonst holen wir uns noch ne Lungenentzündung.« Plötzlich beschwingt sprang sie auf und streckte mir ihre zierliche Hand entgegen. Ich ließ mich von ihr in die Höhe ziehen.
»Willst du zum Leichenschmaus oder sollen wir nach Hause fahren?«
Wenn ich ehrlich war, wollte ich weder an dem einen noch an dem anderen Ort sein.
»Nach Hause«, murmelte ich erschöpft.
1. Kapitel
~~~ Roman ~~~
»Du solltest das nicht lesen.« Energisch entwand Caro mir die Zeitung. Sie warf einen abschätzenden Blick auf die Seite, auf der in Großformat ein Foto meiner Eltern prangte, daneben eines des vollkommen verbeulten Unfallwagens. Dann beförderte sie die Zeitung kurzerhand in den Mülleimer, drückte mir stattdessen einen Pappbecher in die Hand.
Dankbar ergriff ich den Becher und genoss es, wie der Kaffee darin meine Finger wärmte. Caro ließ sich neben mich auf die Sitzbank fallen und musterte die vorbeieilenden Passanten. Ich konnte es nicht lassen, auf die verknickte Zeitungsseite im Papierkorb zu schielen. Der Unfalltod meiner Eltern war schon ein halbes Jahr her, aber erst jetzt hatte irgendein Klatschreporter die Ermittlungsergebnisse ans Licht gezerrt: Mein Vater – seines Zeichens erfolgreicher Geschäftsmann – hatte seine Ehefrau im Kokainrausch in den Tod gefahren.
Gottverdammt, ja, im Kokainrausch ...
Dass ich die Hände krampfhaft zu Fäusten ballte, merkte ich erst, als heißer Kaffee über meine Finger schwappte.
»Fuck!« Ich sprang von der Sitzbank auf und beförderte den Becher samt verbliebenem Inhalt in den Mülleimer. Dunkelbraun ergoss sich der Kaffee über das Gesicht meines Vaters.
»Hier.« Caro streckte mir ein Taschentuch entgegen, von dem ich mich unweigerlich fragte, wie sie es so schnell in den Untiefen ihres XXL-Handgepäcks hatte finden können.
Während ich noch versuchte, den Kaffee von meinem Mantel zu tupfen, warf sie einen prüfenden Blick zur Boarding-Anzeige.
»Wir können«, verkündete sie und raffte ihr Handgepäck zusammen. Der Anblick ihrer vor Aufregung und Vorfreude geröteten Wangen ließ mich schmunzeln und für einen kurzen Moment meine eigene Nervosität vergessen. Es würde Caros erste Reise nach Island, nach Skandinavien überhaupt werden und sie freute sich seit Wochen – nein, eigentlich seit Monaten – wie ein kleines Kind darauf. In mir selbst wütete eine unbestimmte Mischung aus Vorfreude und Panik. In der vergangenen Nacht hatte ich kein Auge zugetan. Hatte mich zum gefühlt eintausendsten Mal gefragt, welcher Teufel mich geritten hatte, dass ich alles aufgab, was ich in Deutschland hatte, um nach Island auszuwandern. In ein Land, das ich nur von Postkarten und Bildbänden kannte.
Aber ein Blick zurück auf das kaffeegetränkte Gesicht meines Vaters wischte die letzten Zweifel fort. Ich wollte nichts mehr von dem, was ich hier in Deutschland hatte. Ich wollte weder das große Haus, noch sein protziges Erbe, geschweige denn meinen Job als Steuerfachangestellter. Ich wollte nur weg. Fort in die Einsamkeit. Nach Island, wo endlose Weite, Eis und Vulkane lockten. Caro war das Einzige, das ich vermissen würde. Doch für die nächsten zwei oder drei Wochen würde ich sie bei mir haben. Und dann ... Nun, man würde schon sehen.
Gepackt von einer neuerlichen Welle aufgeregter Tics bellte ich ein paar Mal durch den Flughafen, fuchtelte ein wenig mit den Armen, ehe es mir gelang, mein Handgepäck zu greifen. Caro hakte sich wie selbstverständlich bei mir unter und gemeinsam steuerten wir das Boarding-Terminal an.
›Ísland, ég kem rétt strax.‹
Ich konnte mich gerade noch beherrschen, nicht durch das Terminal zu brüllen. Meine lautlichen Tics reichten vollkommen aus, da musste ich nicht noch lautstark mit meinen Sprachkenntnissen protzen. Tatsächlich war es reiner Selbstschutz, dass ich in den letzten drei Monaten in jeder freien Minute die isländische Grammatik und Aussprache gepaukt hatte. Ich wollte mich dem Land so gut es ging anpassen, um so wenig wie möglich aufzufallen. Zwar hatte ich ohnehin nicht vor, oft unter Leute zu gehen, aber meinen wöchentlichen Einkauf wollte ich möglichst unauffällig hinter mich bringen. Wenn der Neueinwanderer schon bellte und fluchte, sollte er sich wenigstens in der Landessprache dafür entschuldigen können.
~*~
Bereits als Kind hatte ich großen Respekt vor der Höhe gehabt. Mein erster und einziger Ausflug in einen Klettergarten hatte in einem Desaster geendet. Nicht unbedingt, weil ich mir auf dem 20-Meter-Aussichtsturm in meine nagelneue Kletterhose gepinkelt hatte, sondern vielmehr, weil mein Vater mir erklärt hatte, ich würde mich anstellen wie eine Memme und das hier wäre mit Sicherheit unser letzter gemeinsamer Ausflug gewesen. Ich hatte bitterlich geheult und ihm versprochen, das nächste Mal mutiger zu sein, aber wenn man von meinem Vater etwas hatte lernen können, dann war es Konsequenz. Er war nie wieder mit mir irgendwohin gefahren, wo achtjährige Jungs gerne gewesen wären. Stattdessen fuhr er rund 20 Jahre später mit meiner Mutter auf dem Beifahrersitz gegen einen Baum.
Frustriert über die erneuten Bilder in meinem Kopf, zwang ich mich, aus dem Flugzeugfenster zu sehen. Bereute es gleich darauf wieder, als ich das Land unter uns näherkommen sah. Je mehr sich das Flugzeug senkte, desto weiter hob sich mein Magen.
»Alles okay?« Caro sah mich von der Seite besorgt an. Ich biss die Zähne aufeinander und nickte. Mich auf meinen Magen konzentrieren zu müssen, damit mir nicht der Frühstücksdonut hochkam, hatte auch einen Vorteil: Meine Nervosität sank gegen null und auch meine Tics gaben Ruhe.
Im Landeanflug erreichte die Übelkeit einen Höhepunkt, doch ich schaffte es, nicht nach einer der Kotztüten greifen zu müssen. Ruckelnd setzte die Boeing auf der Landebahn auf, gleich darauf ertönte die freundliche Stimme einer Stewardess durch die Lautsprecher.
»Welcome to Iceland, we wish you a pleasent stay. An to all our icelandic passengers: Velkominn heima!«
Ihre letzten Worte entlockten mir trotz aller Aufruhr im Magen ein Lächeln. In keinem anderen Land dieser Welt wurden die Einheimischen so herzlich am Flughafen empfangen wie in Island.
Caro und ich blieben auf unseren Plätzen sitzen, bis die übrigen Passagiere ausgestiegen waren, was mir Zeit gab, zur Ruhe zu kommen. Auch mein Magen fühlte sich nach wenigen Minuten wieder besser an, und als wir unser Gepäck endlich eingesammelt hatten, verspürte ich sogar so etwas wie Hunger. Bei ›Sbarro‹ holten wir uns zwei Stückchen der berühmten ›Original New York Pizza‹ und ich begann zu begreifen, was die Reiseführerautoren meinten, wenn sie schrieben, Island sei urtümlich und hypermodern in einem.
Rund eine Stunde später nahm Caro hinter dem Steuer unseres Mietwagens Platz und lenkte den Allrad-Wagen sicher vom Flughafengelände. Für unsere Route von Keflavik nach Reykholt hätte es sicher auch jeder Durchschnittswagen getan, aber Caro hatte darauf bestanden ein Auto zu mieten, mit dem wir auch ausgedehnte Trips in die Highlands machen konnten, wenn uns in den nächsten Tagen der Sinn danach stand.
Rasch ließen wir den Leif-Eriksson-Flughafen hinter uns und wechselten auf die Ringstraße in Richtung Reykjavik. Die in Gestein gefräste Landstraße führte stellenweise direkt durch ein Lavafeld. Bizarre Basaltstrukturen blitzten neben der Fahrbahn auf und ich hörte fasziniert zu, wie Caro mir erzählte, die Amerikaner hätten einst auf dieser Straße ihre Mondlandefahrzeuge ausprobiert.
Ich hatte keine Ahnung, wie viele Reiseführer Caro in den letzten Wochen gewälzt hatte, doch ihre Begeisterung für jeden einzelnen Krater neben der Straße steckte auch mich an. Spontan hielten wir kurz vor Reykjavik neben der Fahrbahn, ich kramte meine Kamera aus meinem Rucksack im Kofferraum und schoss über fünfzig Bilder von dem Ausblick über die Ringstraße hinweg. In der Ferne waren die Umrisse eines Vulkans zu erkennen, rund einhundert Meter von unserem Standpunkt entfernt dampfte es aus dem Boden.
Insgesamt fünf Mal unterbrachen wir unsere Fahrt, um auszusteigen, Fotos zu schießen, uns einfach umzusehen. Alleine die rund zweistündige Fahrt von Keflavik nach Reykholt machte uns eines klar: Island war eine andere Welt.
~*~
Mein Haus stand auf einer Hügelkuppe, auf der es das Frühlingsgras bereits jetzt im April schaffte, hier und da ein hellgrünes Köpfchen durch den von Lawageröll überzogenen Boden hindurchzustrecken. Noch kam es mir seltsam vor, das aus rötlichen Backsteinen erbaute und mit einem grauen Flachdach gedeckte Häuschen ›mein‹ zu nennen, aber es würde gehen. Mit der Zeit würde es mehr zu meinem Eigenheim werden, als es das Anwesen meiner Eltern je gewesen war.
»Schön«, stellte Caro fest, als sie mit Taschen beladen neben mich trat. »Echt richtig schön.« Anerkennend ließ sie den Blick über das Tal schweifen, in dem zwischen den Wohnhäusern unzählige heiße Quellen brodelten und rauchten. Das Reykholtsdalur, das Rauch-Tal, machte seinem Namen alle Ehre. Zwar befand sich in unmittelbarer Nähe zu meinem Eigenheim keine Quelle, dafür hatten die Bilder auf der Website der Makleragentur einen ›heitur pottur‹ auf der Terrasse versprochen.
Und genau in jenem ließen meine Cousine und ich den Abend ausklingen, nachdem wir unser Gepäck notdürftig in dem rustikal möblierten Häuschen verstaut hatten. Das runde Betonbecken bot ausreichend Platz, sodass neben Caro und mir noch locker vier weitere Leute hineingepasst hätten. Ich bezweifelte allerdings, dass ich in diesem Haus, geschweige denn in diesem Becken, jemals so viel Besuch empfangen würde.
Das heiße, sprudelnde Wasser lockerte meine verkrampften Muskeln und ich hätte auf der Stelle einschlafen können, wäre der Anblick, wie die Sonne hinter den schroffen Vulkangebirgsketten in der Ferne verschwand, nicht viel zu atemberaubend gewesen.
»Wenn das hier nicht der richtige Platz ist, um endlich dein Herzensprojekt zu schreiben, dann weiß ich auch nicht.«
Durch den Dampf des heißen Pottes hindurch musterte ich meine Cousine nachdenklich. Sie war neben meinen Eltern und meiner Agentin die einzige Person, die wusste, dass mein nicht gerade schlechter Verdienst nicht alleine von meinem Brotjob als Steuerfachangestellter herrührte und dass hinter dem Pseudonym des bekannten Erotik-Thriller Autors Jayden R. Clifton niemand anderes steckte als ich selbst. Meine Agentin und ich hatten ein präzises Lebenskonstrukt um Clifton aufgebaut. Seine Biografie war lückenlos. Nicht einmal die Verlagschefs wussten, dass Jayden R. Clifton nicht aus New York, sondern aus einer Kleinstadt im Norden Deutschlands stammte und nach einer ziemlich deutlichen Ansage meiner Agentin bettelte auch niemand mehr darum, Clifton zu einer Lesung zu überreden. Angeblich lebte Clifton aus Angst vor aufdringlichen Fans zurückgezogen in einem einsamen Landhaus irgendwo in Arizona. Das mochte reichlich theatralisch für einen Autor anmuten, aber ein bisschen Wahnsinn hatte noch keinem Künstler geschadet.
Caro hatte monatelang versucht, mich davon zu überzeugen, dass es meiner Karriere als Autor auch keinen Abbruch tun würde, wenn meine Leser wüssten, dass ich an Tourette litt. Aber alleine die Vorstellung, erkannt und angesprochen zu werden, ließ meine verbalen Tics auf ein schier unerträgliches Höchstmaß steigen, dass ich ihr mit sofortigem Kontaktabbruch gedroht hatte, sollten sie jemals ausplaudern, wer wirklich hinter Jayden R. Clifton steckte. Ganz abgesehen davon, dass mich mein Vater vermutlich eigenhändig umgebracht hätte, hätte ich unsere Abmachung, mich in Bezug auf meine Romane bedeckt zu halten, gebrochen.
»Ja, vielleicht«, murmelte ich und riss mich damit selbst aus meinen Gedanken. »Vielleicht schreibe ich die Story wirklich mal nieder. Aber zuerst muss der nächste Thriller fertig werden. Ende Mai habe ich Abgabetermin.«
Caro begann plötzlich zu kichern und erklärte glucksend: »Wusstest du, dass in isländischen Krimis mehr Morde passieren, als im realen Leben auf Island?«
Ich verdrehte die Augen.
»Wo hast du das nun wieder her? Aber hey, ich hoffe doch, dass es so ist. Wie viele Einwohner hat Island?«
»Etwas weniger als 350.000, glaube ich.«
»Hmm, ich hab zwar keine Ahnung, wie viele Leute schon literarisch auf Island gestorben sind, aber gäbe es annähernd so viele reale Morde, wären die Isländer sicher längst ausgestorben.«
Caro prostete mir mit ihrer Tasse Glühwein zu und verkündete verschwörerisch: »Mehr Platz für dich auf der Insel.«
Ich lachte kurz auf, verstummte aber im nächsten Moment bei dem Gedanken, dass mir selbst dreieinhalb Einwohner pro Quadratkilometer zu viel waren.
»Hast du jemals einen Satz von deinem Herzensprojekt geschrieben?«, wollte Caro unvermittelt wissen. Ich seufzte erneut und schüttelte den Kopf.
»Nein. Ich trage die Geschichte schon so lange mit mir herum, dass ich nicht recht weiß, wie ich anfangen soll. Da sind so viele ungeschriebene Worte, von denen ich genau weiß, wie sie klingen müssen, aber wenn ich dann vor dem Laptop sitze ...«
Caro nickte verstehend, und obwohl sie selbst kaum mehr als Einkaufszettel schrieb, glaubte ich ihr, dass sie es nachvollziehen konnte. Mein Kopf quoll vor Wörtern beinahe über, aber jedes klang falsch, sobald ich es freiließ. Das Problem hatte ich bislang bei keinem meiner Thriller gehabt.
»Du hast mir nie wirklich erzählt, worum es in diesem Projekt eigentlich geht«, meinte Caro nachdenklich. Ungewollt richtete ich mich im Pott auf, mein rechter Arm zuckte unwillig.
»Schon gut.« Caro lächelte schief. »Ich weiß schon, du sprichst nicht gern über unveröffentlichte Romane.«
»Das ist es nicht«, murmelte ich, fand aber auch keine Worte, um zu erklären, was es war.
Meine Cousine lächelte nur wissend und nahm einen erneuten Schluck Glühwein.
2. Kapitel
~~~ Kristján ~~~
Im Türrahmen stehend drehte Andri sich noch einmal zu mir um und sah mich an. In seinen dunklen Augen lag ein feuchter Schimmer, der von Trauer oder einem schlechten Gewissen hätte zeugen können. Doch offenbar hatte ich mich in den letzten Monaten oft genug in seinem Blick getäuscht. Besser also, ich maß seiner Miene keine besondere Bedeutung zu.
»Tja, dann ...« Kurz wirkte es, als wolle er einen Schritt auf mich zutreten, aber er tat es nicht. »Das war’s dann wohl.« Er klang mehr verlegen, denn tatsächlich enttäuscht.
Knapp entgegnete ich: »Ja, das war’s dann. Mach’s gut, Andri.«
Über sein schönes Gesicht, mit den hohen Wangenknochen, die ich so oft geküsst hatte, huschte ein Schatten. Eindeutig Enttäuschung geschuldet.
»Kristján, ich ... Mann, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so endet, aber ...«
»Lass gut sein«, unterbrach ich ihn schroff.
»Aber ...« Er hob die Hände in einer unschlüssigen Geste, was dank der Reisetaschen, die an seinen Armen hingen, reichlich merkwürdig aussah. Der Rucksack auf seinem Rücken erinnerte mich schmerzlich an unsere letzte Trekking-Tour im vergangenen Sommer. An kalte Nächte im Zelt, in denen wir uns im Schlafsack nackt aneinandergekuschelt hatten.
»Nichts aber, Andri. Wenn du ihn liebst, dann ...« Ich brachte den Satz nicht zu Ende, weil ich schlichtweg nicht wusste, was dann war. Dann war es wohl das Ende. Für uns.
»Ja, ich ... das tue ich, aber ...« Er stieß schwer den Atem aus, seine Unterlippe zitterte kaum merklich, aber genug für mich, um es zu erkennen. Nach all der Zeit ... »Aber dich hab ich auch geliebt. Wirklich. Ich ...«
»Geh jetzt bitte.«
Noch einmal öffnete er den Mund, sagte dieses Mal aber nichts. Es war alles ausgesprochen zwischen uns. Was blieb, war ...
Leere.
Gefühlsverwirrtes Vakuum.
»Mach’s gut, Kristján. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.«
Ich glaubte nicht, dass er darauf eine Antwort erwartete, und er erhielt auch keine. Es war nicht so, dass ich ihm keine gute Zukunft wünschte, aber der Schmerz über die Erkenntnis, dass er mich wochenlang verarscht hatte, saß einfach zu tief, um ihn im Guten gehen zu lassen.
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss und zurück blieb die vage Erinnerung an seinen Geruch und an das Gefühl seiner seidig-schwarzen Haare unter meinen Fingern und auf meiner Brust, wenn er sich an mich schmiegte.
Schmerzerfülltes Vakuum.
Abrupt wandte ich mich um und eilte in die Küche, kippte dort meinen nur noch lauwarmem Kaffee hinunter und versuchte nicht daran zu denken, wie Andri mir jeden Morgen eine Tasse ans Bett gebracht hatte. Selbst in den letzten Wochen vor unserer Trennung noch. Selbst als er längst schon mit Daníel geschlafen hatte.
Das Schlimmste an dieser Trennung war nicht, dass Andri und ich ab sofort endgültig getrennte Wege gehen würden. Sicher würde ich ihn vermissen. Aber ich war eigenständig genug, um zu wissen, dass ich auch ohne ihn leben konnte. Was wirklich weh tat, war die Tatsache, dass mich ein Mensch, von dem ich gedacht hatte, ich würde ihn in und auswendig kennen, wochenlang verarscht und belogen hatte.
Über einen Monat lang – das hatte er selbst zugegeben – hatte er sich bereits mit Daníel getroffen. War mit ihm ins Kino gegangen und zum Schwimmen. Hatte ihn berührt, geküsst und ... mehr. Und trotzdem hatte er mir jeden Morgen Kaffee ans Bett gebracht, mich angelächelt und mir einen Kuss auf die Stirn gedrückt, ehe er ging. Seine Küsse hatten sich bis zuletzt angefühlt, als meinte er mit ihnen, was ich erhoffte. Wovon ich ausging. Aber letztlich hatte er dabei vermutlich viel mehr Daníel gemeint als mich.
Ehe ich weiter darüber nachdenken konnte, an welchem Punkt Andri begonnen hatte, sich von mir zu entfernen, ohne dass ich es merkte, vibrierte mein Handy auf der Arbeitsplatte. Mit einem tiefen Stoßseufzer griff ich danach und runzelte überrascht die Stirn, als ich Sóleys Nummer erkannte. Normalerweise rief sie mich nur an, wenn etwas mit den Pferden nicht in Ordnung war. Dementsprechend nervös nahm ich ab.
»Sóley, was gibt’s?«
»Kristján, gut, dass ich dich erreiche. Keine Sorge, auf dem Hof ist alles in Ordnung, aber ich habe eine riesige Bitte an dich.«
»Okay.« Ich nippte noch einmal an meinem Kaffee, kippte das lauwarme Gebräu dann aber kurzerhand in die Spüle.
»Ich hab gerade einen Anruf erhalten. Meine Tante Bryndis ist heute Nacht verstorben und ihre Töchter lassen fragen, ob ich nach Húsey kommen kann – heute noch.«
»Oh, verstehe.« Es war überdeutlich, wohin dieses Gespräch führen würde und Sóleys Stottern verriet, wie unangenehm ihr dieser Anruf war. »Ist okay«, schob ich rasch hinterher, in der Hoffnung, ihr schlechtes Gewisses damit beruhigen zu können. »Ich springe für dich ein.«
»Wirklich? Das wäre ... Ach, Mensch, aber du hast doch Urlaub.«
»Und ich bin frisch getrennt. Glaub mir, ein bisschen Ablenkung schadet mir nicht.«
»Wirklich?«, wiederholte sie. »Tut mir echt leid, das mit Andri. Gunnar würde den Hof sicher auch zwei Tage alleine schmeißen, aber heute startet doch die Þingvellir-Tour und wir haben neunzehn Buchungen, das können wir nicht so kurzfristig absagen und ...«
»Sóley, es ist in Ordnung.« Ich war bereits aus der Küche und auf dem Flur in Richtung meines Schlafzimmers. »Wirklich«, schob ich hinterher, während ich die Tür zur Schrankseite aufzog, die von oben bis unten mit Reitklamotten vollgestopft war. »Ich ziehe mich nur rasch um und dann mache ich mich direkt auf den Weg. Wann soll die Tour starten?«
»Du bist ein Schatz, Kristján! Um zehn Uhr, schaffst du das?«
Ich warf einen prüfenden Blick auf die Uhr und dann einen aus dem Fenster. Kein spontanes Schneetreiben in Sicht.
»Klar. Sind alle Pferde auf dem Hof, die wir brauchen?«
»Alle da, ich hab sie gestern schon von der Weide geholt.«
»Okay, dann mache ich mich gleich auf den Weg. Mein Beileid wegen Bryndis.«
»Danke. Auch wegen der Tour. Ich rede mit Gunnar, dass du die Urlaubstage nachholen kannst.«
»Schon gut, bis dann. Fahr vorsichtig.«
»Klar, bis dann, Kristján.«
Ich ließ das Handy sinken und überlegte, ob Sóleys Tante Bryndis die angeheiratete Großnichte namens Bryndis meines Onkels Oskar sein könnte. Möglich wäre es, denn schließlich war die erste Frage bei isländischen Verwandtschaftsangelegenheiten nicht ob man verwandt war, sondern wie. Ich hätte Sóley nach Bryndis’ Vaternamen fragen sollen, aber deshalb würde ich sie nicht zurückrufen und aufhalten.
Achtlos warf ich das Handy auf mein Bett und zog eine meiner Trekking-Reithosen, ein Funktionsshirt und eine Fleecejacke mit hohem Kragen aus dem Schrank. Während ich mich in die Klamotten zwängte, betete ich innerlich, es mögen sich nur erfahrene Reiter für die Vier-Tages-Tour angemeldet haben. Nicht nur, dass eine solche Tour mit routinierten Reitern sehr viel entspannter war als mit nicht so sattelfesten, mir stand auch nicht der Sinn danach, im Schneckentempo zum Þingvellir zu reiten. Vielmehr sehnte ich mich nach dem Gefühl, wenn das Pferd im Rennpass mit mir über die Schotterstrecken flog.
~~~ Roman ~~~
»Findest du einen Ausflug zum Þingvellir nicht ein wenig ... touristisch?«, hakte ich nach, aber Caro schmetterte meine geäußerten Zweifel eiskalt ab: »Nee, ich finde, das ist Pflicht. Du kannst doch nicht in Island leben, aber noch nie auf der Þingvellir gewesen sein.«
Ich war zwar der Meinung, dass das durchaus im Bereich des Möglichen lag, aber aus Erfahrung wusste ich, dass es keinen Sinn machte, auch nur den Versuch zu starten, Caro von einem gefassten Entschluss abzubringen. Also gab ich seufzend klein bei und nahm auf dem Beifahrersitz Platz.
»Du weißt schon, dass du dir ein Auto kaufen und selber wirst fahren müssen, sobald ich weg bin?«
»Ja«, murrte ich und wandte den Blick betont unbeteiligt aus dem Fenster. Natürlich hatte meine Cousine recht. Ich würde definitiv ein Auto brauchen. In Island gab es genau zwei sinnvolle Fortbewegungsarten: mit dem Auto oder auf dem Pferderücken. Ein Bahnnetz war quasi nicht existent, und spontane Fußwanderungen konnten übel in einem Schneesturm enden.
»Ich könnte mir auch ein Pferd kaufen.«
»Mach doch«, schoss Caro zurück, als sei sie sich sicher, dass ich diese Idee doch nie in die Tat umsetzen würde.
»Ernsthaft«, beharrte ich und umschloss vorsorglich den Haltegriff an der Türinnenseite, als Caro den Allrad-Wagen etwas schneller als nötig über die Schotterpiste vor meinem Haus in Richtung der Landstraße lenkte. »Ich finde die Idee nicht so schlecht. Hier hat jeder Zweite ein Pferd – oder mehrere.«
»Ich fände das auch nicht blöd«, pflichtete sie mir bei und warf mir einen vielsagenden Seitenblick zu. »Dann hättest du wenigstens ein bisschen Gesellschaft. Nicht, dass man ein Pferd mit einem Menschen vergleichen könnte. Einem Mann ... Hast du wirklich vor, dich hier einzumauern? Vermisst du keinen Kerl an deiner Seite? Mal ehrlich, willst du nicht mal wieder Sex haben?«
»Oh, Caro ...«
»Sorry. Aber ist doch wahr. Willst du nicht ...?«
»Nein. Und vor allem will ich nicht darüber reden.« Nicht darüber!
Caro seufzte neben mir, entgegnete jedoch nichts mehr. Ich warf ihr einen langen Blick zu – halb dankbar, halb entschuldigend. Und ein wenig trotzig. Sie lächelte mich schief an und wandte den Blick wortlos auf die vor uns liegende Ringstraße. Auch ich sah wieder aus dem Fenster und wir verfielen in Schweigen.
Es war keine unangenehme Stille, aber sie war auch nicht so komfortabel, dass ich sie hätte genießen können. In meinem Solarplexus kribbelte es ein wenig, ich atmete aus und gestattete meinen Stimmbändern ein paar kläffende Laute zu produzieren. Dazu ruckte mein Kopf ein paar Mal nach links, ehe ich mich entspannt in den Sitz sinken ließ. Mit keinem anderen Menschen an meiner Seite als Caro ließ ich meine Tics so unbedarft zu. Es tat gut, mich in diesem Moment nicht beherrschen zu müssen. Oder vielmehr es versuchen zu müssen. Denn beherrschbar waren meine Tics ohnehin fast nie.
»Musik?«, fragte Caro beiläufig zwischen zwei meiner Kläffer hinein. Ich nickte ihr zu, ohne sie anzuschauen und sobald Sigur Ros’ Stimme aus dem Radio schallte, beruhigte sich mein Solarplexus. Ich ließ meinen Kopf entspannt gegen die Nackenstütze sinken und schloss die Augen.
~*~
Ich musste tatsächlich weggedämmert sein, denn als mich schließlich die sanfte Stimme der Frontfrau von ›Of Monsters and Men‹ aus dem Dämmerzustand holte, bog Caro gerade von der Ringstraße Nummer 1 auf die Þingvallavegur ein. Ich rieb mir die Schläfrigkeit aus den Augen und wurde gleich darauf von der typisch isländischen Landszenerie gefangen genommen.
Wo eben noch teils saftig grüne, teils kargere Wiesen die Straße gesäumt hatten, wuchsen immer mehr Bauernhöfe mit roten oder blauen Wellblechdächern aus dem Boden. Je weiter wir in Richtung der Berge fuhren, desto öfter tauchten kleine Gehöfte am Straßenrand und in der Ferne auf und schließlich erschien rechter Hand eine Villa, die auf den ersten Blick nicht recht in das idyllische, naturbelassene Bild passen wollte.
»Mach mal langsam«, wies ich Caro an und kramte in dem Rucksack zu meinen Füßen nach meiner Kamera. Im Schritttempo zuckelten wir an der dicht am Straßenrand stehenden Villa vorbei. Gljúfrasteinn, das Haus, in dem Halldór Laxness die zweite Hälfte seines langen Lebens verbracht hatte, wirkte auf mich wie ein Wächter am Eingang zu einer anderen Welt. Zu der Welt der großen Schriftsteller Islands und zu der Welt der Sagen und Mythen, die über Jahrhunderte niemals in Vergessenheit geraten waren.
Von meinen Erotik-Thrillern würde in fünfzig oder gar hundert Jahren sicher niemand mehr sprechen. Aber mir sollte es recht sein. Ich war glücklich, solange mir meine Schreiberei meinen Lebensunterhalt sicherte und ich mir ab und an die Leserkommentare durchsehen konnte, in dem Wissen, dass mich niemand auf mein letztes Werk ansprechen würde, träfe er mich beim Bäcker.
»Willst du reingehen?« Caros Stimme riss mich aus meinen Gedanken. »Ich hab gehört, eine Besichtigung soll richtig lohnenswert sein. Die Villa ist noch so eingerichtet, wie zu der Zeit, als Laxness darin gelebt hat.« Sie kicherte leise. »Sogar das Wasser in seinem hauseigenen Schwimmbad soll noch warm sein.«
Auch wenn die Aussicht, noch weiter auf Laxness’ Spuren zu wandeln, verlockend war, winkte ich ab.
»Vielleicht schaue ich es mir irgendwann mal an. Lass uns zum Þingvellir weiterfahren.«
»Okay.«
Caro gab erneut Gas und schon bald tauchte der größte See dieses kleinen Landes vor uns auf. Der Þingvallawatn lag still, tief und wahrscheinlich unendlich kalt zwischen schroffen Basaltformationen. In der Ferne erstreckte sich ein Panorama aus Schildvulkanen und gletscherbedeckten Bergen. Es war eines dieser Bilder, welches man tausendfach auf Postkarten und in Bildbänden bewundern konnte und doch kam keine jener Fotografien dem nahe, was ich durch die Autoscheibe sah. Das vom Meer in tausend Teile gebrochene Licht ließ den See und die umliegenden Berge in einem seltsam klaren Glanz erstrahlen. Es war jenes für Island so typische Licht, das jeden Urlaubsschnappschuss unweigerlich kitschig erscheinen ließ. Es war das Licht einer Natur, die keineswegs unberührt war und doch den Anschein hatte, als würde sie genau in diesem Moment zum ersten Mal betrachtet und fotografiert werden.
Neben mir war Caro in andächtiges Schweigen verfallen. Erst langsam begriff ich, dass sie am Fahrbahnrand angehalten hatte und wir beide wie gebannt auf den Þingvallavatn starrten. Und zum ersten Mal, seit wir vor drei Tagen in Island angekommen waren, hatte ich das Gefühl, wirklich hier zu sein.
~*~
Wir parkten den Wagen in der Nähe des Visitor Centers, wobei uns auf den ersten Blick klar wurde, dass die Þingvellir auch jetzt im April zu den meistbesuchtesten Sehenswürdigkeiten Islands gehörte.
»Meinst du, wir finden irgendwo ein ruhiges Plätzchen?« Zweifelnd sah Caro sich um. Ich zuckte nur mit den Schultern. Die Geste kam mir ganz recht, um einen Tic zu überspielen. Mit all den Touristen um mich herum spürte ich schon wieder das unheilvolle Kribbeln tief im Sonnengeflecht.
Caro zurrte die Riemen ihres Rucksacks fest und hakte sich bei mir unter, zog mich entschlossen fort vom Visitor Center. Wir folgten zu Fuß der Beschilderung auf einen der Hiking Tracks, der zur Almannagjá führte.
Zum Glück war es recht früh am Morgen und die meisten Touristen diskutierten noch über die beste Route oder versuchten ihre quengelnden Kinder zu beruhigen, sodass wir nach wenigen Gehminuten zwar noch andere Leute in Sicht-, nicht aber in Hörweite hatten.