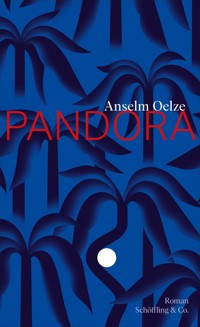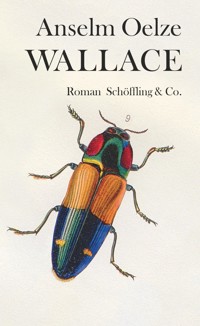Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen und ein Haus, in dem sie aufeinandertreffen - und entscheiden müssen, was sie retten wollen: ihre Überzeugungen oder die Beziehungen zu den Menschen, die sie lieben. Als Tess mit ihrer Freundin Moyra in eine schöne Altbauwohnung im Leipziger Zentrum zieht, gehen für sie gleich mehrere Träume in Erfüllung. Ihre Beziehung hat endlich ein Zuhause und mit der Unterstützung von Moyras Eltern kann sie sogar ihre eigene Schneiderei eröffnen: und zwar im Erdgeschoss des Hauses, wo Rolf, der Mann ihrer Nachbarin Heike, einen Getränkeladen betrieben hatte, bis dieser der Konkurrenz durch die Lieferservices und der steigenden Ladenmiete zum Opfer fiel. Seit über dreißig Jahren lebt das ältere Paar im obersten Stock des Hauses. Als ihm nun auch die Wohnung gekündigt wird, bieten die jungen Frauen Hilfe an. Aber je mehr Heike und Rolf auf »das kaputte System« und »die korrupten Eliten« schimpfen und allerorten Verschwörungen wittern, desto entschlossener geht Moyra auf Distanz. Tess dagegen gerät in arge Solidaritätskonflikte, und schließlich sind alle gezwungen, zu entscheiden, was sie retten wollen: ihre eigenen Überzeugungen oder die Beziehungen zu den Menschen, die sie lieben. In seinem neuen Roman erzählt Anselm Oelze nicht nur die Geschichte eines Hauses und dreier Frauen. Einfühlsam und lebensnah befasst er sich auch mit den Spaltungen in der Gesellschaft und fragt danach, wie Zusammenleben wider alle Erwartungen gelingen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANSELM OELZE
DIE DAOBEN
ROMAN
WALLSTEIN VERLAG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
https://dnb.dnb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2025
Wallstein Verlag GmbH
Geiststr. 11, 37073 Göttingen
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Eva Mutter (evamutter.com)
ISBN (Print) 978-3-8353-5977-2
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8943-4
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8944-1
Inhalt
Frühling
Sommer
Herbst
Winter
Dank
FRÜHLING
1
Das Tempo, mit dem Tess in die Lisztstraße einbog, war zu hoch, das wusste sie. Aber noch bevor sie dieses Wissen in eine Handlung verwandeln konnte, war es zu spät.
»Ey!«, schrie Moyra.
Tess konnte nicht ausmachen, ob das noch eine Warnung oder schon ein Vorwurf sein sollte. Sie spürte vor allem den Stoß, der von ihrem rechten Fuß über die Beine, das Becken und die Wirbelsäule bis hinauf in den Nacken jagte, während der Werkzeugkasten gegen das Armaturenbrett knallte.
»Sorry!«, sagte sie kleinlaut. Sie merkte, wie Moyra sich zusammenriss, jetzt keinen Vortrag über Schlaglöcher zu halten. Der schlechte Zustand vieler Leipziger Straßen war ein Thema, das sie immer wieder ansprach. Aber es war trotzdem nicht ganz klar, ob sie es deshalb tat, weil es für sie tatsächlich ein ernsthaftes Problem darstellte, etwas, das sie stresste, wenn sie, meistens per Fahrrad, in der Stadt unterwegs war. Oder weil sie rätselte, weshalb viele Straßen dreißig Jahre nach der Wende noch immer so aussahen wie vor dem Mauerfall.
»Hat jemand die Tonnen verrückt?« Moyra lehnte sich aus dem Fenster, während Tess den Transporter vor dem Haus mit der Nummer 5 zum Stehen brachte. Das rot-weiße Flatterband hing nicht mehr so straff wie noch am Vorabend, als sie es zusammen mit einem DIN-A4-Blatt und dem Hinweis ›Umzug am 1. April‹ zwischen zwei Mülltonnen gespannt hatten.
»Hat doch jemand für einen Scherz gehalten«, sagte Tess. »Wie ich’s befürchtet habe.«
Moyra ging nicht darauf ein. »Der blaue Twingo stand gestern noch nicht da«, stellte sie fest.
»Stimmt.« Tess regte sich, anders als Moyra, jetzt nicht darüber auf, dass irgendjemand seinen Kleinwagen in einen Teil ihrer Parklücke gestellt hatte. Denn erstens hatten sie sich bewusst dagegen entschieden, kostenpflichtige Parkverbotsschilder beim Ordnungsamt zu beantragen. Und zweitens kam es ganz gelegen, dass Moyras Wut sich nun nicht mehr gegen sie und ihren, wie sie selbst immer sagte, ›robusten‹ Fahrstil richtete, sondern gegen den unbekannten Besitzer oder die unbekannte Besitzerin des Twingos, dessen hellblauer Lack schadenfroh in der Frühlingssonne glänzte.
»Was machen wir jetzt?« Moyra betrachtete die Parklücke.
»Geht auch so.« Tess bewegte ihre Hand zum Schaltknüppel.
»Sicher?«
Sie war sich – ehrlich gesagt – nicht ganz sicher. Aber es war nun mal eine Top-Gelegenheit, den heftigen Stoß, der nicht nur sie, sondern sehr hörbar auch die Kisten und Möbel im Laderaum durchgerüttelt hatte, durch ein Eins-a-Einparkmanöver vergessen zu machen.
Moyras Stirnfalten spornten sie an. Sie sparte sich den Hinweis, dass nicht sie diejenige gewesen war, die eine offizielle Absperrung als »reine Geldverschwendung« bezeichnet hatte, und warf Moyra einen Blick zu, der so zuversichtlich war, wie er nur sein konnte.
Keine zwei Minuten später sprang sie mit einem Grinsen vom Fahrersitz.
»Alle Achtung, Tessi!« Moyra drückte ihr einen Kuss auf die Lippen.
Vom Ende der Straße näherten sich die anderen, die den Weg von Tess’ alter Wohnung per Fahrrad zurückgelegt hatten.
»Sehr schick!«, sagte Fabian. Er lehnte sein Rad an die Hauswand und schaute die beigefarbene Fassade empor. »Wie seid ihr denn da rangekommen?«
Tess öffnete die Türen zur Ladefläche, verbarg ihr Schmunzeln. Sie wusste, was jetzt kam.
»Wir hätten auch nicht gedacht, im Zentrum zu laden«, fing Moyra an. Wie so oft in letzter Zeit, wenn jemand danach fragte, holte sie zu einer ganzen Reihe weiterer Erklärungen aus, die in Tess’ Ohren allesamt wie Entschuldigungen klangen: dass sie ohne den Hinweis einer Kollegin, die mit der Vormieterin befreundet ist, niemals von der Wohnung erfahren hätten; dass das Haus in privater Hand und die Miete wirklich ein Witz im Vergleich zu dem sei, was sonst inzwischen in der Gegend verlangt würde; dass sie von hier aus schnell zum Bahnhof kämen.
»Ist es dir peinlich, hier zu wohnen?«, hatte sie Moyra neulich gefragt.
»Es ist mir nicht peinlich. Ich find’s super!«
»Okay. Und warum erläuterst du dann immer ellenlang die genauen Umstände?«
»Ich erzähle ja nur, wie wir die Wohnung gefunden haben.«
Tess versuchte, sich damit zufriedenzugeben. Trotzdem empfand sie die Äußerungen als Schmälerung dessen, was für sie rundum einen Triumph darstellte: in einer Altbauwohnung in zentraler Lage zu wohnen, mit drei Zimmern, hellem Dielenboden, hohen Fenstern und einem schattigen Hof mit gemeinschaftlich genutztem Garten. Dazu kam – und das war aus ihrer Sicht das Beste – ein Ladenlokal unten im Haus, in dem sie nach all den Jahren schlecht bezahlter, fremdbestimmter Arbeit ihre erste Maßschneiderei einrichten würde.
Sie inspizierte den Laderaum. »Sieht nicht so aus, als wäre was kaputt gegangen«, sagte sie zu Moyra gewandt. Sie griff nach einer Kiste.
In der Wohnung roch es nach dem frisch getrockneten Polarweiß, das sie auf die tapetenlosen Wände gestrichen hatten. Sie stellte die Kiste im Wohnzimmer ab und ging zum Fenster. Moyra stand noch immer mit den anderen vorm Haus. Die Sonne schien auf ihr Haar. Tess wollte sie am liebsten nach oben rufen, um noch einmal kurz mit ihr allein zu sein, die leere Wohnung zu genießen, bevor die Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sie füllten. Es fühlte sich so gut an, ihre Beziehung, die durch das Wohnen an unterschiedlichen Orten bisher immer noch etwas halbgar gewesen war, in etwas Fertiges zu verwandeln.
Sie sprang die Treppe hinunter, nahm jeweils zwei Stufen auf einmal, rief Fabian und Anna zu, dass sie die Kommode ins Schlafzimmer bringen sollten.
»Läuft«, sagte sie zu Moyra und legte ihr die Hände auf die Schultern.
Moyra reagierte nicht. Sie hockte neben einem Stuhl, verrenkte ihren Kopf, um unter die Sitzfläche schauen zu können. Sie sah aus wie eine Automechanikerin, die einen Unterboden inspizierte.
»Scheiße, Tess!«, sagte sie, als sie wieder auftauchte.
»Was ist?«
Moyra griff nach der Sitzschale, bog sie zur Seite. Die Verankerung am Standbein schien beschädigt zu sein. »So viel zum Thema ›Sieht nicht so aus, als wäre was kaputt gegangen‹.«
»Fuck«, murmelte Tess. Sie lehnte sich an die Hauswand.
*
Vor fünf Monaten war sie dem Stuhl zum ersten Mal begegnet, an einem Samstagnachmittag in Berlin. Die Stadt lag unter der üblichen Decke aus Novembergrau. Sie hatten die Nacht nicht in Moyras Einzimmerwohnung im Wedding, sondern um die Ecke vom Rosenthaler Platz in der Maisonette von Nick verbracht. Moyra kannte Nick seit dem Studium. Sie hatten nicht das Gleiche studiert, aber das gleiche Stipendium erhalten. Und Nick hatte nicht den Weg in die Wissenschaft, sondern in eine Großkanzlei eingeschlagen.
»Also das war mindestens finanziell die richtige Entscheidung«, sagte Moyra, während sie im Wohnzimmer seine Plattensammlung durchstöberte. »Der Junge hat einfach so viel Geld.«
Tess bezweifelte das nicht. Und trotzdem stieß sie sich daran, dass Moyra ihre Wohnung für eine Woche an eine Australierin untervermietete, die für eine Tagung und ein wenig Sightseeing in der Stadt war, und zwar zu einem Preis, der deutlich über der Monatsmiete lag, während sie – kostenlos – Nicks Wohnung nutzten.
»Was stört dich daran?«, fragte Moyra und zog eine Dylan-Platte aus der Papphülle. »Die bekommt ihre Übernachtungskosten von der Uni erstattet, und Nick ist in Zürich. Die Wohnung wäre also sowieso leer gewesen. Hätte er was dagegen gehabt, hätte er mir die Schlüssel nicht gegeben, oder?«
Tess streifte durch die Wohnung. Sie war geräumig, sauber und, besonders im Vergleich zu Moyras dunklem Hinterhofloch, sehr hell. Aber bei jedem Schritt und jedem Griff hatte sie Angst, etwas kaputtzumachen: die mundgeblasene spanische Vase, die auf dem Boden stand; die verchromte Siebträgermaschine in der Küche, mit der sie gar nicht erst versuchen würde, einen Kaffee zuzubereiten; die Weißweingläser, von denen Moyra behauptete, eines allein koste mehr als der für ihre Verhältnisse sehr teure Chardonnay, den sie nun auf dem Sofa tranken, während Don’t Think Twice, It’s All Right lief.
Moyra hatte die Beine vor der Brust angewinkelt und rutschte näher, um ihre Hand in Tess Nacken zu legen.
Tess spürte das sanfte Kraulen auf ihrer Haut. Es war klar, was Moyra vorschwebte, um die anderthalb Stunden bis zum Abendessen, für das sie einen Tisch in einer neuen Ramen-Bar ergattert hatten, auszufüllen.
Sie legte ihr die Hand aufs Knie. »Tut mir leid, Mo, aber ich bin irgendwie nicht in Stimmung. Wenn du willst, könnte ich zumindest …«
Moyra schüttelte den Kopf und rutschte von ihr weg.
Tess wollte ihre Unlust auf Nicks Wohnung schieben, auf die großformatigen Bilder, die er einer befreundeten Malerin abgekauft hatte und deren grelle Neonfarben sie abturnten. Aber sie konnte nicht riskieren, die Laune sinken zu lassen. Sie war vielmehr darauf angewiesen, Moyra in eine Hochstimmung zu versetzen, damit die möglichst locker nahm, was sie ihr erzählen wollte (nicht weil sie es wirklich wollte, sondern weil sie meinte, es erzählen zu müssen, wenn sie dem Prinzip treu bleiben wollte, das sie als Rezept für das Gelingen ihrer, ja, jeglicher Beziehung ausgegeben hatten: radikale Ehrlichkeit).
Schon vor fünf Tagen hatte sie den ersten Anlauf nehmen wollen. Moyra war gerade erst aus Göteborg zurückgekehrt und Tess war fest entschlossen, sofort mit der Sprache rauszurücken, sobald sie gefragt wurde, wie ihr Wochenende gewesen war. Doch Moyra ließ sich eine halbe Stunde lang so sehr über ihre Post-Doc-Kollegin Judith aus, dass Tess, als Moyra schließlich nach ihrem Wochenende fragte, lediglich sagte: »Es war ganz okay.«
Natürlich war es viel mehr als lediglich okay gewesen. Sie hatte einen fantastischen Freitagabend gehabt, einen fantastischen Samstag und einen noch viel fantastischeren Samstagabend – eingeleitet durch Fabians Geburtstagsfeier am Freitagnachmittag. Eigentlich hatte sie nur mäßig Lust auf die Feier verspürt. Sie verstand nicht, weshalb ein Geburtstag schon um drei Uhr am Nachmittag beginnen musste, und sie konnte Fabians Begründung, je älter man werde, desto kostbarer sei die Zeit und desto eher müsse man eben anfangen, nur wenig abgewinnen. Trotzdem erschien sie pünktlich.
Im Wohnzimmer fand sie ein verhaltenes Häufchen von Leuten vor, die Kaffee und Wasser tranken. Nur Oliver, den Fabian ihr als Crossminton-Bekanntschaft vorstellte, und seine Freundin Larissa hielten Gläser mit Lillet Wild Berry und Moscow Mule in der Hand. Schon gegen fünf begannen die Ersten wieder zu gehen. Fabian drehte die Musik lauter, forderte zum Tanzen auf; es gelang ihm maximal für je einen Song. Und als Tess um kurz nach sieben mit drei Lillet im Magen zum wiederholten Mal auf die Uhr schaute, gehörte sie bereits zum harten Kern.
»Wer kommt noch mit ins Matador?«, fragte Fabian.
»Wir«, riefen Oliver und Larissa.
Tess verspürte keinen sonderlich ausgeprägten Appetit auf Tapas. Aber sie hatte Hunger, und zu Hause wartete nur ein ungefüllter Kühlschrank. Am Freitagabend ging sie normalerweise mit Moyra zum Aperitivo in ihre italienische Lieblingsbar. Sie aßen sich für wenige Euro am Buffet satt, bestellten über das im Preis inbegriffene Glas Hauswein hinaus immer noch mindestens zwei weitere Gläser, bevor sie zu ihr nach Hause schlenderten und den Rest des Abends im Bett verbrachten. Doch jetzt saß Moyra bei einem Konferenzabendessen, wie sie schrieb, und Tess mochte nicht allein zum Aperitivo gehen.
Im Matador war es voll. Sie schlängelten sich zwischen den Tischen bis zum Tresen vor. Tess landete auf einem Hocker ganz außen neben Larissa.
Larissa strich sich die blonden Haare aus dem Gesicht. Sie war äußerlich das komplette Gegenteil von Moyra, aber genau das, was Moyra gerne als »voll dein Typ« bezeichnete, auch wenn Tess stets in Abrede stellte, überhaupt einen Typ zu haben.
»Du arbeitest immer mal beim Film, meinte Fabi?«
Tess nickte, während sie versuchte, herauszufinden, was Papas arrugadas waren.
»Kartoffeln mit Salzkruste«, sagte Larissa. »Weiß ich aber auch nur, weil ich mal für einen Dreh auf La Palma war.«
Sie zählten sich die Produktionen auf, bei denen sie mitgewirkt hatten, Tess im Kostüm-, Larissa im Szenenbild, lamentierten über die niedrigen Löhne und die kurzen Verträge und erstellten eine Liste mit den schmierigsten Schauspielern und den unangenehmsten Regisseuren, die sie bereits kennengelernt hatten, sodass Tess völlig vergaß, nur aus Mangel an Alternativen mitgekommen zu sein. Sie war geradezu enttäuscht, als Fabian und Oliver nach dem Essen erklärten, sie seien alt und müssten ins Bett.
»Ernsthaft, Jungs? Also Tess und ich würden noch was trinken gehen, oder Tess?«
Es gab nichts, was dagegen sprach. Es war Freitagabend. Sie würde morgen und übermorgen noch genug Zeit alleine haben, und Moyra hatte bereits vorab erklärt, wegen des Konferenzessens heute ziemlich sicher nicht zum Telefonieren zu kommen.
»Kommst du dann zu mir?« Oliver schaute Larissa an.
»Mal sehen. Vielleicht brauche ich ein bisschen Me Time dieses Wochenende. Ich schreibe dir.« Sie gab ihm einen Kuss zum Abschied.
»Ihr wohnt nicht zusammen?«, fragte Tess, kaum dass die beiden Männer sich entfernt und sie sich für eine Bar zwei Straßen weiter entschieden hatten.
»Nee. Ich hätte nichts dagegen, aber Oli …«
»Kenne ich.«
»Dein Freund zögert auch?«
»Meine Freundin, ja.«
»Ah. Und warum?«
Während sie auf die bunt erleuchtete Bar zugingen, zählte sie all die Gründe auf, die sie schon unzählige Male aus Moyras Mund gehört hatte: Sie müsse ihre Wohnung in Berlin mindestens noch so lange behalten, wie ihr Vertrag als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU laufe, eine zweite, wenngleich halbe Miete in Leipzig sei nicht drin, und ohnehin bleibe abzuwarten, wohin es sie im Anschluss an ihre jetzige Stelle verschlage.
Der letzte Grund war für Tess der schmerzhafteste. Sie wusste inzwischen ziemlich gut, dass der akademische Betrieb kein Wunschkonzert darstellte. Dass fachliche Exzellenz – und die besaß Moyra, soweit sie es beurteilen konnte, ohne Frage – allein nicht ausreichte, um es zu etwas zu bringen. Es galt, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und die richtigen Hände zu schütteln. Nur änderte das alles nichts daran, dass sie in Moyras Absage ans Zusammenziehen einen Mangel an Vertrauen in die Haltbarkeit ihrer Beziehung sah. Und das tat weh. Denn dann lag es womöglich gar nicht an anderen Menschen und äußeren Umständen, sondern es lag an ihr!
»Das denke ich auch immer«, sagte Larissa, als sie die Bar betraten. Draußen war es inzwischen fast winterlich kalt. Drinnen stand die Luft so dick und warm, dass Tess’ Brille sofort beschlug. »Aber weißt du«, redete Larissa weiter und nahm sie bei der Hand, um sie zu einem Sofa in der Ecke zu führen, »bei euch beiden glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es an dir liegt.«
Tess nahm ihre Brille ab und wischte sie am Ärmel trocken. »Soll ich uns was zu trinken holen?«
»Ich mach schon.«
Sie schaute Larissa hinterher, sah ihr dabei zu, wie sie beim Barkeeper zwei Negroni Sbagliato bestellte, was sie im Lauf der nächsten Stunden noch dreimal tat, beim dritten Mal aber die Gläser auf dem Tisch abstellte und sich sehr dicht neben Tess aufs Sofa sinken ließ.
»Ich hätte irgendwie Lust zu knutschen.«
Tess zeigte zum Barkeeper. »Er hat leider gerade zu viel zu tun.«
»Nicht mit ihm. Mit dir! Darf ich?«
Tess musste kichern, als wäre sie wieder fünfzehn, nicht einunddreißig. Sie war trotz Brille zu kurzsichtig, um erkennen zu können, ob sich jemand im Raum befand, der sie und Moyra kannte. Sie hatten schon zigmal über das Eintreten einer solchen Situation gesprochen. Und am Ende waren sie sich immer einig gewesen, dass so etwas passieren konnte und auch passieren durfte, solange sie sich ehrlich darüber ins Bild setzten.
Allerdings spürte Tess schon am Sonntag, als sie den zweiten Morgen in Folge neben Larissa aufwachte, dass es mit der Ehrlichkeit in der Praxis deutlich komplizierter werden würde als in der Theorie. Denn wenn sie Moyra erzählte, was Larissa und sie gemacht hatten, würde sie der Vollständigkeit wegen auch berichten müssen, wie es dazu gekommen war, und das drohte ein riesiges Fass aufzumachen. Es half nichts, dass sie und Larissa sich einvernehmlich darauf verständigt hatten, einfach nur ein schönes Wochenende miteinander zu verbringen und nicht am Beginn einer komplizierten Affäre zu stehen. Und es half auch nichts, dass Larissa ihr vorschlug, sie könne es doch so handhaben, wie sie es mit Oli tat (nämlich einfach nichts erzählen). Vor dem gewaltigen Druck des Gewichts, den ein solches Geheimnis auf ihr Gewissen ausüben würde, fürchtete sie sich mehr als vor Moyras Reaktion. Und dennoch brachte sie, als Moyra nach ihrer Rückkehr am Telefon in Sachen Wochenende noch einmal nachhakte, nur noch ein paar Gemeinplätze hervor und sie war ungewohnt zufrieden damit, sie nicht vor Freitagabend zu sehen. Jeder Tag, der verging, würde den Abstand zum Geschehenen vergrößern. Die Berührungen, die sie im Laufe von sechsunddreißig Stunden mit Larissa ausgetauscht hatte, würden in der Erinnerung verblassen und eine knappe Woche später so harmlos wie jedes andere Wochenenderlebnis wirken, sodass das Erzählen davon ganz leicht und selbstverständlich sein würde.
Der verkorkste Start in Nicks Wohnung trug jedoch nicht dazu bei, dass sie die nötige Lockerheit aufbrachte. Moyra rückte sich ein paar Kissen zurecht, legte ihre Füße auf Tess’ Oberschenkeln ab und begann, eine Serie auf dem Handy zu schauen. Hin und wieder nahm sie einen Schluck Wein.
Tess massierte ihr die Ballen, schnappte englische Wortfetzen auf. Sie überlegte, ob sie darum bitten sollte, mitschauen zu dürfen. Aber die Familiendynastie, die für die Opioid-Krise in den USA verantwortlich war, interessierte sie nur wenig. Außerdem hatte sie keine Lust, darum betteln zu müssen, dass Moyra die Untertitel anschaltete, damit sie alles verstand. Und sowieso: Sie hatte eine Aufgabe! Nachher, in der Ramen-Bar, würde sie nicht mehr damit kommen können, die bot zu wenig Privatsphäre. Noch dazu wollte sie kein Drama im öffentlichen Raum riskieren für den Fall, dass Moyra die ganze Sache doch nicht so locker nahm wie erhofft. Doch sie konnte sich nicht überwinden.
Am nächsten Morgen wurde sie durch das Brummen der Kaffeemaschine geweckt. Moyra kam mit einer Tasse Cappuccino ins Schlafzimmer. Sie trug nur ihre Hotpants, in denen sie immer unglaublich gut aussah. Tess war kurz davor, den Vorsatz, den sie am Vorabend nur aus Mitleid beinahe aufgegeben hatte, nämlich nicht mit Moyra zu schlafen, bevor sie ihr von Larissa erzählt hatte, über Bord zu werfen. Das Einzige, was sie davon abhielt, war die Schnelligkeit, mit der Moyra nach einem Guten-Morgen-Kuss erst unter die Dusche und anschließend in die Bäckerei verschwand.
Sie kam mit ofenwarmem Pain au chocolat wieder, bereitete Rührei mit Tomaten und frischem Basilikum zu – Dinge, von denen Tess schon tausendmal gesagt hatte, dass sie sie liebte. Und als Moyra mit einem Bart aus Milchschaum an der Oberlippe erklärte, sie habe Lust, sich die Zanele-Muholi-Ausstellung anzusehen, traute sie sich weder zu fragen, wer oder was Zanele Muholi sei, noch mochte sie zugeben, sich eigentlich schon auf die Helmut-Newton-Retrospektive gefreut zu haben.
Es fiel ihr schwer, sich auf die Bilder zu konzentrieren. Vor ihr hingen Schwarz-Weiß-Fotos von Angehörigen der Schwarzen südafrikanischen LGBTQIA+-Community. Sie betrachtete die Narben auf dem Rücken einer jungen Frau. Sie zogen sich bis zu den Brüsten, den Armen und Beinen, und es bestürzte sie, dass diese Frau gezwungen war, den Hass, der sich gegen sie gerichtet hatte, bis ans Lebensende mit sich herumzutragen. Gleichzeitig bedauerte sie, nicht doch beim Frühstück für Helmut Newton plädiert zu haben. Dann hätte sie jetzt unversehrte, nackte Modellkörper anschauen können, auf deren Haut allenfalls Wasserperlen funkelten und die nichts von der Schlechtigkeit des Menschen erzählten. Der Gedanke fühlte sich schäbig an. Es war falsch, überhaupt so etwas in Erwägung zu ziehen, erst recht im Beisein von Moyra, die versunken eine Vitrine mit den Gerichtsakten zu den Gewalttaten studierte. Es war beneidenswert, wie konzentriert sie sich diesem Thema stellen konnte. Dass sie die Kraft und das Interesse aufbrachte, jedes Detail erfahren zu wollen und wenn es noch so grausam war, wohingegen sie selbst sich beim Blick auf die Uhr und beim Gedanken daran ertappte, was sie vor einer Woche um diese Zeit mit Larissa getan hatte.
Sie wechselte den Raum, betrachtete eine Großformataufnahme queerer Menschen in bunten Kleidern am Durban Beach und erschrak, als sich von hinten eine Hand auf ihre Schulter legte.
»Auch ein tolles Bild!«, sagte Moyra. Sie zeigte auf das Strandporträt. Eine der Personen trug ein knallrotes Kleid. »Überhaupt – die ganze Ausstellung ist wahnsinnig gut, oder?«
»Ja.« Tess war heilfroh, dass Moyra nicht in der Lage war, in ihren Kopf zu sehen. Sonst wäre sie über Erinnerungsbruchteile von Larissas rotem Slip gestolpert, die gerade an die Oberfläche ihres Bewusstseins gespült worden waren. Sie entfernte sich vorsichtig, nicht zu schnell (es durfte nicht nach Flucht aussehen), versuchte zu ergründen, ob diese Erinnerung mit einem tieferen Verlangen einherging. Es tat gut zu merken, dass das nicht der Fall war. Aber das mochte auch damit zusammenhängen, dass das moralische Gefälle zwischen ihr und Moyra mit jedem weiteren Bild, das Moyra hingebungsvoller betrachtete als sie selbst, immer größer wurde, und wenn sie nicht aufpasste, würde es schon bald so groß sein, dass sie es nicht mehr überwinden und nicht mehr auf jenes Niveau gelangen konnte, auf dem Moyra sich befand. Sie musste ihr vom letzten Wochenende erzählen! So schnell wie möglich, sobald sie zurück in Nicks Wohnung waren, und dann mit ihr schlafen, wobei es taktisch klüger sein mochte, die Reihenfolge umzudrehen, aber egal. Als sie die Treppen des Gropius-Baus hinunterstiegen und zum Anhalter Bahnhof gingen, verspürte sie eine Mischung aus kindlicher Aufregung und absoluter Entschlossenheit.
»Wollen wir das letzte Stück laufen?«
Tess widersprach nicht. Es war eine gute Voraussetzung für das anstehende Gespräch, dass Moyra sie jetzt bei der Hand nahm. Ihre Finger waren angenehm trocken und warm in dieser feuchten Kälte.
Moyra blieb vor einem Laden stehen. »Wie geil ist der denn?«
»Wer?«
»Der Stuhl!«
Tess musste zweimal hinschauen, um sicherzustellen, dass kein Missverständnis vorlag, sondern Moyra tatsächlich von dem Stuhl sprach, der dort hinter der Scheibe stand. Er besaß nur ein Bein und sah mit seiner weißen Plastikverschalung wie ein übergroßer Eierbecher aus, dem Dreiviertel des oberen Teils abhandengekommen waren.
»Kommst du mit rein?«
»Wieso?«
»Weil ich den mal Probe sitzen will.«
»Wozu?«
»Um ihn … zu klauen, wenn er bequem ist?!« Moyra lachte, wie sie immer lachte, wenn sie fand, dass Tess sich schwer von Begriff gab. Es hatte bei ihr über die Jahre zu dem Eindruck geführt, ihre Leitung sei vielleicht wirklich etwas länger, aber sicher war sie sich nicht.
Sie ging mit hinein, um nicht draußen in der Kälte stehen zu müssen. Während Moyra Probe saß und sich von der Verkäuferin etwas über den finnischen Designer erzählen ließ, der den Stuhl in den 50er Jahren entwickelt hatte – den ersten Stuhl mit nur einem Bein! –, drehte sie eine Runde durch den Raum und betrachtete eine Reihe bunter Gegenstände, bei denen erst auf den zweiten Blick klar wurde, dass es sich um eine Pfeffermühle oder einen Garderobenhaken handelte. Zudem trug keiner davon ein Preisschild, und das war meistens verdächtig.
»Was kostet der denn?«, fragte sie die Verkäuferin und näherte sich dem Stuhl. Moyra saß noch immer darauf und drehte sich.
»Das hängt ganz davon ab, ob ihr ihn mit gepolsterter Innenschale nehmen wollt oder ohne, drehbar oder nicht …«
»Wir?«, sagte Tess. »Also ich sowieso schon mal nicht.«
Moyras Blicke trafen sie heftig. Es war offensichtlich, wie sehr sie sich dafür schämte, dass ihre Freundin so etwas sagte. »Willst du auch mal sitzen?« Sie machte Anstalten aufzustehen.
Tess musste beinahe lachen darüber, dass dies offenbar das Einzige war, was Moyra einfiel, um die Fassungslosigkeit aus dem Gesicht ihrer Partnerin zu vertreiben, so wie man an einer Unfallstelle eine akut blutende Wunde notdürftig mit einem Pullover abband.
»Nein, danke«, sagte sie, nachdem die Verkäuferin den Preis genannt hatte (Eintausendsiebenhundert Euro in der drehbaren, gepolsterten Variante). »Ich würde schon mal in die Wohnung gehen. Gibst du mir den Schlüssel?«
Moyra zog den Schlüsselbund aus der Jackentasche. Als sie eine halbe Stunde später eintraf, saß Tess auf dem Fensterbrett im Wohnzimmer. Ihre Unterlippe war zerkaut. Es schmerzte, wenn Speichel an die offene Haut gelangte.
»Keine Sorge«, sagte Moyra. Sie legte einen Zettel auf dem Tisch ab. »Ich habe ihn noch nicht gekauft. Nur reserviert.«
Tess wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte die letzten dreißig Minuten damit zugebracht zu überlegen, ob es so schlimm war, dass Moyra offensichtlich ernsthaftes Interesse für ein Möbelstück hegte, das sie selbst nicht nur unter ästhetischen Gesichtspunkten nicht besonders schön fand, sondern das auch preislich jenseits dessen lag, was ihrer Meinung nach für einen Stuhl ausgegeben werden sollte, jedenfalls dann, wenn er sich nur zum Sitzen eignete und nicht nebenbei auch noch selbstständig kochte, staubsaugte oder andere Hausarbeiten erledigte.
»Findest du ihn wirklich so schrecklich?«
»Nein. Aber ich würde ihn trotzdem nicht kaufen.«
»Sollst du ja auch nicht. Wenn, dann würde ich das tun.«
»Eben.«
»Du stößt dich daran, dass ich einen Stuhl kaufen möchte?«
Einen Augenblick lang beobachtete sie die Menschen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Café saßen. Sie waren eingehüllt in dicke Decken, hielten Kaffeegläser in den Händen. Sie überlegte, ob sie den Stuhl gegen das Geständnis eintauschen sollte. Ob das der Preis war, den sie bezahlen musste, um Moyra so sehr zu besänftigen wie nur möglich.
»Ich glaube, ich verstehe einfach nicht, wofür du einen so teuren neuen Stuhl brauchst.«
»Hm. Und was, wenn ich ihn nicht nur für mich, sondern für uns kaufen würde?«
»Für uns? Wo soll er denn stehen? Zwischen Leipzig und Berlin? Am Bahnhof von Lutherstadt Wittenberg?«
Moyra trat näher. »In unserer gemeinsamen Wohnung?!«
»Die haben wir nicht, soweit ich weiß.«
»Das stimmt. Aber wir könnten uns nächste Woche in Leipzig eine ansehen.«
Tess hielt ihren Blick starr auf die andere Straßenseite gerichtet. Unter anderen Umständen wäre sie Moyra jetzt sofort um den Hals gefallen. Allein die Tatsache, den Ausdruck ›gemeinsame Wohnung‹ aus Moyras Mund zu hören, hätte dafür sorgen müssen, dass sie aufsprang und vor Freude kreischte. Aber sie fühlte sich überrumpelt, hintergangen.
»Warum hast du mir das noch nicht erzählt?«
»Weil ich erst vorgestern davon erfahren habe, Tess. Ich habe mit Jana telefoniert und die hat die Wohnung erwähnt und …«
»Aber wir sind schon seit gestern hier zusammen!«
»Ich weiß. Aber du schienst mir gestern Abend nicht in der richtigen Stimmung zu sein.«
Tess wusste, dass sie JETZT etwas sagen musste. Aber sie konnte nicht mehr, weil Moyra nun davon zu reden begann, wie toll die Wohnung sei und dass sie nicht länger warten wolle, bis ihr endlich mal jemand eine feste Stelle anbiete. Sie wolle nicht noch mehr wertvolle Lebenszeit – Zeit mit ihr! – verschwenden.
Tess fühlte sich wie bei einer ihrer ersten Begegnungen, als Moyra ihr gestanden hatte, wie wunderbar sie sei, wie gutaussehend und witzig. Bei jedem Wort war ein weiterer Quadratzentimeter ihrer Haut von einem Schauder erfasst worden, und auch jetzt richteten sich überall auf ihren Armen die Härchen auf.
Sie löste sich aus ihrer Verschanzung, schwang die Beine vom Fensterbrett, zog Moyra zu sich heran und küsste sie. Und als sie zwei Stunden später, es war bereits dunkel draußen, nackt in der Küche standen, um sich ein Käsebrot gegen den Heißhunger zu schmieren, bemerkten sie, wie das Pärchen aus der gegenüberliegenden Wohnung sie dabei beobachtete, und sie schworen sich lachend, die Küchenfenster ihrer eigenen Wohnung mit einem Rollo zu versehen.
*
Am Tag der Besichtigung nieselte es. Sie nahmen trotzdem die Räder und stellten sie vor dem Haus ab.
»Sogar mit Späti unten drin«, stellte Tess fest. »Hatte Jana das auch schon erzählt?«
Moyra schüttelte den Kopf und schob den Fahrradschlüssel in die Jackentasche.
»Sie sind Frau Dr. Ludwig?«
Ein grauhaariger Mann stand im Hauseingang. Sein langer Mantel war halb aufgeknöpft. Er ging auf Tess zu.
Sie musste sich ein Grinsen verkneifen, wies auf Moyra. Sie selbst benutzte den Doktortitel, wenn überhaupt, nur aus Spaß, wenn sie Moyra für eine besserwisserische Bemerkung ärgern wollte. Dem Vermieter schien es jedoch ernst zu sein, und Tess fand, dass Moyra, während sie durch die Wohnung gingen und alles ansahen, genau jene Art von charmant-professionellem Auftritt hinlegte, den Herr Langner vermutlich von einer Frau mit Titel erwartete. Sie überließ ihr das Reden, sagte kaum ein Wort, obwohl sie, nachdem sie alles angesehen hatten und auf dem Weg nach draußen waren, Moyra gerne gefragt hätte, wie sie so unumwunden die Frage, ob ein Mietbeginn im Januar – nach Durchführung einiger Schönheitsreparaturen – möglich sei, bejahen konnte. Selbst wenn sie ihre beiden Wohnungen sofort aufgaben, mussten sie wegen der Kündigungsfrist noch bis mindestens Ende Februar Miete zahlen, und ihr war schleierhaft, wie sie zwei Monate lang das Geld für drei Mieten aufbringen sollten.
»Der Saftladen da ist dann auch zum ersten Januar verschwunden«, sagte Herr Langner. Die Haustür fiel hinter ihm ins Schloss.
Tess wollte ihr Bedauern ausdrücken, doch Moyra war schneller. »Gibt’s schon Nachmieter?«
»Bisher noch nicht. Und da muss auch erstmal ordentlich was gemacht werden. Ist völlig runter. Sie hätten wohl Interesse?«
Tess merkte, wie Moyra sich zu ihr wandte, sie ansah und offenbar irgendeine Reaktion erwartete, aber sie konnte nicht so schnell etwas sagen, wie Moyra es nun tat.
»Ich nicht. Aber meine Partnerin sucht Räume für eine Maßschneiderei.«
Sie wollte kurz protestieren, mindestens korrigieren, dass sie nicht nach Räumen suchte, sondern allenfalls davon träumte. Aber Moyra schien sich nicht daran zu stören. Sie erkundigte sich nach der Höhe der Ladenmiete.
»Woher soll ich das Geld nehmen?«, fragte sie Moyra, nachdem sie sich verabschiedet hatten und Herr Langner außer Hörweite schien. Es fiel ihr schwer, nicht wütend zu klingen.
»Ganz ruhig, Tessi. Ich habe mich ja nur mal erkundigt. Unverbindlich.«
»Ich fand nicht, dass das so unverbindlich klang. Und einen Mietvertrag zum ersten Januar zu unterschreiben, finde ich auch – naja …«
Moyra zog die Augenbrauen hoch. »Willst du die Wohnung etwa nicht?«
»Doch!«
»Na also!«
Tess schaute zu Boden. Moyra war fraglos die bessere Verhandlerin. Das hatte sie schon öfters gemerkt. Ihr fehlte da das Talent, und genau das bot jetzt Anlass zur Frustration.
»Ich kam mir einfach übergangen und minderbemittelt vor.«
»Minderbemittelt?«
»Ja. Du bist eben Frau Doktor Ludwig, kannst von deiner Uni erzählen und …«
»Hey. Er hat zuerst dich für die Doktorin gehalten, richtig?«
»Mhm.«
»Und abgesehen davon: Du bist eine wunderbare Schneiderin, Tess! Überleg mal, wie es wäre, wenn du direkt unter unserer Wohnung deinen Laden hättest!«
Sie musste nicht überlegen. Es klang zu gut, um wahr zu sein, obwohl Moyra auf die Schnelle auch keine Antwort auf die Frage wusste, wie sie die Miete finanzieren sollte, wenn sie noch nicht mal eine eigene Kollektion zum Verkauf anbieten konnte. Deshalb sprachen sie nicht mehr darüber, bis sie am ersten Adventswochenende zu Moyras Eltern nach Bielefeld fuhren.
Tess stand mit teigverschmierten Händen in der Küche. Sie hatte sich bereit erklärt, beim alljährlichen Plätzchenbacken mitzuhelfen, während Moyra bei der ersten Andeutung fluchtartig den Raum verlassen hatte.
»Mo hat erzählt, dass du überlegst, einen Laden anzumieten?«, sagte Inga, Moyras Mutter. Sie nahm Tess die Teigschüssel ab, bemehlte ein Nudelholz und fing an, die Masse auf dem großen Tisch auszurollen.
»Naja«, sagte sie. Sie öffnete den Wasserhahn, schaltete die Brause ein, um sich die Hände abzuspülen. Das Rauschen gab ihr Zeit, sich kurz zu sammeln. »Ich überlege nicht wirklich.«
»›Nicht wirklich‹ heißt?«
Sie ärgerte sich über ihre schludrige Wortwahl, setzte sich auf einen der Barhocker, die an der Kochinsel standen und nahm einen Schluck Glühwein. »›Nicht wirklich‹ heißt: Ich überlege nicht.«
Inga legte das Nudelholz beiseite. »Ich hatte damals auch wahnsinnigen Respekt vor der Selbstständigkeit.« Sie wischte ihre mehlbestaubten Hände an der Schürze ab. »Wenn Jens nicht gewesen wäre, mit seiner Professur, hätte ich mich nicht getraut. Dann würde ich vermutlich noch immer in der Klinik arbeiten.«
Tess nickte nur stumm. Sie konnte jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass Moyra nicht Jens war und eben keine Professur innehatte. Sowieso fand sie den Vergleich von Ingas und ihrer Angst auch unabhängig davon etwas schwierig. Die Gesellschaft war kaputt genug, um einen ständigen Bedarf an Psychiatrischen Praxen zu haben. Aber an Maßschneidereien?
»Jens und ich würden dir gern helfen.« Inga reichte ihr eine Herzform zum Ausstechen. Tess wagte nicht, ihr in die Augen zu schauen. »Wir würden dir ein Startkapital für die Ausstattung des Ladens geben und die Miete für das erste Jahr zahlen.«
»Das kann ich nicht annehmen!«
»Überleg es dir ganz in Ruhe.«
Sie drückte das Herz in den Teig.
Moyra lugte zur Tür herein. Tess wechselte sofort das Thema. Erst am Abend in der Sauna sprach sie Moyra darauf an.
»Du hast deinen Eltern vom Laden erzählt?«
Moyra goss eine Kelle auf. Das Wasser zischte auf den heißen Steinen. »Ja!?«
»Und hast du sie darum gebeten?«
»Worum?«
Das Zedern-Nelken-Orangen-Aroma stieg beißend in die Nase. Sie war sich nicht sicher, ob Moyra bluffte. Sie erzählte, was Inga zu ihr gesagt hatte.
»Nimmst du’s an?«
Dicke Tropfen rannen über ihre Stirn. »Weiß ich nicht.«
»Was spricht dagegen?«
Sie wischte sich die Feuchtigkeit von den Armen. »Keine Ahnung. Es sind deine Eltern.«
»Na und? Sie hätten dir das Angebot nicht gemacht, wenn sie dich nicht mögen würden und das Geld nicht hätten.«
»Ja, aber – was, wenn irgendwas ist und wir …«
»Was soll sein?«
Sie traute sich kaum, es auszusprechen. »Na, zum Beispiel: Wir streiten uns und stellen schon nach zwei Wochen fest, dass wir doch nicht zusammen wohnen können. Oder du kriegst einen tollen Job im Ausland angeboten, verlässt mich für eine andere – solche Dinge eben.«
Moyra lachte. »Ich liebe dich, Tess. Ich habe nicht vor, mich mit dir zu streiten, einen Job im Ausland anzunehmen oder dich für eine andere zu verlassen.«
»Weißt du’s?«
»Nein. Natürlich nicht. Aber wenn ich du wäre, dann – also ich würd’s machen. Dein eigener Laden, Tessi! Direkt bei uns im Haus!«
Sie nickte. Die Wärme, der Duft und Moyras Zuspruch hüllten sie ein. Sie stellte sich vor, wie sie sich die Schneiderei einrichten würde. Dabei wurde ihr bewusst, dass sie Moyra noch immer nichts vom Wochenende mit Larissa erzählt hatte.
»Ist der Stuhl eigentlich noch für dich reserviert?«
»Denk schon. Wieso?«
»Dann lass ihn uns kaufen.«
»Jetzt gefällt er dir plötzlich?«
»Das nicht unbedingt. Aber du willst ihn gerne haben. Und er ist eine Erinnerung an das Wochenende, an dem du mir zum ersten Mal von der Wohnung erzählt hast.«
Moyra lächelte, goss eine weitere Kelle auf, und es war, als ob alle Vorbehalte mit dem Dampf zerstoben und es nur noch Wärme, Licht und Zuversicht gab.
*
»Hey, lass uns erstmal weitermachen, und dann schauen wir, ob wir ihn nicht doch irgendwie reparieren können«, sagte sie zu Moyra, die noch immer die kippelnde Sitzschale auf dem Standbein betrachtete.
»Der ist hinüber«, murrte Moyra nur.
Aber schon zwei Stunden später, als sie zusammen mit den anderen zwischen Kistentürmen im Wohnzimmer saßen und Pizza aus Pappkartons aßen, war der gröbste Unmut verflogen und die Vorfreude auf die neue Wohnung größer als der Ärger über den Stuhl. Alles war nach oben gebracht; sie musste jetzt nur noch den Transporter zurück zur Vermietung fahren und ihre alte Wohnung durchfegen.
Nachdem die anderen sich verabschiedet hatten, zog Tess den Autoschlüssel aus der Jackentasche. »Ich bringe mal schnell den Transporter weg, ja?«
Moyra holte in der Küche bereits die ersten Töpfe aus den Kisten. »Alles klar. Soll ich mitkommen?«
»Musst du nicht.«
»Wenigstens fürs Ausparken?«
»Das Einparken ging alleine, also schaffe ich auch das Ausparken.«
Sie lief nach unten, öffnete den Wagen, schwang sich auf den Sitz, zog die Tür zu, steckte den Schlüssel ins Schloss und sah zur großen Scheibe des Ladens. In der kommenden Woche würde sie mit eigens für sie gestalteten Klebebuchstaben ihren Namen und den schlichten Zusatz Mode. Handgemacht. anbringen. Es fühlte sich großartig an.
Sie ließ das Fenster herunter. Warme Frühlingsluft strömte herein.
Der Motor sprang an, als sie den Schlüssel drehte und die Kupplung durchdrückte. Im Seitenspiegel sah sie die Motorhaube des Twingo. Sie schaltete in den Rückwärtsgang, schlug das Lenkrad ein, trat aufs Gaspedal und setzte zurück.
2
Heike hatte sich ehrlich gefreut auf die grünen Harzwipfel, die auf der Klappkarte zu sehen waren. Und die Aussicht auf ein verlängertes Wochenende mit ihrer Tochter war sowieso das beste Geburtstagsgeschenk, das sie sich vorstellen konnte.
»Das Hotel soll ganz schnuckelig sein«, hatte Susanne am Telefon erklärt. »Mit Spa im Keller. Und du kannst sogar mit dem Zug hinfahren.«
»Ach, ja?« Sie versuchte, so zu klingen, als würde sie ernsthaft eine Zugfahrt in Betracht ziehen.
»Ja. Du fährst – warte, genau – bis Halle, von dort nach Wernigerode, und da steigst du dann in die Harzer Schmalspurbahn. Das ist die, die auch auf den Brocken fährt.«
»Also wie oft umsteigen?«