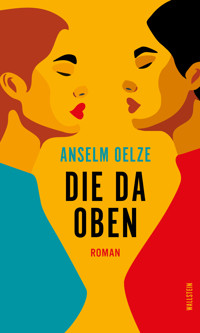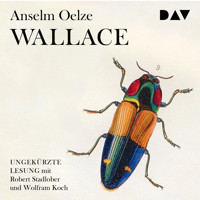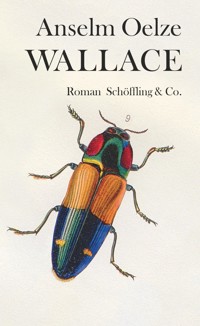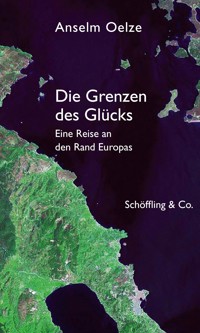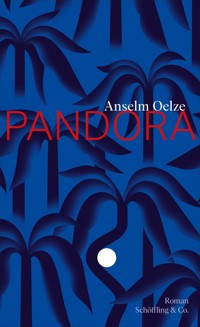
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Menschen stecken in der Krise: Der Schriftsteller David Rubens, weil er von Frau und Kind verlassen wurde. Der Lehrer Telmo Schmidt, weil er von seinen Schülern erpresst wird. Der Astronom Jurij Bogic, weil er mit der Vergangenheit seines Vaters kämpft. Und die Ethnologin Carline Macpherson, weil sie mit der Zukunft der Menschheit hadert. Sie alle sehen sich vor die Frage gestellt, wie es sein kann, dass man das Richtige weiß und trotzdem das Falsche tut. Bis sich abzeichnet, wie das übel der Pandora in etwas Heilbringendes verwandelt werden kann - und es im südamerikanischen Regenwald zu einem unerwarteten Zusammentreffen kommt.Nach seinem erfolgreichen Debüt Wallace ist Anselm Oelze mit Pandora ein fulminanter Roman über die gesellschaftlichen Krisen der Gegenwart und die großen Fragen der Menschheit gelungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
ERSTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
ZWEITER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
DRITTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
VIERTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
FÜNFTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Zitatnachweis
Autor:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
»Ich sann schon oft,aus andrem Grund, in langen Nächten, nach, wodurch der Menschen Leben eigentlich verdorben wird.«
Euripides, Hippolytus
ERSTER TEIL
1
Der Anruf kam zur Unzeit.
Carline stand, die frisch gewaschenen, nassen Haare in ein Handtuch gewickelt, in ihrem Schlafzimmer und musterte die Gegenstände auf ihrem Bett: eine moskitostichsichere Trekkinghose, eine unverwüstliche Bluejeans, eine Leinenhose und eine Bio-Baumwollshorts, zwei T-Shirts, ein Grandad-Hemd und eine Funktionsbluse; eine Regenjacke, Wanderschuhe und Flipflops, vier Paar Socken, drei Sport-BHs und fünf Slips (denn sie fand die Vorstellung, in der tropischen Hitze nicht regelmäßig die Unterhose wechseln zu können, unerträglicher als den Gedanken, mehrere Tage ein und denselben BH tragen zu müssen, und jedes Gramm zählte). Dazu kamen ein ultraleichtes Handtuch, ein faltbarer Sonnenhut und zwei Sonnenbrillen, wobei hier die schwierige Entscheidung noch ausstand, ob es die schicke, braun-melierte Variante sein sollte, die sie sommers auch zu Hause trug, die bei hoher Luftfeuchtigkeit jedoch leichter von der Nase rutschte, oder aber die verspiegelte Sportversion mit rutschfestem Gummi am Nasensteg sowie waschbarem Halteband; in diesem Fall waren allerdings in puncto legeres Aussehen deutliche Abstriche zu machen und dieses Argument hatte durchaus Gewicht, denn darin lag ja gerade der Sinn der Übung, die Carline in diesem Moment durchführte: eine Ausrüstung zusammenzustellen, in der sie weder wie die prototypische Urwald-Ethnologin noch wie das Klischee einer Brasilientouristin aussah, die aber trotzdem den Anforderungen genügte und ihren Zweck erfüllte.
»Ich hab es ihm vorhin gesagt«, erklärte Martje.
Carline atmete einmal deutlich hörbar aus; ihr Blick war noch immer auf das Bett gerichtet. Den Aktivkohle-Wasserfilter, der dort ebenfalls lag, hatte sie schon die letzten Male nicht benötigt. Doch irgendwie entzog er sich geschickt dem Gesetz der Sparsamkeit, das jede Forschungsreise dominierte, und schließlich, whatever, man konnte ja nie wissen.
Ihr Handy machte Bling. Sie wollte es sofort vom Ohr nehmen und die Nachricht lesen (überhaupt: wo waren eigentlich die AirPods?), besann sich aber, um Martje nicht warten zu lassen.
»Wow. Wie hat er reagiert?«
Die Antwort, die folgte, war zwar lang, aber nicht kompliziert, jedoch unsortiert und immer wieder von Schweigepausen und Schluchzern unterbrochen. Carline erlaubte sich während einer der Unterbrechungen einen Blick aufs Telefon.
J&P haben Abendessen gecancelt, dafür komm T, der Neue, mit Partner, schrieb Cédric, und, ja, er schrieb tatsächlich ›komm‹, statt ›kommt‹, und das ärgerte Carline, weil er sie, seit sie sich kannten, immer wieder gern in ihrem schnell und ehrgeizig erlernten Deutsch verbesserte, sich selbst aber, vor allem in Textnachrichten, diversen Schludrigkeiten hingab, und das hasste sie, Schludrigkeiten, selbst dann wenn, wie vielleicht in diesem Fall, die Autokorrektur schuld war, das unsmarteste Tool seit Erfindung des Smartphones.
OK, schrieb sie zurück, zwischen einem Schluchzer von Martje und einem Blick auf die Malaria-Tabletten, die noch von der letzten Reise stammten und die, wie sich bei genauerem Hinsehen auf die Lasche der Packung herausstellte, vor einem Monat abgelaufen waren. Angesichts der Nebenwirkungen war die Vorstellung, jeden Tag prophylaktisch Tabletten einzuschmeißen, ohnehin keine angenehme. Aber zumindest als Notfallmedikament sollten sie parat sein – das hatte auch die Ärztin in der Tropenmedizin beim letzten Impfcheck betont.
Eine plötzliche, starke Hitze staute sich unter dem Handtuch auf ihrem Kopf. Wie sollte das alles bis morgen früh zu schaffen sein? Neue Tabletten besorgen, Sachen packen, Martje zuhören, die sich allem Anschein nach, nein, sogar unglaublich tatsächlich gerade von David, Cédrics bestem Freund, getrennt hatte; und dazwischen nun auch noch Cédric selbst mit zweiminütlichen Updates in Sachen Gästeanzahl für das Abendessen mit Kolleginnen und Kollegen, das bereits vor Monaten in den gemeinsamen Online-Kalender eingetragen worden war und das nur deshalb ungünstigerweise auf den Abend vor ihrer Abreise fiel, weil sie vor der Buchung des Flugs nicht noch einmal in eben diesen Kalender geschaut hatte. Doch anstatt um eine Vorverlegung des Essens zu bitten oder den Flug zu verschieben (die Full-Flex-Option erlaubte es und am Institut verschoben ständig irgendwelche Leute irgendwelche Flüge), hatte sie, wie um sich selbst zu kasteien für diese verdammte Schludrigkeit, allen Ernstes vorgeschlagen, die Menüplanung und das Kochen zu übernehmen. Kurz, ganz kurz immerhin hatte sie Genugtuung dabei empfunden, sich tough und vollkommen gefühlt, weil Cédric in einer solchen Situation niemals so etwas vorgeschlagen hätte. Aber nun, in diesem Moment, mit dem ganzen Zeug auf dem Bett und Martje am Ohr, merkte sie, wie ihr die Sache über den Kopf wuchs.
Sie riss das Handtuch herunter und lief in die Küche.
»Hast du ihm gesagt, dass du weder aus der Wohnung ausziehen noch mit nach Montana kommen wirst?«, fragte sie, kurz bevor sie in der Küche ankam.
Auch diese Frage, obwohl nicht sonderlich komplex, zog eine längere Antwort nach sich und schenkte wertvolle Sekunden.
Auf der Anrichte neben dem Herd lagen drei Kochbücher. Carline blätterte durch das erste und betrachtete einige Gerichte (Gebackene Aubergine mit frittierten Zwiebeln und Zitrone; Salat von geröstetem Blumenkohl mit Haselnüssen; Safraneis mit Berberitzen, Pistazien und Kräutern). Obwohl die Fotos wirklich gut aussahen, legte sie es angewidert zur Seite. Seit längerer Zeit schon kochte gefühlt jede zweite Person in ihrer Umgebung dieses israelisch-mediterrane Essen und sie konnte es eigentlich nicht mehr sehen, geschweige denn riechen und schmecken. Aber selbst wenn sie unter dem Motto ›Mediterran trifft asiatisch‹ zu den Fusionvarianten desselben Kochs überging (Frühlingszwiebeldip mit Grünkohl; Brunnenkresse mit Roter Quinoa; Lammbries mit weißer Pfefferkruste, Erbsenpüree und Miso), war das Risiko zu hoch, dass wenigstens eine Person aus Cédrics Team bereits in dem Londoner Restaurant gegessen hatte, aus dem die Gerichte stammten, und den Vergleich mit dem Original, auf den konnte sie, vielen Dank auch, getrost verzichten.
Sie griff zum The Great Chef’s Guide to Nordic Cuisine, schlug ihn auf und gleich darauf wieder zu. Welcher normale Mensch, bitteschön, hatte Birkenwein, eine Auswahl roh verzehrbarer Wildpilze sowie Trüffel aus Gotland in seiner Küche? Nicht mal ein Delikatessenladen in New York führte all diese Dinge! Und wer auch immer die Idee gehabt hatte, derlei Essen hyperprofessionell fotografieren, auf Hochglanzpapier drucken und in Leinen binden zu lassen, hatte dabei jedenfalls nicht an sie, Carline Macpherson, gedacht, die jetzt in ihrer Küche stand und, verdammt noch mal, die Uhr lief, ein Menü für sechs Gäste zusammenzustellen hatte, die in, Schweiß lass nach, gut fünf Stunden im Wohnzimmer stehen und mit Cédric einen Aperitif zu sich nehmen würden (vermutlich Vermouth, darauf fuhr er seit einer Weile ab; zur Not tat es auch ein Prosecco, aber natürlich ausschließlich di Cartizze, wenn hoffentlich noch eine Flasche davon im Haus war, dann konnte er nämlich erzählen, wie er sie eigenhändig in Italien gekauft und nach Deutschland transportiert hatte).
Sie hieb auf die Arbeitsplatte.
»Ist alles in Ordnung?«
Carline bejahte schnell. Allerdings nur, damit Martje weiterredete und so ausführlich wie möglich die letzten Tage und Wochen vor der Trennung schilderte. Denn es war natürlich nichts in Ordnung. Nichts war in Ordnung! Und während sie zum nächsten Kochbuch überging (Vegetarische Rezepte aus einem zenbuddhistischen Kloster), ärgerte sie sich darüber, nicht selbst so emanzipiert zu sein wie ihre beste Freundin, die einen Cut gemacht hatte; die, wie sie es schilderte, einfach gesagt hatte ›Schluss, aus, vorbei‹. Nein, stattdessen stand sie hier und geriet langsam, aber sicher in Panik, und das nur, weil sie allen, die in einigen Stunden hier eintrudeln würden, insbesondere Cédric, unbedingt beweisen wollte, dass sie nicht das akademische One-Trick-Pony war, für das gefühlt die meisten sie hielten. Ja, okay, ihr Porträtfoto auf der Institutswebsite war, anders als das wirklich gut aussehende Bild von Cédric auf der Seite seiner Firma, mit dem Telefon selbstgemacht, in einer halbstündigen Prozedur zwischen einem Nachmittagskaffee und einer Aufsatzlektüre, wie die meisten Porträts aufstrebender Akademikerinnen. Aber das hieß ja noch lange nicht, dass ihre einzige Fähigkeit universale Unfähigkeit war!
Sie lief zurück ins Schlafzimmer, um den Gedanken abzuschütteln. Doch während ihr Knie nur knapp einem Zusammenstoß mit der Bettkante entging, musste sie feststellen, wie mindestens die Idee, alles hinzuschmeißen, klettenartig an ihr heftete. Aber war eine Trennung wirklich die Lösung? Das schien dann doch etwas zu kurz gegriffen; abgesehen davon, dass sie selbst in diesem Moment felsenfest behauptet hätte, Cédric zu lieben, und noch dazu insgeheim meinte, genau zu wissen, woran es in Martjes und Davids Ehe eigentlich haperte. Das Problem lag – leider – nicht einzig und allein bei David – eine Feststellung, die aus Carlines Sicht den Haken hatte, dass sie ihn etwas zu gut davonkommen ließ, denn er war nun mal ein Gockel, da führte kein Weg dran vorbei. Ein einigermaßen gut aussehender Gockel zwar, wobei, sein Aussehen war gar nicht außergewöhnlich gut; er besaß einfach nur zwei Dinge, die jeden Menschen gut aussehen ließen: Charisma und Charme. Aber die Sache mit Gockeln war ja auch nicht die, dass ihre Federn sie nicht schmückten. Im Gegenteil. Sie waren nicht trotz, sondern vor allem wegen ihrer Federn gockelig und dieses Gockeligsein hatte immer etwas Imponierendes und Lächerliches zugleich. Imponierend auf den ersten Blick in seinem biologischen Erfolg; lächerlich auf den zweiten Blick, etwa dann, wenn David einer Runde von Frauen erklärte, worum es sich beim Mansplaining handele.
Trotzdem, es blieb dabei, das eigentliche Problem, dasjenige also, das leibhaftig einen Keil zwischen Martje und David getrieben hatte, da war Carline sich sicher, war zwei Jahre alt, dunkel gelockt, und hieß Arik. Diese Erklärung gefiel ihr wesentlich besser, nicht nur, weil sie ihrer Meinung nach tatsächlich stimmte, sondern vor allem auch, weil sie einen Einzelfall in den Mittelpunkt rückte, der die Richtigkeit ihrer allgemeinen Einstellung gegenüber Kindern und dem Kinderkriegen bestätigte (was freilich das Induktionsproblem aufwarf, aber das musste an dieser Stelle vielleicht ausnahmsweise einmal nicht stören).
Der kleine Arik hatte, noch bevor er überhaupt gezeugt worden war, schon ganz gehörig das Leben anderer verändert, vornehmlich das von Martje und David. Dabei gehörte Martje eigentlich nicht zu denjenigen, deren Augen leuchteten, wenn sie über Schwangerschaft oder Familienplanung sprach. Diese unsentimentale Haltung bildete, wie Carline erst jetzt bemerkte, eine nicht unwesentliche Grundlage ihrer Freundschaft. Insofern war es nicht verwunderlich, dass ihre Freundschaft an dem Tag einen ersten Riss bekommen hatte, als Martje verkündete, sie fühle sich nun bereit, ihr Leben aufs nächste Level zu heben – ein Ausdruck, von dem Carline unterstellte, Martje verwende ihn wie so viele andere englische Idiome unbewusst, um ihr näher zu sein und ihre Sympathie zu gewinnen. Zunächst gelang ihr das auch, weil Carline in diesem Wunsch vor allem ein Zeichen für die gefestigte Beziehung mit David sah und somit indirekt eine Statusmeldung in Sachen Glück. Doch je länger, angestrengter und vergeblicher Martje versuchte, schwanger zu werden, desto mehr schwand dieses vermeintliche Glück und verwandelte sich in eine Mauer aus Zorn, Selbsthass und Neid, die selbst Carline nur selten zu durchbrechen vermochte. Vielleicht wandte sie auch einfach die falsche Technik an. Denn anstatt Martje gut zuzureden, Mut zu machen und hoffnungsvollen Optimismus zu versprühen, verlegte sie sich aufs Gegenteil.
»Sieh’s mal so«, hatte sie einmal gesagt, während sie bei ihrem vietnamesischen Lieblingsimbiss zu Mittag aßen. »Kinder sind wunderbar, sobald sie selbstständig essen, schlafen, putzen und aufräumen können. Sobald sie ihre Kleidung alleine zurechtlegen oder fragen, was sie für dich kochen sollen und ob sie sonst noch irgendetwas für dich tun können. Nur: kein Mensch ist so, solange er Kind ist. Und selbst danach schaffen es nur die wenigsten, so zu sein. Und wenn sie es sind, dann nicht selten aus eigennützigen Motiven, das heißt, weil sie irgendeine Gegenleistung erwarten. Ich behaupte nicht, jeder Mensch ist charakterlich schlecht. Aber hey, was können Kinder nicht alles ruinieren? Die Karriere, die Beziehung, die Familie, die Freizeit, die Freundschaften, das Konto, die Umwelt …«
Inwiefern Martje wirklich Trost aus diesen Worten zog, war ihr nicht anzusehen; sie ging nicht darauf ein. Aber knapp vier Wochen später hatte Carlines Telefon geklingelt und schon kurz nach dem Abheben hörte sie an Martjes Tonlage und Atemfrequenz, was sie ihr mitteilen wollte: dass sie schwanger sei, ganz frisch noch, aber eindeutig, das habe nicht nur ein Selbsttest zu Hause, sondern auch die Untersuchung bei der Frauenärztin ergeben.
Carline hatte geschluckt, so unhörbar wie möglich, dann gratuliert und sich gefreut, so gut es ging, die folgenden Monate allerdings damit zugebracht, der langsamen Enthüllung jener sich selbst erfüllenden Prophezeiung zuzusehen, die sie beim Mittagessen gemacht hatte, und das war dann auch schon so gut wie die einzige Befriedigung, die sie aus dieser Situation zog, dass sie alles, aber auch wirklich alles hatte kommen sehen: Wie aus guten abendlichen Gesprächen beim Wein plötzlich Treffen des Planungskomitees für Babyausstattung wurden (»Wie findest du dieses Beistellbettchen?«); wie die Eltern und Schwiegereltern in eine Mischung aus höchster Euphorie und abgrundtiefer Besorgnis verfielen (»Ein Kind mit Ende Dreißig – wie schön! Aber auch nicht ganz unbedenklich! Und arbeiten gehen wirst du dann erst mal nicht mehr können, das weißt du, oder?«); wie schon vor der Geburt bei diversen Vorbereitungskursen (»Fit durch die Schwangerschaft«; »Schwanger und yogisch? – Logisch!«) Playdates für die Zeit nach der Geburt arrangiert wurden.
Wenn Carline solchen Treffen beiwohnte (um Martje überhaupt noch zu sehen) oder haarklein darüber informiert wurde, meinte sie, eine Ahnung zu erhalten, wie sich das Mitglied eines isolierten indigenen Stammes fühlen musste, wenn es plötzlich eine Gruppe Weißer reden hörte. In Martjes Fall drehten sich die Gespräche um Fragen, zu denen Carline selbst keinerlei Meinung hatte: Stillen oder Flasche? Wickelbeutel oder -tasche? Tragetuch oder Wagen? Eigene Matratze oder Elternbett? Impfen oder nicht? Plazenta einpflanzen oder einfrieren? Wegwerf- oder Stoffwindeln? (Wobei Julia, eine von Martjes Mutterbekanntschaften, auf letztere Frage eine klare Antwort wusste: Stoffwindeln lohnten sich ökologisch erst ab dem zweiten Kind, das habe eine Studie in Australien ergeben; und noch bevor Carline vorsichtig fragen konnte, ob diese Studie auch den eklatanten ökologischen Fußabdruck weiterer Kinder gegengerechnet habe, wie eine Untersuchung aus Schweden es getan hatte, waren die übrigen Teilnehmerinnen der Runde, mit Ausnahme von Martje, bereits dazu übergegangen, sich mitzuteilen, für wann sie ihr zweites Kind planten.)
Dass Carline mit ihren wissenschaftlichen Ambitionen diesen Runden nichts abgewinnen konnte, stimmte sie nicht weiter nachdenklich. Eltern hatten nun einmal ihre ganz eigenen Themen und Nichteltern konnten zu diesen nur selten etwas Fruchtbares beitragen. Dass aber David solchen Nachmittagen meistens fernblieb, das fand sie auffällig; und nach Ariks Geburt fand sie es sogar ungut, geradezu verurteilungswürdig, zumal wenn er ihr anschließend erklärte, wie es sich für ihn als Vater anfühle, durch die Stadt zu gehen.
»Du kannst dir nicht vorstellen«, sagte er zu ihr, während sie einen Lappen mit kaltem Wasser auswrang, weil Martje sich mit einem Milchstau plagte, »wie junge Frauen, vor allem kinderlose junge Frauen, auf einen allein herumlaufenden Mann mit einem Kind vor der Brust reagieren.«
»Ach, kann ich das nicht?«, wollte sie bereits fragen und darauf hinweisen, dass sie selbst eine kinderlose junge Frau war und dass es durchaus viele Frauen wie sie gab, die sich Besseres vorstellen konnten, als von einem Mann wie ihm geschwängert zu werden. Doch statt dies zu sagen, wies sie ihn lieber darauf hin, dass Martje nebenan auf den Lappen für ihre Brust wartete und sich sicherlich über etwas Gesellschaft und einen Teller Suppe freuen würde.
Noch im Gehen hörte sie, wie die beiden sich im Wohnzimmer stritten: ob er wirklich immer die teuersten Windeln kaufen müsse; ob sie morgen auch wieder allein zu Hause sei, nur damit er sein Manuskript beenden könne; warum an diesem Samstag sein Vater komme, wenn sich doch für Sonntag schon ihre Mutter angekündigt habe.
Carline erfuhr die Antworten, die David auf diese Art von Fragen gab, nicht direkt aus seinem Mund, sondern aus dem von Martje, wenn sie bei ihr anrief und sich nach ihrem Befinden erkundigte. Dieses Sich-Erkundigen kam von Herzen und war ganz ehrlich. Aber Carline benötigte wenigstens zwei Jahre, um zu begreifen, warum. Es schien ihr anfangs unlogisch bis unvernünftig, weiter mit einer Person befreundet zu sein, die auf eine so fundamentale Lebensfrage wie das Kinderkriegen für sich eine andere Antwort gegeben hatte. Ja es erschien ihr geradezu selbstverletzend, dass sie dieser Person sogar jetzt, wo sich die Entscheidung für ein Kind Carlines Meinung nach als Fehler erwies, alle mögliche Unterstützung zukommen ließ. Aber sie konnte nicht davon ablassen, sie musste es tun, und angestrengtes Nachdenken und Gespräche mit Cédric, der ihre Einstellung zu Kindern teilte, brachten sie darauf, weshalb: Weil sie sich mitschuldig an Martjes Misere fühlte. Sie war es gewesen, die Martje und David, besonders am Anfang der Beziehung, als David nur ein unvermeidlicher Freund von Cédric gewesen war, immer wieder gesagt hatte, wie gut er und sie zusammen passten. Zugleich war es ihr ganz offensichtlich nicht gelungen, Martje die Konsequenzen des Pronatalismus eindringlich genug vor Augen zu führen.
Sicherlich, Kinder waren nicht die Eltern aller Probleme. Aber sie waren trotzdem verantwortlich für einen Gutteil davon, lokal wie auch global. Das war am Beispiel von Arik, der täglich wenigstens sechs Wegwerfwindeln verbrauchte und jede Nacht stundenlang schrie, gut zu sehen. Mal litt er an Koliken, mal an Erkältung, Verstopfung oder Zahnungsschmerzen, und seine Eltern, Martje im Besonderen, litten mit ihm, was für Carline den ultimativen Beweis aller antinatalistischen Essenz darstellte: dass Leben stets auch Leiden bedeutete, weshalb es im Grunde unbedingt vermieden werden musste.
So sicher diese Erkenntnis schien, so sehr litt auch sie, und zwar darunter, dass man, indem man sein Leben in der Welt lebte, diese Welt nicht nur kaputtmachte, sondern durch den Zustand, in dem sich diese Welt befand und – viel schlimmer noch – in Zukunft befinden würde, an der Welt kaputtging. Anders ausgedrückt: Kinder waren schlecht für die Welt. Und selbst wenn sie es nicht waren, war die Welt bereits zu schlecht für Kinder. Doch weil sie minderjährig waren und zudem nichts konnten für ihr Geboren-worden-sein, lag die eigentliche Schuld natürlich bei den Eltern, bei denjenigen also, die sich fürs Kinder-in-die-Welt-Setzen entschieden hatten. Und deswegen musste jeglicher Vorwurf, alle Aggression gegen sie gerichtet werden, fand Carline, nur konnte sie das Martje nicht sagen. Schon gar nicht jetzt, in diesem Moment, in dem sie, die frisch getrennte Martje am Ohr, zwischen den Kochbüchern in der Küche und der Reiseausrüstung auf dem Bett pendelte und sie Martje zwar einerseits für die Niederlage des Traums von der glücklichen Kleinfamilie bedauern, andererseits aber für den Sieg weiblicher Selbstermächtigung feiern musste.
Dass sie es ihr nicht sagen konnte, darüber ärgerte sie sich. Genauso, wie sie sich darüber ärgerte, dass Martje sich ausgerechnet jetzt getrennt, sie ausgerechnet jetzt angerufen hatte. Sie wusste doch, dass morgen früh der Flieger nach São Paulo ging. Und sie wusste auch, dass vorher noch ein Abendessen ins Haus stand! Warum, verdammt noch mal, hatte sie jetzt – JETZT! – angerufen?
Ein Schluchzen kam aus der Leitung. Sofort schämte Carline sich für ihre Gedanken, obwohl Martje sie unmöglich gehört haben konnte.
»Hey«, sagte sie. »Ich finde gut, dass du das gemacht hast. Wirklich. Ich finde dich stark!«
Sie selbst fühlte sich schwach. Das Einzige, wofür sie jetzt noch Kraft aufbringen konnte, war Ärger, massiver Ärger: darüber, dass sie reisen musste; darüber, dass sie kochen wollte; darüber, dass sie Martje zuhören sollte; und obendrein ärgerte sie sich, dass sie sich so ärgerte, und noch in dem Moment, als Cédric die Wohnung betrat, sie das Telefonat beendet hatte und ihre Haare getrocknet waren, ärgerte sie sich über sich selbst, über sich und ihre jämmerliche Existenz, und das war erst der Anfang.
2
Jurij Bogić stand auf der Anhöhe und schaute zu den Sternen. Das Kreuz des Südens war gut zu erkennen, auch die Magellanschen Wolken ließen sich ausmachen. Hier und da blinkten die Sonnensegel eines Satelliten. Kein Wind ging auf der chilenischen Hochebene, die Krater der Vulkane ruhten unter Schnee. Nur die Lüftungsanlagen des Observatoriums surrten in die stille Nacht der Wüste.
Am Horizont glomm San Pedro de Atacama. Wie ein glühender Lavastrom breitete der Ort sich aus, einst ein kleines Dörfchen nur, inmitten von Steinen und Staub, nun angewachsen auf ein Vielfaches der ursprünglichen Größe, und niemand wusste so genau, weshalb und warum. Mit den Menschen war das Licht gekommen, hatten Straßenlaternen, Autoscheinwerfer und Reklameschilder Einzug gehalten. In Santiago, so hieß es, sei kein einziger Stern mehr am Himmel zu sehen. Es fielen sogar schon Vögel tot von den Bäumen, erschöpft von tagelangem Gesang, der nicht enden wollte, weil niemals Nacht wurde.
Das Vogelsterben berührte die Allerwenigsten im Observatorium, das Verschwinden der Sterne hingegen schon, zumal von Westen her nicht nur künstliches Licht drohte, sondern, schlimmer noch, Küstennebel. Schon seit Jahren gab es Befürchtungen, die kalte Meeresströmung könne sich durch den Temperaturanstieg deutlich abschwächen. Aber diese Prognose hatte bisher auf dreitausend Metern über dem Meeresspiegel wie die weit entfernte Sorge aus einer anderen Welt gewirkt. Seit Kurzem jedoch mehrten sich die Anzeichen, dass die pessimistischsten Szenarien inzwischen zu den optimistischeren gerechnet werden mussten, und seitdem konnten selbst diejenigen, die vorher immer nur gesagt hatten, sie betrieben Astronomie, nicht Ozeanografie, erklären, weshalb wärmeres Pazifikwasser die Wüstenluft feuchter machen und den radioteleskopischen Blick auf die Sterne erschweren, wenn nicht sogar irgendwann verhindern würde.
Jurij steckte die Hände in die Hosentaschen. Er fror. Obwohl seit sechs Jahren mit einem PhD in Astrophysik ausgestattet, mochte er nicht von sich behaupten, ein Sternenkenner zu sein. Er konnte etwas über Galaxien und Nebel, über den Asteroidengürtel und die Milchstraße erzählen. Er wusste, was der Kappa-Mechanismus, die Transitmethode und die Roche-Grenze waren, aber was hieß es schon, die Sterne auf diese Weise zu kennen? Es ließen sich so unterschiedliche Kenntnisse von ihnen haben; die Gespräche mit Apu, dem bolivianischen Hilfsarbeiter, zeigten es.
»Ist Zeit, den Mais auszubringen«, hatte Apu gestern Abend gesagt, die Stirn unter seine, grellbunte Mütze aus Alpakawolle geschoben. »Wenn die großen Lichter zuerst am Himmel stehen, kannst du sofort beginnen; wenn zuletzt, musst du warten.«
Jurij lachte. Nicht, weil Apu von ›großen Lichtern‹ sprach, nicht, weil sie kein einziges Maiskorn besaßen, das sie hätten aussäen können. Auch nicht, weil es für die Sterne ein belustigender Anblick sein musste, wie sie dort standen: er, der große, breitschultrige Serbe, und Apu, der kurze, gebückte Quechua. Er lachte, weil sie eine fantastisch weise Sicht auf das All war, diese Einteilung in große und kleine Sterne. Wie viel Nutzen und Genügsamkeit lagen doch darin! Er beneidete Apu darum und erinnerte sich an die Zeit, in der auch sein eigener Blick in den Himmel noch ein ganz anderer gewesen war, als er mit seinem Vater auf der Dorfstraße stand und dieser versuchte, ihm das All zu erklären, mit gar nicht mal geringem Erfolg. Wer konnte schon ad hoc eine Antwort auf die Frage eines Fünfjährigen geben, wie viele Sterne dort oben standen? Hunderthunderte? Tausendtausende?
»Quadrillionen«, sagte Vater. »Einige hundert Quadrillionen.« Und, womöglich um sich nicht genauer festlegen oder gar erklären zu müssen, was eine Quadrillion war, fügte er sofort hinzu, dass von der Erde aus und mit bloßem Auge betrachtet nicht einmal zehntausend zu entdecken seien, schätzungsweise aber wenigstens zehn Trilliarden mal so viele existierten, weil ja die Milchstraße mit ihren circa zweihundert Milliarden Sonnen, zu denen die irdisch sichtbaren Sterne ausnahmslos gehörten, nur eine Galaxie von mehreren hundert Milliarden im bekannten Universum darstelle, die wiederum zu Haufen und Superhaufen angeordnet durch den Kosmos schwebten. Wobei die Sterne übrigens stets das Zentrum eines Sternsystems umkreisten und dafür in manchen Fällen einige hunderttausend, im Fall der Sonne zweihundertvierzig Millionen, in der Regel aber mehrere Milliarden Jahre benötigten, manchmal sogar hunderte Milliarden – Zahlen, die dem kleinen Jurij den Kopf ganz schwindelig machten.
Auch jetzt verspürte er einen Schwindel. Aber der rührte eher vom Magen als vom Kopf her. Seit Wochen aß er während der Mahlzeiten nur noch die Suppe, die immer etwas zu stark mit frischem Koriander gewürzt war. Sein Essverhalten war den anderen längst aufgefallen und zog die eine oder andere Frage nach sich, ob es ihm nicht gut gehe, ob er auf Diät sei; er hatte sie alle bisher einigermaßen abgewehrt (»Nur eine vorübergehende Verstimmung, nichts Schlimmes«). Doch insgeheim ahnte er, dass es sich mit dieser wie mit jeder Übelkeit verhielt: dass sie nicht verschwinden würde, bevor der übelmachende Brocken nicht ausgespien war. Und während Apu, wie an den meisten Abenden, neben ihn trat, überlegte er, ob er ihm vielleicht alles erzählen sollte, wenigstens auf Serbisch, sodass Apu nichts verstand (sie spielten dieses Spiel manchmal: Apu fragte etwas auf Quechua, Jurij antwortete in seiner Muttersprache, und dann lachten sie wie kleine Kinder über den sonderbaren Klang ihrer Worte).
Jurij sah auf Apus Mütze hinab. Er wusste gar nicht, wo er anfangen sollte. Am ehesten vermutlich an jenem Märzsonntag in seinem achtzehnten Lebensjahr, an dem er das Schlafzimmer seiner Eltern betrat. Wobei er diesen Schritt wiederum wohl niemals gemacht hätte, wenn nicht genau einen Monat vorher, während der Fahrt im schmerzhaft zeitigen Schulbus, etwas passiert wäre, woran zu denken er bis dato nicht gewagt hatte, und zwar aus guten Gründen.
Sein Körperbau gehörte nicht zu diesen Gründen. Schon bei der Geburt war er außergewöhnlich groß und kräftig gewesen (so sehr, dass es kurzzeitig die Überlegung gab, ihn doch nicht nach Gagarin zu benennen, der, seine Riesenbedeutung für die Raumfahrt hin oder her, nur einen Meter siebenundfünfzig maß). Allerdings besaß Jurij trotz seiner Statur und seines Aussehens nicht die Qualitäten, die ein Schulhof von einem Jungen verlangte. In den Pausen stand er nicht vor dem Hoftor oder in einer abgelegenen Ecke und rauchte Zigaretten. Im Unterricht rief er keine unflätigen Kommentare in die Klasse. Auf der Schulbank hinterließ er keine zweideutigen Schmierereien. Nach Schulschluss verabredete er sich nicht zum Trinken. Lieber saß er irgendwo und las. Keine Romane, wie die Serbokroatischlehrerin es gerne sah, sondern Bücher, die allenfalls noch den Physiklehrer erfreuten, über Plasmateilchen, Strahlungsenergie und Massendichte. Dinge also, von denen er überzeugt war, dass er sie kennen musste, wenn er die Sterne begreifen wollte, zu denen aber nicht einmal sein Vater vorgedrungen war, obwohl der für einen durchschnittlichen Mechaniker ein überdurchschnittliches astronomisches Interesse an den Tag legte. Daher schien es Jurij wie eine glückliche Fügung, dass es im Verwandtschaftssystem des Menschen die Rolle des Onkels gab, auch wenn sein Onkel Stipe sich niemals in persona zeigte, sondern lediglich in Form fest zusammengeschnürter und per Luftpost verschickter Bücherpäckchen, die als Absender das Department of Physics and Astronomy des University College London auswiesen. Wann immer ein solches Päckchen eintraf, empfand Jurij ein Hochgefühl, wie er es ansonsten nur von seinem Geburtstag her kannte, besonders vom Morgen danach, wenn die Kälte der Nacht noch im Zimmer lag, aber, halb im Traum, die warme Erinnerung an die Geschenke aufstieg. Dann schlug er die Decke zurück, lief zum Tisch und nahm die Bücher in die Hand, die Onkel Stipe, wie er schrieb, auf der Brook Street gekauft hatte. Jurij hatte weder eine Ahnung, wie diese Straße aussah, noch, wo sie lag. Auch der Englischlehrer konnte ihm nicht weiterhelfen. Er konnte ja teilweise nicht einmal die Titel der Bücher, die Jurij da geschickt bekam, übersetzen, ohne ein Wörterbuch zu Hilfe zu nehmen.
Überhaupt: So sehr diese Bücher ein Segen waren, so sehr waren sie auch ein Fluch. Einerseits ließ sich mit ihnen gedanklich nicht nur bis dorthin reisen, wo sie herkamen (Jurij schnupperte jedes Mal zuallererst am Papier; er mochte den vermeintlichen Geruch von Ferne, der ihm anhaftete); vor allem nahmen sie mit zu den Sternen, die so weit weg und angenehm gleichgültig gegenüber den menschlichen Problemen waren. Andererseits musste er sich Spott und Häme gefallen lassen, sobald er mit ihnen auf dem Schulhof auftauchte. Wenn es ganz schlimm kam, schlug sie ihm jemand aus der Hand und er konnte nur noch dabei zusehen, wie ihnen die Seiten aus dem Rücken gerissen wurden. Er wusste zwar, dass Bücher keine Schmerzen empfinden konnten, dass sie tote Zellmasse waren, ohne Gefühle oder Bewusstsein. Trotzdem litt er mit jeder Seite, fühlte sich, als würde ein Stück aus ihm herausgerissen, und sobald niemand mehr bei ihm stand, weinte er über das, was ihnen an seiner Stelle angetan worden war. Bevor er nach Hause ging, prüfte er im Seitenspiegel des blauen Zastava Florida, den Vater vor der Werkstatt geparkt hatte, ob auch ja keine Träne mehr zu sehen und die Haut unter den Augen nicht mehr allzu auffällig gerötet war. Die Eltern hatten schließlich schon genug eigene Probleme, wie sich abends im Bett hören ließ, wenn ihre gedämpften Gespräche aus der Küche drangen. Und sowieso schien es nicht sonderlich sinnvoll, sie um Unterstützung zu bitten. Es würde nur damit enden, dass man sich von anderen als ›Muttersöhnchen‹ beschimpfen lassen musste. Daher fasste Jurij jeden Tag als Trainingseinheit auf – als Trainingseinheit mit dem Ziel, möglichst gut allein klarzukommen, und sie begann spätestens auf der Fahrt zur Schule.
Auch an jenem Februarmorgen ruckelte und fauchte der völlig veraltete Bus. Bei jedem Schlagloch warf er die Insassen kurz in die Höhe. Es stank nach dem Diesel, den er in einer dicken, schwarzen Wolke hinter sich herzog. Die Motorwärme verlor sich in der Frostkälte des Wintermorgens. Eisblumen bedeckten die Fensterscheiben.
In Skorić stieg der Augen-Petko ein (sein linkes Auge schaute überall hin, nur nicht in Richtung desjenigen, mit dem er redete), danach die Zopf-Jelena (deren tiefschwarze Haare noch niemand jemals offen gesehen hatte), und in Pristalac polterten die Golko-Brüder herein, die Söhne des Ortsvorstehers, die immer so brüllten, wie ihr Vater es auf den Ratsversammlungen tat. Und während sie mit ihrer Lautstärke alles übertönten, versuchte Jurij, sich noch stärker in das Buch auf seinem Schoß zu vertiefen, und bemerkte gar nicht, wie in Drana Natalija Branković zustieg. Ihre langen nussbraunen Haare fielen über ihre zarten Schultern. Ihre dunklen Augen (die Farbe ließ sich nicht bestimmen, denn bisher hatte sich noch niemand in der Schule so nah an sie herangetraut) schauten aufmerksam aus ihrem Gesicht. Sie musste nur einen Schritt auf dem Schulhof tun und schon drehten sich ein Dutzend Köpfe nach ihr um. Jurij hatte es auch ein paar Mal getan, aber schnell befunden, dass diese Erscheinung im sozialen Universum weit außerhalb seiner Reichweite lag. Es lohnte sich nicht, wie die anderen Jungs aus der Klasse jede Pause darauf zu verwenden, die Umlaufbahnen, auf denen sie ihre Mitschülerinnen umkreisten, enger zu ziehen. Die Zeit war besser ins Lesen in einer abgelegenen Ecke investiert und Jurij erwartete nicht, dass sich irgendein Strahl weiblichen Lichts jemals dorthin verirren würde. Da im Bus die gleichen Naturgesetze wie auf dem Schulhof galten, verschwendete er auch keinen Gedanken darauf, weshalb sich Natalija jetzt in die Reihe vor ihm setzte und mit ihrem Atem dünne Löcher in die Eisblumen blies.
»Jurij?«
Er hob den Kopf und blickte in ihre Augen (sie waren opalgrün).
»Erklärst du mir die Sache mit der Lichtgeschwindigkeit für Physik?«
Er spürte die Blicke der anderen Jungen im Bus. Aber irgendetwas in Natalijas Verhalten sorgte dafür, dass er meinte, sie könnten ihm nichts mehr anhaben.
Er nickte stumm.
»Übermorgen? Nach der Schule?«
Kaum hatte er erneut genickt, drehte sich ihr Kopf wieder um, und Jurij blickte in ihre Haare.
Zwei Tage später wartete sie abseits der Bushaltestelle. Er wich dem Leuchten ihrer Augen aus und setzte ihr mit der gleichen Geduld und Nüchternheit, mit der er es auch bei jeder anderen Person getan hätte, die Definition der Lichtgeschwindigkeit auseinander (»Lichtgeschwindigkeit bezeichnet jene Strecke von Metern pro Sekunde, die das Licht im Vakuum zurücklegt.«). Die Definition bereitete, zumindest physikalisch, keine weiteren Probleme. Doch Natalija war ein schwieriger Fall. Denn anstatt zu sagen, was genau daran sie nicht verstand, verlangte sie, erklärt zu bekommen, weshalb man sich theoretisch mit einem Konzept (»Vakuum ist die Abwesenheit von Materie im Raum.«) zufriedengeben solle, das im gesamten bekannten Universum keine reale Entsprechung habe (»Hast du selbst gerade so gesagt!«). Weil die Viertelstunde bis zur Abfahrt des Busses für weitere Erklärungen nicht reichte und weil Natalija sich im Bus zwar erneut unmittelbar vor ihn setzte, ihm dann aber sofort ihren Haarschopf zudrehte, wurde bald ein weiteres Treffen nötig, und noch eines und noch eines, und keine zwei Wochen später trafen sie sich schon in schöner Regelmäßigkeit.
Obwohl die Abstände zwischen den Treffen immer kürzer, die Treffen selbst immer länger und die Orte, an denen sie stattfanden, immer intimer wurden (sie standen nun nicht mehr nahe der Bushaltestelle, sondern saßen auf einer sichtgeschützten Bank im Park), ging es für Jurij noch immer ausschließlich um die Beschaffenheit des Alls und die Physik der Sterne. Worum sonst hätte es auch gehen sollen? Die Probleme, die dieser Gegenstand mit sich brachte, waren zahlreich. Und da sie inzwischen die Definitionen des Vakuums und der Lichtgeschwindigkeit weit hinter sich gelassen hatten (selbst Natalija hielt sie mittlerweile für einfach), drangen sie zunehmend in Bereiche vor, die selbst Jurij nicht mehr begreiflich schienen, sodass er immer wieder davor zurückscheute, noch weiterzumachen, um nicht zugeben zu müssen, dass sich von dem, wozu sie seiner Meinung nach jetzt zwangsläufig kommen mussten, nur unter größten Schwierigkeiten reden ließ.
Eines Nachmittags fasste er sich ein Herz. Natalijas Augen wanderten durch die Äste der Bäume, die den Parkrand säumten. Er hatte die Hände verknotet und saß in artigem Abstand neben ihr.
»Natalija«, sagte er nach langem Schweigen (dabei merkte er gar nicht, wie sie an ihn heranrückte). Und weil er plötzlich nicht mehr wusste, was er hatte vorausschicken wollen, fing er einfach an.
Das Universum, sagte er, sei angeblich unendlich. Doch was solle das heißen: Unendlichkeit? Zeitlich gesehen sei doch alles endlich. Das Leben eines Menschen zum Beispiel, wie das vom schnauzbärtigen Sportlehrer Kukić, der neulich mit seinem selbstgebauten Motorrad an einem Baum verunglückt war (die leere Flasche Wodka, die auf seinem Küchentisch stand, habe keine unwesentliche Rolle dabei gespielt, hieß es). Auch die Sterne hätten ihre begrenzte Lebensdauer. Fünf Milliarden Jahre in etwa seien der Sonne noch zum Leuchten gegeben. Dann werde sie sich aufblähen und mit ihr ein Teil des Sonnensystems verglühen. Natürlich lasse sich sagen, dass die Materie unendlich sei, weil sie ja nicht verschwinde, sondern sich nur neu formiere, anders zusammenfinde, etwa wenn der Kukić langsam zu Humus verrotte, oder die Sonne als riesige Gaswolke verpuffe. Trotzdem bleibe in der Zeit ja nichts, wie es gewesen sei. Erst recht nicht, wenn man sogar dem Universum insgesamt einen Anfang bescheinige. Deshalb könne mit Unendlichkeit eigentlich nur auf den Raum angespielt sein. Nicht auf die schiere Größe des Weltraums, der sei ja nun wirklich sehr groß, sondern auf die Frage, ob dieser Raum ein Ende habe. Wenn man diese Frage verneine, ziehe das allerdings das Problem der Beweisbarkeit nach sich, denn wie wolle man mit einem endlichen Verstand etwas beweisen, das nicht nur das Vorstellungsvermögen weit übersteige, sondern per Definition von gänzlich anderer Natur sei? Man könne sich ja weder ausmalen, wie sich das anfühlte, ein Flug durchs All, der niemals an sein Ende gelangte, noch könne man ihn jemals unternehmen. Denn das würde bedeuten, dass ein Ergebnis nie verkündet werden würde, und wenn man jetzt noch hinzunehme, dass das Universum sich ausdehnt, was seit vielen Jahrzehnten als ausgemacht gelte, dann sei die Sache wirklich zum Verrücktwerden, denn sie führe unvermeidlich zu der Frage, wohin sich etwas ausdehne, das unendlich ist. In einen Raum außerhalb seiner selbst könne es sich kaum ausdehnen. Dann wäre das Universum ja begrenzt und endlich (und während er es aussprach, strahlte er über das ganze Gesicht, weil ihm zumindest diese eine Schlussfolgerung unwiderlegbar schien). Aber umso größer sei das Problem der Unendlichkeit. Und weil es so groß sei, beschäftige es ihn auch so oft: auf den Busfahrten zur Schule, wenn die verschlafene Landschaft vorbeizog; in den Schulstunden, in denen nur öde Wiederholungen auf dem Plan standen; und manchmal, ja, manchmal beschäftige es ihn sogar nachts. Dann durchzucke es ihn im Schlaf und er liege plötzlich hellwach und die Gedanken wollten nicht weggehen, nein, sie wollten einfach nicht weggehen, und das wiederum sei doch irgendwie peinlich, weshalb er es auch noch niemandem erzählt habe. Niemandem! Jetzt sei das erste Mal. Aber ehe er weiterreden konnte, merkte er, wie Natalijas Hände in seine glitten, die inzwischen ganz feucht waren vom Schweiß, und während sie ihn ansah und ihr Gesicht sich näherte, vergaß er, was es mit dem Problem der Unendlichkeit auf sich hatte.
Dafür trat nach diesem Nachmittag ein anderes Problem auf den Plan, eines, das Jurij zwar ausschließlich mental, aber nicht ohne äußere Anzeichen von Scham als ›Problem der Vorkehrung‹ bezeichnete. Denn obwohl seine Eltern niemals mit ihm darüber geredet hatten (und ›darüber‹ meinte: den Umgang mit einer Frau, die nicht die eigene Mutter war, und der über eine rasche Begrüßung oder einen flüchtigen Blickkontakt hinausging), und obwohl auch die Biologielehrerin in der Schule nur recht allgemein und unbestimmt über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern herumgedruckst hatte, war er aufmerksam genug gewesen, um mitzubekommen, was auf einen Nachmittag wie diesen früher oder später folgen würde. Natalijas Umarmungen wurden mit jedem Tag inniger, ihre Zuwendungen immer ausgedehnter und auch in ihm regte sich ein gewisses Verlangen, dessen Existenz er nicht leugnen konnte und das er, mit jedem Tag, der verging, umso mehr stillen wollte. Aber nur weil er wusste, was zu besorgen war, kannte er noch lange keine befriedigende Antwort auf die Frage, wo und wie. Der kleine Lebensmittelladen im Ort führte nichts in dieser Richtung; der Gang dorthin war sowieso ausgeschlossen, genauso wie derjenige in die Apotheke. Es musste ihn nur irgendwer sehen und schon war die Peinlichkeit perfekt. Deshalb blieb nur eine einzige Möglichkeit: die Nachttischschublade im elterlichen Schlafzimmer. Es gab zwar keine Garantie dafür, dort fündig zu werden, doch die Wahrscheinlichkeit war, so manchen Geräuschen nach zu urteilen, ziemlich groß.
Das Zimmer befand sich am Ende eines schmalen Flurs. Ein kleines Badezimmer mit Toilette, ein Abstellraum für Putzmittel, eine Kammer für Lebensmittel, Jurijs Zimmer (das mit nichts als einer Matratze, einem Tisch und einem Stuhl möbliert war) sowie die Küche zweigten davon ab. Sie bildete zugleich den gemeinsamen Wohn- und Empfangsbereich des Hauses, sehr zum Ärger von Mutter, die in regelmäßigen Abständen darüber schimpfte, dass es eine schlechte Idee gewesen sei, ein ehemaliges Tankstellengebäude zu einem Wohnhaus umzufunktionieren, nur damit Vater die Werkstatt übernehmen könne. Ständig stehe jemand mitten in der Küche und mache mit seinen schlammigen Schuhen den frisch gewischten Boden dreckig, um zu fragen, wo Vlatko Bogić, der Automechaniker, sei.
Jetzt lag der Flur still, in nachmittäglicher Ruhe. Nur die braune Tür zum Schlafzimmer quietschte. Vater hatte sie schon vor Ewigkeiten ölen sollen. Aber weil er Mutters Bitte auch nach Monaten nicht nachkam, hatte sie schließlich Sonnenblumenöl in die Angeln geträufelt; es half nichts, sondern machte die Sache nur noch schlimmer.
Obwohl niemand sonst im Haus war, bemühte sich Jurij, die Tür so leise wie möglich zu öffnen. Die Abfahrt der Eltern im Zastava hatte er genau verfolgt (sie hatten sich etwas verwundert darüber gezeigt, dass er sein Zimmer, anders als sonst, wenn sie gingen, verließ und sie sogar bis zur Tür begleitete). Im Anschluss hatte er mehrere Kontrollgänge durch die Wohnung unternommen, um sicherzustellen, dass die Luft auch wirklich rein war.
Im Schlafzimmer roch es nach Vaters Aftershave. Er hatte es irgendwann in rauen Mengen als Sonderangebot auf dem Markt gekauft und verwendete es seitdem unentwegt, obwohl er von jeder Anwendung rötliche Punkte am Hals kriegte. Darüber hing der Duft von Mutters Parfüm. Jeden Morgen trug sie es auf, immer zu viel, sodass alle Zimmer nach ihr rochen, selbst wenn sie, so wie jetzt, gar nicht da war.
In der Mitte des Raums stand das Bett. Die Decke war sorgfältig glattgestrichen. Darauf drapiert stapelten sich mehrere Kissen, ein ganzer Berg aus federgefülltem Plüsch. Jedes Stück war sorgfältig positioniert. An der Wand hing ein Familienbild aus früheren Tagen.
Der einzige Nachttisch stand auf Vaters Seite. Er war aus schwerem Eichenholz, zu schwer für ein Möbelstück dieser Größe und Funktion, und schwarz lackiert. Der Messinggriff an der Schublade glänzte, die Lade klemmte. Erst im dritten Versuch ließ sie sich aufziehen.
Der Inhalt (eine rostige Gabel, ein Dosenöffner, einige angelaufene Batterien, zwei Heftklammern, ein Taschentuch, eine Schlafmaske und mehrere Kopfschmerztabletten) schien wahllos verstreut. Jurij bemühte sich trotzdem, nichts zu verrücken. Gut möglich, dass Vater die genaue Lage jeder Sache kannte.
Die Behutsamkeit, mit der er vorging, erhöhte den Schwierigkeitsgrad, zumal wenn es darum ging, in den hinteren Bereich der Lade vorzudringen (er entzog sich dem Blick von oben).
Jurij ging in die Knie, hielt sich mit der einen Hand am Griff fest, mit der anderen arbeitete er sich in die Tiefe der Schublade vor. Das Tasten ergab: eine Armbanduhr, einen Bleistiftspitzer und etwas ledern Eingefasstes, ein Kästchen vielleicht, der letzte noch verbliebene Gegenstand.
Er zog das Lederteil vorsichtig hervor. Es handelte sich tatsächlich um einen kleinen Kasten, bezogen mit braunem Leder, versehen mit einem broschenartigen Verschluss. Ein gutes Versteck irgendwie (und es beruhigte ihn zu sehen, dass offenbar auch sein eigener Vater eine gewisse Scham hegte).
Er öffnete den Deckel, sah jedoch nur ein abgegriffenes Büchlein, olivgrün und fleckig. Die Seitenränder waren angebräunt, der Pappeinband wellte sich und knackte. Die erste Seite war, von einem braunen Fleckenmuster abgesehen, leer. Erst auf der zweiten Seite füllten Buchstaben jede Linie, teilweise sogar in Zweierreihen. Die Schrift, eine kleine, fast schon zwergenhaft winzige Handschrift, war unzweideutig als die von Vater zu erkennen. Nur das, was dort geschrieben stand, wollte nicht zu ihm passen, jedenfalls nicht zu dem Menschen, den Jurij als seinen Vater kannte, doch die Neugierde war größer, größer als das Entsetzen, das ihn schließlich packte und so sehr die Brust zuschnürte, dass er kaum atmen konnte. Aber da war es bereits zu spät, um aufzuhören.
3
Telmo Zacharias Durão Schmidt war ein freundlicher Mann von dreiundfünfzig Jahren, mit feuerrotem, lockigem Haar, das vom runden Kopf in den weißen Nacken fiel, der auf einem breiten, gemütlichen Oberkörper saß.
Seine Hände ruhten vor der Tastatur auf seinem Schreibtisch. Die alte Schulglocke läutete, wieder viel zu früh, den ganzen Tag über hatte sie das schon getan. In der dritten Stunde, in Klasse 11, war sie mitten in Platons Protagoras gefahren sowie in die Erläuterung, dass das Prädikatsnomen beim Infinitiv entweder im Kasus seines Beziehungswortes oder im Akkusativ zu stehen habe. In der sechsten Stunde (bei den Zwölftklässlern) hatte sie Ciceros Gespräche in Tusculum und die Frage, weshalb der Tod kein Übel ist, durchkreuzt, und den schwatzhaften Paul Vierkötter davon befreit, eine Übersetzung für ›non miseros sensu carentis‹ finden zu müssen. Auch die letzte Unterrichtsstunde des Tages, Religion in Klasse 9 (der Durchgang durch den Kanon des Neuen Testaments war gerade beim Römerbrief angelangt), hatte sie vorzeitig beendet, und wer auch immer heute Dienst am Läuteseil tat: der Hintergrund des Manövers, die Schulstunden zu spät ein- und zu früh auszuläuten, war nur allzu durchschaubar und jetzt, gegen Ende der Hausaufgabenzeit und mit dem Beginn des Abendessens, wenn alle es kaum erwarten konnten, aus den Internatszimmern in den Speisesaal zu rennen, erst recht. Das Spielchen musste mindestens eine Ermahnung durch den Rektor zur Folge haben, besser noch, aber diesmal unter strengster Einhaltung der vorgeschriebenen Zeiten, einen weiteren Tag Läutedienst oder irgendeine andere Strafarbeit. Doch all diese Einzelheiten waren Telmo Schmidts Problem nicht.
Sein Problem war eines, das ihn hin und wieder recht abstrakt, im Konkreten und mit neuer Dringlichkeit aber seit ein paar Stunden beschäftigte, und das sich am einfachsten in der Frage zusammenfassen ließ: ›Wie kommt es, dass man tun kann, was man eigentlich nicht tun will?‹ Natürlich handelte es sich dabei nicht um ein rein persönliches Problem. Schon der Heilige Thomas, der Heilige Anselm und der Heilige Augustinus, vor ihnen Origines, Aristoteles und Platon, ja sogar die Vorsokratiker hatten sich darüber Gedanken gemacht. Das hieß nicht, dass sie zu einer befriedigenden Lösung gekommen waren. Sie hatten sich heillos zerstritten und schienen am Ende selbst nicht mehr so genau zu wissen, was sie eigentlich wollten. Ohnehin half auch die beste theoretische Lösung nichts, wenn sich ein Problem im alltäglichen Leben und ganz praktisch immer wieder aufs Neue stellte, und genau so hatte es das Problem des Unwillentlichen bei Telmo erst heute Mittag getan, und zwar auf diabolischste Art und Weise: in Form eines Hähnchen-Cordon-bleu.
Diabolisch war daran schon allein die Zubereitung. Es bedurfte ja doch einer gewissen kulinarischen Perversität, um ein Schweineschinkenstück in ein Geflügelteil zu stopfen, dasselbe mit geronnener Kuhmilch zu füllen, in einen Mantel aus Paniermehl und geschlagenem Ei zu hüllen (womöglich noch in ein Ei, das in Sichtweite des armen Hähnchens gelegt worden war) und dann in Butterschmalz auszubacken. Nur: die Sache roch einfach so gut!
Schon im Klassenzimmer, die Tür war nicht geöffnet, aber die Abzugsrohre der Schulküche befanden sich direkt unter dem Fenster, war der Duft zu spüren und er ließ allen, denen er in die Nase stieg, den Magen knurren, und das am frühen Vormittag. Entsprechend stürmisch verabschiedeten sich die Neuntklässler aus der Tür. Nur ihr Lehrer blieb allein zurück.
In aller Ruhe wischte er die weiße Tafel ab. Mehrfach erneuerte er das Papier am Tafellöscher, zog ihn in langen Bahnen über die bunten Vokabeln. Er tat es nicht, weil er ein Freund glänzend blanker Whiteboards war, im Gegenteil. Die konnten ihm nicht nur, wenn es ums Essen ging, gestohlen bleiben (wo waren bloß die Zeiten hin, in denen die Tafeln noch unaufdringlich grün waren?). Er tat es, weil das meditativ-langsame Wischen in diesem Moment das einzig probate Mittel im Kampf gegen das innere Verlangen schien, den Schülerinnen und Schülern umgehend nachzufolgen. Er beneidete sie tief um ihre Freiheit (denn zumindest in den Pausen waren sie ja frei). Viel mehr noch aber beneidete er sie, weil sie sich nicht an einen strengen Diätplan halten mussten, wie er ihm vor einer Woche von seinem Hausarzt Doktor Kuhn persönlich aufgebrummt worden war.
Fleisch: max. 1x alle zwei Wochen, stand dort zu lesen, mit roten Ausrufezeichen am Rand versehen. Darunter prangten neonpink umkringelt die Werte, die ein Bluttest, eine Harnprüfung, eine Gewichts- und Körperfettmessung sowie ein Elektrokardiogramm ergeben hatten und die Doktor Kuhn allesamt als ›ziemlich besorgniserregend‹ bezeichnete. Der Einschätzung folgte ein leises Schmatzen und dann eine ausführliche Schilderung dessen, was im Religionsunterricht wohl unter der Überschrift ›Apokalypse‹ zu behandeln gewesen wäre, sich in Kuhns Worten aber bei einem ›Apfeltyp‹, wie er die vorliegende Fettverteilung nannte, schlicht mit einer sehr hohen statistischen Wahrscheinlichkeit ergebe, als da wären: Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin, Diabetes mellitus Typ 2 – Etliches davon sei ja bereits zu erkennen – und schlussendlich ein früher Tod, herbeigeführt vermutlich durch Herzinfarkt; wobei früh nicht bedeuten müsse schnell, denn schnell wünschten es sich ja alle! Aber gerade denjenigen, die im Leben allzu sehr sündigten, würde das Sterben erst recht unbequem gemacht: durch Schlaganfall, Arteriosklerose, Darmkrebs oder Gicht, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das Ende komme also nicht kurz und schmerzlos, sondern langsam und qualvoll, es sei denn, ja, es sei denn, es würde radikal umgesteuert, wie Kuhn sagte. Und nachdem er in seinem Bürostuhl erst zum einem, dann zum anderen Ende seines Schreibtisches gerollt war, klierte er eine Handvoll Anordnungen auf ein Blatt, die Telmo nur mit Mühe lesen konnte und von denen ihm besonders eine fast noch schlimmer als ein früher Tod vorkam: die restlebenslange Einschränkung des Fleischverzehrs.
Fünf Minuten waren vergangen, seitdem die Klasse den Raum verlassen hatte; fünf Minuten, in denen er nicht (oder fast nicht) an das Cordon bleu gedacht hatte. Es war ein Erfolg, ein kleiner nur, aber immerhin, und das erfüllte ihn mit Stolz; so wie er am heutigen Donnerstag auch stolz auf die sechs Tage zurückblickte, die seit der Predigt von Kuhn vergangen waren und die er ungelogen gänzlich fleischabstinent überstanden hatte. Zugegeben, es hätten volle sieben sein können, eine ganze Woche schon. Aber am Tag des Arztbesuches hatte es Gulasch gegeben. Und dem ließ sich schwer entsagen, zumal es eine wirklich willkommene Hilfe darstellte, um die schlimme Diät-Nachricht zu verdauen. Damit die Bilanz aber nicht schon im Ansatz versaut war, beschloss Telmo, die neue Zeitrechnung erst am folgenden Tag beginnen zu lassen, einem Freitag, von dem an das Leben in seine postkarnale Ära gehen sollte (was leichtfiel, weil die Küche freitags Fisch servierte).
Er ließ weitere fünf Minuten verstreichen. Im Schulhaus war nun völlige Ruhe eingekehrt. Alle saßen im Speisesaal, alle außer ihm. Aber gerade darin lag eine große Hoffnung. Die Küche bereitete nämlich, durch Fehlplanung, direktoriale Weisung oder was auch immer bedingt, nicht selten zu wenig Essen zu. Dabei machte sich die Knappheit interessanterweise nicht bei Kartoffeln, Reis, Nudeln und Gemüsen, sondern vor allem bei den Fleischbeilagen bemerkbar. Und während Telmo vor einer Woche noch das Eintreten einer solchen Knappheit zutiefst gefürchtet hatte, sehnte er sie jetzt herbei. Denn wo kein Fleisch mehr lag, da konnte auch kein Verlangen mehr danach entstehen. Wenn es doch entstand, konnte ihm immerhin ganz einfach ein Riegel vorgeschoben werden.
Das Schloss der Klassenzimmertür klemmte beim Versuch, es zuzuschließen. Am Fuß der Treppe, die zum Speisesaal hinunterführte, lagen Schulranzen. Telmo, die Tasche mit dem Platon und dem Cicero drin fest unter den Arm geklemmt, achtete darauf, über keinen von ihnen zu stolpern, auch wenn er das innige Bedürfnis verspürte, wenigstens einen in hohem Bogen durch die Luft zu schleudern, sodass er scheppernd auf dem Boden aufkäme und die Glasflasche, die sich womöglich darin befand, zerstört würde und alles Wasser oder, noch besser, alle klebrige Limonade sich über die Bücher und Schulhefte ergösse. Aber gerade noch rechtzeitig, bevor er dem Impuls folgte, tat er ihn als billige Ersatzhandlung für den Frust über die Einschränkung seines Fleischverzehrs ab. Beherrschung, Mäßigung! Das war es, worauf es ankam.
Er besann sich darauf, dass das Fleischessen, biblisch gesehen, auch nur ein Ersatz war. Im Garten Eden wuchsen allerhand Bäume mit nahrhaften Früchten. Adam und Eva konnten so viel von ihnen nehmen, wie sie wollten, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ausgenommen. Aber weil sie sich bekanntlich nicht daran hielten, waren die Menschen, kaum erschaffen, bereits dem Verfall anheimgegeben. Und so verkam auch das Land, auf dem sie lebten, mitsamt der Früchte, die sie nährten, weshalb sie schließlich zum Fleisch greifen mussten, es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Doch dann war der Apostel Paulus gekommen und hatte erklärt, man solle weder Fleisch essen noch Wein trinken. Und weil dies geschrieben stand unter der Überschrift ›Starke und Schwache in der Gemeinde‹ war die Fleischabstinenz ja eigentlich auch, wenn nicht sogar vor allem, eine Frage der Glaubensstärke.
Telmo klammerte sich fest an diesen Gedanken, während er den Speisesaal betrat. Der große Raum war schon nicht mehr ganz gefüllt. Erneut keimte Hoffnung in ihm auf; die Hoffnung, einfach kein Fleisch mehr vorzufinden, erlöst zu sein von der Möglichkeit des Sündigenkönnens, und diese Hoffnung verwandelte sich zusehends in Gewissheit, je näher er der Essensausgabe kam. Es konnte doch gar nicht anders sein, als dass die anderen schon alles verzehrt hatten. Und wenn es normalerweise hieß, wer zu spät komme, den bestrafe das Leben, hieß es nun, wer zu spät kommt, der ist der Glückliche, der Glückselige, weil er nicht in Versuchung geführt wurde.
Beschwingt stieg er die Stufen zur Theke hinab. Als er unten ankam, erschrak er.
Auf einem Blech mit Backpapier, dem letzten, das überhaupt noch an der Ausgabe stand, lag, da gab es kein Vertun, neben den Behältern mit Kartoffeln und Fingermöhren, in einer hinteren Ecke, ganz klein und fast schon bemitleidenswert, aber doch ausreichend sichtbar, ein allerletztes Hähnchen-Cordon-bleu.
Er wollte kehrtmachen, die Treppe wieder hinaufgehen, raus aus dem Speisesaal, weg von diesem lasterhaften Ort, diesem Ort der Sünde und der Verführung. Aber da rief es von der Ausgabe her.
»Sie komm’ mir wie gerufen, Pater Schmidt!«
Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach.
Nein, es war nicht die böse Schlange, die da rief. Es war Evelin Mertens, die beste aller herzensguten Küchenfrauen, und was sie in der Hand hielt, war auch nicht die verbotene Frucht, nein, die war es nicht. Es war viel schlimmer noch: sie schwenkte eine lange Zange, silbern glänzend und fettig an den Enden, und mit dem großen Greifer packte sie nun das Cordon bleu und legte es auf einen Teller, dazu Kartoffeln und Fingermöhrchen. Sie versah alles mit einem ordentlichen Schwung Soße und hielt den vollen Teller mit zufriedenem Lächeln in die Höhe.
Telmo schwitzte. Wusste der Teufel im Paradies eigentlich, dass er Böses tat? War der Satan vielleicht der Prototyp desjenigen, der willentlich unwillentlich handelte? Oder handelte er, wie so viele Menschen es taten, die unschuldige Mertens eingeschlossen, in der Überzeugung, Gutes zu tun, das heißt ohne zu wissen, dass er eigentlich Schlechtes tat?
Die Möhren auf dem Teller dampften; aus einer Ecke des Cordon bleu lief geschmolzener Käse.
Telmo begann zu rechnen: Wenn die Vorgabe lautete, binnen zweier Wochen maximal ein Stück Fleisch zu verzehren, musste es doch möglich sein, binnen einer Woche, sozusagen auf Kredit, zwei Stück zu essen, solange in den restlichen drei Wochen auf weiteres Fleisch verzichtet wurde; oder sogar drei Stück in einer Woche für sechs Wochen im Voraus oder vier für acht Wochen und so weiter und so fort, und noch bevor er die Rechnung für die verbleibenden dreizehneinhalb Wochen des Jahres und die zweihundertundacht Wochen der nächsten vier Jahre aufgestellt hatte, griff er zu, setzte sich an den Rektortisch, wo auch die übrigen Lehrkräfte saßen, verspeiste wortlos und hastig sein Essen und wischte sich abschließend das Butterschmalz aus den Mundwinkeln.
Einen Rest davon meinte er, auch jetzt noch schmecken zu können. Eine halbe Stunde war inzwischen vergangen, seit dem verfrüht eingeläuteten Abendbrot.
Die ersten Schülerinnen und Schüler kamen, durch das nordwestliche Fenster seiner Wohnung konnte er es sehen, bereits aus dem Speisesaal zurück. Sie hielten belegte Brote in den Händen. Die stellten nicht etwa ihr Abendbrot dar, sondern den Proviant für die Zeit danach, von der sie glaubten, niemand wisse, wo und wie sie sie zubrächten. Telmo aber wusste es ganz genau. Seit fünfundzwanzig Jahren arbeitete er schon an der Schule, nicht zuletzt war er selbst hier Schüler gewesen, und es war absolut klar, dass sich in den Rucksäcken, die jetzt auf den Rücken das Gelände verließen, keine Vokabelhefte oder Schulbücher befanden, sondern Getränke, womöglich sogar die ein oder andere geklaute Flasche Abendmahlswein, nur dass der jetzt alles andere als eucharistisch konsumiert werden würde. Da konnte er bei der montagmorgendlichen Andacht so viel reden, wie er wollte.
Er trat ans Fenster und sah ihnen nach. Er beneidete sie um ihre Jugendlichkeit. Sie würden jetzt zum Fluss gehen, im letzten Tageslicht, und dort, kaum dass die Dunkelheit hereingebrochen war, vom Wein gelöst das Unaussprechliche tun, das aber zugleich das Offensichtlichste darstellte, wonach es ihren jungen Körpern verlangte.
Telmo zog die Vorhänge zu. Er kannte das Kribbeln, das jetzt in ihm aufstieg. Es besuchte ihn jeden Abend. Es kam ausnahmsweise nicht vom Magen her, eher von den Lenden, war aber eben auch eine fleischliche Begierde, nur immerhin eine, die gesundheitlich unbedenklich schien. Damit war zwar noch nichts über die Christlichkeit – oder vielmehr: die Unchristlichkeit – der Sache gesagt. Doch die Liebe, allem voran die geistige, hatte, da sprachen die einschlägigen Broschüren, die einst im Priesterseminar gelegen hatten und von denen einige hin und wieder auch im Schulhaus auftauchten, eine eindeutige Sprache, allein dem Herrn zu gelten.
Das Verlangen loderte wie ein kleines Flämmchen. Bisher war seine Hitze noch gering. Doch es würde umso größer und heftiger werden, je mehr er sich auf seine Betrachtung konzentrierte, das wusste er aus Erfahrung.
Er begann, ein Vaterunser zu sprechen, brach es aber noch vor dem Geheiligt werde dein Name ab. Wie stand es im Zweiten Buch Mose? Du sollst nicht verlangen! Es war mit diesen Worten so verhext wie mit allen Verneinungen. Je mehr man sich bemühte, etwas nicht zu denken, desto mehr dachte man daran. Oh, wenn da nicht auch wieder der Teufel seine dreckigen Hände im Spiel hatte! Es war ja fast schon anzunehmen, er habe diesen lästigen, lasterhaften Körper geschaffen, diesen Körper mit seinen Nerven- und Blutbahnen, seinen Fettspeichern und Botenstoffen, die im Gewebe ihre Wirkung entfalteten und – war es nicht so? – immer gegen die Vernunft, anstatt für sie arbeiteten. Auch davon redete doch Paulus: vom Gesetz der Vernunft und vom Gesetz der Sünde, welch letzteres sich in den Gliedern befinde. Und warum, bitteschön, sollte der allmächtige Vater so etwas geschaffen haben? Er musste doch gesehen haben, dass es nicht gut war. Folglich konnte er es nicht geschaffen haben, weil er ja, nachdem er alles geschaffen hatte, gesehen hatte, dass es gut war! Die Freiheit des Menschen, seine Fähigkeit, sowohl Gutes als auch Schlechtes zu tun, war ein teuflisches Gottesgeschenk. Zugleich war sie eine notwendige Gabe. Denn machte das nicht den eigentümlichen Charakter des Menschen aus? Sich für oder gegen etwas entscheiden zu können, anstatt nur blindem Instinkt zu folgen, wobei die Vernunft und der Wille, um ihre Freiheit wirklich ausleben zu können, eines Gegenspielers bedurften, den sie im Körper fanden? Ach, wenn es doch so einfach gewesen wäre! Wie oft aber wurde etwas zum Gegenstand eines Willensaktes, das eben der Wille selbst noch kurz zuvor als abstoßend beurteilt hatte?
Telmo hatte nun sämtliche Gardinen zugezogen. Er prüfte jede einzelne von ihnen auf Undurchlässigkeit. Nichts von dem, was nun folgen würde, sollte nach draußen dringen. Er spürte eine kleine Hitze auf seinen Wangen, während er daran dachte.
Er kühlte sich mit einem Glas Wasser in der Küche ab, ging anschließend zurück ins Arbeitszimmer und setzte sich an den Schreibtisch. Die Wände waren von schweren Bücherregalen bedeckt. Er hatte sie samt Inhalt vom Vorgänger übernommen. Dazu den alten Sessel, der in der Ecke stand und den Telmo, weil er sein Gewicht nicht mehr trug, ohne unangenehme Geräusche von sich zu geben, nur noch als Papierablage nutzte. Auf einem Beistelltischchen neben dem Sessel stand eine Messinglampe mit grünem Schirm, die einzige Beleuchtung im Zimmer neben der Arbeitsleuchte, die er beim Einzug hastig vom Hausmeister ausgeliehen, seitdem behalten und eher notdürftig an seinem Schreibtisch befestigt hatte. An der von Regalen freien Wand hing ein Kupferstich des Klosters, das die heutige Schule einst gewesen war. Darüber war mit einem Nagel ein Kruzifix befestigt.
Telmo sprang auf, lief zur Wand und zog ein Staubtüchlein hinter dem Heizkörper hervor. Vorsichtig breitete er es von der Dornenkrone her aus, bis es den Kreuzhängenden ganz bedeckte.
Zurück am Schreibtisch nahm er die Brille ab, hauchte die Gläser an, wischte sie in kreisenden Bewegungen an den Ärmeln seines Jacketts ab, bevor er sich seiner entledigte. Er öffnete den Gürtel mitsamt dem Knopf seiner Hose.
Mit der rechten Hand zog er die Tür des Eichenholzschreibtischs auf. Im oberen Fach standen die Bände dreizehn bis achtzehn der neunzehnten Auflage des Brockhaus, mit Kopfgoldschnitt und schwarzem Rücken. Ihr Leder schien stark zu riechen, aber Telmo wusste, dass nicht sie es waren, die den ledrigen Geruch verströmten. Nein, er kam von weiter hinten, aus dem Allerheiligsten, dem geheimen Tabernakel, verdeckt durch den Buchstabenbereich LAH bis RUS, und während Telmo sich mit den Fingern bis dorthin vorarbeitete, dachte er unwillkürlich an den Abend der ersten Berührung, einen hellen, warmen Sommerabend, wie man ihn sich nur wünschen konnte für einen Abiturball. Die Vorbereitungen der Schülerinnen und Schüler hatten auch dieses Mal schon vor Monaten begonnen; im Grunde begannen sie bereits am Schuljahresanfang, wenn sich ein Festkomitee bildete und eine erste Planungssitzung abhielt. Und auch wenn Telmo all das nur von Ferne mitbekam (durch die Pausengespräche, die zunehmende Geschäftigkeit der Abiturklassen und die wachsende Zahl der den Ball betreffenden Aushänge), regte es doch eine gewisse Vorfreude in ihm an, die sich über die kommenden Monate steigerte, die er aber vor der Schülerschaft und dem Kollegium geheim hielt. Niemand sollte Verdacht schöpfen. Niemand sollte sich darüber wundern, dass er dem Ball mit übertriebener Regung entgegenfieberte.
Am meisten bemühte er sich, die Vorfreude vor derjenigen zu verbergen, die er jedes Jahr zu seiner ›Helena‹ kürte, wie er es nannte (sie hieß in diesem Schuljahr mit bürgerlichem Namen Merle-Sophia Gruber), denn sie war diejenige, auf die am Abend der Abiturentlassfeier alles hinauslief (wenn auch nur auf einen vermeintlich unbedeutenden Teil von ihr). Seine Wahl verkündete Telmo für sich selbst traditionsgemäß in jenem Moment, in dem er die Erwählte im Griechischunterricht die Passage aus der Ilias übersetzen ließ, worin Aphrodite dem jungen Paris zum Dank für die Schenkung des goldenen Apfels die Liebe der schönsten Frau der Welt verspricht, und es war kein Zufall, dass auch Telmos Helena bereits vergeben war (im Fall Merle-Sophia Grubers an Benedikt Renz).