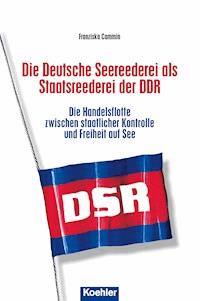
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Koehlers Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Diese Dissertation behandelt die Entwicklung der DSR vom Gründungsjahr 1952 bis zur Privatisierung 1992 unter dem besonderen Augenmerk der Flottenentwicklung in dieser Zeit. Die Entwicklung und Arbeit der DSR (Deutsche Seereederei) war in hohem Maße dem Einfluss verschiedener staatlicher Organe ausgesetzt. Ebenso wurde die Reederei streng überwacht. Diese Vorkommnisse werden in vorliegendem Werk praxisnah und eindrucksvoll geschildert. Es wird aufgezeigt, wie sehr die Entwicklung der DSR von den damaligen politischen Gegebenheiten abhängig war und welches wechselseitige Gefüge entstand. Im November 2014 erhielt die Autorin für ihre Arbeit den Stiftungspreis der Stiftung zur Förderung von Schifffahrts- und Marinegeschichte. +++Achtung bei diesem Titel handelt es sich um eine fixed Layout-Version. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf darüber, ob Ihr Gerät diese Datei öffnen und korrekt darstellen kann.+++
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Franziska Cammin
Die Deutsche Seereederei als Staatsreederei der DDR
Die Handelsflotte zwischen staatlicher Kontrolle und Freiheit auf See
Frau Dr. Franziska Cammin wurde für Ihre Dissertation »Die Deutsche Seereederei als Staatsreederei der DDR« mit dem ersten Preis der Stiftung zur Förderung der Schifffahrts- und Marinegeschichte ausgezeichnet.
Ein Gesamtverzeichnis unserer lieferbaren Titel senden wir Ihnen gerne zu. Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse an: vertrieb@koehler-books.de Sie finden uns auch im Internet unter: www.koehler-books.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-7822-1208-3
eISBN 978-3-7822-1465-0
Koehlers Verlagsgesellschaft
© 2014 by Maximilian Verlag, Hamburg
Ein Unternehmen der Tamm Media
Alle Rechte vorbehalten
Layout und Produktion: Nicole Laka
Für meine Eltern, Birgitt und Wolfgang Grolik.
Für alles.
Vorwort
Ich möchte mich bei vielen Personen für ihre Unterstützung bei der Arbeit an diesem Buch bedanken, hier sollen einige namentlich aufgeführt werden.
Meinen Betreuern Prof. Dr. em. Werner Müller und Prof. Dr. Nikolaus Werz danke ich für ihre Hinweise, ihre Geduld und ihr Vertrauen in meine Arbeit.
Besonders danke ich meinen Zeitzeugen, den Herren Karl-Ernst Eppler, Thomas Dabelstein, Wolfgang Grolik, Werner Molle und Heinz Werner, für ihre Offenheit und Unterstützung sowie den Einblick in ihre privaten Unterlagen und Bilder.
Den Mitarbeitern des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde und des angeschlossenen SAPMO, der BStU-Standorte Berlin und Rostock, des Landesarchivs Greifswald und des DSR-Archivs Rostock danke ich für ihre Geduld, die zahlreichen Hinweise auf Archivalien und die Unterstützung. Dem Leiter des Kulturhistorischen Museums Rostock, Dr. Steffen Stuth, danke ich für die zahlreichen Fotos.
Dank auch an Marion Grödel für die zahlreichen Gespräche, ebenso Katharina Knebel für ihre unschätzbare Hilfe und Prof. Dr. Heidrun Budde für ihre Materialien und ihre Hinweise.
Der meiste Dank gebührt meinem Mann Ronny Cammin für seinen uneingeschränkten Beistand bei Problemen und Erfolgen, für seine Rücksicht und seinen unerschütterlichen Glauben an mich. Er und meine Familie haben es mir überhaupt ermöglicht, meine Forschung zu betreiben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Entwicklung der Staatsreederei
2.1 Die DSR – Vom Kriegsende bis zum Mauerbau
2.1.1 Der lange Weg zur Gründung
2.1.2 Die Gründung – Probleme, Pläne und Durchführung
2.1.3 1952 bis 1961 – Das erste Jahrzehnt der neuen Reederei
2.2 Die DSR als Universalreederei bis 1970
2.2.1 Der Mauerbau
2.2.2 Entwicklung zur Universalreederei
2.3 Die Trennung der Reedereien DSR und Deutfracht 1970
2.4 Die DSR als Stammbetrieb des Kombinates Seeverkehr und Hafenwirtschaft
2.4.1 Direktor oder Generaldirektor? Frage um den Titel des Leiters der DSR
2.4.2 Die 1980er Jahre
2.5 Das Ende der Staatsreederei – Die DSR nach 1989
2.5.1 Neue Freiheiten für die Seeleute der DSR
2.5.2 Die Treuhandverwaltung und die Privatisierung
3. In internationalen Gewässern – Liniendienste und Konferenzen
3.1 Liniendienste und Schifffahrtskonferenzen der DSR
3.2 Liniendienste
3.3 Schifffahrtskonferenzen
4. Die Partei fährt immer mit – Parteiarbeit auf See und an Land
4.1 Entwicklung der Parteiarbeit in der DSR
4.2 Die Politische Abteilung der Handelsflotte bei der Direktion Seeverkehr und Hafenwirtschaft
4.3 Die Industriekreisleitung Seeverkehr und Hafenwirtschaft
4.4 Das Parteilehrjahr
4.5 Der Politoffizier
4.6 Informationsgewinnung und Parteiinformation
4.7 Die Arbeit der Massenorganisationen in der DSR
5. Das Kaderproblem – Arbeitskräftemangel und Ausbildung
5.1 Die Matrosenlehrlingsausbildung
5.2 Frauen auf See
5.3 Weiterbildung und Umschulung
5.4 Komplexbrigaden und Sondergenehmigungen
5.5 Einschätzung der Mitarbeiter
5.6 Fluktuation und Anreiz
5.7 Der Umschwung
6. Die wirtschaftlichen Aufgaben der DSR
6.1 Die Transportaufgabe
6.2 Die Gewinn- und Devisenfunktion der Handelsflotte
6.3 Über Westdeutschland nach Panama in die DDR zurück – Schiffsverkäufe als Möglichkeit, Devisen zu erwirtschaften
6.4 Die Containerisierung in der Handelsflotte der DDR
6.4.1 Überblick über die internationale Entwicklung der Containerschifffahrt
6.4.2 Die Einführung der Containertechnologie in der DDR-Handelsflotte
6.4.3 Die DSR-Containerlinien
6.5 Die Konsumgüterproduktion
6.5.1 Die 1970er Jahre
6.5.2 Die Suche nach einem Fertigungsort
6.5.3 Das Sortiment
6.5.4 Die 1980er Jahre
7. Der soziale und kulturelle Auftrag der Reederei
7.1 Freizeit an Bord
7.1.1 Sport an Bord
7.1.2 Feste und Bordabende
7.2 Sicherheit an Bord und im Hafen
7.3 Die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten der Reederei an Land
8. Republikflucht und Vaterlandsverrat – Überwachung der Hochseeschifffahrt durch das Ministerium für Staatssicherheit
8.1 Die Abteilung Hafen des Ministeriums für Staatssicherheit
8.2 Ungesetzliches Verlassen der DDR durch DSR-Seeleute
8.2.1 Fälle von ungesetzlichem Verlassen vor 1961
8.2.2 Die Entwicklung der Republikfluchten von 1961 bis 1989
8.2.3 Prominente Beispiele
8.2.4 Landgang als Risiko
8.2.5 Der Nord-Ostsee-Kanal
8.2.6 Rettung von Personen in Seenot – auch gegen ihren Willen
8.3 DSR-Angehörige im Visier der Geheimdienste
8.3.1 Doppelagenten auf See
8.3.2 Republikflüchtlinge und Rückkehrer
8.4 Seefahrtsbücher und Sichtvermerke
8.4.1 Die Aktion »Leuchtturm« und die »Wer ist wer?«-Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit
8.4.2 Entscheidungen über Zulassungen und Ablehnungen
8.4.3 Die Kontroll- und Beratungsgruppe des Generaldirektors
8.4.4 Der Entzug der Sichtvermerke
8.4.5 Die Protokolle der Kontroll- und Beratungsgruppe
8.5 INMARSAT – Ein internationales Schiffssatellitensystem in den Plänen des Ministeriums für Staatssicherheit
8.6 Überwachte Transporte und geheime Ladungen
8.6.1 Waffen- und Munitionslieferungen als Sondertransporte im Auftrag der Ministerien
8.6.2 Probleme bei Sondertransporten
8.6.3 Geheimhaltung und Absicherung
8.6.4 Der letzte Waffentransport der DSR
8.7 Mitarbeiter des MfS in der Handelsflotte
8.7.1 Werbung und Aufgaben von IM in der DSR
8.7.2 Hauptberufliche Mitarbeiter des MfS in der Handelsflotte
8.7.3 Der Einfluss der IM – Ein Direktor unter Verdacht
9. Zusammenfassung
Anhang
Tabelle 42: Entwicklung des Schiffsbestandes der Handelsflotte von 1952 bis 1989
Tabelle 43: Zahlenmäßige Entwicklung der Beschäftigten der DSR (Personal)
Tabelle 44: Zahlenmäßige Entwicklung der Beschäftigten der Deutfracht
Tabelle 45: Sortiment der Konsumgüterproduktion von 1982 bis 1985
Tabelle 46: Sortiment der Konsumgüterproduktion der DSR und Angabe von geplanten Mengen und Erlösen von 1985 bis 1990
Tabelle 47: Übersicht über die Protokolle der Kontroll- und Beratungsgruppe des Generaldirektors von 1974 bis 1989
Abbildungen: Sichtvermerk, Antrag auf Ausstellung eines Seefahrtsbuches
Gehalt- und Heuertabellen
Tabelle 48: Übersicht der Schiffszuführungen
Abkürzungsverzeichnis
°C Grad Celsius
ACTS Alfred-C.-Toepfer-Schiffsgesellschaft
AHB Außenhandelsbetrieb
AWG Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft
BDVP Bezirksdirektion der Volkspolizei
BfV Bundesamt für Verfassungsschutz
BND Bundesnachrichtendienst
BRD Bundesrepublik Deutschland
BRT Bruttoregistertonnen
BV Bezirksverwaltung
c & f cost and insurance
CIA Central Intelligence Agency
cif cost, insurance, freight
cm Zentimeter
CSSR Tschechoslowakische Sozialistische Republik
COS Czechoslowak Ocean Shipping Prag
D. Dampfer
DDR Deutsche Demokratische Republik
DM Deutsche Mark
DSF Deutsch-Sowjetische Freundschaft
DSH Direktion Seeverkehr und Hafenwirtschaft
DSR Deutsche Seereederei Rostock/Deutfracht Seereederei Rostock
DSU Deutsche Schiffahrts- und Umschlagszentrale
EACON Euro-Asia Container Service
EMA Europe-Middle-East-Asia-Service
ENM Empresa de Navegación Mambisa Havanna
ESC Estonian Shipping Company Tallin
FDGB Freier Deutscher Gewerkschaftsbund
FDJ Freie Deutsche Jugend
fob free on bord
FPG Fischereiproduktionsgenossenschaft der See- und Küstenfischer
Genex Geschenkedienst und Kleinexporte
GdK Gehilfe des Kapitäns
GDR German Democratic Republic
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMS Gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit
GO Grundorganisation
GST Gesellschaft für Sport und Technik
HV Hauptverwaltung
IHS Ingenieurtechnische Hochschule
IKL Industriekreisleitung
IM Inoffizieller Mitarbeiter
IMCO Zwischenstaatliche Beratende Seeschifffahrtsorganisation
IME Inoffizieller Mitarbeiter im besonderen Einsatz
IMF Inoffizieller Mitarbeiter der Abwehr mit Feindverbindung zum Operationsgebiet
IMS Inoffizieller Mitarbeiter zur politisch-operativen Durchdringung und Sicherung des Verantwortungsbereiches
ITA Ingenieurtechnischer Außenhandel
ITU Internationaler Fernmeldeverein
KAP Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion
KBG Kontroll- und Beratungsgruppe
KGP Konsumgüterproduktion
KSH Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft
Kümo Küstenmotorschiff
LKW Lastkraftwagen
LPG Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
MAW Ministerium für Außenwirtschaft
MBO Management-Buy-out
MdF Ministerium der Finanzen
MfS Ministerium für Staatssicherheit
MfAA Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
MfV Ministerium für Verkehrswesen
MS Motorschiff
NCHP Navale et Commerciale Havraise Peninsulaire
NOK Nord-Ostsee-Kanal
NSW Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet
NVA Nationale Volksarmee
OV Operativer Vorgang
PDS Partei des Demokratischen Sozialismus
POL Polish Ocean Lines
POS Polytechnische Oberschule
PS Pferdestärke
PZM Polish Steamship Co. Szczecin
RF Republikflucht
RGW Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
RIKO Richtungskoeffizient
Ro/Ro Roll-on, Roll-off
RTW Round-the-World-Service
SBZ Sowjetische Besatzungszone
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SFB Seefahrtsbuch
SHR Seehafen Rostock
SPW Schützenpanzerwagen
SV Sichtvermerk
SW Sozialistisches Wirtschaftsgebiet
SWA Sowjetskaja Wojenneja Administrazija, Sowjetische Militäradministration
t Tonnen
tdw tons dead weight
TEU Twenty-foot Equivalent Unit
THA Treuhandanstalt
tkm Tonnen-Kilometer
Tricon Tricontinental-Service
tsm Tonnen-Seemeilen
UdSSR Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
UG Ungesetzlicher Grenzübertritt
UKW Ultrakurzwelle
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNO United Nations Organisation
USA United States of America
UV Ungesetzliches Verlassen
UWAS United Westafrica Service
VE Volkseigene/r/s
VEB Volkseigener Betrieb
VGW Valutagegenwert
VM Valutamark
VR Volksrepublik
VVS Vertrauliche Verschlusssache
ZK Zentralkomitee
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Selbstkostenstruktur von 1952 bis 1956 in 1.000 Mark
Tabelle 2: Entwicklung der Leistung bis 1956
Tabelle 3: Entwicklung der Kapazität bis 1957
Tabelle 4: Wichtige Kennziffern von 1952 bis 1961
Tabelle 5: Beförderte Gütermenge (in t) der DSR-Tankschiffe von 1961 bis 1968
Tabelle 6: Beförderte Gütermengen (in t) der Bulkcarrier-Schiffe der DSR von 1962 bis 1968
Tabelle 7: Reedereiuntypische Bereiche und deren Beschäftigte 1989
Tabelle 8: Entwicklung der Gütertransporte der DSR von 1989 bis 1993
Tabelle 9: Entwicklung der Personalzahlen vom 31.12.1989 bis zum 01.01.1993
Tabelle 10: Übersicht über Flottenentwicklung von 1960 bis 1992
Tabelle 11: Entwicklung der Transporte mit Liniendiensten der DSR von 1956 bis 1960
Tabelle 12: Liniendienste der DSR von 1955 bis 1989
Tabelle 13: Transportierte Mengen im Ostafrikadienst 1965 bis 1967 in Tonnen
Tabelle 14: Struktur und Stellenplan der IKL der SED Seeverkehr und Hafenwirtschaft93
Tabelle 15: Entwicklung der Zahl der Politoffiziere 1977 bis 1989
Tabelle 16: Entwicklung der Anzahl der Patentträger in der DSR
Tabelle 17: Besetzungspläne für die Schiffe der DSR
Tabelle 18: Anzahl der weiblichen Besatzungsmitglieder der Handelsflotte der DDR
Tabelle 19: Vorhandene gültige Sondergenehmigungen per 01.01.1971
Tabelle 20: Durchschnittsbruttoarbeitseinkommen verschiedener Wirtschaftsbereiche in der DDR von 1955 bis 1989 in Mark
Tabelle 21: Übersicht über Bordzulagen
Tabelle 22: Valutahandgelder der DDR, VR Polen und CSSR gültig 1984 in Valutamark
Tabelle 23: Abdeckungsgrad des seewärtigen Transportbedarfes des DDR-Außenhandels von 1980 bis Ende des 1. Halbjahres 1988 in Prozent
Tabelle 24: Gütertransportmenge der Seeschifffahrt nach Gutarten von 1958 bis 1989 (in 1.000 Tonnen)
Tabelle 25: Tonnageproduktivität der Welthandelsflotte und der DSR von 1970 bis 1989
Tabelle 26: Devisenbilanz von 1953 bis 1956 in Rubel
Tabelle 27: Entwicklung des Gütertransportes von 1960 bis 1966 in Tonnen
Tabelle 28: Valutaeinnahmen und -ausgaben von 1960 bis 1966
Tabelle 29: Valutabilanz NSW in Mio. VM von 1974 bis 1983
Tabelle 30: Ausgaben für die Charterung von BRD-Schiffen von 1968 bis 1973
Tabelle 31: Valutaverluste bei Nichtvorhandensein einer DDR-Handelsflotte
Tabelle 32: Valutakennzahlen von 1980 bis 31.06.1988
Tabelle 33: Darstellung des Valutasaldos pro Schiff und Jahr bei Einsatz von Schiffen des Typs »Äquator«
Tabelle 34: Einrichtung von Containerlinienschifffahrt
Tabelle 35: Planzahlen der Konsumgüterproduktion an das Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft
Tabelle 36: Übersicht über Anzahl der Mahnungen verschiedener Dienststellen 1970
Tabelle 37: Mahnungen im Jahr 1970 an Diensteinheiten der Bezirksverwaltung Rostock
Tabelle 38: Entzug des Seefahrtsbuches und Streichung des Sichtvermerkes durch KBG-Beschluss
Tabelle 39: Statistische Übersicht über die Bearbeitung von Anträgen auf ein Seefahrtsbuch von 1977 bis 1988
Tabelle 40: Übersicht über die Entscheidungen der Kontroll- und Beratungsgruppe des Generaldirektors von 1974 bis 1989
Tabelle 41: Finanzielles Ergebnis aus der Mitgliedschaft zur INMARSAT in 1.000 US-Dollar
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Aufbau der Leitungsstruktur und Unterstellungsverhältnisse der Seeverkehrswirtschaft
Abbildung 2: Strukturplan für Reederei vom 03.07.1951
Abbildung 3: Strukturplan für den volkseigenen Betrieb Seeschiffahrt mit dem Sitz in Rostock 1952
Abbildung 4: Haus der Schiffahrt in der Langen Straße, Rostock
Abbildung 5: Lokale Leitungsebenen der Seeverkehrswirtschaft
Abbildung 6: Trennung von Stammbetrieb und Kombinatsbetrieben
Abbildung 7: Entladearbeiten an MS Thomas Müntzer im Überseehafen Rostock
Abbildung 8: Matrosenlehrlinge der DSR bei der Zuckerrohrernte in La Habana, Kuba
Diagramm 1: Entwicklung der Arbeitskräftezahlen von 1952 bis 1992
Abbildung 9: Übersicht über Seemannsknoten, angefertigt von Matrosenlehrlingen des Lehrjahres 1988/89
Abbildung 10: Vollmatrosenlehrlinge auf MS BÜCHNER 1973, Klasse VM6
Abbildung 11: MS HALBERSTADT, Typ IV, im Rostocker Überseehafen 1961
Abbildung 12: Bewertungsbogen zur Einschätzung der Mitarbeiter
Abbildung 13: Basarberechtigungsschein im Wert von 0,10 VM
Abbildung 14: MS PASEWALK, Typ Neptun 421
Abbildung 15: Volleyballspiel in Ladeluke, Ersatzspieler auf der »Bank«
Abbildung 16: Wimpel »Sport an Bord«
Abbildung 17: Fasching auf MS BLANKENBURG 11.11.1989
Abbildung 18: Äquatortaufe MS SCHWERIN 1975, Neptun und Gefolge
Abbildung 19: Täufling bei Äquatortaufe, MS SCHWERIN 1975
Abbildung 20: Strukturvorschlag Abt. Hafen
Abbildung 21: Hierarchie des Seeverkehrs und zuständige Abteilungen des MfS
Diagramm 2: Übersicht über die u.V.-Vorfälle in der DSR von 1956 bis zum ersten Halbjahr 1989
Abbildung 22: MS HEINRICH HEINE im Rostocker Überseehafen, Winter 1963
Abbildung 23: Beispiel eines Seefahrtsbuches mit Sichtvermerk (gekürzt)
Abbildung 24: MS SCHWERIN im Überseehafen Rostock, 1960
1.Einleitung
Im Rostocker Stadthafen lag bis zum 27. Mai 2013 ein Schiff, das als Ausbildungsschiff der DSR zahlreichen Lehrlingen Unterkunft geboten hatte und nach 1991 an die Stadt Rostock verkauft wurde, um ab 2003 als eine schwimmende Jugendherberge im Stadthafen zu dienen: das MS GEORG BÜCHNER. Der Verein, der sich seitdem der Wartung und dem Erhalt der GEORG BÜCHNER. widmete, konnte sich Ende 2012 jedoch die hohen Sanierungskosten nicht mehr leisten. Bereits im Januar 2013 sollte das Schiff zur Verschrottung nach Litauen verbracht werden.1 Eine Meldung in der Zeitung beziehungsweise im Rundfunk schien eine Ära zu beenden und einen Teil der maritimen Geschichte der Stadt Rostock, der 60 Jahre zurückreicht.
Dabei hatte dieser Teil 1952 noch recht unscheinbar begonnen, lediglich zwei Schiffe konnte die neu gegründete »Deutsche Seereederei Rostock« ihr Eigen nennen. Die Entwicklung zur Universalreederei mit zeitweise 200 Schiffen verlief mühsam über viele Jahre, die in erster Linie durch Mangel gekennzeichnet waren, wie so oft in der DDR. Der Mangel an notwendigen Schiffen und Ersatzteilen, an Besatzungsmitgliedern und vor allem Mangel an Eigenständigkeit erschwerte zwar den Flottenausbau, dennoch konnte sich die Deutsche Seereederei Rostock über Jahrzehnte einen guten Ruf als zuverlässiger Geschäftspartner auf dem Weltmarkt erarbeiten. Dies verdankte sie nicht zuletzt den engagierten Mitarbeitern, die sich teilweise heute noch eng mit »ihrer« Reederei verbunden fühlen.
In der Innenstadt Rostocks hatte die Reederei ihre Spuren hinterlassen, sei es durch das Seemannshotel »Sonne«, das »Haus der Schiffahrt« in der Langen Straße, den Internationalen Klub der Seeleute in der Östlichen Altstadt oder eben im Stadthafen. Doch 60 Jahre nach der Reedereigründung verschwinden diese Spuren immer mehr oder werden verwischt: Immobilien haben den Eigentümer und den Namen gewechselt, der Klub der Seeleute stand jahrelang leer und nun musste der Stadthafen eine Attraktion einbüßen, die besonders den ehemaligen DSR-Seeleuten am Herzen liegt.
Nach einem empörten Aufschrei aus der Bevölkerung wurden die Verkaufs- und Verschrottungspläne des Rostocker Fördervereins Traditionsschiff jedoch eingehend geprüft. Eine Expertenkommission bescheinigte dem Frachtschiff aus der Werft Cockerill Hoboken in Belgien Denkmalwert.2 Besonders die Hauptmaschine war nach der Meinung von Sachkundigen erhaltenswert. Dennoch wurde der Denkmalschutz Ende Mai 2013 aufgehoben, die Stadt Rostock gab das Schiff zur Verschrottung frei. Ein anonymer Käufer ließ die GEORG BÜCHNER am 27. Mai in Richtung Klaipeda schleppen, um dort die Verschrottung einzuleiten. Dort allerdings wird das Schiff vorerst nicht ankommen, denn die GEORG BÜCHNER sank unter noch ungeklärten Umständen auf der Höhe von Danzig in der Ostsee.
Der Umgang mit diesem Stück maritimen Kulturguts der Rostocker Geschichte scheint symptomatisch. Von einigen als Schandfleck im Stadthafen gesehen, von anderen als erhaltenswürdig und einmalig gepriesen, stellte die GEORG BÜCHNER mehr dar als nur ihren Materialwert. Leider wurde sie aber vorrangig an diesem gemessen – ähnlich wie ihr ehemaliger Eigner, die DDR-Staatsreederei DSR. Auch das Vorgehen im Fall der GEORG BÜCHNER zeigt Parallelen zu dem Umgang mit der DSR auf. Intransparente Entscheidungen, ein hoher zeitlicher Druck und viele offen gebliebene Fragen prägen sowohl das Ende des Schiffes als auch das Ende der DSR.
Fragestellung und zeitliche Einordnung
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Deutschen Seereederei Rostock3 als Staatsreederei der DDR von der Gründung 1952 bis zur Privatisierung 1993.
Eine Untersuchung, die einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren abdeckt, kann nur schwer auf eine einzelne Fragestellung hin geführt werden. Das primäre Ziel ist es, die Deutsche Seereederei Rostock im Spannungsfeld von politisch-ideologischen Anforderungen einerseits und den Erfordernissen des Weltmarktes andererseits darzustellen. Dazu mussten die Aufgaben und Funktionen der Staatsreederei der DDR ermittelt und die Entwicklung von Flotte und Verwaltung im Hinblick auf die Probleme beim internationalen Einsatz aufgezeigt werden. Die Flottenvergrößerung – nicht nach Bedarf, sondern nach Plan – und der Aufbau der landseitigen Einrichtungen, die die fehlende Dienstleistungsinfrastruktur der DDR ausgleichen mussten, sind nur zwei Beispiele für die Einschränkungen aufgrund der Vorgaben der Zentralen Plankommission.
Anhand einer chronologischen, zumeist auf die strukturelle Entwicklung der Reederei ausgerichteten Darstellung von 1952 bis 1993 werden sowohl der Flottenausbau als auch die Transportleistung beleuchtet. In fünf zeitlichen Abschnitten, die sich durch politische Umstände oder strukturelle Veränderungen in der Reederei ergeben, wird die Entwicklung der DSR aufgezeigt. Es handelt sich um die Zeiträume Gründung bis zum Mauerbau, Mauerbau bis zur Ausgliederung der Deutfracht 1970, der Zeitraum von 1970 bis zur Kombinatsbildung 1974 und die folgende Zeit bis zur Privatisierung.
Mit der Wiedervereinigung endete auch das Dasein der DSR als Staatsreederei, nur die Treuhandverwaltung und der Verkauf der Reederei werden über diesen Zeitpunkt hinaus noch dargestellt. Die Jahre nach der Privatisierung werden lediglich kurz umrissen; dieser kurze Ausblick auf die weitere Entwicklung der DSR GmbH rundet die chronologische Aufarbeitung ab.
Die Darstellung der Entwicklung bildet die Grundlage für die weitere Untersuchung, die sich mit drei thematischen Schwerpunkten beschäftigt. Zum einen wird die wirtschaftliche Aufgabe der DSR anhand ausgewählter Beispiele dargelegt. Eine systematische Aufarbeitung ist aufgrund fehlender Quellen nicht möglich4, dennoch wird die wirtschaftliche Bedeutung der Reederei für die Volkswirtschaft der DDR erläutert und anhand von Beispielen verdeutlicht. Hierbei steht die devisenwirtschaftliche Funktion im Mittelpunkt, war sie doch auf der einen Seite für den Staatshaushalt der DDR von Interesse, auf der anderen Seite ein Zeichen für die Sonderstellung der DSR, da das Erwirtschaften von Devisen zumeist den Außenhandelsbetrieben vorbehalten war. Die zu diesem Zweck notwendigen technischen Anpassungsmaßnahmen an die Erfordernisse des Weltmarktes und die damit verbundenen Schwierigkeiten werden anhand der Containertechnologie erläutert. Die späte und oft unzureichende Umsetzung der neuen Technologie ist symptomatisch für den Umgang der Politik mit der Reederei. Forderungen nach Gewinnen – am besten in frei konvertierbaren Währungen – wurden ohne Zugeständnisse an Fortschritt oder Umsetzbarkeit gestellt. Neben der besonders hervorgehobenen Aufgabe der Devisenerwirtschaftung steht auch die Produktion von Konsumgütern ab 1971 zur Befriedigung der Konsumwünsche der DDR-Bürger und als Exportartikel sowohl als Beispiel für den starken staatlichen Einfluss als auch für die wirtschaftliche Bedeutung der DSR für die DDR.
Der Einfluss der politischen Abteilung der Reederei und später der Industriekreisleitung für Seeverkehr und Hafenwirtschaft auf den täglichen Arbeitsablauf wird besonders in Hinblick auf die Umsetzung der politisch-ideologischen Erziehung der Werktätigen in der Flotte untersucht. Als besonderer Vertreter der politischen Abteilung steht hierbei der Gehilfe des Kapitäns beziehungsweise der Politoffizier im Vordergrund. Die Aufgaben des Politoffiziers bestanden in erster Linie darin, die Stimmung an Bord zu beobachten und zu bewerten sowie die politische Abteilung bei ungewöhnlichen Ereignissen zu informieren, vor allem bei solchen, die von der gewünschten Darstellung der DDR im Ausland und der Festigkeit des Klassenstandpunktes der Besatzungsmitglieder und Passagiere abwichen. Die Anleitung und Unterstützung von Grundorganisationen an Bord sowie der nicht in den Massenorganisationen vertretenen Besatzungsmitglieder lagen hier zumeist nicht in den Händen von seemännisch erfahrenen, sondern vielmehr politisch geschulten Mitarbeitern.
Die Zusammenarbeit der politischen Leiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit stellt nicht nur den quantitativ umfangreichsten Themenschwerpunkt dar, sondern auch den mit dem größten Bedarf an Aufarbeitung. Nicht nur die Einschätzung und Überwachung der im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzten Mitarbeiter der Reederei ist hier von Interesse, auch auf andere Einflussnahmen durch das MfS, zum Beispiel bei der Überwachung von Transporten von militärischen Gütern, wird anhand von Einzelfalldarstellungen eingegangen. Hier fehlt ebenso eine systematische Aufarbeitung, die durch den Mangel an aussagekräftigen Quellenfunden bedingt ist. Zwar ist die Fülle der vorhandenen Materialien beeindruckend, dennoch handelt es sich oftmals um an einzelne Personen oder Vorfälle gebundene Akten. Diese ermöglichen trotzdem eindrucksvolle Einblicke in die Arbeit des MfS im Bereich der Seeverkehrswirtschaft, wenn auch keine durchgehenden Aussagen zu eingesetzten hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern oder der Anzahl von Einsätzen zur Sicherung von Sondertransporten enthalten sind.
Forschungsstand
Bislang sind kaum wissenschaftliche Schriften zu den Aufgaben der DDR-Handelsflotte und deren Erfüllung erschienen. Die Literatur aus DDR-Zeiten ist von ideologischen Darstellungen geprägt und nur bedingt zur wissenschaftlichen Untersuchung des Zeitraumes von 1952 bis 1990 geeignet. Besonders der Mangel an absoluten Zahlen, vor allem für wirtschaftliche Themengebiete, ist unübersehbar. Zumeist werden Vergleiche von Jahresergebnissen in Prozentzahlen ohne Nennung von tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen vorgenommen.
Die oftmals stark subjektiv eingefärbten Publikationen ehemaliger DSR-Mitarbeiter, die im Rahmen der noch heute aktiv durchgeführten Seemannstreffen5 erscheinen, können lediglich als Einblicke in die Stimmung und den Alltag an Bord bezeichnet werden. Nur selten ernste Themen betreffend, zeigen diese Sammlungen von Erinnerungen und Anekdoten doch deutlich das Interesse an der DSR, das nicht nur bei ehemaligen Mitarbeitern besteht. Die Geschichte der DDR-Schifffahrt findet auch in den Medien verstärkt Beachtung, nicht nur gedruckt in Buchform, sondern vor allem in Fernsehdokumentationen.6
Für die Phase der Umstrukturierung und Privatisierung liegen mehrere Darstellungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten vor; daher wird dieser Aspekt stärker auf Literatur als auf Quellenfunden aufgebaut.7 Vor allem die Beiträge des ehemaligen Geschäftsführers zwischen 1990 und 1993, Harry Wenzel8, sind sowohl von fachlicher Kenntnis als auch von persönlichem Einblick in die Geschehnisse der Umstrukturierungsphase geprägt. Gleiches gilt für den mittlerweile sehr gut erschlossenen Zweig der Passagierschifffahrt der DSR. Neben den Aufarbeitungen durch einen ehemaligen Kapitän der DSR, Gerd Peters, wurde dieses Themengebiet auch wissenschaftlich umfassend und mit reicher Quellengrundlage durch Andreas Stirn behandelt.9 Auch Heidrun Budde widmete sich in ihrer Betrachtung der DDR als Staat willkürlicher Maßnahmen mit einem Kapitel den »sozialistischen Traumschiffen«.10 Eine gesonderte Darstellung dieses Zweiges erfolgt deshalb nicht, vielmehr wird an entsprechender Stelle in der Arbeit auf die Entwicklung des Kreuzfahrtgeschäftes der DSR hingewiesen.
Die Fährverbindungen über die Ostsee sowie von Mukran nach Klaipeda wurden bereits auf den Einfluss der Staatssicherheit hin untersucht; eine weitergehende Beschäftigung mit diesem Aspekt wird zugunsten unbearbeiteter Themenschwerpunkte unterlassen.11 Der Fährhafen Mukran stellte zwar ein Prestigeobjekt der DDR-Verkehrsplanung dar, unterlag aber kaum dem direkten Zugriff der DSR. Vielmehr übernahm die DSR die Kosten für den Bau und die Unterhaltung, nachdem der Fährhafen aus der Trägerschaft des Ministeriums für Verkehrswesen in die Verantwortung der DSR überging. Bis dahin waren allerdings schon die meisten relevanten Entscheidungen getroffen worden.
Die Vergabe und der Entzug von Seefahrtsbüchern wurde bereits von Heidrun Budde thematisiert; hier aber lag der Schwerpunkt eher bei exemplarischen Darstellungen zur Untermauerung der zentralen These, die DDR sei ein von Willkür gekennzeichneter Staat gewesen. Ungeschönt und mit zahlreichen Auszügen aus den originalen Protokollen wird hier der Einfluss der politischen Vorgaben auf die Berufsentwicklung von Lehrlingen, Besatzungsmitgliedern und Patentträgern aufgezeigt. Auch die Probleme bei Anträgen auf Genehmigung einer Mitreise von Ehefrauen und den Einsatz von inoffiziellen Mitarbeitern des MfS in der DSR stellt Budde dar, aber immer als Einzelfall betrachtet, nicht systematisch und umfassend für die gesamte Reederei aufbereitet. Daher konzentriert sich das entsprechende Kapitel dieser Arbeit in erster Linie auf die systematische Darstellung der Prozesse, die zu einem Entzug des Sichtvermerkes oder des Seefahrtsbuches führten. Dies beinhaltet auch eine detaillierte Aufstellung der Sitzungsprotokolle der Kontroll- und Beratungsgruppe des Generaldirektors der DSR, in denen die Entscheidungen gegen oder zugunsten eines weiteren seeseitigen Einsatzes der Seeleute der DDR-Handelsflotte diskutiert wurden. Einzelfalldarstellungen erfolgen zumeist überblicksartig, in wenigen Fällen auch ausführlich, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Übertragbarkeit.
Als gelungenes Beispiel einer umfassenden Darstellung sei Siegfried Köhlers Aufarbeitung seines eigenen Falles des Seefahrtsbuchentzugs durch das MfS genannt, ausführlich mit den Quellen der BStU rekonstruiert und eindrucksvoll geschildert.12
Quellenstand
Die Quellenlage ist weitaus komplizierter als die recht überschaubare Literaturlage. Ein Großteil der Reedereiunterlagen ist im Landesarchiv Greifswald zu finden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Akten aus dem Zeitraum von 1952 bis 1974 und die Protokolle der Kontroll- und Beratungsgruppe des Generaldirektors, die Entscheidungen über die Vergabe und den Entzug von Seefahrtsbüchern und Sichtvermerken enthalten. Die Unterlagen zur SED-Industriekreisleitung Seeverkehr und Hafenwirtschaft seit der Gründung 1974 bis zur Auflösung 1990 befinden sich ebenfalls in Greifswald. Diese sind besonders als Ergänzung zur Verdeutlichung des Spannungsfeldes von politisch-ideologischen Entscheidungen und deren Umsetzung in der Reederei geeignet.
Die Akten des Kombinates Seeverkehr und Hafenwirtschaft, in das die DSR 1974 integriert wurde, liegen im DSR-Archiv Rostock. Hierbei handelt es sich um das Firmenarchiv, nicht um eine öffentliche Einrichtung. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Arbeit mit den dort lagernden Akten. Neben dem stark eingeschränkten Zugang zum Archiv, der höchstens einmal wöchentlich möglich ist, existiert auch keine Übersicht über die Akten, sodass es nur ungenaue Angaben über den Bestand und dessen Umfang gibt. Auch fehlen eindeutige Signaturen, was den Nachweis der ermittelten Informationen erschwert.
Der Bestand des Bundesarchives Berlin zeigte sich als nicht so umfangreich, wie zu Beginn der Recherche erhofft. Auch hier wird die Zäsur durch die Kombinatsbildung 1974 deutlich. Trotzdem konnten die Bestände das Bild der Untersuchung erweitern, vor allem durch die von staatlichen Stellen stammenden Anweisungen und Beschlüsse.
Die Materialien der BStU sind sowohl umfangreich als auch gut erschlossen. Da die Arbeit besonderen Wert auf systematische Aufarbeitung, weniger auf Einzelbeispiele legt, konnte ein Großteil der Akten, die sich lediglich mit einzelnen Vorfällen, zum Beispiel Republikfluchten, beschäftigen, aus der Untersuchung weitestgehend ausgeschlossen werden. Das besonders im Fokus stehende Themengebiet »Überwachung durch das MfS« konnte durch die Vielzahl an Akten gut und mit verschiedenen Schwerpunkten erarbeitet werden.
Als problematisch hat sich die starke Verflechtung der DSR mit anderen Betrieben der Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft herausgestellt, so unter anderem der enge Zusammenhang von Flottenausbau und Errichtung des Rostocker Überseehafens oder die Verbindungen zum Schiffbau. Diese wurden weitestgehend außen vor gelassen und lediglich dann berücksichtigt, wenn die Auswirkungen der Zusammengehörigkeit für die DSR von Bedeutung waren. Dennoch nahmen Informationen zu diesen benachbarten Betrieben einen vergleichsweise großen Teil der Quellen ein. In den 1960er Jahren dominierte der Bau des Überseehafens auch die reedereiinterne Berichterstattung, in den 1980er Jahren dann der Bau des Fährhafens Mukran. Da zu diesem Zeitpunkt die DSR bereits Stammbetrieb des Kombinates Seeverkehr und Hafenwirtschaft war, ist diese Verflechtung verständlich, wenn auch der thematische Fokus in dieser Zeit die Recherche zu den eigentlichen Schifffahrtsaktivitäten erschwert. Die Fixierung der Presse, allen voran der Betriebszeitung, auf den Bau des Überseehafens, der zwar der DSR zugutekommen sollte, aber faktisch kein Bestandteil der Reederei wurde, ist weniger logisch, vor allem weil zu dieser Zeit die Entwicklung der Reederei selbst genügend Berichtenswertes aufweist.
Auch die Informationen zum Schiffbau, der zu keiner Zeit verwaltungstechnisch der Reederei angebunden war, nehmen viel Raum in den Quellen ein, können aber zur Darstellung der eigentlichen Reedereientwicklung nur wenig beitragen – vor allem da nicht jedes Schiff, das auf einer DDR-Werft gebaut wurde, in die Flotte der Reederei aufgenommen wurde.
Oral History und das zeitgeschichtliche Erinnerungsinterview
Die Methode der Oral History ist fachlich zwar anerkannt, der Begriff selbst jedoch ist eher umstritten.13 In den USA geprägt und verbreitet, lässt sich der Begriff nur bedingt auf die deutsche Forschungslandschaft übertragen, vor allem weil der alltagsgeschichtliche Ansatz, der in den USA dieser Methode zugrunde liegt, in Deutschland nur einen Aspekt dieser Methode widerspiegelt.14 Eine einfache Übersetzung in »mündliche Geschichte« trifft nicht den Kern, weder den der Technik noch den des Ergebnisses. Passender zeigt sich der Begriff des »zeitgeschichtlichen Erinnerungsinterviews«, enthält er doch sowohl Hinweise auf die Besonderheit der Quelle, der daraus resultierenden Subjektivität und der Technik.15 Als relativ junge Disziplin der Geschichtswissenschaft steht das zeitgeschichtliche Erinnerungsinterview noch immer im Verdacht, zu subjektiv und nicht genug vor Beeinflussung durch den Fragenden geschützt zu sein. Trotz zahlreicher Projekte und der Tatsache, dass Erinnerungsinterviews in anderen Fachrichtungen, vor allem soziologischen und ethnologischen, bereits seit Längerem zur Informationsgewinnung eingesetzt werden, erscheinen die mündlichen Quellen in der (zeit-)geschichtlichen Forschung zumeist nur als Ergänzung zu den klassischen, schriftlichen Quellen.16
Wierling unterscheidet grob zwischen drei Typen des Interviews. Das Experteninterview wird mit einem Befragten auf einen ganz bestimmten Untersuchungsgegenstand und Zeitraum hin geführt, zu dessen Beschaffenheit der Befragte aus persönlicher, zumeist aber beruflicher Kenntnis Stellung nehmen soll. Gekennzeichnet sind diese Interviews durch spezifische Sachfragen und eine genaue Vorbereitung durch den Fragenden, da somit die Möglichkeit, Hintergrundwissen und Zusammenhänge aufzuzeigen sowie Widersprüche oder Fehlinformationen und -interpretationen aufzuklären, optimal genutzt werden kann. Das thematische Interview hingegen bezieht sich auch auf einen zeitlichen Ausschnitt, ist aber narrativer geprägt und weniger im Voraus strukturiert. Zwar sollte ein Abschweifen in themenfremde Erinnerungen vermieden werden, aber der offene Rahmen eines thematischen Interviews ermöglicht auch unerwartete, zumeist assoziative Informationen. Das biographische Interview stellt die am wenigsten strukturierte Variante dar. Der zeitliche Rahmen ergibt sich aus dem Leben des Befragten.17
Die für die vorliegende Untersuchung geführten Interviews entsprachen zumeist dem von Wierling charakterisierten thematischen Interview. Nach einem kurzen Vorgespräch, bei dem der thematische Rahmen und das Vorgehen bei dem eigentlichen Interview besprochen wurden, erfolgte der eigentliche Bericht des Interviewten. Dieser wurde frei und narrativ gestaltet, lediglich durch eventuelle Verständnisfragen unterbrochen. Anschließend wurden sowohl vorbereitete Fragen als auch solche, die sich aus der Schilderung ergaben, beantwortet. Nach der Transkription wurde den Befragten die erste Reinschrift übermittelt, eventuelle Änderungswünsche – zumeist sprachlicher Natur – wurden umgesetzt, sodass am Ende eine Version vorlag, deren Nutzung durch den Befragten autorisiert wurde.
Um möglichst viele unterschiedliche Aspekte bei den Befragungen abzudecken, wurden die Interviewpartner nach ihrer Position in der Reederei, der Dauer ihrer Zugehörigkeit und dem Schwerpunkt der zu erwartenden Berichte ausgewählt. Neben dem »klassischen« Vollmatrosen, der von 1972 bis zur Privatisierung unter der DDR-Flagge gefahren ist, konnte ein ehemaliger Direktor des Flottenbereiches Asien/Amerika für ein Interview gewonnen werden, ebenso ein Chief, der lange Jahre aktiv zur See gefahren ist und nach dem Entzug seines Seefahrtsbuches in der Konsumgüterproduktion der Reederei eingesetzt wurde. Auch ein ehemaliger Kapitän, der lange Jahre in der Schiffsinspektion tätig war und als Kandidat im Zentralkomitee der SED die Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft vertreten sollte, sowie ein Elektroingenieur, der als Springer auf unterschiedlichen Schiffen eingesetzt wurde, stellten sich für die Befragung zur Verfügung. Zwei der fünf Befragten sind ehemalige Mitglieder der SED, vier blicken auf eine Tätigkeit in der aktiven Seefahrt zurück, zwei verloren ihre Stellung durch Wirken der Staatssicherheit. Durch die Interviews war es möglich, die alltäglichen Probleme der DDR-Handelsflotte besser darzustellen. In den Fällen, in denen die Akten nur wenig Aufschluss über die Geschehnisse gaben – zum Beispiel über die Empfindungen der Seeleute nach dem Bau der Berliner Mauer oder während der friedlichen Revolution von 1989 –, konnten die Interviews diese Lücken schließen. Auch stellen sie ein Gegengewicht zu den offiziellen, meist ideologisch geprägten Darstellungen, Anweisungen und Zeitungsartikeln dar.18
Aufgaben und Funktionen der Handelsflotte
Die Notwendigkeit einer eigenen Handelsflotte lag im Außenhandel begründet. Da die DDR über wenig eigene Rohstoffe verfügte, wie zum Beispiel Steinkohle, Erze, Eisen und Stahl, mussten diese importiert werden, um die Industriezweige zu beliefern. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg waren die metallverarbeitenden Betriebe, vor allem der Maschinenbau, auf Lieferungen aus dem Westen Deutschlands, unter anderem aus dem Ruhrgebiet, angewiesen.19 Anders zeigt sich das Bild in der chemischen Industrie. Hier wurden vielmehr Grundprodukte geschaffen, deren Weiterverarbeitung nicht in der SBZ erfolgte. Diese Produkte mussten exportiert werden, um Einnahmen zu erzielen und eine weitere Verarbeitung zu gewährleisten.20 Sowohl die auf dem Seeweg erfolgenden Importe als auch Exporte konnten nicht durch den eigenen Außenhandel durchgeführt werden, stattdessen mussten ausländische oder westdeutsche Reedereien genutzt und bezahlt werden. Um Gelder einzusparen, aber auch um sich vom Weltfrachtmarkt und westdeutschen Häfen und Reedereien unabhängig zu machen, sollte eine eigene Handelsflotte in Zukunft dem DDR-Außenhandel zur Verfügung stehen.
Die Aufgabe der DDR-Handelsflotte im Speziellen und des Seetransportes im Allgemeinen wurde in der DDR-Fachliteratur zwar nicht kontrovers gesehen, aber durchaus mit unterschiedlichen Modellen erläutert. So sah das Autorenkollektiv von Neukirchens »Handbuch Seeverkehr«21 die Produktionsaufgabe der Seeschifffahrt, soweit sie über Kabotage, also den Güter- oder Personentransport innerhalb eines Landes, hinausgeht, als Einheit der transportökonomischen und außenwirtschaftlichen Aufgaben. Anders als andere Transportunternehmen, zum Beispiel Bahn- oder Lkw-Transport, wies die Seeschifffahrt als Besonderheit die exklusive Bindung an den Außenhandel auf. Alle Transportgüter waren einheitlich in ihrem Charakter hinsichtlich der ökonomischen Bestimmung entweder Import- oder Exportgüter. Territorial gesehen fand der Seetransport außerhalb der für den Bereich der nationalen Volkswirtschaft vorgegebenen Staatsgrenzen statt. Er war den Weltmarktbedingungen unterworfen und stellte auch somit eine Ausnahme für DDR-Betriebe dar.22
Mit der transportökonomischen Aufgabe auf der einen Seite und der außenwirtschaftlichen auf der anderen hatte die Staatsreederei dennoch in erster Linie ein Ziel: die positive Beeinflussung der Handels- und Zahlungsbilanz. Auf finanzökonomischem Gebiet hatte die Seeschifffahrt Einfluss auf die Valutabilanz. Zum einen konnten Deviseneinnahmen durch Cross Trade und indirekt auch bei Transporten von eigenen Außenhandelsgütern, realisiert über den Warenpreis, erzielt werden. Zum anderen gab es Devisenausgaben, durch Hafen- oder Kanalnutzung, Bunker oder Wartungs- und Reparaturarbeiten in ausländischen Werften direkt an den Transport gekoppelt oder indirekt durch Exporte und Importe, die auf fremde Tonnage zurückgriffen. Der dritte Bestandteil der Valutabilanz stellte die Deviseneinsparung dar. Diese erfolgte durch die Senkung von Devisenausgaben bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen, also Einsparung von Ausgaben für Bunker oder Reparatur. Auch die Importe und Exporte mit eigener Tonnage fielen in diese Kategorie.23
Die ökonomische Zielsetzung für den Einsatz einer eigenen Flotte bestand in der Maximierung des Devisennutzens im Bereich des seewärtigen Außenhandels. Die Gewinne oder Deviseneinnahmen allein waren nicht die entscheidende Größe in der Bewertung der Rentabilität der Handelsflotte, vielmehr war die Valutabilanz, der effektive Nutzen für die DDR-Volkswirtschaft, das Instrument zur Einschätzung der Leistung der DSR.
Die Dualität von Transportökonomie und Außenwirtschaft wurde 1974 in der »Ökonomie des Seetransportes«24 weiter aufgespalten. Die enge Verknüpfung von Seetransport und Außenwirtschaft blieb Grundlage für die Funktionen des sozialistischen Seeverkehrs, die teilweise von denen anderer Verkehrsträger der DDR abwichen.25 Als hauptsächliche volkswirtschaftliche Aufgaben des Seeverkehrs wurden vier Funktionen genannt. Die Transportfunktion sollte die ökonomische Unabhängigkeit der DDR sichern, indem ein wesentlicher Anteil des nationalen Außenhandelsvolumens durch die eigene Flotte und die eigenen Häfen umgeschlagen und transportiert wurde. Die Zielstellung dieser Funktion lag in der planmäßigen und bedarfsgerechten Versorgung der Industrie und der Bevölkerung mit Importmaterialien und Konsumgütern sowie dem kostengünstigen Absatz von Exporterzeugnissen.
Die Gewinnfunktion orientierte die Seeverkehrsbetriebe, also auch die DSR, auf die Erwirtschaftung eines langfristig stabilen Beitrages zum Nationaleinkommen. Die Stellung der Seeverkehrsbetriebe als nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeitende Bestandteile der Volkswirtschaft beruhte auf der Gewinnfunktion. Die devisenwirtschaftliche Funktion hingegen hatte zum Ziel, das höchstmögliche Valutaergebnis zu erwirtschaften. Hierbei war weniger die Stabilität, sondern vielmehr die Höhe entscheidend. Wie auch bei Neukirchen setzt sich das Valutaergebnis aus den Valutaeinnahmen und den Valutaeinsparungen zusammen. Allerdings wurden die Valutaausgaben, die zur Erwirtschaftung der Einnahmen notwendig wurden, nicht gesondert aufgeführt. Dies ist eine Schwachstelle dieses Modells, die die Frage aufwirft, warum lediglich die positiven Valutaergebnisse berücksichtigt wurden und die Aufwendungen in Fremdwährungen außen vor bleiben sollten. Gerade die in anderen Bestandteilen große Nähe zum Modell nach Neukirchen lässt dieses Defizit besonders deutlich hervorstechen. Trotzdem wurde das differenzierte Modell nach Schelzel, Jenssen und Dora in den nachfolgenden Jahren in DDR-Publikationen bevorzugt eingesetzt.26
Als eine weitere bei Neukirchen nicht angesprochene Aufgabe führen Schelzel, Jenssen und Dora die militärisch-strategische Funktion auf. Diese beschreibt die Rolle der Flotte und der Häfen als Transportpotenzial bei der Landesverteidigung. Für die Erfüllung dieser Funktion ist eine ausreichend große und gut strukturierte Flotte unabdingbar.27
Darüber hinaus sollte die Handelsflotte noch Aufgaben erfüllen, die weniger wirtschaftlich geprägt waren. So sollten die Flotte an sich und vor allem auch die Besatzungsmitglieder und Auslandsvertreter die DDR im Ausland repräsentieren, weswegen die Auswahlkriterien für die Flottenmitarbeiter im grenzüberschreitenden Einsatz besonders streng waren. Da in der DDR das Recht auf Arbeit gesetzlich verbrieft war, bestand eine weitere Aufgabe der DSR darin, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Diese Beschäftigungsaufgabe erfüllte die Reederei mit 13.279 Beschäftigten im Jahr 1989 durchaus eindrucksvoll – war sie doch damit die größte deutsche Reederei überhaupt. Weitere Funktionen waren die Wachstumsfunktion, die außenpolitische und natürlich die versorgungsstrategische Funktion. Diese wurden jedoch weder von Neukirchen noch von Schelzel, Dora und Jenssen geprägt, sondern von Britta Strehl.28
Rechtschreibung
Der Text ist nach den seit 1996 geltenden Orthographienormen erstellt, enthält aber sowohl in den Zitaten als auch in einigen Bezeichnungen Formen der alten Rechtschreibung. Dem Thema geschuldet tritt besonders häufig die Form »Schiffahrt« auf, so zum Beispiel in Schreibungen wie »Vollmatrose der Handelsschiffahrt«, »Flottenbereich Spezialschiffahrt«, »Hauptverwaltung Schiffahrt« oder »Haus der Schiffahrt«. Auch ohne Anführungszeichen verstehen sich diese Bezeichnungen als feststehende Wendungen oder Eigennamen, die nicht an die heutige Schreibung angepasst werden.
Zitate erfolgen immer nach der originalen Schreibung, eventuelle Orthographiefehler im zitierten Text werden nicht korrigiert. Eingriffe in den zitierten Text werden mit eckigen Klammern […] gekennzeichnet. Die Berufsbezeichnung »Seemann« ist historisch aus einer Zeit erwachsen, in der die Besatzungsmitglieder ausschließlich männlich waren. Obwohl seit den 1960er Jahren auch Frauen aktiv in der DSR zur See fuhren, wird vorrangig die Bezeichnung Seemann genutzt. Diese sowie der Plural Seeleute schließen nicht explizit Frauen aus.
des Schifffahrtmuseums der Hansestadt Rostock Bd. 9, Rostock 2002, S. 21. Letzteres ist aber wenig verwunderlich, handelt es sich bei dem Verfasser doch um einen Mitbegründer besagten Modells.
1http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/buechner103.html, Stand: 11.12.2012, 16.05 Uhr. NDR: »GEORG BÜCHNER wird verschrottet«.
2http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/georgbuechnerrostock107.html, Stand: 25.01.2013 16.30 Uhr. NDR: GEORG BÜCHNER wird nicht verschrottet.
3Das wiederkehrend genutzte Kürzel »DSR« steht – unabhängig von dem angesprochenen Zeitpunkt – für die Deutsche Seereederei. Durch strukturelle Änderungen im Zuge der Kombinatsbildung wurde 1974 der Name der Reederei zu »Deutfracht/Seereederei Rostock«, das Kürzel blieb jedoch unverändert bestehen. Dem kurzen Zeitraum von 1970 bis 1974, in dem zwei Reedereien der DDR existierten, wird weitestgehend Rechnung getragen, indem alle die neue Reederei »VEB Deutfracht, Internationale Befrachtung und Reederei« betreffenden Aussagen auch deren Namen tragen. In den Übersichten zu Flottenentwicklung oder Gütertransportmengen spielt die Trennung keine Rolle; hier werden die Ergebnisse beider Flotten zusammengefasst.
4Weder in den Archivquellen noch in der Literatur sind durchgehende Bilanzen für die DSR zu finden.
5Besonders die Reihe der Bordgeschichten sei hier genannt. Eindrucksvoll mit Bildern und Faksimiles dokumentiert, werden kurze Begebenheiten aus der Fahrenszeit einzelner DSR-Seeleute geschildert. Viele der ehemaligen DDR-Seeleute finden sich in den Erzählungen wieder und tragen immer wieder Geschichten zu neuen Bänden bei. (DSR-Seeleute e. V. [Hrsg.]: Bordgeschichten: aus Tagebüchern ehemaliger DSR-Seeleute. 10 Bände. Freiberg 2001–2011.)
6Stellvertretend für andere Publikationen soll hier auf die Sendereihe »DDR Ahoi!« vom NDR und MDR hingewiesen werden.
7Vgl. Heimann, Jan: Das Verkehrswesen in den neuen Bundesländern. Aufgaben- und Vermögenstransformation, Diss., Speyer 1996; von Seck, Falk: Transformation der Seeschiffahrt. Privatisierung und Restrukturierung im Ostseeraum, Wiesbaden 1998.
8Vgl. Wenzel, Harry: Von der Staatsreederei zu einem Privatunternehmen – Die DSR als Unternehmen der Treuhand. S. 112–124, in: Jenssen, Bruno (Hrsg.): 50 Jahre Deutsche Seereederei Rostock. Beiträge zur Entwicklung und Transformation der Handelsschifffahrt der DDR. Schriften des Schifffahrtmuseums der Hansestadt Rostock Bd. 9, Rostock 2002 und Götz, Brigitte; Wenzel, Harry: DSR. Deutsche Seereederei Rostock. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Hamburg 2004.
9Vgl. Peters, Gerd: Vom Urlauberschiff zum Luxusliner. Die Seetouristik des VEB Deutsche Seereederei Rostock, Hamburg 2005 und Stirn, Andreas: Traumschiffe des Sozialismus. Die Geschichte der DDR-Urlauberschiffe 1953–1990, Berlin 2010.
10Budde, Heidrun: Willkür! Die Schattenseite der DDR, Rostock 2002.
11Gerade die Verbindung von Mukran nach Klaipeda mittels der Eisenbahngüterfähren wird in zahlreichen Akten sowohl der BStU als auch des Landesarchivs Greifswald behandelt. Die Aufarbeitung durch Siegfried Köhler und Wolfgang Klietz ist jedoch so umfangreich, dass kaum neue Erkenntnisse erwartet werden können, zumal es sich hierbei nur um eines von vielen Beispielen für die Einmischung des MfS in die Arbeit der DSR handelt.Klietz, Wolfgang: Ostseefähren im Kalten Krieg, Berlin 2012.Köhler, Siegfried: Die Fährverbindung Mukran-Klaipeda. Ein Sonderbauvorhaben im Griff der Staatssicherheit (1982 bis 1989), Schwerin 2007.
12Köhler, Siegfried: Die Staatssicherheit und der Fährverkehr über die Ostsee, Schwerin 2004.
13Mrotzek, Fred: Das zeitgeschichtliche Erinnerungsinterview, in: Müller, Werner; Pätzold, Horst (Hrsg.): Lebensläufe im Schatten der Macht. Zeitzeugeninterviews aus dem Norden der DDR, Schwerin 1997, S. 17–28.
14Ebenda, S. 20.
15Ebenda, S. 22.
16Einblicke in die wissenschaftliche Entwicklung der Oral History in Deutschland und der Welt gibt Wierling, Dorothee: Oral History, in: Michael Maurer (Hrsg.): Aufriß der historischen Wissenschaften, Bd. 7: Neue Themen und Methoden der Geschichtswissenschaft, Stuttgart 2003, S. 81–151.
17Wierling, S. 109f.
18Um auch in der Sprache diese Polarität darzustellen, wurden die Interviews nach der Transkription nur behutsam an das geschriebene Wort angepasst. Lediglich auf Wunsch des Befragten wurden stärkere Eingriffe in Wortwahl und Syntax vorgenommen. Auf diese Weise sollte die typische »Mündlichkeit« fixiert werden, um somit den Gegensatz zu den oft stereotypischen Wendungen der DDR-Schriftlichkeit zu bewahren.
19Steiner, André: Von Plan zu Plan. Eine Wirtschaftsgeschichte der DDR. Berlin 2007, S. 22ff.
20Ebenda, S. 22.
21Neukirchen, Heinz (Hrsg.): Handbuch Seeverkehr. 3 Bände, Berlin 1969–1970.
22Neukirchen, Heinz (Hrsg.): Handbuch Seeverkehr. Band 1, Berlin 1969, S. 30f.
23Ebenda, S. 31.
24Schelzel, Manfred; Jenssen, Bruno; Dora, Helmut: Ökonomie des Seetransportes. Grundlagen, Berlin 1974.
25Ebenda, S. 11.
26Vgl. Maul, Artur: Der seewärtige Containerverkehr. Mittel zur Verwirklichung der Außenhandelsstrategie der DDR und Festigung der Marktposition des VEB DSR auf den internationalen Schiffahrtsmärkten der 90er Jahre. Warnemünde/Wustrow, Ingenieurhochschule f. Seefahrt, Diss., 1989.Auch in neueren Veröffentlichungen findet sich das Modell nach Schelzel/Jenssen/Dora, zum Beispiel bei von Seck, Falk: Transformation der Seeschiffahrt. Privatisierung und Restrukturierung im Ostseeraum, Wiesbaden 1998 und Jenssen, Bruno: Das schifffahrtspolitische Umfeld für den »VEB Deutsche Seereederei« (DSR), in: Jenssen, Bruno (Hrsg.): 50 Jahre Deutsche Seereederei Rostock. Beiträge zur Entwicklung und Transformation der Handelsschifffahrt der DDR. Schriften
27Ebenda, S. 11.
28Strehl, Britta: Ökonomische Interessen der Mitgliedsländer des RGW bei der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung – untersucht in der Seeverkehrswirtschaft. Diss., Leipzig 1986. Die zusätzlichen Funktionen sind nicht ausschließlich wirtschaftlich, sondern auch politisch geprägt, so vor allem die beschäftigungspolitische, außenpolitische und repräsentative Funktion. Diese sind für die Bewertung der Rentabilität und somit für die vorliegende Arbeit nur ergänzend nutzbar, werden demnach weitestgehend unbehandelt bleiben.
2.Die Entwicklung der Staatsreederei
2.1Die DSR – Vom Kriegsende bis zum Mauerbau
2.1.1Der lange Weg zur Gründung
Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte sich für Mecklenburg-Vorpommern folgendes Bild in Bezug auf die Schifffahrt: Nach der Aufteilung Deutschlands fiel der mecklenburg-vorpommerische Teil der deutschen Ostseeküste der sowjetischen Besatzungsmacht zu. Diese gründete am 1. August 1945 die »Deutsche Zentralverwaltung des Verkehrs«, unter anderem mit der Hauptverwaltung Schiffahrt als eines von sieben Verwaltungsorganen.29 Zu verwalten gab es aber zu diesem Zeitpunkt kaum etwas, vor allem im Hinblick auf den Seehandel.
Bereits vor Kriegsbeginn gab es im deutschen Ostseeraum keine ausgeprägte Schifffahrt mehr, die maritime Wirtschaft hatte sich nach Westen verlagert. Ende der 1930er Jahre zeigte sich diese Entwicklung unter anderem in den Bereichen Schiffbau und Fischerei. Der Anteil Mecklenburgs an der Ostseefischerei betrug sechs Prozent, am deutschen Schiffbau war diese Region nur mit zwei Prozent der gesamten Kapazität beteiligt. Der Anteil an der Handelsschifffahrt war verschwindend gering, der Zugang zum Ostseeraum war von Hamburg aus ebenso möglich wie von Rostock, Wismar oder Stralsund30, hatte aber den Vorteil, dass die Waren über Hamburg direkt weiter nach Westen verschifft werden konnten. Während 1939 die westdeutschen Häfen 1.122 Schiffe mit über vier Millionen Bruttoregistertonnen (BRT) verzeichneten, dienten Rostock und Wismar lediglich 23 Schiffen mit 34.100 BRT als Heimathafen. Damit lagen in ostdeutschen Häfen weniger als ein Prozent der deutschen Handelsflotte.31
Nach Kriegsende wurde auf der Potsdamer Konferenz unter anderem das weitere Vorgehen in Bezug auf die deutsche Handelsflotte besprochen. Der Beschluss sah nicht nur die Beschlagnahmung der deutschen Schiffe durch die Siegermächte Großbritannien, USA und Sowjetunion vor, sondern verbot auch eine deutsche Handelsflagge und beschränkte die festgelegte deutsche Restflotte stark in ihren Einsatzmöglichkeiten.32
Der Befehl Nr. 17 vom 12. September 1945 von dem Chef der Verwaltung der Wasserstraßen und dem Chef der Transportabteilung der SWA in Deutschland benennt die zu beschlagnahmenden Schiffe in der SBZ. Das Gebiet, für das der Befehl galt, erstreckte sich von »der Oder mit Ausnahme des Stettiner Hafens bis zum Hafen von Fürstenberg einschließlich, auf den Flüssen und Kanälen des Berliner Wasserstraßen-Knotenpunktes, und auf der Elbe von der tschechoslowakischen Grenze bis hin zum Hafen Dömitz einschließlich«.33
Demnach sollten bis zum 25. September 1945 alle Fahrgast- und Gütertransportschiffe übergeben werden, die kleinere oder größere Reparaturen oder Wartungsarbeiten benötigten, einschließlich der versenkten Schiffe, die mittels Reparaturen wieder seetauglich gemacht werden konnten. Darüber hinaus umfasste der Befehl alle Schiffe, die über 67 Meter lang und 9,7 Meter breit waren, alle Fahrgastschiffe sowie Selbstfahrer, die eine Maschinenleistung bis 100 PS aufwiesen, alle Stahlschleppkähne mit einer Ladefähigkeit bis 200 Tonnen und alle Kompositionsschleppkähne mit einer Ladefähigkeit bis 250 Tonnen sowie alle Holzfahrzeuge. Die gesamte technische und auch sonstige Flotte wurde ebenfalls eingezogen.
Da es in der sowjetischen Besatzungszone kaum maritime Wirtschaft gab, blieben starke Proteste im Osten – anders als im Westen – aus. Bei Kriegsende gab es kaum Schiffe, die beschlagnahmt werden konnten, und somit auch weniger Arbeitsplätze, die an die maritime Wirtschaft gebunden waren, was weniger Betroffene zur Folge hatte. Diese Situation sollte sich bis 1950 kaum ändern.
Neben der Beschlagnahmung der Restflotte verboten die sowjetischen Besatzer den Schiffbau für den deutschen Bedarf in ihrer Besatzungszone; die Werften waren mit dem Bau von Schiffen als Reparationsleistung für die UdSSR ausgelastet.34 Da dieser Industriezweig bis dato wenig entwickelt war, mussten für den Bau von Hochseeschiffen die Produktionsstätten erst einmal geschaffen werden. Die Forderung nach Reparationsleistungen in Form von Schiffen hatte dafür gesorgt, dass sich der Schiffbau in der SBZ etablierte und später in der DDR florierte.35
Am 13. Oktober 1950 wurde der erste und vorläufig auch einzige Dampfer VORWÄRTS, die ehemalige JOHANN AHRENS, an die »Deutsche Schiffahrts- und Umschlagszentrale« (DSU) übergeben. Dem ging ein mehrjähriges Tauziehen um das Schiff voraus, da der eigentliche Besitzer, der Rostocker Reeder Erich Ahrens, 1948 nach Westdeutschland übergesiedelt war. Obwohl Erich Ahrens sich bereit erklärte, das Schiff nach einer notwendigen Reparatur in Kiel zurück in die SBZ zu schicken, und später sogar anbot, den Dampfer zu verkaufen, dauerte es bis zum Oktober 1950, bis die JOHANN AHRENS offiziell den Besitzer wechseln konnte.36 Die dringend erforderlichen Reparaturen wurden nicht in Kiel, sondern auf Geheiß des Generaldirektors für Schiffahrt, Ernst Wollweber, in Stralsund durchgeführt, zweifellos um sicherzustellen, dass der Dampfer nach der Werftzeit in der SBZ eingesetzt werden kann und nicht in Westdeutschland verbleibt. Die Deutsche Schiffahrts- und Umschlagszentrale war die Nachfolgeorganisation der »Arbeitsgemeinschaft Binnenschiffahrt« und wie diese der »Generaldirektion Schiffahrt« unterstellt.37 Bereits am 7. Juni 1948 gab die sowjetische Militäradministration den Befehl Nr. 103, der als Geburtsurkunde der DSU gilt.38 Diese beschäftigte sich vor allem mit der Binnenschifffahrt und verfügte mit der VORWÄRTS nun über ein hochseetaugliches Schiff. Neben der VORWÄRTS existierte noch der Seeleichter FORTSCHRITT, beide sollten später als Grundstock der neugegründeten Staatsreederei der DDR dienen.39
Abbildung 1: Aufbau der Leitungsstruktur und Unterstellungsverhältnisse der Seeverkehrswirtschaft40
Obwohl der VEB DSR mit anderen volkseigenen Betrieben der Seeverkehrswirtschaft theoretisch gleichgestellt war, ging seine Bedeutung für die Seeverkehrswirtschaft weit über die der anderen Betriebe hinaus. Vielmehr entwickelten sich die anderen Seeverkehrsbetriebe zu unterstützenden Einheiten im gesamten Prozess des Seetransportes. Der Ausbau des Rostocker Überseehafens während der 1960er Jahre war in erster Linie dem Bedarf der DSR geschuldet. Außer von den DDR-Schiffen wurden die DDR-Häfen hauptsächlich von Flotten aus dem baltischen Raum genutzt, besonders von polnischen und sowjetischen Schiffen. Die VEB Schiffsmaklerei und Schiffsversorgung waren ebenfalls vorwiegend mit der Betreuung der DDR-Schiffe betraut.
2.1.2Die Gründung – Probleme, Pläne und Durchführung
Das Ministerialblatt der DDR Nr. 39 vom 29. August 195241 verkündete offiziell die Gründung der Staatsreederei mit Sitz in Rostock, rückwirkend zum 1. Juli des Jahres42, und erfüllte somit die Ankündigung des 3. Parteitages der SED im Juli 1950, eine eigene Handelsflotte für die DDR zu schaffen.43
Diesem Dokument gingen viele Arbeitsstunden des Ministeriums für Verkehrswesen, der Generaldirektion Schiffahrt und der DSU voraus. So wurde bereits am 3. Juli 1951 in einer Aktennotiz der DSU ein Strukturplan der zukünftigen Reederei erstellt, die Anzahl der notwendigen Angestellten und die Frage nach einem einheitlichen Tarif diskutiert. Zu der Zeit gingen die Beteiligten von einer Flottenstärke von maximal fünf Schiffen aus, allerdings war bereits das Wachstum der Reederei und damit auch der Flotte geplant.
Für die Flotte von 4/5 Dampfern wäre folgendes Personal zu Beginn erforderlich. Berücksichtigt muss werden, dass die Reederei im wachsen sein wird und einzelne Abteilungen später nach Bedarf verstärkt werden müssen.
Leiter der Reederei
Inspektor für technische und allgemeine Fragen (Ausrüstung usw.)
Jüngerer technischer Sachbearbeiter
Hauptbefrachter-Makler
Jüngerer Befrachter-Makler (gleichzeitig für Planung und Statistik)
Stenotypistin-Sachbearbeiterin mit Kenntnissen der deutschen, englischen und russischen Sprache
Sachbearbeiter für Personal und Kulturfragen
Oberbuchhalter
Buchhalter-Kassierer (Lohnabrechnungen)
Stenotypistin für deutsche Arbeiten.44
Die geplante Struktur war den Erfordernissen einer kleinen Reederei angemessen, sollte aber noch häufiger überarbeitet werden.
Abbildung 2: Strukturplan für Reederei vom 03.07.195145
Hierbei handelt es sich nur um die landseitigen Angestellten in der Verwaltung der Reederei. Auffällig ist, dass bereits zu diesem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit mit den nichtsozialistischen Ländern nicht ausgeschlossen wird; für den Fall der Geschäftskontakte mit englischsprachigen Partnern wurde eine Fremdsprachenkorrespondentin sowohl mit Russisch- als auch mit Englischkenntnissen eingeplant.
Schon in den ersten Entwürfen wurde beabsichtigt, einen eigenen Schiffsmakler zu beschäftigen. Dies hatte vor allem wirtschaftliche Gründe, da auf diesem Wege die Klarierungskosten an unabhängige Makler eingespart werden konnten. Die Argumentation wurde bereits 1952 in den Akten vermerkt. Nicht nur die möglichen Einsparungen – vor allem im Devisenbereich –, sondern auch das bessere Betreuungsverhältnis zwischen einem eigenen Makler und den Schiffen sowie dem Personal der DSR wurden als Vorteil angeführt.
Aktenvermerk
Betr.: Warum soll die Seereederei selbst Schiffe klarieren?
Zur Senkung der Betriebskosten. Zum Beispiel: Dampfer VORWÄRTS hätte jede Reise in Rostock – eingehend in Ballast und ausgehend mit Ladung DM 250.– und eingehend und ausgehend mit Ladung DM 500.– Klarierungsgebühr an den Makler zu zahlen. Ein Makler würde nur die erforderlichen Arbeiten ausführen. Dagegen würde die Reederei wenn sie selbst klariert, gleichzeitig, für das Personal und für die Instandhaltung des Schiffes mitsorgen. Würden alle Vorlageprovisionen fortfallen. Auch würden Telegrammkosten und anderer [sic] Spesen niedriger sein, als von den Maklern, üblich, in Rechnung gestellt werden. Die Betreuung von Mannschaft und Schiff sorgfältiger durchgeführt werden.46
Als Firmensitz stand zu dieser Zeit Rostock fest, aber auch an eine Zweigstelle in Stralsund wurde gedacht, um eine umfassende Versorgung zu gewährleisten. Da sowohl Wohn- als auch Büroräume knapp waren, konnte der neuen Reederei jedoch kein eigenes Gebäude zugewiesen werden. Stattdessen plante man, die DSR räumlich in der Hafengegend, genauer gesagt in den Bürogebäuden der im Hafen angesiedelten Verwaltungsorganisationen, unterzubringen.
Die Reederei müsste aus wirtschaftlichen und technischen Gründen in Rostock als dem Zentral gelegenen Hafen errichtet werden. Falls die Reederei im Besitz von kleineren Fahrzeugen (Motorschiffen und Küstenseglern) im Besitz [sic] kommt, müsste in Stralsund eine Zweigstelle geschaffen werden, welche die Belange der kleinen Fahrzeuge im Abschnitt Stralsund (Barth, Insel Rügen, Greifswald, Wolgast, Anklam, Uckermünde sowie Peenestationen) vertritt. Hierfür müsste 1 Makler-Befrachter, 1 Schiffstechnischer Sachbearbeiter sowie eine Schreibkraft eingestellt werden.
Räumlichkeiten – In Rostock müsste man versuchen eigene Räume in der Hafengegend zu beschaffen. Fall[s] dieses zu Beginn nicht gelingt, müüste [sic] man versuchen bei der Hafengemeinschaft oder Hauptwasserstrassenamt unterzukommen. In Stralsund könnte man einen Raum bei der DSU oder Wasserstrassenamt freibekommen. Die Räume müüsten [sic] mit neuem Mobiliar ausgestattet werde.47
Die Frage nach der Bezahlung, genauer gesagt nach Tarifverträgen, stellte sich sogar doppelt, da weder für Angestellte noch für Seeleute in der Seeschifffahrt bis dahin entsprechende Tarife existierten. Die DSU hatte zwar für die Binnenschifffahrt bestimmte Tarife, aber die Handelsschifffahrt verlangte durch andere Voraussetzungen, zum Beispiel nautische Patente, und Bedingungen wie längere Fahrtzeit auch eine andere Entlohnung der Seeleute. Durch den notwendigen Einsatz im grenzüberschreitenden Verkehr standen den Seeleuten der Handelsflotte auch Devisenhandgelder zu, die für Binnenschiffer nicht gezahlt wurden.
Gehälter für Angestellte – Da kein Tariff [sic] für Angestellte in der Seeschiffahrt besteht, müssten mit den Fachkräften Einzelverträge abgeschlossen werden, um dieselben an die Reederei zu binden.48
Schon zu Beginn der Handelsflotte zeigte sich die Befürchtung, die Seeleute könnten durch westliche Reedereien oder andere Konkurrenz, zum Beispiel der Fischereiflotte, abgeworben werden. Auch deswegen sollte der materielle Anreiz derart gestaltet werden, dass die Zugehörigkeit der Seeleute zur Handelsflotte der DDR möglichst dauerhaft war.
Tariffe [sic] – für die Besatzungen auf Schiffen für weite Fahrten, für Fahrten im Nord-Ostsee Raum, sowie für Küstenfahrten (Kümofahrzeuge) müssen schnellstens herausgebracht werden, da andernfalls ein Teil der Seeleute zur Fischereiflotte oder auch nach dem Westen abwandern. Der Binnenschiffahrtstariff [sic] ist auf keinen Fall in der Küstenschiffahrt anwendbar.49
Dieser erste umfassende Entwurf zur Struktur der DSR sollte nicht der letzte bleiben. Die Planung der DSU musste erweitert werden, da die Erfordernisse der neuen Reederei andere waren als die der Binnenschifffahrt. Bereits ein Jahr später sah die geplante Struktur der Reederei folgendermaßen aus:
Abbildung 3: Strukturplan für den volkseigenen Betrieb Seeschiffahrt mit dem Sitz in Rostock 195250
Deutlich zu erkennen ist eine stärkere Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Generaldirektor und seinem Stellvertreter, der im ersten Entwurf nicht eingeplant war. Auch die Abteilungen Planung und Seebäderdienst hatten im ersten Entwurf noch keine Entsprechung. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die neue Reederei nicht mit vier bis fünf Schiffen beginnen sollte, wie anfangs geplant, sondern am 9. April 1952 bereits von 22 Schiffen unterschiedlichen Typs ausgegangen wurde.51 Dabei handelte es sich um folgende Aufteilung:
Typ I
4 Stück
Typ II
a 6 Stück (zusätzl. Frachtschiff von Werft »Neptun«)
Typ IV
4 Stück
5 Schiffe (Kümo) zu 200–250 BRT und
3–4 Schiffe zu 500–800 BRT.
Passagierschiffe werden keine gebaut, jedoch Passagierplätze auf den Handelsschiffen vorgesehen.
2 Schiffe sind mit schwerem Ladegeschirr (schwere Lademasten) auszustatten.
Die Frage des Bunkerns und Tankens im Zusammenhang mit der Klärung des diskutierten Baus von Tankern für Zwischenbunkerung ist zu klären (mit Außenhandel).52
Frachtschiffe des Typs I waren für die Ostseefahrt geeignet und hatten 1.000 BRT, Typ II a umfasste 3.000 BRT und konnte sowohl in Ost- als auch Nordsee eingesetzt werden und Typ IV, der wahrscheinlich bekannteste Schiffstyp in der DDR, war für den Ostasiendienst konzipiert und hatte stattliche 10.000 BRT.53 Passagierschiffe waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geplant, allerdings gab es die Möglichkeit, Passagen auf Frachtschiffen zu buchen. Bunkerschiffe, also kleinere Tanker, boten die Möglichkeit der Zwischenbetankung.
Der vor der Gründung entstandene zweite Strukturentwurf wurde erneut verworfen; in der Geschäftsordnung der DSR54 ist eine dritte, aber noch immer nicht endgültige Unterteilung der Reederei verzeichnet. Die Abteilungen sind stärker technisch orientiert und vielfältiger:
Direktor
Stellvertretender Direktor
Hauptbuchhalter mit Rechnungswesen
Kaderabteilung
Abteilung Arbeit
Abteilung Technik
Abteilung Planung
Abteilung Verkehr
Abteilung Schiff/Nautik
Abteilung Schiffstechnik
Auftrags- und Rechnungskontrolle
Kaufmännische Abteilung
Justitiar/Archiv und Verschlußsachen
Sicherheits- und Arbeitsschutz-Inspektion
Investbeauftragter mit Bauaufsicht
Dispatcher 55
Bereits an diesem Punkt zeigt sich, dass die Struktur der Reederei vielen Veränderungen unterworfen war, die selten organisch gewachsen sind, sondern vielmehr »von oben« diktiert wurden. Im Laufe der Zeit sollte sich das Gesicht der Reederei noch häufiger nach den Wünschen der übergeordneten Ministerien verändern.
Die im Geschäftsverteilungsplan vom 1. April 1957 aufgeführten Bereiche der Reederei umfassen 15 verschiedene Posten beziehungsweise Abteilungen, somit hat sich die Struktur seit 1951 von sieben Abteilungen – die Stenotypistinnen sind nicht eingerechnet – auf mehr als das Doppelte erhöht. Besonders der kaufmännische und nautische Bereich wurde in den ersten Entwürfen vernachlässigt, sodass sich in diesen Bereichen die umfassendsten Veränderungen zeigten.
Die internen Strukturen wurden zeitgleich mit den Einbindungen der Deutschen Seereederei in die bereits existierenden Ministerien und Institutionen entwickelt. Am 2. Februar 1952 entstand ein früher Entwurf zur Gründung der DSR, in dem die Zugehörigkeit zum Ministerium für Verkehrswesen und der Generaldirektion Schiffahrt dargestellt wurde.
Die »Deutsche Seereederei« ist der Generaldirektion Schiffahrt unmittelbar [handschriftlich eingefügt] unterstellt. […]
Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die »Deutsche Seereederei (VEB)« berechtigt,
mit Einwilligung der Generaldirektion Schiffahrt Zweigstellen innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik zu errichten,
mit Einwilligung der Generaldirektion Schiffahrt, die hierbei im Einvernehmen mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten zu entscheiden hat, Zweigstellen ausserhalb der Deutschen Demokratischen Republik zu errichten,
eigene Schiffe ein- und auszuklarieren.56
Der Entwurf enthält des Weiteren die juristischen Grundlagen der DSR nebst Grundfonds, Aufgaben und Rechte der DSR und des Generaldirektors sowie weitere Angaben zum strukturellen Aufbau. Trotzdem schien es von Anfang an deutlich, dass auch eine eigene Reederei nicht das gesamte seewärtige Außenhandelsaufkommen der DDR allein abwickeln, sondern lediglich einen Teil davon übernehmen konnte.
Der Fünfjahresplan sieht das Entstehen einer Handelsflotte vor, die zur Bewältigung des ständig wachsenden seewärtigen Aussenhandels der Deutschen Demokratischen Republik wesentlich beitragen soll. Die hiermit in Zusammenhang stehenden Aufgaben müssen von einem neu zu schaffenden volkseigenen Betrieb wahrgenommen werden.57
Fraglich ist, welche Aufgaben genau dem neuen Betrieb zufallen sollten. Neben dem eigentlichen Transport von Gütern und den dabei anfallenden Verwaltungsaufgaben zeigten sich vor allem der Schiffbau und die Hafenwirtschaft als eng mit der Handelsflotte verzahnte Bereiche. Die Formulierung im Entwurf ließ Raum, um bei Bedarf noch nachträglich den Aufgabenbereich zu erweitern. Faktisch musste die Reederei besonders bei dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur und den Dienstleistungen, vor allem im Hafen, viele Probleme selbst lösen.
2.1.31952 bis 1961 – Das erste Jahrzehnt der neuen Reederei
Die ersten Reisen des Dampfers VORWÄRTS waren auf den Ostseeraum begrenzt, da weder Handelsbeziehungen zum Westen bestanden noch die Klasse des Schiffes für die Nordsee zugelassen war. Es wurden vor allem Transporte im Inland und im baltischen Raum durchgeführt, zu 70 Prozent handelte es sich dabei um Exportfahrten.
Die Bilanz für das zweite Halbjahr 1952 weist ein positives Ergebnis auf: Mit 234,5 Prozent und insgesamt 1.172.700 Mark58 wurde der Plan übererfüllt. Der Gütertransportplan sah 12.857 transportierte Tonnen Ladung vor, erreicht wurden 29.859 Tonnen, somit wurde der Plan mit 232,2 Prozent übererfüllt. Die Kosten betrugen 427.300 Mark.59
Im zweiten Geschäftsjahr wurde die Ladungskapazität der Reederei durch die Übernahme des Leichters FORTSCHRITT um 60 Prozent auf 2.000 tdw60 gesteigert. Der Einsatz des Leichters war auf die Küstengebiete und Inlandsfahrten begrenzt.61 Durch die erhöhte Kapazität wurden auch die Plananforderungen erhöht, konnten aber weder im Bereich der Einnahmen noch im Bereich des Gütertransportes erfüllt werden. Der Gütertransport konnte nur 99,7 Prozent der vorgegebenen 50.122 Tonnen erreichen, die Einnahmen lagen mit 99,4 Prozent bei 1.482.100 Mark. Lediglich durch die niedrigen Kosten, die vor allem dadurch erzielt wurden, dass der Dampfer VORWÄRTS unterbesetzt gefahren wurde, konnte ein positives Gesamtergebnis vorgelegt werden.62
Im Jahr 1954 kamen tiefgreifende Veränderungen auf die junge Reederei zu. Im Februar wurde der Leichter FORTSCHRITT außer Dienst genommen, im April folgte die VORWÄRTS wegen zu vieler technischer Mängel. Das hohe Alter des Schiffes und die zeit- und kostenintensiven Reparaturen sprachen gegen einen weiteren, da unrentablen Einsatz. Zwar waren bereits neue Schiffe bestellt worden, doch die ersten Auslieferungen verzögerten sich bis Oktober.
So existierte die Reederei sechs Monate lang ohne Schiffe. Dadurch wurde der Jahresplan unerfüllbar, ohne Tonnage konnten auch keine Transporte durchgeführt werden. Trotz Eingabe an die Hauptverwaltung Schiffahrt wurde keine Plankorrektur vorgenommen. Der zum 1. August 1954 bestellte 3.000-Tonnen-Frachter ROSTOCK konnte erst am 11. Oktober geliefert werden, auch der baugleiche Frachter WISMAR konnte erst im November in Empfang genommen werden. Im Dezember folgte das Motorgüterschiff STRALSUND mit 1.250 tdw. Die Einsatzzeit der Neubauten konnte den Verlust durch den Ausfall des Dampfers VORWÄRTS nicht mehr ausgleichen. Durch die verzögerte Auslieferung der neugebauten Frachter entstanden der DSR zusätzliche Kosten für die Heuer der bereitstehenden Mannschaften und Einnahmeausfälle für geplante Transporte. Die bereits aus dem Verkehr gezogene VORWÄRTS verursachte weiterhin Kosten, da sie noch als Bestandteil des Anlagefonds geführt wurde und Versicherungen und Unterhaltskosten trotz Außerdienststellung bezahlt werden mussten. Von den im Plan vorgegebenen 1.220.100 Mark wurden nur 444.500 Mark, also 36,4 Prozent, erwirtschaftet.
Die Kosten überschritten den Plan um 27,3 Prozent, also 356.300 Mark, sodass 1.785.700 Mark statt der geplanten 1.429.400 Mark Ausgaben entstanden.63
Die Frachter ROSTOCK und WISMAR erweiterten die möglichen Fahrtgebiete auf die Nordsee, Levante64 und Ägypten. Somit waren auch Handelskontakte mit westlichen, kapitalistischen Ländern möglich, wodurch die Erwirtschaftung von Valutaeinnahmen über den Rubel hinaus angestrebt wurde, also in erster Linie freikonvertierbare Währungen wie der US-Dollar oder das Britische Pfund.65
Im Jahr 1955 verbesserte sich die Lage der Reederei spürbar. Durch sechs neugebaute Küstenmotorschiffe (Kümos) erhöhte sich die Kapazität auf 13.350 tdw. Die Kümos, die zwischen dem 1. August und dem 1. Dezember in Betrieb genommen wurden, dienten kleineren Transporten im Küstenbereich. Zu diesem Zeitpunkt war die im Fünfjahresplan 1951–1955 vorgesehene Tonnage nur zu 26 Prozent verfügbar. Geplant waren 22 Schiffe mit insgesamt 58.000 tdw, allerdings konnten bis 1955 nur elf Schiffe mit 15.050 tdw in Betrieb genommen werden.66
Das Küstenmotorschiff TIMMENDORF, das eigentlich am 1. September in Dienst gestellt werden sollte, stand wegen Lieferschwierigkeiten erst im April 1956 zur Verfügung. Dennoch war es – ebenso wie die bereits im Vorjahr außer Dienst gestellte VORWÄRTS





























