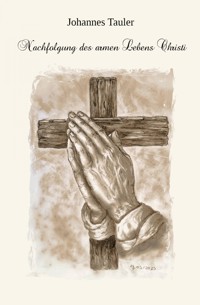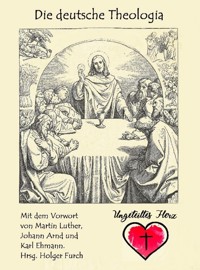
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Theologia, auch als Eyn deutsch Theologia, Theologia Germanica oder "Der Franckforter" bekannt, hatte als christlich-mystische Schrift eines anonymen Autors des 15. Jhd. einen erheblichen Einfluss auf die Reformation in Deutschland. Martin Luther laß das Buch zunächst mit etwa 27 Jahren, ließ die deutsche Theologia 1516 als Druck im Auftrag geben und genießt noch heute eine große Beliebtheit. Laut der gedruckten Ausgabe von 1518 hatte die deutschen Theologia, nach der Bibel und der Bekenntnisse Augustinus von Hippo, maßgebend Einfluss auf Luthers Theologie. In dieser vorliegenden Ausgabe ist der vollständige und unveränderte Nachdruck von Karl Christian Eberhard Ehmann aus dem Jahr 1892, mit dem Vorwort von Martin Luther und Johann Arnd, enthalten. Dieser Nachdruck wurde mit einem zusätzlichen Vorwort, sowie einer Erklärung, einem Abkürzungs-, Bibel- und Quellenverzeichnis erweitert und umfasst knapp 200 Seiten. Auf Dekret von Papst Paul V. wurde die deutsche Theologia sowohl in der lateinischen Übersetzung von Johannes Theophilus als auch weitere Sprachausgaben auf das Index Librorum prohibitorum (Verzeichnis verbotener Bücher) gesetzt. Trotzallem erfreute sich die deutsche Theologia wachsender Beliebtheit, wurde bis zum heutigen Zeitpunkt zwischen 60 und 70. Auflagen gedruck und bereits in mehreren Sprachen übersetzt. Die deutsche Theologia umfasst verschiedene Ansätze der christlichen-mittelalterlichen Mystik. Enthalten hierzu sind Zitate und Grundgedanken der Heiligen Schrift sowie von Augustinus von Hippo, von Pseudo-Dionysius Areopagita und von Johannes Tauler. Ein wesentlicher Merkmal der christlichen Mystik ist die eigene Gotteserfahrung und die Unio Mystica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die deutsche Theologia,
das ist
ein edles Büchlein
vom rechten Verstande,
was Adam und Christus sei, und wie Adam
in uns sterben und Christus in uns erstehen soll.
Mit den Vorreden Dr. Martin Luthers
Joh. Arnds.
Karl Christian Eberhard Ehmann
Neudruck und Erweiterte Auflage von 1892
Holger Furch (Herausgeber)
1. Auflage (2022)
Wortzähler: 43370
Duisburg, 15.07.2022
Ungeteiltes Herz
Alle Rechte vorbehalten. Urheberrecht liegt beim Herausgeber.
Unerlaubte Vervielfältigung in schriftliche oder elektronische Form
sowie für Übersetzungen oder Mikrofilm sind nicht gestattet.
Ungeteiltes Herz ist ein eingetragener Name
beim Deutschen Patent- und Markenamt
Nr. 30 2021 011 928
Erweiterter Nachdruck „Deutsche Theologia“.
Hrsg. Karl Christian Eberhard Ehmann (1808 – 1879)
1892, Stuttgart, J. F. Steinkopf Verlag.
Bild:
Das Heilige Abendmahl von
Joseph Ritter von Führich (1800 – 1876)
Gestaltung, Design und Logo:
Heike Brömmelhaus
www.hb-artdesign.de
Herstellung:
Epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Impressum:
Holger Furch
Güntherstr. 32
Ungeteiltes Herz
47051 Duisburg
0177/3805216
https://www.ungeteiltesherz.de
Facebook:
https://www.facebook.com/UngeteiltesHerz
Instagram:
Ungeteiltesherz.de
Twitter:
UngeteiltesHerz
Gefällt Ihnen die Bücherreihe „Ungeteiltes Herz“
und möchten dies finanziell unterstützen:
https://www.paypal.me/ungeteiltesherz
https://www.ungeteiltesherz.de/disclaimer
Anfragen, Kritik, Reklamationen, Korrekturen
und weitere Auskünfte bitte an:
Widmung:
Vater, Sohn und Heiliger Geist
Karl Ferdinand & Brigitte Inge Furch
Meiner Frau und meiner lieben Familie
Meinen Pateneltern Willi und Petra
Evangelische Kirchengemeinde Ense
Hansekolleg Lippstadt
SMD Duisburg-Essen
Universität Duisburg-Essen
Evangelische Kirche Deutschland
Lars, Michael, Oliver, Phil, Shabbir, Thomas und Tim
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Bücherreihe „Ungeteiltes Herz“
Vorwort die Deutsche Theologia
Vorrede des Herausgebers
(Karl Christian Eberhard Ehmann. Ausgabe von 1892)
Vorrede Dr. Martin Luthers.
Vorrede Johann Arnds
Kapitel 1. Was das vollkommene, einige ewige Gut sei, und was das unvollkommene Stückwerk sei, und wie man ableget das Unvollkommene, so da kommt das Vollkommene.
Kapitel 2. Was Sünde sei, und wie man sich selbst nicht zueignen soll was gut ist, denn solches allein dem wahren Gute angehöret.
Kapitel 3. Vom Fall Adams, und wie des Menschen Fall und Abkehren müsse gebessert werden.
Kapitel 4. Wie der Mensch, so er sich selber etwas Gutes zuschreibt oder zueignet, einen Fall thut, und Gott in seine Ehre greift.
Kapitel 5. Wie man das verstehen soll, daß der Mensch ohne eigene Weisheit, Liebe, Willen, Begierde und dergleichen Affekte sein soll?
Kapitel 6. Wie man das Beste und Edelste am allerliebsten haben soll, allein darum, daß es das Beste ist.
Kapitel 7. Von zweien geistlichen Augen, mit denen der Mensch siehet in die Ewigkeit und die Zeit, und wie eins vom andern gehindert werde.
Kapitel 8. Wie die Seele des Menschen, dieweil sie im Leibe ist, empfangen mag einen Vorschmack ewiger Seligkeit.
Kapitel 9. Wie dem Menschen nützer und besser sei, daß er wahrnehme, was Gott durch ihn wirken wolle, oder wozu ihn Gott brauchen wolle, denn daß er weiß, was Gott in allen Kreaturen je gewirket habe, oder wirken will; und wie die Seligkeit allein liegt an Gott und an keinen Werken und nicht an der Kreatur.
Kapitel 10. Wie die vollkommenen Menschen anders nichts begehren, denn daß sie dem ewigen Gute möchten sein, als dem Menschen seine Hand ist, und wie sie verloren haben Furcht der Hölle und Begierde des Himmelreichs.
Kapitel 11. Wie der gerechte Mensch in der Zeit in die Hölle wird gesetzt und mag darin nicht getröstet werden, und wie er aus der Hölle ins Himmelreich versetzt wird und mag darin nicht betrübet werden.
Kapitel 12. Was rechter, wahrer, innerlicher Friede sei, welchen Christus seinen Jüngern zur Letze gelassen hat.
Kapitel 13. (L. u. A. 12 c.) Wie der Mensch den Bildern etwas zu frühe Urlaub giebt.
Kapitel 14. (L. u. A. 12. c.) Von dreien Graden, die den Menschen führen zur Vollkommenheit.
Kapitel 15. (L. u. A. 13. c.) Wie alle Menschen in Adam sind gestorben und in Christo wieder lebendig worden, und vom wahren Gehorsam und Ungehorsam.
Kapitel 16. Was der alte und neue Mensch sei.
Kapitel 17. Wie man sich des Guten nicht annehmen oder anmaßen soll, sondern sich des Bösen, so man gethan hat, schuldig geben.
Kapitel 18. Wie das Leben Christi sei das edelste und beste Leben, so je gewesen ist, und werden mag, und wie das ruchlose, sichere, freie Leben sei das allerböseste.
Kapitel 19. Wie man zum wahren Licht und zu Christi Leben nicht kommen mag durch viel Fragen oder Lesen, oder mit hoher, natürlicher Kunst oder Vernunft und Geschicklichkeit, sondern mit einem Verziehen und Verleugnen sein selbst und aller Dinge.
Kapitel 21. Wie ein Freund Gottes von außen williglich vollbringet mit Werken die Dinge, die da sollen und müssen sein, das ist, die nötig sind, und mit den übrigen bekümmert er sich nicht.
Kapitel 22. Wie der Geist Gottes etwan einen Menschen besitzet, und sein mächtig ist, und auch etwan der böse Geist.
Kapitel 23. Wer Gott leiden soll und gehorsam sein will, der muß alle Dinge leiden, das ist, Gott, sich selbst und alle Kreatur, und muß in allem gehorsam sein in leidender Weise und etwa auch in thuender Weise.
Kapitel 24. Wer Dinge gehören dazu, daß der Mensch fähig werde göttlicher Wahrheit und des heiligen Geistes teilhaftig werde.
Kapitel 25. Von zweien bösen Früchten, die da wachsen aus dem Samen des bösen Geistes, und sind zwo Schwestern, die da gerne bei einander wohnen: die eine geistliche Hoffart und Reichtum, die andere ungeordnete, falsche Freiheit.
Kapitel 26. Von Armut des Geistes und wahrer Demut, wobei man erkennen soll die gerechten, geordneten, wahren Freien, so die Wahrheit gefreiet hat.
Kapitel 27. Wie das zu verstehen sei, daß Christus spricht, man soll alle Dinge lassen und verlieren; und woran die wahre Vereinigung mit dem göttlichen Willen gelegen sei.
Kapitel 28. Wie nach Vereinigung mit göttlichem Willen der innere Mensch unbeweglich stehet, und der äußere Mensch hin und her beweget wird.
Kapitel 29. Wie der Mensch vor seinem Tode dazu nicht kommen mag, daß er von außen unleidentlich und unbeweglich werde.
Kapitel 30. Wie man kommen mag über alle Gesetz, Weise, Ordnung, Gebot, und dergleichen, oder wie dem Gerechten kein Gesetz gegeben sei.
Kapitel 31. Wie man Christi Leben nicht soll hintan setzen, sondern sich darin üben und damit umgehen bis in den Tod.
Kapitel 32. Wie Gott ein wahres, einfältiges, vollkommenes Gut ist, und wie er ein Licht ist, und ein Verständnis und alle Tugend ist,und wie man dasselbige allerhöchste und beste Gut am allerliebsten haben soll.
Kapitel 33. Wie in einem vergotteten Menschen die Liebe lauter und unvermischt ist, und wie dieselbe Liebe alle Kreaturen lieben und ihnen wohlthun, ja das Allerbeste thun will, und in Summa, ein vergotteter Mensch muß und kann nicht anders, denn lieben.
Kapitel 34. Soll der Mensch zu dem Besten kommen, so muß er seinen eigenen Willen lassen, und wer dem Menschen hilft zu seinem eigenen Willen, der hilft ihm zu dem Allerbösesten. Summa, des Menschen Wille ist böse, darum muß er gelassen werden.
Kapitel 35. Wie in einem vergotteten Menschen wahre, gründliche, wesentliche Demütigkeit sei und geistliche Armut.
Kapitel 36. Wie sonst nichts wider Gott sei, denn Sünde, und was Sünde sei und ist.
Kapitel 37. Wie in Gott, sondern er Gott ist, nicht kommen mag Betrübnis, Leid, Mißfallen und desgleichen; es ist aber in einem vergotteten Menschen anders.
Kapitel 38. Wie man das Leben Christi an sich nehmen soll aus Liebe und nicht um Lohns willen, und soll es nimmer hinlegen oder hintansetzen.
Kapitel 39. Wie Gott Ordnung, Weise, Maß und dergleichen in den Kreaturen haben will, denn er es ohne Kreaturen nicht haben mag, und von vielerlei Menschen, die nach Ordnung, Gesetz und Weise handeln und damit umgehen.
Kapitel 40. Vom Unterschied des wahren und falschen Lichts, (das ist:) seines eigenen Lichts und von seiner Eigenschaft.
Kapitel 41. Wie das ein vergotteter Mensch heißt und ist, der da durchleuchtet ist mit dem göttlichen Licht, und entzündet ist mit ewiger, göttlicher Liebe, und wie Licht und Erkenntnis nicht tauge ohne Liebe.
Kapitel 42. Ob man Gott möge erkennen und nicht lieben, und wie zweierlei Licht und Liebe ist, wahre und falsche.
Kapitel 43. Wobei einen wahren, vergotteten Menschen erkennen mag, und was ihm zugehöre, und was einem falschen Lichte oder einem falschen freien Geist auch zugehöre.
Kapitel 44. Wie nichts anders wider Gott sei, denn des Menschen eigener Wille, und wer sein Bestes suchet als das Seine, der findet es nicht, und wie der Mensch von ihm selber nichts Gutes weiß oder vermag.
Kapitel 45. Wo das Leben Christi ist, da ist auch Christus, und wie Christi Leben das allerbeste und edelste Leben sei, das je ward oder immer werden mag.
Kapitel 46. Wie ganze Genüge und Ruhe in Gott allein sei, und in keiner Kreatur, und wer Gott gehorsam sein will, der muß allen gehorsam sein in leidender Weise, und wer Gott lieb haben will, der muß alle Dinge lieb haben in einem.
Kapitel 47. Ob man auch Sünde soll lieb haben, weil man alle Dinge lieb haben soll?
Kapitel 48. Wie man etliche Dinge von göttlicher Wahrheit zuvor muß glauben, ehe man kommt zu einem wahren Wissen und Befinden göttlicher Wahrheit.
Kapitel 49. Vom eigenen Willen, und wie Lucifer und Adam von Gott sind gefallen durch den Eigenwillen.
Kapitel 50. Wie diese Zeit sei eine Vorstadt des Paradieses und Himmelreichs, und darinnen ist nicht mehr, denn ein Baum verboten, das ist eigener Wille.
Kapitel 51. Warum denn Gott den eigenen Willen erschaffen habe, wenn er ihm so sehr zuwider ist.
Kapitel 52. Abermal warum Gott den Willen geschaffen.
Kapitel 53. Der eigene Wille macht den Menschen unruhig.
Kapitel 54. Im Himmel ist nichts Eigenes, oder hat keiner etwas Eigenes.
Kapitel 55. Wie man das verstehen soll, das Christus spricht: Folge mir nach!
Kapitel 56. Wie man die zwei Worte verstehen soll, die Christus gesprochen hat: Niemand kommt zu dem Vater, denn durch mich; das andere: Niemand kommt zu mir, der Vater ziehe ihn denn.
Kapitel 57. Wer Christi Nachfolger und Diener sei.
Kapitel 58. Das andere Wort: Niemand kommt zu mir, der Vater ziehe ihn denn.
Kapitel 59. Wie der Vater zum Sohn ziehe, und hinwieder der Sohn zum Vater.
Kapitel 60. Wie Gott alles in dem Menschen sei.
Kapitel 61. Gott allein zu lieben und zu ehren.
Eine andere kurze Rede oder Wiederholung. (Ps. 54.) Wie der Mensch in keinen Dingen das Seine soll suchen, weder im Geist noch in Natur, sondern allein die Ehre Gottes, und wie man durch die rechte Thür, das ist: durch Christum ein soll gehen in das ewige Leben.
Etliche Hauptreden und Sprüche, in denen sich ein jeder fleißiger Schüler Christi üben mag, zu prüfen und zu erkundigen, was von rechter, wahrer Vereinigung mit dem höchsten, einigen Gut zu lernen und zu betrachten sei.
Nachwort zur deutschen Theologia (Ausgabe 2022)
Erklärung
Schluss
Abkürzungsverzeichnis
Register der Bibelverweise (sortiert in kanonischer Anordnung)
Literaturverzeichnis
Vorwort zur Bücherreihe „Ungeteiltes Herz“
Mit der neuen Bücherreihe „Ungeteiltes Herz“ möchte ich ganz herzlichst hierzu einladen die christliche Tradition ein bisschen besser kennenzulernen. Die christliche Tradition ist vergleichbar mit den unterschiedlichen Ästen eines Baumes und die Bibel bildet den Stamm (Kanon). Bei der Frage, welches Buch als Christ zuerst gelesen werden sollte, egal ob progressive oder traditionelle Gruppen, wird die Bibel als solches empfohlen. Die Bibel bildet für die Christen die schriftliche Grundlage und dient als Maßstab unseres Handelns. Dennoch sind einige Sätze in ihrer Bedeutung sehr schwer zu verstehen und benötigen manchmal weitere Lektüre und Erläuterungen, um den Inhalt zu erfassen. Für diese Bücherreihe „Ungeteiltes Herz“ steht die Gemeinschaft und die Erbauung im Vordergrund. Wissenschaftliche Quellen werden soweit bekannt berücksichtigt und im Literaturverzeichnis aufgelistet. Anhand von Beispielen ergibt sich, dass die verschiedenen Abschnitte und Teile der Bibel nicht im Widerspruch stehen oder stehen müssen, sondern aneinander ergänzen. Für einige Leserinnen und Leser können die Begriffe von Kindern und Erwachsenen im Widerspruch stehen. Beispielsweise sollen wir laut 1. Korinther 13 selbst Verantwortung für uns und andere Menschen übernehmen und menschlich wachsen. In diesem Zusammenhang ist der Vergleich der Erwachsenen positiv besetzt. Das Kind gilt in diesem Zusammenhang als unreif (vgl. 1. Korinther 13 LSM2010, Seite 813). In Matthäus 19: 15, Markus 10: 14 und Lukas 18: 16-17 wurden die Kinder von Jesus gesegnet. „Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen gehört das Himmelreich“ (Matthäus 19: 15 LUT2017). „Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen“ (Lukas 18: 17 LUT2017). In diesem Zusammenhang sind wir nicht in der Rolle eines Erwachsenen, sondern in der Rolle des Kindes, da Gott uns erschaffen hat und wir lieben sollen wie wir unsere leiblichen Eltern lieben. Anhand dieses Beispiels soll veranschaulicht werden, dass Gottesdienste und ergänzende Bücher ebenfalls wichtig sind, um die eigenen Widersprüche zu lösen und um geistig zu wachsen. Mit dieser Bücherreihe möchte ich die Leserinnen und Leser dazu bringen wieder mehr nach Gott zu leben.
Der Name „Ungeteiltes Herz“ entdeckte ich für mich, als ich das Herz als Denkorgan wahrnahm. Das Herz als fühlendes Organ, das Mut oder auch Liebe empfindet, während ich das Gehirn als Denkfabrik für das Ratio sehe, aber bei bestimmten Gefühlen oder Phänomen keine logischen Erklärungen bietet. Mit welcher Skala soll auch Liebe oder Mut ausgedrückt werden? In welcher Syntax oder Begriffen sollen wir Gott erklären? Gott auf eine rationale oder logische Ebene zu erklären ist schwierig, aber nicht unmöglich. Das wir leben ist Beweis für Gottes Liebe. Die Liebe wird vor allem mit dem Herzen assoziiert.
Das Herz wurde aber trotz seiner bösen Eigenschaften niemals außer Acht gelassen, beispielsweise betete Salomo für seine Gemeinde zu Gott, dass die Herzen seines Volkes ungeteilt zu Gott stehen. Ein ungeteiltes Herz, dass nicht nach Lüsten und Verlangen hinterherrennt, sondern einzig und allein auf Gott gerichtet ist. Das Herz ist dennoch für mich ein Symbol, um im Glauben und in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, wenn das Herz an der richtigen Stelle sitzt. „Und er [Abija] wandelte in allen Sünden seines Vaters [Rehabeams], die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem HERRN, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David“ (1. Könige 15: 3 LUT2017).
Das Herz ist in mancherlei Hinsicht ein schwieriges Organ, dass nach der Bibel boshaft und undankbar ist. „Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen“ (Matthäus 15: 19 EÜ2018). „Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er in seinem Herzen gut ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Dein Reden ist von dem bestimmt, was in deinem Herzen ist“ (Lukas 6: 45 NBH2018). Im Prophetenbuch Sacharja, auch Zacharias, heißt es: „Und ihr Herz machten sie zu einem Diamant, so daß es dem Gesetze nicht folgte, noch auch den Ermahnungen, die Jehova, der Weltenherrscher, an sie ergehen ließ durch seinen Geist, vermittelst der vorigen Propheten; und so wurde groß der Zorn Jehovas, des Weltenherrschers“ (Zacharias 7: 12 Van Eß 1881). Das Herz ist in diesem Zusammenhang das Denkorgan, allerdings verhärtet und taub für die Ermahnungen Gottes. Johannes Calvin schrieb in seinem Magnus Opum „Institutio Christianae Religionis“, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist, hominis ingenium perpetuam, ut ita loquar, esse idolorum fabricam (vgl. Calvin et al. 1960, vgl. Postbarthian 2019). Seiner Ansicht aber zur Folge können Herzen durch Gebete gute Fähigkeiten angeeignet werden (vgl. Sanchez 2014: 286, 288).
Bereits vor der Sintflut hieß es: „Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf den Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar“ (1. Mose 6: 5 LUT2017). Ebenfalls schrieb Jeremia „Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?“ (Jeremia 17: 9 LUT2017). Gott selbst ergründet die Herzen (vgl. Psalm 34: 19; vgl. Offenbarung 2: 23) Daher ist es besonders wichtig, Gott vom ganzen Herzen zu lieben (vgl. 5. Mose 6: 5). Aus diesem Grund muss das Herz vor bösen Einflüssen beschützt werden (vgl. Sprüche 4: 23; vgl. Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk 1931: 310-311). „Und du sollst gedenken des ganzen Weges, den Jehova, dein Gott, dich hat wandern lassen diese vierzig Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht“ (5. Mose 8: 2 ELB1907). Aus diesem Grunde ist es wichtig zu erkennen, ob das Herz seinen eigenen Lüsten hinterher eifert oder ob es den Gesetzen und Geboten Gottes befolgt.
„Und euer Herz sei ungeteilt bei dem HERRN, unserm Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht.“ (1. Könige 8: 61 LUT2017).
Die deutsche Theologia bildet den Auftakt dieser Bücherreihe. Ziel dieser
Reihe ist die Erbauung, der Liebe und die Erkenntnis Gottes. Ich hoffe
vom ganzen Herzen, dass dieses Buch und die folgende Bücherreihe
Ihnen viel Freude und viel Wissen vermitteln kann.
Holger Furch, Duisburg, 24. Juni 2022
„Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen“ (Römer 5: 5
LUT2017).
Vorwort die Deutsche Theologia
Die Deutsche Theologia, auch als Eyn deutsch Theologia, Theologia Germanica oder „Der Franckforter“ bekannt, hatte als christlich-mystische Schrift eines anonymen Autors des 15. Jhd. einen erheblichen Einfluss auf die Reformation in Deutschland (vgl. Haas 1980: 14; vgl. Von Hinten 1982: 16). Nach der Brockhaus Enzyklopädie leitet sich das Wort Mystik vom Lateinischen mysticus für geheimnisvoll ab (vgl. Brockhaus a). Die christliche Mystik hatte Anknüpfungspunkte mit der Philosophie, insbesondere dem Neuplatonismus und „vollendet sich ‚„in Christo Jesu‘“ in „der Teilnahme an seinem Leiden und Kreuz“ (Dumoulin 1966: 66; vgl. Dumoulin 1966: 24). Die christliche Mystik setzt ihren Schwerpunkt auf die Gottesbegegnung oder Gotteserfahrung (vgl. Brockhaus b; vgl. Wrede 1974: 231). Allerdings sollte nach Dumoulin zur Folge die christliche Mystik nicht als die alles entscheidende christliche Strömung dienen, sondern sollte als ein wesentlicher Teil der christlichen Gemeinschaft betrachtet werden. Hierzu schrieb Dumoulin: „Die mystische Institution kann auch deshalb nicht uneingeschränkt als die absolut vollkommene Erkenntnisweise angesprochen werden, weil sie wegen ihres intellektuellen Charakters die Gefahr der Vernachlässigung anderer wesentlicher Elemente in sich birgt“ (Dumoulin 1966: 96). Ebenfalls darf „[…] echte Mystik […] keineswegs in Widerspruch zur Gemeinschaft stehen. Dies ist der andere Grund, weshalb mystisches Erleben niemals letzte Norm werden kann“ (Dumoulin 1966: 96). Für die christliche Mystik sollte der zeitgeschichtliche und gesellschaftlicher Gesamtkontext betrachtet werden. Hieraus zeigt sich, dass die christliche Mystik und Mystiker wie beispielsweise Hildegard von Bingen, Meister Eckhart oder Bernhard von Clairvaux positiven Einfluss auf die christliche Geschichte hatten.
Gleiches gilt auch für christlichen-mystischen Schriften wie der deutschen Theologia. Zu den Differenzierungen und Unterscheidungen der christlichen Mystik kann die deutsche Theologia als einflussreiches Werk für die christliche Geschichte in Deutschland bezeichnet werden. Tritsch gibt als Datum der deutschen Theologie 1497 an und vermutet Erstveröffentlichung Mitte des 15. Jhd. (vgl. Tritsch 1952: 271; vgl. Uhl 1926: 64). Wegener listet vorhandene Schriften und Fragmente des 15. Jahrhunderts auf, weist aber darauf hin, dass die deutsche Theologia ihren Ursprung auch im 14. Jahrhundert haben kann, insbesondere durch die Predigtexte von Johann Tauler (vgl. Wegener 2016: 11, 13). Martin Luther (1483-1546) selbst erhielt 1510 eine Ausgabe der deutschen Theologia (vgl. Büttner 1910: V). Laut der gedruckten Ausgabe von 1518 hatte die deutschen Theologia, nach der Bibel und der Bekenntnisse Augustinus von Hippo, maßgebend Einfluss auf Luthers Theologie (vgl. von Hinten 1982: 4). Luther schrieb am 14.12.1516 einen Brief an seinen Weggefährten Spalatin und ließ ihm ein Exemplar der deutschen Theologia zukommen (vgl. Von Hinten 1982: 3). Auf Dekret von Papst Paul V. wurde die deutsche Theologia sowohl in der lateinischen Übersetzung von Johannes Theophilus als auch weitere Sprachausgaben auf das Index Librorum prohibitorum (Verzeichnis verbotener Bücher) gesetzt (vgl. Baring 1963: 6; vgl. Von Hinten 1982: 4). Ebenfalls wurde die deutsche Theologia von Johannes Calvin abgelehnt (vgl. Von Hinten 1982: 4). Der heute verwendete Titel basiert auf den beauftragten Druck „Theologia teütsch“ von Silvan Ottmar, Augsburg, vom 23.09.1518 (vgl. von Hinten 1982: 3; vgl. Wegener 2016: 3). Der Titel „Der Franckforter“ basiert auf die Handschrift der Bronnbacher Zisterzienserabtei (vgl. Wegener 2016: 19; vgl. von Hinten 1982: 3).
Die Druckereien veröffentlichten das Buch im Auftrag von Martin Luther und bis zum heutigen Zeitpunkt wurden zwischen 60 und 70. Auflagen gedruckt (vgl. Wegener 2016: 435; vgl. Haas 1980: Deckblatt). Baring konnte bereits 1961 insgesamt 190 Ausgaben, davon 124 deutschsprachige Ausgaben auflisten (vgl. Baring 1963: 151; vgl. Von Hinten 1982: 4). In dieser vorliegenden Ausgabe ist der vollständige Nachdruck von Karl Christian Eberhard Ehmann aus dem Jahr 1892, mit Vorwort Martin Luthers und Johann Arnd, enthalten. Dieser Nachdruck (Seite 3 bis Seite 175) wurde mit einem Vorwort, sowie einer Erklärung, einem Abkürzungsverweis, Bibelverzeichnis und Quellenverzeichnis erweitert. Der Seitenaufbau und die Anzahl der Wörter entsprechen der Ausgabe von Ehmann (1892). Nennenswerte Textstellen, die in der ursprünglichen Ausgabe fett gedruckt wurden, werden auch in dieser Ausgabe hervorgehoben. Das Titelbild, in abgeänderter Form, stammt von Joseph Ritter von Führich (1800 – 1876), „Das Heilige Abendmahl“. Das Bild wurde gewählt, weil das Heilige Abendmahl ein Kernelement des Christentums ist. Erbauung und Gemeinschaft wurde immer wieder im Neuen Testament betont und kann vielleicht auch zeigen, dass Gotteserfahrungen nicht nur im stillen Kämmerlein möglich sind, sondern auch beispielsweise in der Gemeinschaft, in Hauskreisen oder in Kirchen.
Vorrede des Herausgebers (Karl Christian Eberhard Ehmann. Ausgabe von 1892)
Das Büchlein, welches hiemit in einer neuen Ausgabe erscheint, wurde von Dr. Martin Luther, „ohne Titel und Namen funden“, und zuerst durch Druck bekannt gemacht. Er gab im Jahr 1516 nur einen kleinen Teil mit einer kurzen Vorrede, im Jahr 1518 aber das Ganze mit einer andern Vorrede, beidemal bei Joh. Grünenberg in Wittenberg, in Quart heraus.
Das Büchlein ist seitdem unzählige mal teils deutsch wieder abgedruckt, teils ins Lateinische, Französische, Englische, Holländische und Flämische übersetzt worden. Alle diese Ausgaben und Übersetzungen hatten den luther’schen Text zur Grundlage, bis Ende der Vierziger Jahre der Professor und Universitätsbibliothekar Dr. Reuß in Würzburg auf der fürstlich Löwenstein-Wertheim-Freudenbergischen Bibliothek zu Bronnbach, (der ehemaligen Cisterzienser-Abtei bei Wertheim an der Tauber und dem Main) eine alte Handschrift vom Jahr 1497 auffand, von welcher sofort Franz Pfeiffer, damals Bibliothekar an der K. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart im Jahr 1851, bei S. G. Liesching in Stuttgart einen wertvollen, wortgetreuen Abdruck besorgte.
Das Büchlein wurde lange für ein Werk des erleuchteten Johann Tauler gehalten, der jedoch im 12. Kapitel als ein früherer Schriftsteller angeführt wird, und daher nicht der Verfasser sein kann. Eine neuere Behauptung, wonach es von Luther herrühren soll, steht im Widerspruch mit des Reformators eigenen Aussprüchen. Andere durchaus unerfindliche Vermutungen verdienen hier nicht angeführt zu werden.
Dr. Philipp Jakob Spener teilt in seiner Vorrede zu Taulers Schriften die Nachricht mit, daß der Verfasser der deutschen Theologie zu Frankfurt am Main gelebt habe. Seine Worte sind diese: „Ich achte es nicht für geringe Ehre hiesiger Stadt, daß solches Büchlein darin soll geschrieben sein, wie Michael Neander aus einer alten Edition allegiert, daß es gemacht worden durch einen gottseligen Mann, der vor diesem deutscher Herr, ein Priester und Custos gewesen in der deutschen Herren Haus in Frankfurt“, nämlich Frankfurt am Main, oder (nach Pfeiffer) bestimmter ausgedrückt: jenseits des Mains, zu Sachsenhausen.
Diese einzig zuverlässige Nachricht über den Verfasser gründet sich auf eine Bewertung, welche sich in der lutherschen Ausgabe von 1518 auf der vierten Seite vor dem Inhaltsverzeichnis findet und folgendermaßen lautet:
„Diese Büchlein hat der allmächtige Gott ausgesprochen durch einen weisen, verständigen, wahrhaftigen, gerechten Menschen, seinen Freund, der da vor Zeiten gewesen ist ein deutscher Herr, ein Priester und Custos in der deutschen Herren Haus zu Frankfurt, und lehret manchen lieblichen Unterschied göttlicher Wahrheit, und besonders, wie und womit man erkennen möge die wahrhaftigen Gottesfreunde, und auch die ungerechten, falschen, freien Geister, die der heiligen Kirche gar schädlich sind.“
Aus dieser Bemerkung und dem Büchlein selber geht hervor, daß der Verfasser dem mystischen Verein der Gottesfreunde angehörte, der sich in dem Zeitraum von etwa 1335 bis 1400 über das ganze Rheingebiet von Basel bis Köln, über die Schweiz, das Elsaß, Schwaben, Bayern, Franken verbreitet hatte. Er bestand aus Geistlichen und Laien aller Stände, deren Häupter waren Nicolaus von Basel, der in hohem Alter von der Inquisition in Vienne als unverbesserlicher Ketzer verbrannt wurde, Johann Tauler, der Straßburger Bürger Rulmann Merswin, Verfasser der sieben Felsen, Heinrich Suso (der Seuß) aus Constanz, Heinrich von Nördlingen, Hermann von Fritzlar, die Nonnen Margaretha und Christiana Ebner u. a.
Eines Widerspruchs mit der Kirchenlehre scheinen sie sich nicht bewußt gewesen zu sein. Die Hauptaufgabe, die sie sich selber und andern stellten, war Verleugnung des eigenen und Vollbringung des göttlichen Willens. Aber eben durch dieses rein sittliche Streben und Wirken stießen sie auf das herrschende Verderben und gerieten dadurch einerseits in eine zweifelhafte Stellung gegenüber der Kirche, andererseits in einen offenen Kampf mit der leichtfertigen Sekte der Brüder des freien Geistes. Diesem Verein der Gottesfreunde gehörte der Verfasser der deutschen Theologie ohne Zweifel an. Es tritt bei ihm nicht bloß die gleiche sittlich-ernste Geistesrichtung, sondern ganz besonders auch die Lehre von der rechtfertigenden Gnade Gottes, mit bestimmtem Widerspruch gegen die Verdienstlichkeit der sogenannten guten Werke, klar hervor. Deswegen, und nicht wegen des zufälligen Umstandes, daß Luther das Büchlein zuerst herausgab, hat man den Verfasser nebst seinen Gesinnungsgenossen mit Recht unter die Vorläufer der Reformation gerechnet.
Da die Spuren der Gottesfreunde mit dem Ablauf des 14. Jahrhunderts verschwinden, so muß „die deutsche Theologia“ gegen das Ende dieses Jahrhunderts entstanden sein.
Ältere sowohl als neuere Forschungen über den Namen des Verfassers sind ohne Erfolg geblieben. Wahrscheinlich ist der Name absichtlich geheim gehalten worden, da es, nach Tauler, ein Hauptgrundsatz der Gottesfreunde war, sich vor allen Kreaturen zu verbergen, daß niemand von ihnen sprechen könne, weder Gutes noch Böses.
Der Titel des Buches rührt wie aus Luthers Vorrede hervorgeht, nicht von dem Verfasser selber, sondern von Luther her. Seit Arnd ist der Titel: „die deutsche Theologie“ üblich geworden, was indes zuviel sagt, daher unsere Ausgabe auf den von Luther gegebenen Titel zurückgeht. Den Text anlangend, so gehen wir nicht die ältere deutsche Originalsprache, die zwar unvergleichlich schön, kräftig und naiv, aber den wenigsten verständlich ist, sondern wir folgen mit gutem Grund der Ausgabe des alten frommen Joh. Arnd, der das Werk höchst kernhaft, mit gesalbtem Geiste in die neudeutsche Mundart übertragen und mit vielen erklärenden Umschreibungen und Zusätzen durchwebt hat. Jedoch wurden nicht nur die Ausgaben von Luther und Pfeiffer sorgfältig verglichen und der besseren Lesart immer der Vorzug gegeben, sondern